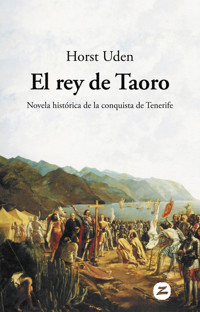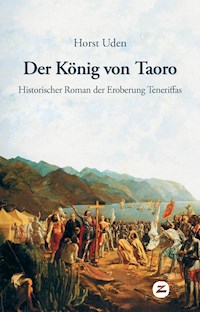
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zech Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane und Erzählungen
- Sprache: Deutsch
Als der spanische Eroberung Alonso Fernández de Lugo im Mai 1494 auf Teneriffa landet, stößt er ein hölzernes Kreuz in die Erde und gründet hier die Stadt Santa Cruz de Tenerife. Er ist von den Katholischen Königen beauftragt, "die Inseln La Palma und Teneriffa, die sich in Händen kanarischer Heiden befinden, zu erobern und ... Uns zu unterwerfen." Der König von Taoro ist Mencey Bencomo, Fürst von La Orotava, der mutig gegen die Eindringlinge kämpft. Sieg und Niederlage wechseln sich in La Matanza und La Victoria ab. Doch die Guanchen können gegen die spanische Übermacht nicht gewinnen... Lassen Sie sich verführen zu einer Zeitreise ins 15. Jahrhundert, tauchen Sie ein in die Welt der Guanchen und der spanischen Konquistadoren. Sie werden Teneriffa danach mit anderen Augen sehen. "Ein Werk, an dem niemand achtlos vorbei geht." (Don Francisco P. Montes de Oca (+), Historiker des kanarischen Archipels)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Uden
Der König von Taoro
Historischer Roman der Eroberung Teneriffas
DAS BUCH: Als der spanische Eroberung Alonso Fernández de Lugo im Mai 1494 auf Teneriffa landet, stößt er ein hölzernes Kreuz in die Erde und gründet hier die Stadt Santa Cruz de Tenerife. Er ist von den Katholischen Königen beauftragt, »die Inseln La Palma und Teneriffa, die sich in Händen kanarischer Heiden befinden, zu erobern und ... Uns zu unterwerfen.« Der König von Taoro ist Mencey Bencomo, Fürst von La Orotava, der mutig gegen die Eindringlinge kämpft. Sieg und Niederlage wechseln sich in La Matanza und La Victoria ab. Doch die Guanchen können gegen die spanische Übermacht nicht gewinnen...
DER AUTOR: Eugen Kuthe (Pseud. Horst Uden) wurde 1898 in Schlesien geboren, er starb 1973 in Málaga. 23-jährig brach er zu Reisen auf, die ihn zunächst nach Andalusien und von dort aus in zahlreiche Länder Lateinamerikas führten. Er arbeitete als Buchhalter, Hoteldirektor und Übersetzer, schrieb Abenteuerromane, Reiseberichte, Theaterstücke. Der hier vorliegende historische Roman Der König von Taoro entstand nach einem Besuch auf den Kanarischen Inseln in den 30er Jahren, zusammen mit Unter dem Drachenbaum, einer Sammlung kanarischer Legenden.
Impressum
Textgrundlage dieses E-Books Der König von Taoro ist die mit dem gleichnamigen Titel im Zech Verlag (Teneriffa 2001-2015) erschienene Taschenbuchauflage, erstmals veröffentlicht im E-Pub-Format im Februar 2015. Originalausgabe: Das Bergland Buch, Salzburg 1941
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, öffentlichen Vortrag, Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen, z.B. über das Internet.
Alle Rechte vorbehalten. © 2015 ZECH VERLAG
Verena Zech, 38390 Santa Úrsula (Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien)
Tel./Fax: (34) 922-302596 · E-Mail: [email protected]
Text: Horst Uden (Pseud.), Erben von Eugen Kuthe
Covergestaltung: Verena Zech
Titelbild: Ausschnitt aus »Fundación de Santa Cruz de Tenerife« von Gumersindo Robayna (1854, Öl auf Leinwand 82x124cm, Museum der Schönen Künste, Santa Cruz de Tenerife)
Konvertierung: Zech Verlag
E-Book ISBN 978-84-941501-7-3 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-84-933108-4-4
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Webseite:
www.editorial-zech.es/de/
Karte von Teneriffa
Bis zur Eroberung durch die Spanier im Jahr 1496 war die Insel Teneriffa in neun Fürstentümer (menceyatos) aufgteilt. Die graue Linie beschreibt den Weg der Eroberer von ihrer Landung in Añaza (heute Santa Cruz de Tenerife) über La Matanza, La Victoria bis zu dem Ort, an dem die Guanchen kapitulierten, im heutigen Los Realejos.
Geleitwort
Von Don Francisco P. Montes de Oca García (†), amtlicher Chronist des Kanarischen Archipels und Korrespondierendes Mitglied der Geschichtlichen Fakultät und Schönen Künste von San Fernando
In seinem Werke »Der König von Taoro« gestaltet der Dichter Horst Uden zum ersten Male in der Weltliteratur romanhaft den großen Freiheitskampf der Guanchen gegen die spanischen Eroberer. Steinchen für Steinchen trug er den ungeheuren Stoff zusammen und schrieb ein heldisches Mosaik auf die edle Rasse, die zu ewigem Untergang verdammt war. Die Zähigkeit, mit der er sich in seine Arbeit verbiß, die gründlichen Nachforschungen, die er anstellte, sein schnelles Sichhineinfinden in den Geist und die Materie jener Zeit runden das Ganze zu einem anschaulichen Bild und zwingen den Leser in den Bann seiner Feder.
Kein Fleckchen, das er schildert und nicht selbst besucht hat! Er durchwanderte »Die Schlucht des Todes«, er stand auf dem Magojes und blickte über das tief eingeschnittene Tal von Taganana, er erklomm die Höhen des Tigaiga und ließ sich am Seil in die unzugänglichen Grotten von Güímar hinab.
Auf vielen seiner Ausflüge begleitete ich ihn als Freund und Mentor. Ich führte ihn durch private und kirchliche Archive, wir standen zusammen am Grabe des General-Kapitäns der Katholischen Könige, Don Alonso Fernández de Lugo, und betrachteten schweigend den tausendjährigen Drachenbaum von Icod, der alles miterlebte, was in diesem Buche geschildert wurde.
In seinem Werk zeichnet er mit bewundernswerter Einfühlung die Charaktere Mencey Bencomos und seines großen Gegenspielers. In den »Unzertrennlichen Zwölf« läßt er uns tief in Wesen und Fühlen der Söldner eindringen, in seiner Ur-Sage verquickt er künstlerisch die griechische Mythologie mit dem Ergebnis neuester Forschung.
Düster hallen seine prophetischen Verse aus dem »Tamo gantem Acorán«, und wie eine Siegesfanfare tönt sein »Schwertlied« an unsere Ohren. Wir hören den Schlachtenlärm, der über die Hochebene von La Laguna schallt, das Heulen der Kartaunen und Falkonette, das Bellen der Basilisken, das Aufklingen der Armbrüste und das todkündende Pfeifen der Guanchen.
Seine Kunst löscht die Jahrhunderte aus und läßt uns teilhaben am Geschehen. Wir knien mit dem Grafen Medina Sidonia im Halbdämmer der kleinen Kapelle des Alcazar, wir begleiten weinend den bleichen Schädel Tinguaros zur Grabhöhle der Könige. Durch unsere Hände gleitet die zierliche Muschelkette, die nur den Hals einer Königin von Taoro schmücken durfte, wir laben uns an den süßen Früchten des Erdbeerbaums . . .
Es ist ein Werk, das seinen Weg machen wird, ein Werk, an dem niemand achtlos vorbeigeht.
»Más de todos, Bencomo, el de Taoro,
Fué el más temido, amado y estimado
De más vasallos, tierras y distritos...«
(Poema de Viana)
1. Die glückliche Insel
»Wer überlegt, sieht überall Gefahr,
wer sich blindlings hineinstürzt,
dem winken unsterbliche Lorbeeren...«
(Der Feind)
Die Guanchen
Strahlend enttauchte die Sonne dem blutroten Weltmeer und zerteilte die flüchtigen Morgennebel, die die schroffen Klippen der Insel umspielten. Sie überstieg die Ostkette und blickte hinein in das weite, blühende Tal von Arautápala, das langsam aus seinem Sommerschlaf erwachte. Sanft zum Meer abfallend dehnten sich die üppigen Felder, an deren Rainen knorrige Drachenbäume starr und unbeweglich ihre Äste spreizten und Schildwacht standen gleich trutzigen, eisenbewehrten Rittern mit gefällten Lanzen.
Die Morgenstrahlen glitten über die schroffen Felswände, die sich an den Höhen des Tigaiga dahinzogen, und tanzten einen Augenblick spielerisch über dem Eingang der geräumigen Königshöhle, der Behausung des greisen Quebehi Bencomo, des obersten Fürsten der Guanchen. Vor ihr breitete sich ein schmaler Altan mit einer mächtigen Steinbank, gleich einem von Zyklopenhand aus dem Fels gehauenen Thron, die eine weite Sicht ins Tal gewährte und von einer riesigen kanarischen Kiefer überschattet wurde.
Ein schmaler Felsweg führte hinunter zum Tagoror, der Rats- und Gerichtsstätte, in deren Mitte ein tausendjähriger Drachenbaum, das Wahrzeichen von Taoro, seine Krone wölbte. Den weiten Platz umsäumten hohe, ausladende Lorbeerbäume, gespreizte Fächerpalmen und schmuckreiche Zedern.
Mehr als hundert Jahre war es her, daß Tehinerfe der Große die Insel unter seine neun Söhne aufgeteilt hatte. Imobach, dem ältesten, gab er das fruchtbare Tal von Arautápala, und stillschweigend erkannten seit dieser Zeit die Fürsten der anderen Stämme die Vorherrschaft des Menceys von Taoro an. Und das hatte auch noch einen anderen Grund: Taoro war nicht nur der reichste, sondern auch der festeste Platz der Insel.
Schlägt man einen Halbkreis an der felsigen Nordküste zwischen der Punta de Anaga und der Punta de Teno, so läuft seine Peripherie über die Ost- und Südkette und stürzt steil über die Höhen des Tigaiga ins Meer zurück. In der Mitte des Halbkreises von der Südkette bis zur Küste zog sich ein breiter Streifen undurchdringlichen Urwalds. Nur ein schmaler, verschlungener Pfad durchkreuzte ihn und stellte die Verbindung her zwischen dem Tal von Arautápala und Taoro, das jäh an den Höhen des Tigaiga hinaufstrebte. Taoro war die unbezwingliche Burg, Arautápala das reiche, zugehörige Lehensland.
In den unzugänglichen Höhlen des Tigaiga lebten die tapfersten Krieger der Guanchen, bereit, auf den Ruf ihres Fürsten auszuziehen und einen unbotmäßigen Stamm zum Gehorsam zurückzuführen. Ihre Hauptwaffe war der mit der Hand geschleuderte, unfehlbare Stein, die Streitaxt und die spitze, eisenharte Lanze aus Tea-Holz. Im Gürtel ihres Tamarco, eines Fellhemdes, steckte die scharf geschliffene Tabona, das Steinmesser aus Obsidian, das sie geschickt zu handhaben wußten. Mit furchtbarem Kriegsgeschrei warfen sie sich aus dem Hinterhalt auf den Gegner, rollten mächtige Felsblöcke auf ihn herab und waren unvergleichlich im Nahkampf. Wer keinen Schild aus der Rinde des Drachenbaums besaß, wickelte sich den Tamarco fest um den linken Arm und kämpfte nackt, nur mit einem Lendenschurz bekleidet.
So unversöhnlich die Guanchen dem widerstehenden Feinde entgegentraten, so edel waren sie gegen den unterlegenen. Gefangene wurden von ihren Wunden geheilt, ausgetauscht und oft noch mit Geschenken entlassen.
Wilde Tiere gab es auf ihrer glücklichen Insel nicht, nicht einmal die kleinste Giftschlange. Der einzige, den sie fürchteten, war Guayote, der Dämon, der im feuerspeienden Echeyde wohnte (Echeyde, Hölle, oder Teide: der Pico de Tenerife).
Wenn er zürnte, schleuderte er glühende Felsen aus dem Bauche des Riesen, ein breiter Feuerstrom ergoß sich aus seinem weitgeöffneten Maul. Alles riß er nieder, was sich ihm in den Weg stellte. Sengend fuhr er über die fruchtbaren Felder. Aus seinen Nüstern blies er dunkle, giftige Schwaden in den stahlblauen Tigot, den Himmel, die strahlende Magec, die Sonne, verdunkelte sich, das Meer schäumte auf und donnerte über die Klippen bis tief in den Wald hinein, knickte Bäume wie dürre Äste und zerspellte sie, zurückflutend, an den Felsen.
Dann flohen die Guanchen in ihre Höhlen, hockten ängstlich zusammengekauert zwischen den Schafen, Ziegen und Hunden, die sich eng aneinanderdrängten, horchten erschauernd auf das höllische Grauen und flehten zu Acorán, zu Gott, um Hilfe und Rettung.
Ihr Glaube war kindlich und einfach wie sie selbst: Gott schuf einige Menschen und gab ihnen Herden, Land und Wasser. Dann schuf er mehr, gab ihnen nichts und sagte: »Dient den anderen, und sie werden euch geben!« So gehörte alles Land dem Mencey; er verteilte es auf Lebenszeit, dann fiel es an ihn zurück.
Ihre Hauptnahrung bestand aus Gofio, geröstetem und dann gemahlenem Getreide, das sie mit Milch oder Wasser mischten, aus Pilzen, Feigen, saftigen Früchten des Mocán und des Erdbeerbaums, aus Brombeeren, Datteln, Fichtenzapfen und Palmenbirnen. Allem aber zogen sie Zickelfleisch und Wildkaninchen vor. Als ganz besondere Leckerbissen beim Guatativoa, dem Festmahl, galten junge, feiste, kastrierte Hunde.
Die Guanchen verehrten ihre Frauen und hielten die Ehe rein. Wer auf einsamem Felswege einem jungen Mädchen begegnete, machte ehrerbietig Platz und sprach sie nicht an.
Die Gerichtsbarkeit lag allein in Händen des Mencey. Sein Wort war Gesetz: Prügel waren die Strafe für Diebe; Kinder, die ihre Eltern schmähten, wurden gesteinigt, Mörder von den steilen Klippen des Tigaiga ins Meer gestürzt, Ehebrecher aber lebendig begraben. Alles andere wurde durch Wiedervergeltung gesühnt: Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Gold war ihnen unbekannt wie jedes Metall, desgleichen berauschende Getränke. Beim Festmahl mischten sie Wasser mit Fruchtsaft.
Gegen innere Krankheiten nahmen sie den roten Saft des Drachenbaums, den sie »Drachenblut« nannten.
Die Guanchen besaßen große Geschicklichkeit im Flechten von Körben, Matten und Fischnetzen aus Binsen sowie einer Art Rucksäcke aus Palmenblättern. Aus Knochen und Fischgräten stellten sie Angelhaken und Nadeln her, aus Eingeweiden drehten sie Fäden und Seile. Ziegenhörner, an einem Brett befestigt, dienten als Pflug. Ihre Gefäße waren aus Tonerde oder aus hartem Holz.
Auch Künstler gab es viele unter ihnen: sie malten auf geglättete Steine mit Ocker und anderen Erdfarben. Meister aber waren sie in der Behandlung von Tierfellen, die sie für Kleidungsstücke, Decken und Sitze herrichteten. Ihre Art, die Felle zu bereiten, gab den besten marokkanischen Arbeiten von Mogador und Tafilete nichts nach.
Obgleich sie Inselbewohner waren, konnten sie nicht schwimmen. Auch Boote waren ihnen unbekannt. Sie fischten mit der Angel von den Klippen aus oder wateten bis an die Brust ins Meer hinein, die Binsennetze zwischen sich. Nachts entzündeten sie Fackeln und harpunierten die Fische. Auch zapften sie dem Tabaiba-Strauch, der Euphorbia canariensis, einen milchähnlichen Saft ab, den sie in stille Buchten und Lagunen gossen und damit die Fische betäubten. Ihre Frauen schmückten sich mit Muscheln, Blumen und Armbändern. Aus gebrannter Tonerde verfertigten sie zylindrische Stäbchen, die sie rotbraun färbten, auf Fäden zogen und als Ketten um den Hals trugen.
Beñesmen
Der greise Quebehi Bencomo trat aus seiner Höhle und beschattete die Augen mit der Hand gegen das grelle Morgenlicht. Seine hohe, sehnige, noch ungebeugte Gestalt straffte sich, Herrscherstolz sprach aus seinem ruhigen, klaren Blick, Klugheit und Edelsinn. Weißes Haar wallte ihm lang herab bis auf die Schultern.
Steinern, unbeweglich sah er über das Meer, als schaute er in zeitliche Fernen: weit zurück in die Vergangenheit und noch weiter in unbekannte Zukunft. Fleißig, geeint und friedlich lebten die Stämme der Guanchen auf dieser Insel inmitten des ungeheuren Weltmeers. Würde es immer so bleiben? Sorgenfalten zogen über seine hohe Stirn, er seufzte schwer auf. Dann ließ er sich auf der Felsbank unter der hohen kanarischen Kiefer nieder. Kühl wehte es von der Bucht herauf, die Kronen der schlanken Dattelpalmen neigten sich in der Morgenbrise.
Bencomos Blick glitt über das weite Tal von Arautápala und blieb dann auf dem Tagoror zu seinen Füßen haften. Heute war Beñesmen, das große Erntedankfest, das jedes Jahr mit Spielen, Kämpfen und Festmahl gefeiert wurde. Für ihn hatte das heutige eine besondere Bedeutung: es war das letzte, auf dem er als Herrscher von Taoro, als mächtigster Fürst der Insel Tehinerfe, den Vorsitz führte. Langsam strich seine Hand über die Kerben, die er stets am Ende des großen Gastmahls mit der scharf geschliffenen Tabona in den Stamm der stolzen Kiefer geritzt hatte: es waren mehr als viermal so viel, wie er Finger an beiden Händen hatte.
So lange schon war es her, daß er als junger, strahlender Mann zum Herrscher von Taoro gekrönt worden war. Ihm schien es wie gestern, daß die Fürsten und Edlen sich vor ihm niederwarfen, seine Xercos, Sandalen, küßten und ihm mit dem königlichen Gruß huldigten: »Zahaniat Guayohec!« Ich bin dein Vasall!
Sein Entschluß stand fest: heute wollte er seinem Sohn Durimán feierlich das Zepter überreichen und ihn zum Mencey von Taoro ausrufen.
Der Greis fuhr aus seinen Gedanken auf. Vom Tagoror herauf hörte er Lachen und polternde Steine. Den schmalen Felspfad empor stürmten zwei junge Menschen, voran sein Enkel Ruimán, ein blonder, hochgewachsener Jüngling. Ihm folgte in kurzem Abstand Dácil, die Schwester. Ruimán warf sich zu Boden, während Dácil den Großvater stürmisch umarmte. Liebevoll zog der Alte die beiden neben sich auf die Felsbank.
Dácil war schon festlich gekleidet. Ihre schnell atmende, jungfräuliche Brust hob sich deutlich unter dem seidenweichen Tamarco ab. Ein enger Gürtel umschlang die knabenhafte Hüfte. Ihre Füße staken in zierlichen Guaicas, Fellstiefeln. Um den Hals trug sie Muschelketten und weiße, duftende Guaidil-Blüten im Haar.
Ruimán war ein helläugiger, stolzer, selbstbewußter Jüngling, natürlich, unbefangen und strahlend wie der junge Morgen. So mochte der Bencomo ausgesehen haben damals, als noch sein Großoheim regierte und er als junger Prinz die Kampfspiele beim Beñesmen leitete.
Während Ruimán träumerisch über das Meer blickte, begann Dácil schnell und kindlich zu plaudern: »Ist es wahr, daß Vater heute Mencey wird, wie die Frauen beim Flechten der Matten in den Höhlen flüstern? Darf ich mit Guacimara beim Fest tanzen? Ich habe sie schon seit zwei Wintern nicht mehr gesehen...« Und ein wenig neugierig fügte sie hinzu: »Hast du auch Añaterve eingeladen, den Fürsten von Güímar?«
Bei diesen Worten runzelte der Alte die Stirn und sah sie von der Seite an. Dann sagte er langsam: »Ja... alle... auch ihn. Doch du weißt, er gefällt mir nicht, ich sehe nicht gern, daß du mit ihm sprichst. Er hat etwas Verschlagenes in seinem Blick...«
Hier unterbrach ihn der Ruf Ruimáns: »Vater kommt von der Jagd zurück, an seinem Gürtel hängen Wildkaninchen!«
Den jenseitigen Hang hinab glitt behende ein sehniger Mann. Nun verdeckten ihn Felsen, nun tauchte er wieder auf und winkte. Hinter ihm wurde ein großer, zottiger Inselhund sichtbar, der freudig bellte. Ruimán legte beide Hände an den Mund und rief: »Chacán, hierher!«
Mit wilden Sätzen über Gestrüpp und Steingeröll stürzte das Tier den Abhang hinunter, verschwand in der Schlucht und sprang kurz darauf an dem Sohn seines Herrn in die Höhe, der ihm liebkosend das weiche Fell klopfte.
Da tauchte der Vater aus der Schlucht auf und schwang sich auf den Altan. Ehrerbietig verneigte er sich vor dem greisen Quebehi. Dann umarmte er seine Kinder. Er war ein großer, stattlicher Mann mit auffallend blondem Haar, griechischer Nase, vorspringendem, tatkräftigem Kinn und kühnen Augen. Seine adlige Haltung verriet den geborenen Fürsten.
Auf dem Tagoror wurde es bald lebendig. Von allen Seiten strömten Männer, Frauen und Kinder herbei. In ihren Händen trugen sie Palmenwedel, Feldblumen, Blüten vom Guaidil und Lorbeerzweige, mit denen sie den Platz schmückten. Unter dem großen Drachenbaum wurden Binsenmatten und Felle ausgebreitet und die Añepa, die Standarte des Fürsten, eingerammt.
Ruimán und Dácil hielt es nicht länger. Sie sprangen auf und eilten lachend hinunter, um mitzuhelfen bei den Vorbereitungen für das große Fest.
Der greise Bencomo blieb allein mit seinem Sohn auf dem Altan zurück. Schweigsam saßen sie nebeneinander, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. So mochte Telemach, der Sohn des Odysseus, mit dem alten, weisen Nestor vom hohen Felsbalkon über das Ägäische Meer geschaut und seinen Lehren gelauscht haben. Schwer legte sich die Hand des Fürsten auf die Schultern des jungen Bencomo. Langsam, getragen begann er zu sprechen:
»Mein Sohn Durimán! Ich weiß, daß du tapfer, edel, gerecht, klug und ein würdiger Nachkomme deiner großen Ahnen bist. Von Jugend an gab ich dir die beste Erziehung, die je einem Prinzen von Taoro zuteil wurde. Dein Oheim Tinguaro, der größte Feldherr seit Tigaigas Zeiten, unterrichtete dich in der Kriegskunst. Unfehlbar ist der von deiner Hand geschleuderte Stein, kein Wild entgeht dem sicheren Wurf deiner Lanze. Einfach ist deine Lebensweise wie die deiner Ahnen, groß dein Ansehen unter den Fürsten der Insel.
Die uneinnehmbaren Höhen von Taoro, das reiche Tal von Arautápala, die Liebe und Achtung, die unsere Untertanen uns, den Enkeln des großen Tehinerfe, entgegenbringen, ihr sprichwörtlicher Mut, ihre zahlenmäßige Überlegenheit, sichern dir für immer die Vorherrschaft über die Insel, wenn es sein muß – mit Gewalt!«
Hier unterbrach sich der Alte, so als schweiften seine Gedanken in ferne Zeiten zurück, und fuhr dann fort:
»Gewalt! Sie ist die sicherste, schnellste, männlichste Waffe gegen den Feind, aber – auch die gefährlichste. Sie schlägt Wunden, die zwar vernarben, aber schwer vergessen werden. Eines Tages brechen sie auf und tränken das Land mit neuem Blut.
Auch ich habe, als du noch ein kleiner Knabe warst, Kriege führen müssen. Nicht Jugend, Herrschsucht oder Machtgelüst bestimmten mich dazu, sondern das heilige Vermächtnis Tehinerfes zwang mich, die Waffen zu ergreifen. So warf ich die Aufstände von Güímar und Abona nieder, so besiegte ich die Stämme von Daute und Adeje. Doch durch weise und gerechte Herrschaft verstand ich, die geschlagenen Wunden zu heilen und mir die ehemaligen Feinde zu bewundernden Freunden zu machen. Denn wisse: das heilige Vermächtnis, das Tehinerfe auf dem Sterbelager seinem Lieblingssohn Imobach mitgab, lautet: ›Meide den Bruderkrieg, wo immer du kannst, und greife nur dann zur Gewalt, wenn die Einigkeit des Guanchenvolkes in Gefahr ist. Eines Tags wird ein großer Feind übers Meer kommen und euch bedrohen. Ihr werdet unbesiegbar sein, solange ihr wie ein Mann zusammensteht.‹«
»Ein großer Feind?«
Der junge Bencomo war aufgesprungen und hatte zur Lanze gegriffen, die an der Kiefer lehnte. Seine Augen sprühten, hochrot schwoll die Zornesader auf seiner Stirn. Auch Chacán war in die Höhe gefahren, sprungbereit, wie um sich auf einen unsichtbaren Gegner zu stürzen.
Beruhigend zog ihn der Alte wieder auf die Bank nieder:
»Seit geraumer Zeit befinden sich Fremde in unserem Lande, die sich in Güímar, im Bereich des Fürsten Añaterve, niedergelassen haben. Eines Tages kamen sie von Morgen auf einem schwarzen Vogel mit weißen Flügeln, den wir Argijon, das Schiff, nennen. Oft habe ich diese Ungetüme beobachtet, wenn sie weit draußen über das Meer nach Benahore liefen. Sie tragen viele Menschen auf ihrem Rücken und in ihrem Bauch und müssen Diener des Guayote sein, der im Echeyde wohnt und unser Volk vernichten will.
Bisher sind es nur wenige, die hier ihr geheimnisvolles Wesen treiben. Vertraute berichteten mir, daß sie lange, schwarze Tamarcos tragen, die bis auf die Erde reichen, und ein Kreuz an einer geflochtenen Schnur auf der Brust. Krieger sind es nicht, auch führen sie keine Waffen. Sie gehören zu dem mächtigen Volk der Spanier und nennen sich Christen. Sie sagen, sie wären von Gott gesandt, doch nicht von Acorán, an den wir glauben, sondern von einem mächtigeren, unbekannten, der über dem Tigot wohnt und sie beschützt. Ihren Sigoñe, den Anführer, nennen sie Pater. Es ist ein alter Mann mit verzückt leuchtenden Augen, vor dem sie sich auf die Knie werfen und Stirn, Mund und Brust dreimal mit dem Finger berühren.
Zuerst lachten alle über das seltsame Gehabe dieser Fremden, doch dann geschah etwas Wunderbares. Als eines Tages ein Hirt Añaterves, der in der Grotte von Atbínico übernachtete, am Morgen aus seinem Schlummer erwachte, sah er neben sich im Halbdunkel eine hohe Frauengestalt in langem, faltenreichem Gewand, eine leuchtende Krone auf dem Haupt, in der Hand eine weiße Taube.
Zuerst glaubte er, es wäre ein lebendes Wesen, doch bald überzeugte er sich, daß es eine kunstvolle Figur aus Holz war. So etwas hatte er noch nie gesehen! Wie kam sie hierher? Sollten sie die Fremden während seines Schlafes hier aufgestellt haben? Er eilte hinaus, um Nachricht nach Güímar zu bringen.
Wie angewurzelt blieb er vor der Grotte stehen, er glaubte seinen Augen nicht zu trauen: den steilen Felspfad hinauf bewegte sich ein langer Zug dichtgedrängter Menschen. Voran schritt der Pater, die Hände gefaltet, den Kopf demütig zur Erde geneigt. Seine Diener in ihren langen, schwarzen Tamarcos folgten ihm. Ihnen schlossen sich Männer, Frauen und Kinder an, in deren Gesichtern Neugierde und Furcht geschrieben stand. Was bedeutete das? Was war geschehen? Hatte es etwas mit der Figur zu tun, die steif und unheimlich hinter ihm in der Grotte stand?
Näher und näher kam der lange Zug, jetzt hielt er vor dem Eingang der Höhle. Die Fremden warfen sich auf die Knie und murmelten unverständliche Worte vor sich hin. Dann erhob sich der Pater und trat, gefolgt von seinen Dienern, ein, während das Volk draußen wartend zurückblieb.
Bald hörte man aus dem Innern tiefen, langgezogenen Gesang. Vorsichtig lugte der Hirt hinein, neugierig drängten andere nach.
Was sie sahen, schien ihnen unheimlich und geheimnisvoll. Die Fremden hatten Fackeln entzündet und sie in die Felsspalten gesteckt. Aus einem blinkenden Gefäß, das einer der Diener schwenkte, drang süßlich betäubender Duft wie der Saft der Tabaiba, in rauchigem Nebel schwebte die Jungfrau über der Erde. Der Schmuck auf ihrem Haupte glänzte wie die Strahlen der Morgensonne, während die weiße Taube in dem flackernden Licht mit den Flügeln zu schlagen schien.
Jetzt wandte sich der Pater um, erhob beide Arme zum Himmel, breitete sie aus, als ob er alle umfassen wollte, und begann zu dem Volk zu sprechen:
›Leute von Güímar! Großes Heil ist euch widerfahren! Ausgezeichnet seid ihr unter allen Stämmen des Guanchenvolkes. Christus, unser mächtiger Gott, hat euch ein sichtbares Zeichen seiner Gnade gesandt. Seht her! Diese heilige Jungfrau ist seine wundertätige Mutter, die von jetzt ab in dieser Grotte wohnen wird, die ihr Atbínico nennt. Sie wird die Gläubigen beschützen und die Frevler strafen, sie wird Wunden heilen und Kranke genesen machen, sie wird ewig sein und die Hand schützend über euch, eure Kinder und Kindeskinder halten, wenn ihr dem falschen Acorán abschwört und euch dem einzigen Gotte, Christus, zuwendet. Lasset uns beten!‹ Dabei fiel er auf die Knie und mit ihm die Diener, während das Volk scheu zurückwich.
In diesem Augenblick drängte sich Zerdeto, einer der tapfersten Krieger von Güímar, durch die Menge. In seiner Hand hielt er einen schweren Feldstein. ›Guanchen!‹ rief er, ›diese Fremden sind Lügner und im Bunde mit Guayote, dem Dämon! Glaubt nicht ihren großsprecherischen Worten! Das dort drüben soll die Mutter eines mächtigen Gottes sein? Dieser mit den Farben des Teufels bemalte Holzklotz? Vor ihm sollt ihr euch auf die Erde werfen und ihm huldigen mit dem Gruß »Zahaniat Guayohec«, der nur dem Könige gebührt? So wahr ich der Krieger Zerdeto bin, der in der Schlacht in der ersten Reihe steht, ich werde dieser lächerlichen Gottesmutter das Haupt zerschmettern!‹ Dabei holte er weit aus und schleuderte den schweren Feldstein gegen das Standbild.
Doch was war das? Der Stein verfehlte sein Ziel! Hatte das flackernde Licht den Meister des Wurfs getäuscht, der Zorn ihm sein Auge getrübt, der Räuchernebel ihn betäubt? Polternd schlug der Stein gegen die Felswand.
Im selben Augenblick fiel Zerdeto mit einem Aufschrei zu Boden. Als sie ihn emporhoben, hing der rechte Arm, mit dem er den Stein geschleudert hatte, leblos herunter. Er war wie abgestorben, wie der kahle Zweig einer Pinie. Das Volk aber floh entsetzt aus der Grotte, den steilen Felspfad hinunter, verbarg sich in den Höhlen, flehte zu Acorán und bat ihn, die fremden Zauberer zu vernichten.
Als Añaterve von diesem Vorfall erfuhr, ließ er Zerdeto zu sich kommen. Der junge, tapfere Krieger schien in wenigen Stunden um Jahre gealtert. Er zitterte, sprach stammelnd, verwirrt, unzusammenhängend. Schweigend hörte Añaterve den merkwürdigen Bericht und blieb in Gedanken versunken in seiner Höhle.
Kurz darauf trat der Pater ein. Was die beiden bis tief in die Nacht hinein miteinander verhandelten, habe ich nie erfahren können.
Drei Tage und drei Nächte ließ Añaterve niemanden zu sich, dann rief er seine Sigoñes und Krieger zusammen und verkündete, daß die Christen unter seinem Schutze stünden und er ihnen die Grotte von Atbínico zu eigen gäbe.
Zerdeto aber siechte dahin: er magerte ab, sein Haar wurde weiß, eines Morgens fand man ihn tot auf seinem Lager.
Geraume Zeit verging, da erkrankte Ico, die Lieblingsschwester Añaterves. Zuerst klagte sie über Schmerzen in allen Gliedern, dann verschmähte sie Speise und Trank, Fieber stellte sich ein, in ihren Träumen rief sie immer wieder nach dem neuen Gott. Man packte sie in feuchte Lorbeerblätter, flößte ihr Drachenblut ein, nichts half. Ihr Zustand verschlimmerte sich immer mehr.
Da befahl Añaterve, die Todkranke hinaufzutragen zur Grotte von Atbínico, wo jetzt die wundertätige Mutter des neuen Gottes wohnte, die sie Maria nennen.
Als die Bahre mit der Prinzessin sich dem Eingang näherte, trat der Pater heraus und schlug über Ico das Zeichen des Kreuzes. Dann trugen seine Diener die Kranke in die Grotte. Añaterve folgte ihnen auf dem Fuße.
Es war das erstemal, daß er der Heiligen Jungfrau gegenüberstand. Gebannt blieb sein Blick auf dem strahlenden Schmuck ihres Hauptes hängen, der im Schein der Fackeln wie Meeresleuchten flimmerte.
Alle warfen sich zu Boden, von unbekanntem Schauer erfaßt – auch Añaterve. Ico aber stand auf, fiel der Jungfrau zu Füßen und küßte den Saum ihres faltigen Tamarco.
Als das der Pater und seine Diener sahen, stimmten sie einen Lobgesang an und priesen die Allmacht ihres mächtigen Gottes, der solches Wunder vollbracht und Ico geheilt hatte. Das Volk aber, das draußen harrte, brach in lauten Jubel aus und rief: ›Heil dir, Maria des Lichts! Du sollst von nun ab die Schutzgöttin unseres Stammes sein!‹
Am Abend folgte ein großes Fest auf dem Tagoror von Güímar. Anderntags aber wurde Añaterve ein Christ und mit ihm viel Volks. Seit dieser Zeit brennen ewige Fackeln in der Grotte von Atbínico und jeden siebenten Tag bewegt sich ein langer Zug den steilen Felspfad hinauf, um der ›Heiligen Jungfrau des Lichts‹ zu huldigen. Voran schreitet Añaterve und hinter ihm die einst so stolzen Krieger von Güímar, gebückt, Asche auf dem Haupt, Gebete murmelnd. Ihnen folgen Frauen, Kinder und Greise ...«
Bis hierher hatte der junge Bencomo seinen Vater schweigend angehört, nun unterbrach er ihn:
»Und warum riefst du nicht deine Krieger, tötetest die Fremden oder jagtest sie aus dem Lande? Gefährden sie nicht die Einigkeit unter den Stämmen der Guanchen? Sind sie nicht der Feind, den der große Tehinerfe ankündigte?«
»Höre weiter, mein Sohn Durimán! Auch ich trug mich zuerst mit diesem Gedanken. Doch dann sandte ich heimlich den jungen Prinzen Badenol, den Bruder Acaimos, des Fürsten von Tacoronte, als Hirt verkleidet über das Gebirge. Was er mir bei seiner Rückkehr berichtete, war seltsam genug. Doch es beruhigte mich und ließ mich von Gewalt absehen.
›Diese Christen sind friedliche Leute,‹ so sagte er, ›die nichts als Gutes tun. Sie bebauen das Land um die Grotte von Atbínico, besuchen Kranke und Sterbende in ihren Höhlen und sprechen ihnen Trost zu. Sie tragen niemals Waffen und scheinen auch keine zu besitzen. Dabei leben sie abgesondert, und auch Frauen berühren sie nicht.
Manchmal kommt ein großer, schwarzer Vogel mit weißen Flügeln über das Meer und bringt ihnen Geschenke, die sie unter das Volk verteilen: Halsketten mit kleinen Kreuzen, auf denen ihr Gott abgebildet ist, gelbe Fackeln aus einer weichen Masse, die sie Velas, Kerzen, nennen, buntfarbene Tamarcos für Frauen und Mädchen...
Es ist wahr, viele Guanchen von Güímar huldigen dem neuen Gott. Doch mehr als ihn verehren sie dich, o Mencey von Taoro, und deine Ahnen. Wenn du sie rufst, werden alle Krieger wie ein Mann an deiner Seite stehen.‹
Ich ging lange mit mir zu Rate, Prinz Badenol hatte recht. Die Fremden waren friedlich und ungefährlich. Wenn ich sie tötete oder aus dem Lande jagte, kamen vielleicht Krieger ihres Volkes, um sie zu rächen. Ich fühlte, daß es das beste war, sie einfach zu übersehen. Welche Gefahr konnte denn dem mächtigen Volke der Guanchen von einer Handvoll unbewaffneter Männer drohen, die einsam blieben und nicht einmal Kinder zeugten? Es wurde mir klar, daß, wenn ich Gewalt gegen die Fremden gebrauchte, ein Bruderkrieg unvermeidlich war. Ließ ich sie jedoch ruhig gewähren, so ging ich jedem Haß und Zwist aus dem Wege und erfüllte so das Vermächtnis unseres großen Ahnen.«
Er unterbrach sich einen Augenblick, sah seinen Sohn liebevoll an und umarmte ihn:
»Heute, Durimán, lege ich feierlich die Herrschaft über das geeinte, starke und mächtige Volk der Guanchen in deine Hand. Vergiß nie die letzten Worte des edlen Tehinerfe! Suche stets den Frieden unter den Stämmen zu erhalten und verabscheue den Bruderkrieg, denn: Gewalt gebiert Gewalt! Doch sollte eines Tages der große Feind übers Meer kommen, so tritt ihm an der Spitze deiner Krieger entgegen, denn dann geht es um die Freiheit der Guanchen!«
Helle Nachmittagssonne lag über dem festlich geschmückten Tagoror. Unter den riesigen Lorbeerbäumen, die den weiten Platz umstanden, herrschte reges Leben. Von allen Seiten strömte das Volk herbei, um Beñesmen, das große Erntedankfest, zu feiern. Männer, Frauen und Kinder aus allen Teilen der Insel waren herbeigeeilt, um ihren geliebten Fürsten, den greisen Quebehi Bencomo, und damit Acorán selbst zu ehren.
Da sah man stolze Krieger aus den Bergen von Tegueste, hochgewachsene, schöne Frauen aus Anaga, blonde, sehnige Jünglinge aus Tacoronte, die den Beginn der Kampfspiele kaum erwarten konnten, dunkeläugige, braungebrannte Fischer aus Adeje, Abona und Güímar und schweigsame Bewohner aus den Bergen von Icod.
Alle trugen Festgewänder: lose fallende, fußfreie Tamarcos, eng anliegende Huirmas, Ledergamaschen, und feste, hohe Guaicas. Die Schilde der Krieger und die Lanzen waren mit Blumen umwunden.
Frauen und Mädchen hatten ihren schönsten Schmuck angelegt: Halsketten aus weißen, gleichmäßigen Muscheln, auf Fäden gereihte, zierliche Schnecken, nach Rosenholz duftende Guaidil-Blüten im Haar. Ihre schmiegsamen Tamarcos, über der Hüfte mit einem breiten Gürtel zusammengehalten, reichten bis auf die Erde. Nur beim Schreiten erhaschte das suchende Auge den schlanken Fuß in der leichten, breitriemigen Sandale.
Langsam füllten sich die steinbehauenen Sitze, die den weiten Platz umstanden, vor denen sich Knaben und Mädchen im Sand niederließen. Winkend begrüßten sich Freunde, die sich seit dem letzten Beñesmen nicht mehr gesehen hatten, Rufe flogen herüber und hinüber, Verwandte umarmten sich.
Da klang der langgezogene Ton eines Fatuto, Muschelhorns, über den Tagoror und brach sich an den schroffen Felsen des Tigaiga. Lautlose Stille trat ein. Aller Augen starrten gebannt hinauf zur Königshöhle, in deren Eingang jetzt hocherhobenen Hauptes der greise Quebehi erschien.
Unter der großen Kiefer blieb er stehen und ließ seinen Blick über das Volk schweifen, das sich von den Sitzen erhoben hatte. Dann streckte er den Arm weit zum Gruß vor, die Hand nach unten, als wollte er mit dieser Bewegung andeuten, daß sie alle unter seinem Schutze stünden. Ein tausendstimmiger Jubelschrei antwortete ihm.
Langsam stieg er den steilen Felspfad zum Tagoror hinunter, hinter ihm sein Sohn, gefolgt von Ruimán und Dácil. An die Füße seines Herrn geschmiegt, den Kopf erhoben, mit offenem Maul, aus dem das kräftige Gebiß leuchtete, drängte sich Chacán, majestätisch, stolz, als wäre er sich der Feierlichkeit der Stunde bewußt.
Der Kreis teilte sich, und ehrerbietig verneigte sich das Volk, als die vier hindurch und auf den Drachenbaum zuschritten. Unter der Añepa, der Standarte, blieb der greise Bencomo einen Augenblick stehen, dann ließ er sich auf dem mit Fellen bedeckten Felsblock nieder.
Wieder öffnete sich der Kreis, und herein traten die Fürsten und Edlen der Inselstämme. Voran schritt der noch rüstige, ungebeugte Tinguaro, der Bruder Quebehi Bencomos, der große Feldherr, der mit lautem Zuruf begrüßt wurde. Ihm folgten Beneharo, Mencey von Anaga, der seine Tochter Guacimara am Arm führte, Fürst Pelicar von Icod, Zebensui von Tegueste und Acaimo von Tacoronte, neben ihm sein junger Bruder Prinz Badenol.
Dann kamen die Menceys Perinor, Rosmen und Ajoña, von Adeje, Daute und Abona. Den Schluß machte stolz und ein wenig verächtlich über das Volk hinlächelnd Fürst Añaterve, Mencey von Güímar.
Langsam näherten sie sich dem Sitz Bencomos, ließen sich einzeln vor ihm auf die Knie nieder und küßten den Saum seines Tamarcos. Dann nahmen sie um ihn herum unter dem Drachenbaum Platz.
Nun schwankten auf großen Tragbahren die Gastgeschenke heran, die zu Füßen der Fürsten niedergesetzt wurden: saftige Brombeeren aus dem Tal von Taganana, Feigen und Datteln aus Adeje, goldgelbes Getreide aus Güímar, Palmenbirnen und Fichtenzapfen aus Abona. Tegueste und Tacoronte sandten junge Lämmer, Icod zarte, wohlschmeckende Bergzicklein, Daute frisch erlegte Wildkaninchen, Pilze und Früchte vom Erdbeerbaum.
Jetzt gab Quebehi Bencomo seinem Bruder Tinguaro ein Zeichen. Dieser hob die Hand, ein Muschelhorn ertönte, die Kampfspiele begannen.
Zuerst traten die besten Läufer an. Schnell hatten sie sich ihres Tamarcos entledigt, die Huirmas abgestreift und die Fellstiefel mit leichten Sandalen vertauscht. Auf ein Zeichen Tinguaros stürmten sie los, von den Umsitzenden durch laute Zurufe angefeuert.
Dreimal um den Tagoror ging das Rennen. Der Sieger, ein junger Krieger aus Tacoronte, kniete vor Tinguaro nieder, der ihn unter dem Beifall der Zuschauer mit frischem Lorbeer schmückte und ihm einen feinen Hammel überreichen ließ.
Springen, Lanzenwerfen, Steinstoßen und Ringkampf folgten. Im letzteren blieben wie stets die zähen Bergbewohner von Icod Sieger.
Dann trat eine Pause ein, während der Knaben und Mädchen erfrischende Fruchtgetränke herumreichten, die Zuschauer miteinander plauderten und die Kämpfer ihre Festgewänder wieder anlegten.
Prinzessin Dácil und Guacimara gingen unter dem Drachenbaum auf und ab und sprachen lebhaft miteinander. Jetzt gesellte sich Ruimán zu ihnen und drückte fest die Hand des schlanken, hochgewachsenen Mädchens, neben dem seine Schwester wie eine zierliche Tanagra-Figur wirkte.
»Blume von Anaga«, sagte er und sah sie mit seinen großen, träumerischen Augen an, »es ist lange her, daß wir uns gesehen haben, und die Knospe von damals ist aufgeblüht.«
Einen Augenblick schlug das Mädchen errötend den Blick nieder, dann sah sie ihn frei an: »Auch du, Ruimán, bist ein stattlicher Jüngling geworden, dem die adlige Geburt auf die Stirn geschrieben steht.« Und leise fügte sie hinzu: »Ich würde mich freuen, dich einmal in Anaga zu sehen.« Sie wollte fortfahren, da unterbrach sie der langgezogene, dumpfe Ton des Fatuto.
»Bis nachher!« rief Ruimán, drückte ihr schnell die Hand, winkte seiner Schwester zu und eilte auf den Kampfplatz, auf den man in einer Entfernung von zehn Lanzenlängen zwei große Felsblöcke gerollt hatte.
Gleichzeitig mit Ruimán war Prinz Badenol in den Kreis getreten. Jetzt gingen beide aufeinander zu und grüßten sich mit hocherhobenem Arm. Dann bestieg jeder einen der beiden Felsblöcke. Ein Krieger reichte ihnen kleine Schilde und flache Steine hinauf.
Alle folgten mit Spannung den Vorbereitungen zum Zweikampf der beiden Prinzen. Es galt, jedem Wurf des Gegners auszuweichen, ohne die Fußstellung zu verändern. Ein Treffer gegen Mann oder Schild entschied den Sieg.
Prinz Badenol eröffnete den Angriff. Scharf hintereinander sausten drei Steine durch die Luft, dicht über Ruimán hinweg, der sich rasch gebückt hatte. Einen vierten, der der Hand des Prinzen Badenol zu früh entschlüpft schien, fing er geschickt auf und schleuderte ihn so blitzschnell zurück, daß seinem Gegner gerade noch Zeit blieb, den Kopf hinter dem schützenden Schild zu bergen. Ein Jubelschrei kündete den Sieg des Prinzen von Taoro. Beide sprangen vom Felsen herab, schüttelten sich die Hände und gingen dann Arm in Arm aus dem Tagoror.
Zweikampf auf Zweikampf folgte. Jedesmal, wenn einer getroffen wurde, trat ein anderer an seine Stelle, die Begeisterung der Zuschauer stieg, Mädchen warfen den Siegern Blumen zu...
Die Sonne war schon halb hinter der Insel Benahore, deren zackige Umrisse sich scharf gegen den blutroten Himmel abhoben, versunken, als auf ein Zeichen Tinguaros die Spiele abgebrochen wurden.
Inzwischen hatte man rings um den Tagoror große Holzstöße errichtet, die jetzt entzündet wurden. Gleichzeitig flammten auf den Bergen von der Ostkette bis zum Tigaiga riesige Freudenfeuer auf, deren Rauch senkrecht in den sich verdunkelnden Abendhimmel stieg.
Atemlose Stille entstand, als sich der greise Bencomo erhob. Sein Blick glitt schweigend über die Fürsten, die erwartungsvoll zu ihm aufschauten. Nur Añaterve sah zur Erde und malte mit seiner Tabona Figuren in den Sand. Als er den Kopf hob, lag um seinen Mund ein lauernder Zug.
Bencomo, das Zepter gegen den Drachenbaum gestützt, reckte sich hoch auf und hob die Hand:
»Fürsten der Guanchen, Edle von Tehinerfe, Krieger und Volk, hört mich an!
Heute ist es das letztemal, daß ich als Fürst von Taoro und König der Insel zu euch spreche. Viele Jahre sind vergangen, seit ich das erste Beñesmen mit euch feierte. Die Reihen meiner Altersgenossen haben sich gelichtet, nur wenige sind es noch, die ich um mich sehe. In meiner langen Regierungszeit habe ich mich bemüht, euch ein gerechter und kluger Herrscher zu sein. Ich sorgte dafür, daß Streitigkeiten unter den Stämmen friedlich beigelegt wurden, daß die Vorratskammern gefüllt waren, wenn der Guayote unsere Felder verwüstete oder Mißernten unser Land heimsuchten.
Und nicht nur das! Das Wohlergehen jedes einzelnen von euch lag mir am Herzen. Nie war mein Ohr einer gerechten Bitte verschlossen, unverschuldete Notlagen milderte ich, wo ich konnte, wohlverdiente Hilfe wurde jedem zuteil, der sie benötigte.«
Beifälliges Gemurmel unterbrach ihn, dann fuhr er fort:
»Mein Haupt ist weiß geworden wie der Scheitel des Echeyde im Winter, mein Auge trübe von dem vielen, was es in langen Jahren sah, mein Arm, mit dem ich euch in Einigkeit zusammenhielt, ermüdet. Deshalb habe ich mich entschlossen, heute meinem Sohn Durimán das Zepter zu übergeben. Von dieser Stunde ab soll er als Mencey Bencomo euer Herrscher sein! Gehorcht ihm, wie ihr mir gehorcht habt, und steht einig zu ihm, wann immer er euch ruft!«
Damit trat der alte Quebehi auf seinen Sohn zu und überreichte ihm das Zepter, den heiligen, vom Fleisch entblößten Oberarmknochen des großen Tehinerfe, das Zeichen der Macht über die Inselstämme.
Durimán nahm es aus der ruhigen Hand des Alten, küßte es ehrfurchtsvoll, schwang es über dem Haupte und sprach dabei die Krönungsformel: »Acorán, nun habec, sahagua reste guagnat, sahur banot gerage sote.« Ich schwöre bei Gott und den Gebeinen meines Ahnen, seinem Beispiel zu folgen und meine Untertanen glücklich zu machen!
Dann ging das Zepter unter den Fürsten von Hand zu Hand. Jeder küßte es, hielt es auf den Rücken und sprach den Eid: »Wir schwören bei dem Tag deiner Krönung, immer deine und deiner Sippschaft Verteidiger zu sein! Agonec Acorán in at Zahana namet! Ich schwöre, o Gott, den Vasallen auf den Knochen!«
Während Tinguaro dem neuen Herrscher die Stirn mit Lorbeer schmückte, beugte sich der greise Quebehi als erster vor seinem Sohn nieder, um den Saum seines Tamarco zu küssen. Doch schnell hob Durimán ihn auf und umarmte ihn. Als er in sein Antlitz sah, hatten sich die Augen des Vaters für immer geschlossen.
Das Volk aber warf die Arme in die Luft und rief:
»Es lebe Fürst Durimán! Es lebe Mencey Bencomo!«
Das Heiligtum von Taganana
Grollend schlugen dunkle Wogen gegen die steilen Basaltklippen von Anaga, sprangen an ihnen empor, zerstäubten und rieselten in hellem Mondlicht wie flüssiges Silber in die dunkle See zurück. Schwarz, drohend, unheimlich türmten sich die zerklüfteten Bergketten der Cumbre gegen den nächtlichen Himmel, der im lautlosen, urgewaltigen Feuerwerk südlicher Sterne strahlte.
Prinzessin Guacimara lag schlaflos in der geräumigen Höhle auf weichem Lager und träumte vor sich hin. Ein Kienspan warf sein flackerndes Licht auf die zackigen Wölbungen der Decke, und im Halbdunkel tanzten zitternde Schatten über die felsigen Wände. Leise tönten vom Eingang her die flüsternden Stimmen der Dienerinnen...
Kurz vor Dämmerung waren Boten aus Taoro gekommen, die ihrem Vater Beneharo das Eintreffen des Prinzen Ruimán und seiner Schwester Dácil meldeten. Er hatte also Wort gehalten, damals beim letzten Beñesmen, als er ihr versprach, nach Anaga zu kornmen. Morgen gegen Mittag würde er hier sein.
Jähes Glücksgefühl machte sie wonnig erschauern. »Blume von Anaga« hatte er sie genannt mit seiner schönen, weichen und doch so männlichen Stimme, »Blume von Anaga...«
Sie liebte ihn, diesen jungen, ritterlichen Prinzen mit den träumerischen Augen und der adligen Gesinnung. Schon als Kinder hatten sie zusammen am Strande von Taoro gespielt, waren von Klippe zu Klippe gesprungen, hatten kleine, weiße Muscheln gesucht und flache Steine übers Meer tanzen lassen. Wenn sie müde war, trug er sie auf seinen Armen hinauf zum Tagoror, legte sie behutsam unter den schattigen Lorbeerbäumen nieder und bewachte ihren Schlummer.
Ja, sie liebte ihn! Wenn einer ebenbürtig war an Sinn und Geschlecht, dann er, nur er. Und sie? Sie würde einst Königin von Taoro, Königin von Tehinerfe sein, sie, die sie Guacimara, die Mannhafte, nannten.
Strahlend lag der Lebensweg vor ihr. War nicht ihr Vater Beneharo der Vertrauteste des großen Durimán Bencomo unter den Fürsten der Insel? Hatte er nicht immer getreu zu den Enkeln Tehinerfes gehalten, damals im Streit um Güímar und Abona, als er die unüberwindliche Cumbre besetzte und den Verrätern in den Rücken fiel? Sie, Guacimara, haßte nur eins: Verrat! Und sie liebte nur eins: Seelenadel! Wäre Ruimán nichts als ein Hirt gewesen, sie wäre mit ihm gegangen, irgendwohin, wo es Futter gab für ein paar Schafe und Ziegen, Getreide, Wurzeln und für die Festtage Früchte vom Erdbeerbaum.
Sie spann sich in diesen Gedanken ein: Ja, mit ihm allein... irgendwohin... wo es nichts gab als Sonne, Meer und Einsamkeit, keine Menschen, keinen Streit, keinen Freund, keinen Feind.
Gedankenvoll sah sie einer Fledermaus nach, die ängstlich um den Kienspan flatterte und dann ins Freie flog... Wie hatte doch das dunkle, düstere, unverständliche Orakel gelautet, das dumpf aus dem Heiligtum von Taganana an ihr Ohr gedrungen war, ehe sie hinüberwanderte nach Taoro zum letzten Beñesmen? Leise wiederholte sie es:
»Du liebst einen Prinzen
Von edlem Geschlecht,
Von adligem Wesen
Voll Tugend und Recht.
Und eh ihr euch beide
Für immer vereint,
Steht an diesem Gestade
Der mächtige Feind.
Doch der Prinz wird dich holen
Und mit dir entfliehn,
Und fern von hier
Wird die Liebe euch blühn.
Einen armen Hirten nur
Wirst du frei’n,
Ohne Krone, Zepter und Macht,
Und kurz wird euer Glück nur sein,
Denn schnell kommt die ewige Nacht.
Kein Irdischer kann
Seinem Schicksal entfliehn,
Du liebst einen Prinzen
Und stirbst mit ihm...«
Ja, wenn die Magades, die heiligen Priesterinnen, die den Schleier der Zukunft lüften konnten, recht behielten, dann wollte sie nach dem Willen Acoráns gern mit ihm zusammen sterben. Denn was war das Leben ohne ihn? Selig lächelnd schlummerte sie ein...
Eine Dienerin, die lautlos herangehuscht war, machte den anderen ein Zeichen. Das Gespräch verstummte. Prinzessin Guacimara schlief.
Schweigen im Walde von Tacoronte. Ein erster Sonnenstrahl huscht zitternd durch dichtes Laubwerk und spielt über das Antlitz des jungen Prinzen. Ruimán fährt aus dem Schlaf auf und erhebt sich. Neben ihm auf sorgsam geschichtetem Lager ruht Dácil und träumt. Um ihren schön geschwungenen Mund spielt ein glückliches Lächeln.
Schweigend betrachtet er sie: ihre zierliche Figur, ihre langen, seidenen Wimpern, ihre schmalen, feingliedrigen Hände... Manchmal scheint es ihm, als ob sie aus einer anderen Welt wäre. Seit dem frühen Tod der Mutter ist er ihr steter Begleiter, Vertrauter, Freund, Spielgefährte. Die kleine Dácil! Für sie gab es nur Sonne, Lächeln und Träume...
Jetzt beugt er sich über sie und weckt sie mit einem Kuß. »Dácil!« Voll schlägt sie die Augen zu ihm auf und schlingt die Arme um seinen Hals. Er hebt sie empor und klopft das Laub von ihrem Tamarco.
Ehrerbietig nähern sich die Krieger, die am Waldrand den Schlaf der Königskinder bewachten. Schnell ist das Frühstück eingenommen: eine Hand voll Gofio aus dem ziegenledernen Beutel, ein paar süße Früchte vom Mocán. Dann gibt Prinz Ruimán das Zeichen zum Aufbruch.
Es geht steil bergan. Nach ein paar Stunden rasten sie auf der Cumbre, dem Grat. Zu ihren Füßen dehnt sich das unendliche Meer wie eine blaue Kristallschale, gefüllt mit flimmernden Silberstücken. Steil und zerrissen stürzen die Schluchten nach Anaga ab.
Auf einem Ziegenpfad, der sich in unzähligen Windungen hinunterschlängelt, geht es in die Tiefe. Bald wieder nimmt sie schattiger Laubwald auf.
Als sie sich mitten auf einer Lichtung befinden, wird es um sie her plötzlich lebendig: Muschelhörner ertönen, festlich geschmückte Krieger treten aus dem Wald und schließen sich ihrem Zug an. Es ist das Ehrengeleit, das ihnen Mencey Beneharo bis an die Grenze seines Reiches entgegengesandt hat.
Sie durchschreiten einen hohen Pinienwald, überqueren eine blumige, sanft geneigte Wiese, durch die sich ein munterer Bach schlängelt. Ragende Kiefern... ein lichter Palmenhain... ein weiter, von leuchtenden Büschen umstandener Platz: vor ihnen rundet sich der Tagoror von Anaga.
In der Mitte unter einer hohen, schlanken Dattelpalme steht Beneharo mit seinen Sigoñes und Edlen; neben ihm Guacimara, bunte Frühlingsblumen im Haar. Krieger und Volk umlagern das weite Rund.