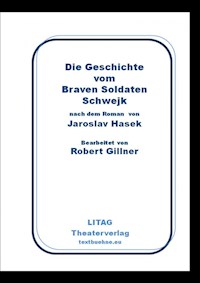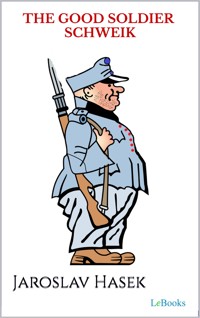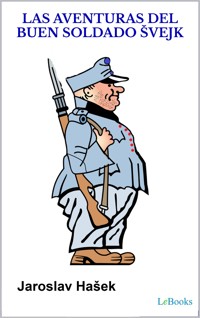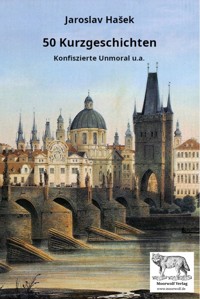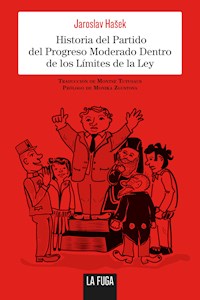Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wieser Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: wtb Wieser Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Diese frühen Texte Jaroslav Hašeks in der Übersetzung der vortrefflichen Grete Reiner waren lange unbekannt. Hier werden sie den Lesern geboten, die mehr über den Autor des braven Soldaten Schwejk erfahren wollen. Wichtig ist vor allem die Erzählung "Kommandant der Stadt Bugulma", ohne die Hašeks berühmter Roman nicht zu verstehen ist, meinte Karel Kosík. Der Band wird ergänzt durch Berichte von František Langer und Josef Lada, Freunden Hašeks, und zwei Essays zu seinem Werk, einem von Karel Kosík und einem von Hans Dieter Zimmermann zu den Antipoden Kafka und Hašek.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HAŠEK • DER URSCHWEJK
Zur Aussprache tschechischer Buchstaben mit diakritischen Zeichen:
á
langes a
Č, č
stimmloses tsch wie in Tschechische Republik
é
langes e
ě
je
í
langes i
ň
nj
ř
gerolltes r gleichzeitig mit sch
Š, š
stimmloses Sch, sch wie in Schule
t’
tj
ú, ů
langes u
ý
langes i
Z, z
stimmhaftes S, s wie in Rose
Ž, ž
stimmhaftes sch wie in Journal
JAROSLAV HAŠEK
Der Urschwejk
und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Rußland
Aus dem Tschechischen von Grete Reiner Mit einem Essay von Karel Kosík und einem Nachwort von Hans Dieter Zimmermann
wtb 045
KLAGENFURT/CELOVEC • WIEN • LJUBLJANA • BERLIN
A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12
Tel. +43(0)463 37036, Fax. +43(0)463 37635
www.wieser-verlag.com
Copyright © dieser Ausgabe 2021 bei Wieser Verlag GmbH,
Klagenfurt/Celovec
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Josef G. Pichler
ISBN 978-3-99029-452-9 (Print Ausgabe)ISBN 978-3-99047-118-0 (Epub)
Inhalt
Vorrede von Grete Reiner (1928)
I.
Der Urschwejk
1. Schwejk zieht gegen Italien
2. Schwejk holt Meßwein
3. Schwejk wird superarbitriert
4. Schwejk im Arsenal
5. Schwejk als Flieger
II.
Kommandant der Stadt Bugulma
III.
Der Horschitzer Bezirkshauptmann
IV.
Die Staatspolizeischule
V.
Oberpolizeikommissär Wagner
VI.
Die Korruptionsaffaire des Magistratspraktikanten Bachura
VII.
Der Bandwurm der Fürstin
VIII.
Die Sarghandlung
IX.
Spiritistischer Nachwuchs
X.
Die Geschichte vom toten Wähler
XI.
Hymne der Beharrlichkeit
XII.
Der junge Kaiser und die Katze
XIII.
Die Verlobung in unserer Familie
XIV.
Gerichtssachverständige
XV.
Der Tolpatsch
XVI.
Wie man mit Erfolg Selbstmörder rettet
XVII.
Kettenhandel mit Sacharin
XVIII.
Historische Anekdoten
XIX.
Er schüttelt den Staub von seinen Schuhen
XX.
Begegnung mit dem Verfasser meines Nekrologs
František Langer: Erinnerungen an Jaroslav Hašek
Josef Lada: Wie ich sie kannte
Karel Kosík: Schwejk und Bugulma oder Die Entstehung des großen Humors
Hans Dieter Zimmermann: Jaroslav Hašek – Leben und Legende. Ein Nachwort
Hans Dieter Zimmermann: Die Übersetzerin Grete Reiner
Zu diesem Band
Literaturhinweise
In diesem Band wurde die alte Rechtschreibung beibehalten.
Vorrede
Nicht nur in seinem Schwejk, sondern auch in Kurzgeschichten, von denen bereits ein Band* vorliegt, erweist sich Hašek als Humorist größten Formats. Niemand versteht es so wie er, das Groteske seiner Situation zu erfassen und es mit ein paar Strichen und doch mit unglaublicher Plastizität festzuhalten. Die Proben, die in diesem Bande gesammelt erscheinen, zeigen ihn vor allem wiederum als unübertrefflichen Durchschauer aller k. und k. Fäulnis. Es kann keine vollkommenere Abrechnung mit dem österreichischen Polizeiregime, ja darüber hinaus mit jedem Polizeiregime geben, als die Geschichte von dem diensteifrigen Spitzel Braun, der zum Schluß seinen eigenen Sohn und seine eigene Frau verhaftet.
Über die Bedeutung des Schwejk Worte zu verlieren, wäre überflüssig. In dem vorliegenden Band sind die ersten Entwürfe Hašeks zu dieser ohne Übertreibung weltberühmt gewordenen Gestalt enthalten. Sie stammen durchwegs aus der Zeit vor dem Kriege und zeigen, wie lange diese Gestalt im Kopfe Hašeks reifte. Ihre Frische und ihr Humor stehen hinter dem Nachkriegs-Schwejk wohl kaum zurück.
Ein besonders breiter Raum wurde in dieser Auswahl der Kriegszeit, diesem Haupterlebnis Hašeks, und insbesondere seinen Erlebnissen während der russischen Revolution eingeräumt. Hašek war als österreichischer Soldat gefangengenommen worden und hatte sich den tschechischen Legionen angeschlossen, ging jedoch später zu den Bolschewiki über. In der Zeit seines Aufenthaltes in Rußland, der bis zum Jahre 1920 dauerte, schrieb er eine Unzahl Humoresken, Feuilletons, ja sogar Theaterstücke, von denen bisher nur ein spärlicher Rest gesammelt werden konnte. Sein Kampf an der Seite der Bolschewiki trug ihm in seiner Heimat starke Antipathien ein, und er hatte nach seiner Rückkehr viele Anfeindungen zu bestehen. Wie aus den in diesem Bande vereinigten Grotesken aus Rußland hervorgeht, hatte sich Hašek bei aller Sympathie für die Bolschewiki ein scharfes Auge für alle Nutznießer des welthistorischen Umsturzes in Rußland bewahrt. Und so sind seine Schilderungen neben ihrer humoristischen Potenz zwar nicht als Dokumente, wohl aber als Stimmungsschilderungen aus Rußland von höchster Bedeutung. Und auch die Stimmung der Heimkehrertransporte aus Rußland ist wohl von keinem zeitgenössischen Schriftsteller mit so prägnanter Eindringlichkeit festgehalten worden wie von Hašek in der Groteske »Er schüttelte den Staub von seinen Schuhen«.
Nirgends verleugnet sich der große Rebell: Von dem höflichen Gruß Schwejks angefangen, »Gelobt sei Jesus Christus, melde gehorsamst«, der die endgültige Abrechnung mit jeglicher Verbindung von Schwert und Altar bedeutet, bis zur Schilderung des Massengrabes der niedergeschossenen Rotarmisten in Narwa. So wird das Buch neben seinem literarischen Wert zu einem Dokument des Kampfes, den Jaroslav Hašek in seiner Weise für die Armen und Unterdrückten auf dieser Erde führte.
Prag, am 11. November 1928
Grete Reiner
* Jaroslav Hašek: Von Scheidungen und anderen tröstlichen Dingen, Verlag A. Synek, Prag.
I. Der Urschwejk
1. Schwejk zieht gegen Italien
Schwejk rückte frohen Herzens ein. Er hatte kein anderes Ziel, als sich beim Militär einen Jux zu machen, und es gelang ihm auch, zum Schrecken der ganzen Garnison in Trient zu werden, den Garnisonskommandanten inbegriffen. Schwejk hatte stets ein Lächeln um die Lippen, war liebenswürdig in seinem Benehmen und saß wohl deshalb ständig im Arrest.
Und wenn er die Haft verließ, antwortete er mit einem Lächeln auf alle Fragen. Mit restloser Ruhe ließ er sich wieder einkasteln und war in seinem Innern glücklich, weil alle Offiziere von der Garnison in Trient Furcht vor ihm hatten. Nicht wegen seiner Grobheit, im Gegenteil, wegen seiner höflichen Antworten, seines höflichen Verhaltens und seines freundschaftlichen Lächelns, vor dem ihnen angst und bange ward.
Kommt ein Inspektionsoffizier in die Mannschaftsstube, sitzt der lächelnde Schwejk auf dem Kavalett und grüßt höflich: »Gelobt sei Jesus Christus, melde gehorsamst.«
Leutnant Walk knirscht mit den Zähnen, wie er so das aufrichtige, freundschaftliche Lächeln Schwejks sieht, und würde ihm verteufelt gern die Kappe auf dem Kopf zurechtrücken, damit sie vorschriftsmäßig sitze. Doch der warme und innige Blick Schwejks hält ihn von allen Kundgebungen zurück.
In die Mannschaftsstube tritt Major Teller. Leutnant Walk wirft einen strengen Blick auf die Mannschaft, die vor den Kavaletts steht, und ruft: »Sie, Schwejk, bringen Sie das Gewehr!«
Schwejk erfüllt gewissenhaft den Befehl und bringt den Tornister. Major Teller blickt wütend auf die unschuldigen lieblichen Züge im Gesicht Schwejks und fährt tschechisch los: »Sie nicht wissen, was das ist ein Gewehr?«
»Melde gehorsamst, nein.«
Und schon führt man ihn in die Kanzlei. Man bringt Gewehre und steckt sie ihm unter die Nase:
»Was ist das, wie heißt das?«
»Melde gehorsamst, ich weiß nicht.«
»Das ist ein Gewehr.«
»Melde gehorsamst, das glaub ich nicht.«
Er wird eingesperrt, und der Profoß erachtet es für seine Pflicht, ihm zu sagen, daß er ein Esel ist. Die Mannschaft rückt aus zu schweren Übungen im Gebirge. Doch Schwejk sitzt ruhig und lächelnd hinter den eisernen Stäben.
Da man mit ihm nichts anfangen konnte, machte man ihn zum Offiziersdiener der Einjährigfreiwilligen. Er half beim Mittag- und Abendessen im Kasino aus.
Trug Gedecke, Speisen, Bier und Wein, setzte sich bescheiden bei der Türe nieder, rauchte eine Zigarette und murmelte von Zeit zu Zeit: »Melde gehorsamst, Herr Lajtnant Walk is doch nur sehr ein braver Herr.« Und blies lächelnd den Zigarettenrauch in die Luft. Auch ins Kasino kam eine Inspektion, und irgendein neuer Offizier hatte das Unglück, den bescheiden bei der Türe stehenden Schwejk zu fragen, zu welcher Kompanie er gehöre.
»Melde gehorsamst, bitte sehr, ich weiß nicht.«
»Himmelsakrament, welches Regiment liegt hier?«
»Melde gehorsamst, bitte sehr, ich weiß nicht.«
»Um Himmels willen, Menschenskind, wie heißt die Stadt, in der Ihr Regiment liegt?«
»Melde gehorsamst, bitte sehr, ich weiß nicht.«
»Mensch, wie sind Sie überhaupt hergekommen?«
Mit freundlichem Lächeln und einem ungewöhnlich lieben und angenehmen Blick auf den Offizier erklärte Schwejk: »Melde gehorsamst, daß ich auf die Welt gekommen bin, und dann bin ich in die Schule gegangen. Dann war ich bei einem Tischler in der Lehre und hab auch ausgelernt, dann hat man mich in ein Wirtshaus geführt, und dort mußte ich mich splitternackt ausziehen. Nach ein paar Monaten sind dann Gendarmen gekommen und ham mich in eine Kaserne gebracht. In der Kaserne hat man mich untersucht und gesagt: ›Menschenskind, Sie sind ja um drei Wochen zu spät eingerückt. Wir wern Sie einsperren.‹ Ich hab sie gefragt warum, wo ich doch gar nicht zum Militär wollt und gar nicht weiß, was ein Soldat is. Trotzdem hat man mich eingesperrt, und dann hat man mich in einen Zug gesetzt und hin und her geschleppt, bis wir hierher gekommen sind. Ich hab niemanden gefragt, bei welchem Regiment ich bin, bei welcher Kompagnie oder in welcher Stadt, damit ich niemanden beleidig, und gleich beim ersten Exerzieren hat man mich eingesperrt, wie ich mir in Reih und Glied eine Zigarette angezündet hab, und ich weiß, was ein Soldat is. Trotzdem hat man mich eingesperrt, wo ich mich nur gezeigt hab, bald weil ich das Bajonett verloren hab, dann wieder, weil ich um ein Haar den Herrn Oberst auf dem Schießstand erschossen hätt, bis ich endlich zu den Herren Einjährigfreiwilligen gekommen bin.«
Der brave Soldat Schwejk warf einen kindlich klaren Blick auf den Offizier, der nicht wußte, ob er lachen oder sich ärgern sollte.
Der Heilige Abend rückte heran. Die Einjährigfreiwilligen hatten im Kasino ein Bäumchen geschmückt, und nach dem Abendbrot hielt der Herr Oberst eine ergreifende Rede: Christus sei geboren, wie wohl alle wüßten, habe seine Freude an ordentlichen Soldaten, und ein ordentlicher Soldat habe Freude über sich selbst. Und in diese feierliche Ansprache tönte ein inniges: »Oh ja! So is das schon!«
Der Ausruf stammte von dem braven Soldaten Schwejk, der mit leuchtenden Augen unbeobachtet zwischen den Einjährigfreiwilligen stand.
»Sie, Einjähriger«, brüllte der Herr Oberst, »wer hat denn da geschrien?«
Aus den Reihen der Einjährigfreiwilligen trat Schwejk und blickte lächelnd auf den Herrn Oberst:
»Melde gehorsamst, ich bin hier bei den Herren Einjährigfreiwilligen bedienstet, und sehr hats mir gefallen, was Sie gerade gesprochen ham. Es is Ihnen so vom Herzen gekommen!«
Als in Trient die Glocken zur Mitternachtsmesse riefen, saß der brave Soldat Schwejk bereits mehr als eine Stunde hinter Schloß und Riegel.
Damals blieb er hübsch lange in Haft, und als man ihn freiließ, gab man ihm ein Bajonett und teilte ihn der Maschinengewehrabteilung zu.
Es gab eine große Übung an der italienischen Grenze, und der brave Soldat Schwejk zog mit der Armee.
Vor der Expedition hatte er den Vortrag eines Kadetten gehört: »Stellt euch vor, daß Italien den Krieg erklärt hat und daß wir gegen die Welschen ziehen.«
»Gut, vorwärts!« rief Schwejk, wofür er sechs Tage faßte.
Nach Verbüßung der Strafe wurde er mit drei andern Arrestanten und einem Korporal marschbereit gemacht und seiner Maschinengewehrabteilung nachgeschickt. Anfangs marschierte man durch ein Tal, dann gings zu Pferd ins Gebirge hinein, und hier verirrte sich Schwejk, wie zu erwarten gewesen war, in den dichten Wäldern an der italienischen Grenze.
Er kroch durchs Gestrüpp und spähte vergeblich nach seinen Gefährten, bis er glücklich in voller Rüstung die italienische Grenze überschritt.
Und dort zeichnete sich der brave Soldat Schwejk aus. Eine Maschinengewehrabteilung aus Mailand hatte gerade eine Übung an der österreichischen Grenze, und ein Maultier mit einem Maschinengewehr und acht Mann befanden sich auf dem Plateau, auf dem der brave Soldat Schwejk suchend umherblickte.
Die italienischen Soldaten waren in ihrer Sorglosigkeit ins Dickicht gekrochen und eingeschlafen, und das Maultier mit dem Maschinengewehr weidete ernst und entfernte sich von seiner Abteilung, bis es schließlich zu der Stelle kam, von der der brave Soldat Schwejk lächelnd auf den Feind blickte.
Der brave Soldat Schwejk nahm das Maultier am Zügel und kehrte mit dem italienischen Maschinengewehr auf dem italienischen Maultier nach Österreich zurück.
Er stieg von dem Berghang wieder in das Tal hinab, aus dem er emporgeklettert war, trieb sich noch einen Tag lang in irgendeinem Wald herum, bis er endlich am Abend das österreichische Lager erblickte.
Die Wachposten wollten ihn nicht durchlassen, da er nicht die Losung kannte. Ein Offizier lief herbei, und da stellte sich Schwejk lächelnd in Habtachtstellung, salutierte und meldete: »Melde gehorsamst, Herr Lajtnant, daß ich von den Italienern ein Maultier samt Maschinengewehr erbeutet hab!«
Nicht lange darauf brachte man den braven Soldaten Schwejk in den Garnisonsarrest – aber in Österreich wußte man, wie das neueste italienische Maschinengewehrmodell aussah.
2. Schwejk holt Meßwein
Der apostolische Feldvikar Doktor Koloman Belepotocky, Bischof von Antiochia, ernannte Augustin Kleinschrodt zum Militärseelsorger in Trient. Zwischen einem gewöhnlichen Geistlichen, einem Zivilpriester und einem Militärgeistlichen besteht ein großer Unterschied. Bei diesem verbindet sich in vollendeter Weise die Religion mit dem Soldatenwesen. Zwei völlig verschiedene Kasten sind hier vereint. Die Unterschiede zwischen beiden Arten von Seelsorgern sind so groß wie die zwischen einem Dragonerleutnant, der an der Militärakademie Reitstunden gibt, und einem Hippodrombesitzer.
Der Militärgeistliche wird vom Staate bezahlt. Er ist ein Militärbeamter in einer bestimmten Rangstufe, hat das Recht, Säbel zu tragen und Duelle auszufechten. Der Zivilseelsorger bekommt zwar auch ein Gehalt vom Staate, doch muß er sich immerhin auch bemühen, aus den Gläubigen Geld herauszuschlagen, um bequem leben zu können.
Der Soldat muß einen gewöhnlichen Priester nicht grüßen, aber einem Militärseelsorger muß er die gebührende Ehrenbezeugung leisten, sonst wird er eingesperrt. Gott hat also auf Erden zweierlei Vertreter: solche in Zivil und solche in Uniform. Der Gottesdiener in Zivil muß für politische Agitation sorgen, die Militärgeistlichen hingegen haben den Soldaten die Beichte abzunehmen und sie einzusperren, was der liebe Gott sicherlich bereits damals ins Auge gefaßt hatte, als er diese sündige Erde und später den Augustin Kleinschrodt schuf.
Wenn dieser hochwürdige Herr durch die Straßen von Trient kugelte, sah er von weitem aus wie ein Komet, mit dem der erzürnte Gott die unglückliche Stadt strafen wollte. Er war fürchterlich in seiner Hochwürdigkeit, und es ging um ihn das Gerücht, daß er in Ungarn bereits drei Duelle gehabt habe, in denen er seinen Gegnern aus dem Offizierskasino, die allzu lax im Glauben waren, die Nasen abgeschlagen hatte.
Nachdem er auf diese Weise das Ausmaß des Unglaubens verringert hatte, wurde er nach Trient versetzt. Es war gerade zu der Zeit, wo der brave Soldat Schwejk den Garnisonsarrest verließ und zu seiner Kompagnie zurückkehrte, um in der Verteidigung des Vaterlandes fortzufahren.
Der geistliche Vater der Garnison in Trient suchte zu jener Zeit einen neuen Diener und war gerade auf dem Wege, ihn persönlich unter der Mannschaft auszuwählen.
Was Wunder, daß sein Auge, als er durch die Mannschaftsstube schritt, auf das gutmütige Antlitz des braven Soldaten Schwejk fiel, daß er ihm auf die Schulter klopfte und sagte: »Komm mit!« Der brave Soldat Schwejk begann sich zu entschuldigen; er habe nichts angestellt, aber der Korporal stieß in ihn hinein und führte ihn in die Kanzlei.
In der Kanzlei erklärte der Unteroffizier nach langen Entschuldigungen dem Militärseelsorger, daß der brave Soldat Schwejk ein »Mistvieh« sei. Doch der hochwürdige Herr Kleinschrodt unterbrach ihn: »Ein Mistvieh kann doch ein gutes Herz haben«, wozu der brave Soldat Schwejk demütig mit dem Kopf nickte. Sein lächelndes Gesicht mit den aufrichtigen Augen schaute rundlich aus einem Winkel hervor, und der militärische Seelenhirt wollte beim Anblick dieses gutmütigen Gesichtes nicht einmal das Sündenregister des braven Soldaten Schwejk anhören.
Von diesem Augenblick an begann für Schwejk ein glückliches Leben. Er trank im geheimen Meßwein und putzte seinem Vorgesetzten so sauber das Pferd, daß ihn der hochwürdige Priester Kleinschrodt einmal deswegen lobte.
»Melde gehorsamst«, ließ sich der brave Soldat Schwejk vernehmen, »daß ich alles mach, damit der Gaul so schön is wie Sie.«
Dann kamen die großen Tage des Feldlagers bei Castel-Nuovo, wo eine Feldmesse zelebriert werden sollte.
Augustin Kleinschrodt benutzte zu kirchlichen Zwecken nur niederösterreichischen Meßwein aus Vöslau. Italienischen Wein konnte er nicht einmal schmecken, und so kam es, daß er, als der Vorrat ausging, den braven Soldaten Schwejk zu sich rief und ihm sagte: »Morgen früh bringst du aus der Stadt Vöslauer Wein. Geld bekommst du in der Kanzlei; du bringst ein Achtliterfäßchen mit und kehrst sofort zurück. Merk dir: Aus Vöslau in Niederösterreich. Abtreten!«
Schwejk bekam am nächsten Tage zwanzig Kronen. Und damit ihn bei der Rückkehr die Wache nicht am Betreten des Lagers hindere, wurde ihm ein Passierschein eingehändigt, in dem stand: »Dienstlich um Wein.«
Der brave Soldat Schwejk ging in die Stadt, wiederholte sich gewissenhaft auf dem ganzen Weg: »Vöslau, Niederösterreich«, meldete dasselbe im Stationsgebäude und saß dreiviertel Stunden darauf zufrieden in einem Zug, der nach Niederösterreich fuhr.
An diesem Tage wurde der würdige Verlauf der Feldmesse nur durch den herben italienischen Wein in der Kanne getrübt.
Gegen Abend kam Augustin Kleinschrodt zu der Überzeugung, daß der brave Soldat Schwejk ein Halunke sei, der seine militärischen Pflichten vergessen habe.
Das Fluchen Augustin Kleinschrodts war im ganzen Lager zu hören, drang hinan bis zu den Alpengipfeln und verhallte im Etschtal bei Meran, durch das einige Stunden vorher der brave Soldat Schwejk mit einem zufriedenen Lächeln und dem frohen Bewußtsein seiner erfüllten Pflicht gefahren war.
Er fuhr durch das Tal, er durcheilte Tunnels, und auf jeder Station fragte er trocken: »Vöslau, Niederösterreich?«
Endlich erblickte das gutmütige Gesicht des braven Soldaten Schwejk den Bahnhof von Vöslau, und der brave Soldat Schwejk zeigte irgendeinem Mann in einer Dienstkappe seinen Militärpassierschein: »Dienstlich um Wein.«
Mit einem freundlichen Lächeln fragte er, wo hier die Kaserne stehe.
Der Mann mit der Dienstkappe wollte seine Marschroute sehen. Der brave Soldat Schwejk erklärte, er wisse nicht, was eine Marschroute sei.
Dann kamen noch zwei Männer mit Kappen und begannen Schwejk zu erklären, daß sich die nächste Kaserne in Korneuburg befinde.
Der brave Soldat Schwejk kaufte sich also eine Fahrkarte nach Korneuburg und fuhr weiter.
In Korneuburg liegt ein Eisenbahnregiment, und in der Kaserne wunderte man sich sehr, als in der Nacht der brave Soldat Schwejk am Kasernentor auftauchte und der Torwache seinen Passierschein zeigte: »Dienstlich um Wein.«
»Wir wern bis zum Morgen warten«, sagte der Wachkommandant. »Der Inspektionsoffizier ist gerade eingeschlafen.«
Der brave Soldat Schwejk legte sich auf ein Kavalett mit dem frohen Bewußtsein, daß er alles für den Staat tat, was in seiner Macht stand, und schlief zufrieden ein. Am Morgen führte man ihn in die Magazinskanzlei. Dort wies er dem Rechnungsoffizier seinen Passierschein vor: »Dienstlich um Wein«, mit der Stampiglie: »Feldlager Castel-Nuovo, Rgt. 102, Bat. 3« und der Unterschrift des diensthabenden Offiziers.
Der entsetzte Unteroffizier führte ihn in die Regimentskanzlei, wo er vom Oberst einem Verhör unterworfen wurde.
»Melde gehorsamst«, sagte der brave Soldat Schwejk, »ich komme über Auftrag des hochwürdigen Feldkuraten Kleinschrodt aus Trient. Ich soll ein Achtliterfaß Meßwein aus Vöslau mitbringen.«
Eine große Beratung hub an. Schwejks gutmütiges, einfältiges Gesicht, sein aufrichtiges, militärisches Verhalten und sein Passierschein: »Dienstlich um Wein« mit der ordnungsgemäß ausgestellten Stampiglie und der Unterschrift, das alles machte den denkbar günstigsten Eindruck, und die ganze Sache erschien noch verwickelter.
Eine große Debatte begann. Man sprach die Ansicht aus, der hochwürdige Feldkurat Kleinschrodt sei wohl verrückt geworden, und es bleibe nichts anderes übrig, als den braven Soldaten Schwejk mit einer Marschroute zurückzuschicken.
Der Unteroffizier fertigte daher für Schwejk eine Marschroute aus. Er war ein braver Mensch, und ihm kam es auf ein paar Kilometer nicht an. Er schrieb daher Schwejk eine Rückreise über Wien, Graz, Agram, Triest nach Trient vor. Die Reisedauer setzte er mit zwei Tagen an. Man gab Schwejk eine Krone sechzig auf die Hand, der Unteroffizier kaufte ihm die Fahrkarte, und der Koch schenkte ihm aus Mitleid drei Laib Kommißbrot.
Zur selben Zeit ging Feldkurat Augustin Kleinschrodt durch das Lager bei Castel-Nuovo, knirschte mit den Zähnen und sagte nichts als: »Fangen, binden, erschießen.«
Man führte den braven Soldaten Schwejk als Deserteur in Evidenz. Wie groß war die Überraschung, als der brave Soldat Schwejk in der Nacht des vierten Tages beim Eingang ins Lager auftauchte und der Wache lächelnd seine Marschroute aus Korneuburg und seinen Passierschein übergab: »Dienstlich um Wein.« Unverzüglich nahm man ihn fest, legte ihm zu seinem Entsetzen Spangen an und führte ihn in die Baracke, wo man ihn einsperrte.
Am Morgen brachte man ihn nach der Stadt in die Kaserne.
Gleichzeitig traf eine Zuschrift von seiten des Eisenbahnregimentes in Korneuburg ein, in der man den Oberst fragte, weshalb der hochwürdige Feldkurat Augustin Kleinschrodt den Soldaten Schwejk um Vöslauer Wein nach Korneuburg geschickt habe.
Nach dem Verhör des braven Soldaten Schwejk, der mit aufrichtigem und seligem Lächeln erzählte, wie sich alles zugetragen hatte, fand eine große Beratung statt, und der hochwürdige Feldkurat Augustin Kleinschrodt suchte den braven Soldaten Schwejk im Arrest auf.
»Du Viechskerl, du wirst am besten tun, wenn du dich superarbitrieren läßt, damit wir von dir Ruhe haben.«
Doch der brave Soldat Schwejk sagte mit einem aufrichtigen Blick auf den Feldkuraten: »Melde gehorsamst, ich wer Seiner Majestät dem Kaiser dienen bis zum letzten Atemzug.«
3. Schwejk wird superarbitriert
In jeder Armee gibt es Lumpen, die nicht dienen wollen. Sie ziehen es vor, ganz gemeine Zivilmamelucken zu werden. Diese geriebenen Kerle führen beispielsweise Klage darüber, daß sie einen Herzfehler haben, obwohl sie vielleicht nur an Blinddarmentzündung leiden, wie bei der Sezierung zutage tritt. Auf solche und ähnliche Weise suchen sie sich von der militärischen Pflicht zu drücken. Doch wehe ihnen! Noch gibt es das Superarbitrierungsverfahren, das ihnen verflucht auf die Finger guckt. So ein Kerl beschwert sich, daß er einen Plattfuß hat. Der Regimentsarzt verschreibt ihm Glaubersalz und ein Klistier und der »Plattfuß hin, Plattfuß her« läuft, wie wenn man ihm Dynamit unter die Füße gestreut hätte, und am nächsten Tag sperrt man ihn ein.
Ein anderer Haderlump beschwert sich, daß er Magenkrebs hat. Man legt ihn auf den Operationstisch und sagt: »Bei vollem Bewußtsein den Magen öffnen.« Noch bevor man zu Ende gesprochen hat, ist der Krebs geheilt, und der durch ein Wunder Genesene wandert ins Kittchen.
Die Superarbitrierungskommission ist eine Wohltat für die Armee. Wenn es keine Superarbitrierungskommission gäbe, dann würde sich jeder Wehrpflichtige krank fühlen und glauben, daß er den Tornister nicht tragen könne.
Superarbitrierung ist ein Wort lateinischen Ursprungs. Super – über, arbitrare – prüfen, beobachten. Superarbitrierung also »Überprüfung«.
Ein Stabsarzt hat das gut ausgedrückt: »So oft ich einen Maroden untersuche, tue ich dies mit der Überzeugung, daß man nicht von ›superarbitrare‹ (überprüfen) sprechen soll, sondern von ›superdubitare‹ (überzweifeln), ob so ein Marodeur überhaupt krank ist und nicht gesund wie ein Fisch. Von diesem Prinzip gehe ich auch aus. Ich verschreibe Chinin und Diät. Nach drei Tagen fleht er, ich soll ihn um Christi willen aus dem Krankenhaus entlassen. Und wenn so ein Simulant in der Zwischenzeit stirbt, dann tut er dies mit Absicht, um uns zu ärgern und seinen Betrug nicht absitzen zu müssen. Also ›superdubitare‹ und nicht ›superarbitrare‹. Bis zum letzten Atemzug an jedem zweifeln.«
Als man den braven Soldaten Schwejk zur Superarbitrierung bestimmte, neideten es ihm alle Kompagnien.
Der Militärprofoß, der ihm Essen in die Zelle brachte, sagte ihm: »Du Saukerl hast ein Glück. Wirst nach Haus gehen, wirst superarbitriert werden, daß es alle Farben spielt.«
Doch der brave Soldat Schwejk sagte ihm: »Melde gehorsamst, bitte sehr, das geht nicht. Ich bin gesund wie ein Fisch und will Seiner Majestät dem Kaiser dienen bis zum letzten Atemzuge.«
Mit einem seligen Lächeln legte er sich auf das Kavalett. Der Profoß meldete diesen Ausspruch Schwejks dem diensthabenden Offizier Müller.
Müller knirschte mit den Zähnen: »Wir werden den Lumpen schon kurieren«, rief er aus, »er soll nicht glauben, daß er beim Militär bleiben kann. Er muß zumindest Flecktyphus bekommen, und wenn er davon verrückt werden sollte.«
Unterdessen erklärte der brave Soldat Schwejk seinen Mithäftlingen: »Ich wer Seiner Majestät dem Kaiser dienen bis zum letzten Atemzug. Wenn ich einmal Soldat bin, dann muß ich Seiner Majestät dem Kaiser dienen, und niemand darf mich aus der Armee jagen, nicht einmal, wenn ein Herr General kommt und mir einen Tritt in den Hintern gibt und mich aus der Kaserne herauswirft. Ich möcht zu ihm zurückkehren und möcht sagen: Melde gehorsamst, Herr General, daß ich Seiner Majestät dem Kaiser dienen will bis zum letzten Atemzug und daß ich mich wieder bei meiner Kompagnie meld. Und wenn Sie mich hier nicht haben wollen, geh ich zur Marine, um wenigstens auf dem Meer Seiner Majestät dem Kaiser zu dienen. Und wenn man mich auch dort nicht will und mir auch der Herr Admiral einen Tritt in den Hintern gibt, dann wer ich Seiner Majestät dem Kaiser in der Luft dienen.«
In der ganzen Kaserne herrschte jedoch die Überzeugung vor, daß es gelingen werde, den braven Soldaten Schwejk aus der Armee zu entfernen. Am 3. Juni holte man ihn mit einer Tragbahre und brachte ihn ins Garnisonsspital, nachdem man ihn nach einem wütenden Widerstand mit Riemen an der Bahre festgebunden hatte. Überall, wo man ihn vorübertrug, ließ sich von der Tragbahre her sein patriotischer Ruf vernehmen: »Soldaten, helft mir, damit ich weiter Seiner Majestät dem Kaiser dienen kann!«
Man schaffte ihn auf die Abteilung für Schwerkranke, und der Stabsarzt Jansa erklärte nach einer flüchtigen Untersuchung: »Du hast eine vergrößerte Leber und Herzverfettung, Schwejk. Weit hast dus gebracht, jetzt müssen wir dich aus dem Militärdienst entlassen.«
»Melde gehorsamst«, ließ sich Schwejk vernehmen, »ich bin gesund wie ein Fisch. Was möcht, melde gehorsamst, die Armee ohne mich anfangen? Melde gehorsamst, ich will wieder zu meiner Kompagnie und wer Seiner Majestät dem Kaiser treu und ehrlich dienen, wie sichs für einen ordentlichen Soldaten ziemt und schickt.«
Man verschrieb ihm ein Klistier, und als es ihm der ukrainische Sanitäter Botschkovsky gab, da erklärte der brave Soldat Schwejk in dieser heiklen Situation mit Würde. »Bruder, schon mich nicht, wenn ich mich vor den Italienern nicht gefürchtet hab, werd ich mich auch vor deinem Klistier nicht fürchten. Ein Soldat darf sich vor nichts fürchten und muß weiter dienen, das merk dir!«
Dann führte man ihn auf den Abort, und dort bewachte ihn ein Soldat mit geladenem Gewehr.
Dann legte man ihn wieder auf das Bett, und der Wärter Botschkovsky schritt um ihn herum und seufzte: »Pschia krev, hast du Eltern?«
»Hab.«
»Von hier wirst du kaum herauskommen, du Simulant.«
Der brave Soldat Schwejk gab ihm eine Ohrfeige. »Ich ein Simulant? Ich bin vollkommen gesund und will Seiner Majestät dem Kaiser dienen bis zum letzten Atemzug.«
Man packte ihn in Eis. Drei Tage blieb er in Eiskompressen eingewickelt, und als der Stabsarzt kam und ihm sagte: »Nun, Schwejk, du wirst halt doch nach Haus gehn«, erklärte Schwejk: »Melde gehorsamst, Herr Stabsarzt, ich bin weiter gesund und will auch weiter dienen.«
Man packte ihn abermals in Eis, und zwei Tage später sollte die Superarbitrierungskommission zusammentreten, um ihn für immer seiner militärischen Pflichten zu entheben.
Einen Tag vor Zusammentritt der Kommission, als bereits sein Entlassungsschein ausgestellt war, desertierte jedoch der brave Soldat Schwejk. Um Seiner Majestät dem Kaiser weiter dienen zu können, mußte er flüchten. Vierzehn Tage lang fehlte von ihm jede Spur.
Wie groß war aber die Überraschung aller, als nach diesen vierzehn Tagen der brave Soldat Schwejk eines Nachts vor dem Kasernentor auftauchte und dem Wachposten mit seinem aufrichtigen Lächeln in dem rundlichen gutmütigen Gesicht meldete: »Melde gehorsamst, ich komm mich einsperren lassen, weil ich desertiert bin, damit ich Seiner Majestät dem Kaiser bis zum letzten Atemzug weiter dienen kann.«
Er erhielt ein halbes Jahr aufgebrummt, und als er weiter dienen wollte, versetzte man ihn ins Arsenal, wo er lernen sollte, Torpedos mit Schießbaumwolle zu laden.
4. Schwejk im Arsenal
Und es kam so, wie der hochwürdige Feldkurat prophezeit hatte: »Schwejk, du Lump, wenn du unbedingt dienen willst, dann wirst du also im Arsenal dienen. Vielleicht wird dir dort die Lust vergehen.«
So lernte also der brave Soldat Schwejk im Arsenal mit Schießbaumwolle hantieren. Er lud sie in Torpedos. So ein Dienst ist kein Spaß, denn man ist immer mit einem Fuß in der Luft und mit dem andern im Grab.
Doch der brave Soldat Schwejk fürchtete sich nicht. Er lebte zwischen Dynamit, Ekrasit und Schießbaumwolle zufrieden wie ein ehrbarer Soldat, und aus der Baracke, wo er die Torpedos mit diesem furchtbaren Explosivstoff lud, drang sein Lied: »Stelle deine Posten auf die feste Brucken, Piemont, Piemont, wir werden doch hinüberrucken. Hop, hop, hop. Hei, das war ein Schlachten, bei Solferino dorten, Blut floß dort in Fülle, floß an allen Orten. Hop, hop, hop. Blut bis an die Knie, wie im Fleischerladen, weil sich die Achtzehner dort geschlagen haben. Hop, hop, hop.«
Nach diesem schönen Lied, das den braven Soldaten Schwejk in einen Löwen verwandelte, kamen andere ergreifende Lieder an die Reihe, von Klößen so groß wie ein Kopf. Der brave Soldat Schwejk aß nämlich Klöße mit unbeschreiblicher Wollust.
Und so lebte er zufrieden inmitten der Schießbaumwolle einsam und allein in einer der Baracken des Arsenals.
Eines Tages kam eine Inspektion, die von Baracke zu Baracke ging, um zu schauen, ob alles in Ordnung sei. Als die Inspektionsoffiziere die Baracke betraten, in der der brave Soldat Schwejk mit Schießbaumwolle hantieren lernte, da erkannten sie an den Rauchwolken, die aus einer Pfeife emporstiegen, daß der brave Soldat Schwejk ein unerschrockener Krieger war.
Als Schwejk die Offiziere sah, stand er auf, nahm vorschriftsmäßig die Pfeife aus dem Mund und legte sie möglichst nahe neben sich, und zwar in ein offenes Stahlfaß mit Schießbaumwolle. Dabei rief er salutierend: »Melde gehorsamst, nichts Neues, alles in Ordnung.«
Es gibt Augenblicke im Menschenleben, wo Geistesgegenwart eine große Rolle spielt.
Der Klügste von der ganzen Gesellschaft war der Herr Oberst. Aus der Schießbaumwolle stiegen kleine Rauchkringel empor, und da sagte er: »Schwejk, weiterrauchen.«
Das war ein kluges Wort, denn es ist entschieden besser, wenn sich eine brennende Pfeife im Mund befindet, als in Schießbaumwolle. Schwejk salutierte und erklärte: »Melde gehorsamst, ich werde rauchen.« Er war eben ein gehorsamer Soldat.
»Und jetzt kommen Sie auf die Wachstube, Schwejk!«
»Melde gehorsamst, das geht nicht, weil ich muß hier laut Vorschrift bis sechs Uhr Abend bleiben, bis man mich ablösen kommt. Nämlich bei der Schießbaumwolle muß immer jemand sein, damit kein Unglück geschieht!«
Die Inspektion verschwand. Sie raste zur Wachstube, wo die Herren den Auftrag gaben, Schwejk durch eine Patrouille holen zu lassen.
Als sie vor die Baracke kam, wo der brave Soldat Schwejk mitten in der Schießbaumwolle mit der brennenden Pfeife saß, rief der Korporal: »Schwejk, du Lumpenkerl, schmeiß die Pfeife durchs Fenster, und komm heraus!«
»Fällt mir nicht ein! Der Herr Oberst hat befohlen, ich soll weiterrauchen, also muß ich weiterrauchen, bis man mich in Stücke reißt.«
»Komm heraus, du Rindvieh!«
»Melde gehorsamst, ich komm nicht heraus. Es is erst vier Uhr, und ihr dürft mich erst um sechs ablösen. Bis sechs muß ich bei der Schießbaumwolle bleiben, damit nicht ein Unglück passiert. Ich bin ja so vorsich…«
Das »tig« sprach er nicht mehr aus. Vielleicht habt ihr auch von der großen Explosion im Arsenal gelesen. Eine Baracke nach der andern flog in die Luft, bis innerhalb dreiviertel Sekunden das ganze Arsenal zerstört war.
In der Baracke, wo der brave Soldat Schwejk mit Schießbaumwolle hantieren lernte, fing es an, und wie ein Grabhügel wölbte sich über diese Stätte ein Wirrwarr von Brettern, Latten, Eisenkonstruktionsteilen, die von allen Seiten geflogen kamen, um dem wackeren Soldaten Schwejk, der sich vor der Schießbaumwolle nicht gefürchtet hatte, die letzte Ehre zu erweisen.
Drei Tage arbeiteten die Pioniere auf der Trümmerstätte und legten Köpfe, Rümpfe, Arme und Beine zusammen, damit der liebe Gott beim Jüngsten Gericht die Chargen leichter erkennen und sie dementsprechend belohnen könne.
Es war ungeheuer schwierig. Drei Tage räumten sie Bretter, Eisenkonstruktionen von dem Grabhügel Schwejks ab, und in der dritten Nacht, als man in die Trümmerstätte eindrang, hörte man eine angenehme Stimme singen: »Hei, das war ein Schlachten, bei Solferino dorten, Blut floß dort in Fülle, floß an allen Orten. Hop, hop, hop.«
Bei Fackellicht grub man sich zu der Stimme durch, die sang: »Blut bis an die Knie, wie im Fleischerladen, weil sich die Achtzehner dort geschlagen haben. Hop, hop, hop.«
Und im Schein der Fackeln gewahrten die Retter eine aus Eisenkonstruktionen und Brettern entstandene Grotte und in einem Winkel derselben den braven Soldaten Schwejk, der, die Pfeife beiseite legend, salutierte und sagte: »Melde gehorsamst, nichts Neues, alles in Ordnung!«
Man führte ihn hinaus aus dieser Trümmerstätte, und als sich der brave Soldat Schwejk vor dem diensthabenden Offizier befand, erklärte er zum zweitenmal: »Melde gehorsamst, alles in Ordnung. Bitte um Ablösung, denn sechs Uhr is schon vorbei, und bitte um ›Minaschgeld‹ für die Zeit, wo ich begraben war.«
Der tapfere Schwejk war der einzige vom ganzen Arsenal, der diese Katastrophe überlebt hatte.
Ihm zu Ehren wurde abends in der Stadt von den militärischen Kreisen eine kleine Feier im Offizierskasino veranstaltet. Von Offizieren umringt, trank der brave Soldat Schwejk wie ein Bürstenbinder, und sein gutes, rundes Antlitz leuchtete vor Freude.
Am nächsten Tag erhielt er »Minaschgeld« für drei Tage so wie im Krieg, und drei Wochen darauf wurde er zum Korporal befördert und bekam die große Kriegsmedaille.
Als er mit ihr und den Sternchen geschmückt seine Kaserne in Trient betrat, begegnete er Leutnant Knobloch, der erzitterte, als er das gefürchtete gutmütige Antlitz des braven Soldaten Schwejk erblickte.
»Du hast was Schönes angestellt, du Lump«, sagte er ihm.
Lächelnd entgegnete hierauf der brave Soldat Schwejk: »Melde gehorsamst, ich hab mit Schießbaumwolle hantieren gelernt.«
Und in gehobener Stimmung betrat er den Hof, um seine Kompagnie aufzusuchen.
An jenem Tage verlas der diensthabende Offizier der Mannschaft einen Erlaß des Kriegsministeriums über die Schaffung einer Fliegerabteilung in der Armee mit der Aufforderung, Freiwillige mögen sich melden.
Da trat der wackere Soldat Schwejk vor, meldete sich bei dem diensthabenden Offizier und sprach: »Bitte gehorsamst, daß ich schon in der Luft war und daß ich mich darin auskenn und auch in der Luft Seiner Majestät dem Kaiser dienen will.«
So wanderte der brave Soldat eine Woche später zur Fliegerabteilung, wo er sich der Situation nicht minder gewachsen zeigte als im Arsenal, wie ihr sofort sehen werdet.
5. Schwejk als Flieger
Österreich besaß vor dem Kriege drei lenkbare Luftschiffe, achtzehn unlenkbare Luftschiffe und fünf Flugzeuge. Das war Österreichs Luftmacht.
Der brave Soldat Schwejk wurde zu Nutz und Ehr dieser neuen Abteilung zur Fliegerabteilung versetzt. Anfangs zog er auf dem Militärflugfeld die Flugzeuge aus dem Hangar und putzte die Metallbestandteile mit Terpentin und Wiener Kalk.
Er diente also bei den Flugzeugen von der Pike auf. Und so wie er dem hochwürdigen Feldkuraten in Trient fürsorglich die Pferde geputzt hatte, so arbeitete er hier mit Liebe und Lust an den Flugzeugen, bürstete die Tragflächen, als striegle er Pferde, und führte als Korporal die Wachposten zu den einzelnen Hangars und belehrte sie: »Fliegen muß man, drum erschießt einen jeden, der ein Flugzeug stehlen wollt.«
Etwa vierzehn Tage nach Antritt seines Dienstes sollte er fliegen. Das ist wohl ein recht gefährliches Avancement.
Er galt als Ballast und flog mit den Offizieren. Aber der brave Soldat Schwejk forcht sich nicht. Mit einem Lächeln flog er in die Lüfte, blickte ehrerbietig und achtungsvoll auf den Offizier, der das Flugzeug lenkte, und salutierte, wenn er unter sich eine höhere Charge über den Flugplatz schreiten sah.
Und wenn sie irgendwo abstürzten und das Flugzeug in Stücke ging, kroch immer der brave Soldat Schwejk als erster aus den Trümmern, half seinem Offizier auf die Beine und meldete: »Melde gehorsamst, daß wir abgestürzt, aber am Leben und gesund geblieben sind.«
Er war ein angenehmer Gesellschafter. Eines Tages flog er mit Leutnant Herzig, und als sie sich achthundertzweiundsechzig Meter hoch befanden, versagte der Motor.
»Melde gehorsamst, daß uns der Benzin ausgegangen is«, ließ sich hinter dem Offizier die angenehme Stimme Schwejks vernehmen: »Ich hab, melde gehorsamst, vergessen, den Behälter nachzufüllen.«
Und kurz danach rief er: »Melde gehorsamst, daß wir in die Donau fallen.«
Und als ihre Köpfe ein paar Augenblicke später aus den erregten, grünlichen Wogen der Donau auftauchten, sagte der brave Soldat Schwejk, während er hinter dem Offizier ans Ufer schwamm: »Melde gehorsamst, wir ham heut den Höhenrekord geschlagen.«
Es war vor dem großen militärischen Flugfest auf dem Flugplatz Wiener Neustadt. Sie kontrollierten die Flugzeuge, überprüften die Motoren und trafen die letzten Vorbereitungen zum Abflug.
Leutnant Herzig wollte mit Schwejk auf einem Wright-Doppeldecker mit Morisson-Motor starten, mit dessen Hilfe man ohne Anlauf vom Boden auffliegen kann.
Militärattachés fremder Mächte waren zugegen.
Für Herzigs Flugzeug interessierte sich lebhaft der rumänische Major Gregorescu, der sich hineinsetzte und die Hebel und Steuer untersuchte.
Der brave Soldat Schwejk ließ auf Befehl des Leutnants den Motor an, der Propeller begann sich zu drehen, Schwejk, neben dem neugierigen rumänischen Major sitzend, brachte mit großem Interesse das Drahtseil in Ordnung, an dem das rückwärtige Höhensteuer befestigt war, und ging so eifrig ans Werk, daß er dem Major die Kappe vom Kopf schlug.
Leutnant Herzig geriet in Wut: »Schwejk, Sie Mordstrottel, fliegen Sie zu allen Teufeln!«
»Zu Befehl, Herr Lajtnant«, rief Schwejk, ergriff das Höhensteuer und die Hebel der Morisson-Maschine, und das Flugzeug löste sich unter weithin hörbaren Explosionen des vortrefflichen Motors vom Erdboden. Schon sausten sie in zwanzig, hundert, zweihundert, dreihundert, vierhundertfünfzig Meter Höhe in der Richtung nach Südwesten den weißen Alpen zu, mit einer Geschwindigkeit von hundertfünfzig Kilometern in der Stunde.
Der bedauernswerte rumänische Major kam über irgendeinem Gletscher zu sich, den sie in solcher Höhe überflogen, daß der Major klar die Naturschönheiten, wie Eisfelder und Schluchten, unter sich unterscheiden konnte, die streng und drohend auf ihn blickten.
»Was ist geschehen?« fragte er stotternd vor Furcht.
»Wir fliegen laut Befehl, melde gehorsamst«, meldete ehrerbietig der brave Soldat Schwejk. »Der Herr Lajtnant hat befohlen: ›Fliegen Sie zu allen Teufeln‹, also fliegen wir zu ihnen, melde gehorsamst.«
»Und wo werden wir landen?« fragte der neugierige rumänische Major Gregorescu zähneklappernd.
»Melde gehorsamst, daß ich nicht weiß, wo wir abstürzen werden. Ich flieg laut Befehl, aber ich kanns nur hinauf, herunter kann ichs nicht, wir hams nie gebraucht, wenn wir mit dem Herrn Lajtnant geflogen sind. Immer wenn wir oben waren, sind wir von selbst abgestürzt.«
Der Höhenmesser zeigte auf achtzehnhundertsechzig Meter. Der Major hielt sich krampfhaft an der Stange fest und schrie auf rumänisch: »Diu, diu, Gott, Gott«, und der brave Soldat Schwejk, geschickt das Steuer handhabend, sang über den Alpen, über die sie gerade flogen: »Den Ring, den du mir gegeben, trag ich nimmermehr, verdammt noch einmal, warum denn nicht? Bis ich zu meinem Regiment komm, lade ich ihn ins Gewehr.«
Der Major betete laut auf rumänisch und fluchte fürchterlich, während in der reinen Luft weiterhin die helle Stimme des braven Soldaten Schwejk ertönte: »Das Tuch, das du mir gegeben, trag ich nimmermehr, verdammt noch einmal, warum denn nicht? Bis ich zu meinem Regiment komm, putz ich damit das Gewehr, verdammt noch einmal, warum denn nicht?«
Unter ihnen zuckten Blitze, wütete ein Gewitter.
Mit herausgewälzten Augen blickte der Major vor sich hin und fragte mit pfeifender Stimme: »Wann wird das enden?«
»Einmal schon«, antwortete lächelnd der brave Soldat Schwejk, »wenigstens sind wir mit dem Herrn Lajtnant immer irgendwo abgestürzt.«
Sie waren bereits über der Schweiz und flogen gegen Süden.
»Nur Geduld, bitte gehorsamst«, meinte der brave Soldat Schwejk, »wenn der Benzin ausgeht, müssen wir herunterfallen.«
»Wo sind wir denn?«
»Über irgendeinem Wasser, melde gehorsamst, sehr viel Wasser is zu sehen; wir wern wahrscheinlich ins Meer falln.«
Major Gregorescu fiel in Ohnmacht. Sein dicker Bauch keilte sich zwischen die Stangen, so daß er fest in dem Metallgestänge hängenblieb.
Und über dem Mittelmeer sang der brave Soldat Schwejk vor sich hin: »Wer ein Mann sein will von Größe, der muß gerne essen Klöße, eins, zwei. Im Krieg schlägt man ihn dann nicht tot, eins, zwei, weil er gern gegessen Klöße, gute militärische Klöße, von nes Manneskopfes Größe, eins, zwei.«
Und der brave Soldat Schwejk fuhr über der unendlichen Wasserfläche, tausend Meter hoch, zu singen fort: »General Grenevill zieht hinaus, durch das Tor ins Schlachtgebraus.«
Die Seeluft weckte den Major aus seiner Ohnmacht. Er schaute in die entsetzliche Tiefe, und als er das Meer erblickte, rief er: »Diu, diu!« und fiel abermals in Ohnmacht.
Sie flogen die ganze Nacht hindurch, flogen unaufhörlich. Plötzlich rüttelte Schwejk den Major und sagte gutmütig: »Melde gehorsamst, daß wir abstürzen, aber bißl langsam.«
Im Gleitflug senkte sich das Flugzeug, dem der Benzin ausgegangen war, in einen Palmenhain bei Tripolis in Afrika zu Boden.
Und der brave Soldat Schwejk half dem Major aus dem Flugzeug, salutierte und sagte: »Melde gehorsamst, alles in Ordnung!«
Der brave Soldat Schwejk hatte mit diesem Flug, der über die Alpen, Südeuropa, das Mittelmeer nach Afrika gegangen war, einen Weltrekord aufgestellt.
Als der Major um sich Palmen sah, versetzte er Schwejk zwei Ohrfeigen, die dieser lächelnd hinnahm, denn er hatte nur seine Pflicht erfüllt, als ihm Leutnant Herzig gesagt hatte: »Fliegen Sie zu allen Teufeln!«
Was weiter geschah, darüber läßt sich schwer sprechen, da dies unserem Kriegsministerium vielleicht recht unangenehm wäre. Es wird zweifellos in Abrede stellen, daß ein österreichisches Flugzeug in Tripolis abgestürzt ist, denn das würde eine große internationale Spannung hervorrufen.
II. Kommandant der Stadt Bugulma
1.
Als mir Anfang Oktober 1918 vom militärischen Revolutionssowjet der »linksufrigen Gruppe in Simbirsk« (levobereschnaja gruppa v Simbirsku) bekanntgegeben wurde, ich sei zum Stadtkommandanten von Bugulma ernannt worden, fragte ich den Vorsitzenden: »Und wissen Sie das auch bestimmt, daß Bugulma schon erobert ist?«
»Nähere Meldungen haben wir nicht«, lautete die Antwort, »und ich zweifle sehr, daß es bereits jetzt in unseren Händen ist, aber bevor Sie dort eintreffen, wird es hoffentlich bereits gefallen sein.«
»Und wird mich jemand hinbegleiten?« fragte ich leise. »Und dann noch etwas: Wie komme ich nach Bugulma, wo liegt es eigentlich?«
»Sie bekommen eine Eskorte von zwölf Mann, und was die zweite Frage betrifft, schaun Sie sich die Karte an. Glauben Sie, es ist meine Sorge, wo irgendein idiotisches Bugulma liegt?«
»Noch eine Frage, Towarisch Kajurov. Wann bekomme ich Geld für die Reise und Auslagen?«
Kajurov schlug die Hände zusammen ob dieser Frage.
»Sie sind verrückt geworden. Auf dem Wege kommen Sie doch durch mehrere Dörfer, wo man Sie schon anfüttern wird, und in Bugulma werden Sie eine Kontribution einheben …«
In der Wachstube unten wartete meine Eskorte. Zwölf kräftige jungen Tschuwaschen, die sehr wenig russisch verstanden, so daß sie mir in keiner Weise erklären konnten, ob sie einberufen seien oder freiwillig dienten. Ihrem biederen und furchtbaren Aussehen konnte man entnehmen, daß sie eher Freiwillige seien, die zu allem entschlossen waren.
Als ich meine Dokumente und einen Haufen Vollmachten erhalten hatte, in denen man nachdrücklich darauf hinwies, daß mir von Simbirsk bis Bugulma jeder Bürger jedwede Unterstützung gewähren müsse, begab ich mich mit meiner Expedition auf den Dampfer, und wir fuhren auf der Wolga und auf dem Kamafluß bis nach Tschistopol.
Während der Reise erlebte ich kein besonderes Abenteuer. Nur einer meiner Tschuwaschen fiel in betrunkenem Zustand über Bord und ertrank. So blieben mir nur elf. In Tschistopol, wo wir den Dampfer verließen, meldete sich ein Tschuwasche, er werde Fuhrwerke beschaffen, und kehrte nicht mehr zurück. So blieben ihrer zehn, und ich erfuhr, daß der verschwundene Tschuwasche nach seinem ungefähr vierzig Werst entfernten Heimatort entlaufen sei, um zu schauen, wie es seinen Eltern gehe.
Als ich endlich nach langem Fragen bei der Ortsbevölkerung festgestellt hatte, wo Bugulma eigentlich liegt und wie man hingelange, verschafften meine Tschuwaschen Fuhrwerke, und wir machten uns auf den grundlosen, furchtbaren Straßen dieser Gegend über Kratschalg, Jelanov, Moskov, Gulukov, Ajbaschov auf den Weg. Das sind lauter Dörfer, die von Tataren bewohnt werden, bis auf Gulukov, wo Tscheremisen mit Tataren vermengt leben.
Da zwischen den Tschuwaschen, die bereits vor etwa fünfzig Jahren das Christentum angenommen haben, und den Tscheremisen, die noch heute Heiden sind, furchtbare Feindschaft herrscht, begab sich in Gulukov ein kleines Mißgeschick. Meine bis auf die Zähne bewaffneten Tschuwaschen brachten mir nach der Durchsuchung des Dorfes den Ortsvorsteher Dawledbaja Schakir geschleppt, der in der Hand einen Käfig mit drei weißen Eichhörnchen hielt, und einer von den Tschuwaschen, der am besten russisch sprach, wandte sich zu mir mit folgender Aufklärung: » Die Tschuwaschen rechtgläubig seit ein, zehn, dreißig, fünfzig Jahren – die Tscheremisen Heiden, Schweine.« Und während er der Hand Dawledbaja Schakirs den Käfig mit den weißen Eichhörnchen entwand, fuhr er fort: »Weißes Eichhörnchen ihr Gott sein – ein, zwei, drei Götter. Dieser Mann Priester, springt mit Eichhörnchen, springt, betet zu es. Du wirst ihn taufen …«
Die Tschuwaschen gebärdeten sich so drohend, daß ich befahl, Wasser zu holen, und den Dawledbaja Schakir besprengte, wobei ich unverständliche Worte murmelte. Dann ließ ich ihn frei.
Die tscheremisischen Götter wurden hierauf abgehäutet, und ich kann jedem versichern, daß der Herrgott der Tscheremisen eine sehr gute Suppe gibt.
Dann machte mir der mohammedanische Lokalmulla Abdulhalej seine Aufwartung und sprach mir seine Freude darüber aus, daß wir die Eichhörnchen aufgegessen hatten. »Jeder muß an etwas glauben«, sagte er, »aber an Eichhörnchen, das ist eine Schweinerei. Sie springen nur von Baum zu Baum, und wenn sie im Käfig sind, machen sie an. Für so einen Herrgott bedanke ich mich.« Er brachte uns einen Haufen gebratenen Hammelfleisches und drei Gänse und versicherte uns, wenn die Tscheremisen sich in der Nacht auflehnen würden, würden alle Tataren an unserer Seite kämpfen.
Doch passierte nichts, da, wie Dawledbaja Schakir erklärte, der sich am Morgen zu unserem Abmarsche eingefunden hatte, der Wald voller Eichhörnchen war. Zum Schluß passierten wir Ajbaschev, und am Abend langten wir ohne weiteren Zwischenfall in Klein-Pisecnic ein, einem russischen Dorf, zwanzig Werst weit von Bugulma entfernt.
Die Ortsbevölkerung war sehr gut informiert über die Vorgänge in Bugulma. Vor drei Tagen hätten die Weißen die Stadt kampflos verlassen, die Sowjettruppen ständen auf der andern Seite der Stadt und fürchteten sich einzumarschieren, um nicht in einen Hinterhalt zu fallen.
In der Stadt herrsche Anarchie, und der Bürgermeister warte mit der ganzen Gemeindevertretung bereits zwei Tage lang mit Brot und Salz in der Hand, um den zu begrüßen, der die Stadt besetze.
Ich schickte den Tschuwaschen voraus, der am besten russisch sprach, und am Morgen rückten wir nach Bugulma vor.
An der Stadtperipherie kam uns eine unübersehbare Menschenschar entgegen. Der Bürgermeister hielt in der Hand ein Tablett, auf dem ein Laib Brot und eine Schale Salz standen.
In seiner Rede sprach er die Hoffnung aus, ich würde mit der Stadt Erbarmen haben. Ich kam mir vor wie der böhmische Nationalheld Žižka, besonders als ich in dem Aufzug auch Schulkinder erblickte.
Ich dankte mit einer langen Rede, schnitt mir eine Scheibe Brot ab und bestreute sie mit Salz. Ich betonte mit Nachdruck, daß ich nicht gekommen sei, um irgendwelche Schlagworte zu predigen, sondern mein Ziel sei Ruhe, Friede und Ordnung. Zum Schluß küßte ich den Bürgermeister, reichte den Vertretern der orthodoxen Kirche die Hand und begab mich aufs Rathaus, wo mir Räumlichkeiten für das Stadtkommando zugewiesen wurden.
Hieraufließ ich den Befehl Nummer eins folgenden Inhalts plakatieren:
Bürger!
Ich danke Euch allen für die warme und aufrichtige Begrüßung mit Salz und Brot. Bewahret stets den altslawischen Brauch, gegen den ich nichts einzuwenden habe. Doch bitte ich Euch, vergeßt dabei nicht, daß ich zum Stadtkommandanten ernannt wurde, der ebenfalls seine Pflichten hat.
Ich bitte Euch daher, liebe Freunde, morgen um zwölf Uhr alle Waffen im Rathaus in den Räumlichkeiten der Stadtkommandantur abzuliefern.
Ich drohe natürlich nicht, aber Ihr wißt, daß sich die Stadt im Belagerungszustand befindet.
Ich betone noch, daß ich beauftragt wurde, der Stadt eine Kontribution aufzuerlegen, daß die Stadt aber keine Kontribution zahlen wird.
Unterschrift.
Am folgenden Tag um zwölf Uhr füllte sich der Ringplatz mit bewaffneten Leuten. Es kamen ihrer mehr als tausend Mann mit Gewehren, hie und da schleppte einer auch ein Maschinengewehr.
Wir elf Mann wären von dieser Sturmflut bewaffneter Bürger hinweggefegt worden, aber sie kamen nur, um ihre Waffen abzuliefern. Bis spät in die Nacht dauerte die Ablieferung, wobei ich jedem die Hand reichte und ein paar leutselige Worte sagte.
Am Morgen ließ ich Befehl Nummer zwei drucken und plakatieren:
Bürger!
Ich danke der gesamten Bevölkerung Bugulmas für die genaue Ausführung des Befehls Nummer eins.
Unterschrift.
Ich ging an jenem Tag ruhig schlafen. Ich ahnte nicht, daß über mir ein Damoklesschwert hänge, in der Gestalt des Twersker Revolutionsregimentes.
Wie ich bereits sagte, standen die Sowjettruppen in einer Entfernung von etwa fünfzehn Werst südlich von Bugulma und wagten nicht, in Bugulma einzudringen, da sie sich vor einem Überfall fürchteten. Schließlich erhielten sie vom Revolutionsmilitärsowjet in Simbirsk den Befehl, um jeden Preis Bugulma zu besetzen und so die Basis der Sowjettruppen zu sichern, die östlich von Bugulma operierten.
Und so schickte sich Genosse Jerochymov, Kommandant des Twersker Revolutionsregimentes, in der Nacht an, Bugulma zu erobern und zu besetzen, als ich bereits drei Tage lang gottesfürchtig Stadtkommandant war und zur allgemeinen Zufriedenheit aller Bevölkerungsschichten amtierte.
Das Twersker Regiment »drang« in die Stadt ein, feuerte Salven in die Luft beim Marsch durch die Straßen und stieß nur auf den Widerstand bei dem Wachposten meiner Tschuwaschen. Diese wurden nämlich während des Wachdienstes aus dem Schlaf gerissen und wollten Genossen Jerochymov, der mit dem Revolver in der Hand an der Spitze seines Regimentes an die Besetzung des Rathauses schritt, nicht ins Rathaus lassen. Die Twersker nahmen die Tschuwaschen gefangen, und Jerochymov trat in meinen Amts- und Schlafraum.
»Hände hoch!« rief er siegesberauscht und zielte mit dem Revolver auf mich. Ich erhob ruhig die Hände.
»Was sind Sie eigentlich?« fragte der Kommandeur des Twersker Regimentes.
»Stadtkommandant.«
»Von den Weißen oder von den Sowjettruppen?«
»Von den Sowjettruppen. Kann ich die Hände herabgeben?«
»Sie können, aber ich ersuche Sie, mir sofort nach Kriegsrecht das Stadtkommando zu übergeben, denn ich habe Bugulma erobert.«
»Aber ich wurde ernannt«, wandte ich ein.
»Der Teufel hole alle Ernennungen. Zuerst müssen Sie eine Stadt erobern.«