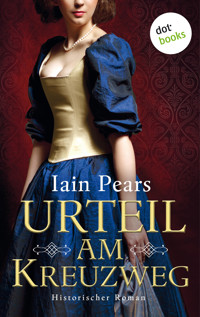
5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman, wie man ihn selten findet: Der internationale Bestseller »Urteil am Kreuzweg« von Iain Pears jetzt als eBook bei dotbooks. Verbirgt sich hinter ihrem unschuldigen Gesicht eine eiskalte Mörderin – oder ist sie das Opfer einer Intrige? England im Jahre 1663: Ganz Oxford gerät in Aufruhr, als ein angesehener Tutor des New College vergiftet wird. Die Täterin scheint schnell gefunden. Doch warum hat die schöne Sarah Blundy den Mord begangen? Drei Männer beginnen, aus ganz unterschiedlichen Gründen nach Antworten zu suchen: Marco da Cola, ein Arzt aus Venedig, Jack Prescott, der Sohn eines Verräters, und John Wallis, bekannt als Meister der Geheimschriften. Sie ahnen nicht, in welches Wespennest sie damit stechen – und dass die Wahrheit immer das ist, was die Mächtigen der Zeit dazu erklären … Opulent, fesselnd und voller Überraschungen: Iain Pears erweckt das 17. Jahrhundert zu neuem Leben – jene Zeit, in der die Wissenschaft den Aberglauben besiegen wollte, in der kühne Denker wie der Chemiker Robert Boyle, der Philosoph John Locke und der Astronom Christopher Wren wirkten … und trotzdem allerorts Lüge, Machtgier und Verrat herrschten! »Eine literarische Tour de Force, die Hochspannung und Bildung verbindet«, urteilte Bestsellerautorin P.D. James – und die britische Sunday Times unterstreicht: »Ein Roman von der literarischen Feinheit eines Umberto Eco.« Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Urteil am Kreuzweg« von Iain Pears ist historischer Roman, faszinierendes Zeitporträt und fesselnder Thriller zugleich. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1319
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Verbirgt sich hinter ihrem unschuldigen Gesicht eine eiskalte Mörderin – oder ist sie das Opfer einer Intrige? England im Jahre 1663: Ganz Oxford gerät in Aufruhr, als ein angesehener Tutor des New College vergiftet wird. Die Täterin scheint schnell gefunden. Doch warum hat die schöne Sarah Blundy den Mord begangen? Drei Männer beginnen, aus ganz unterschiedlichen Gründen nach Antworten zu suchen: Marco da Cola, ein Arzt aus Venedig, Jack Prescott, der Sohn eines Verräters, und John Wallis, bekannt als Meister der Geheimschriften. Sie ahnen nicht, in welches Wespennest sie damit stechen – und dass die Wahrheit immer das ist, was die Mächtigen der Zeit dazu erklären …
Opulent, fesselnd und voller Überraschungen: Iain Pears erweckt das 17. Jahrhundert zu neuem Leben – jene Zeit, in der die Wissenschaft den Aberglauben besiegen wollte, in der kühne Denker wie der Chemiker Robert Boyle, der Philosoph John Locke und der Astronom Christopher Wren wirkten … und trotzdem allerorts Lüge, Machtgier und Verrat herrschten!
Über den Autor:
Iain Pears, geboren 1955 im englischen Coventry, studierte in Oxford und arbeitete später in Rom und Paris als Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters. Heute ist er als Journalist und Kunsthistoriker bekannt – und als Autor hochgelobter Kriminalromane und historischer Romane. Sein internationaler Bestseller »Urteil am Kreuzweg« wurde in 15 Sprachen übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Iain Pears den Roman »Scipios Traum« sowie die Kriminalromane rund um den Kunsthistoriker Jonathan Argyll und die Kommissarin Flavia di Stefano: »Giottos Handschrift«, »Caravaggios Erben« und »Die makellose Täuschung«.
***
Ein Verzeichnis über die wichtigsten in diesem Roman auftretenden historischen und fiktiven Figuren finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2020
Die britische Originalausgabe dieses Buchs erschien 1997 unter dem Titel »An Instance of the Fingerpost« bei Jonathan Cape, London. Diese deutsche Erstausgabe erschien 1998 im Diana Verlag unter dem Titel »Das Urteil am Kreuzweg«.
Copyright © 1997 by Iain Pears
Copyright © 1998 der deutschsprachigen Erstausgabe by Diana Verlag AG, München und Zürich
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Gregor Buir, Mary Mo und Adobe Stock/lancex
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-970-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Urteil am Kreuzweg« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Iain Pears
Urteil am Kreuzweg
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Edith Walter und Friedrich Mader
dotbooks.
Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae.Die Geschichte aber ist die Zeugin der Zeiten, das Licht der Wahrheit, das Leben der Erinnerung, die Lehrerin für das Leben.
CICERO, De Oratore
Eine Frage der Priorität
»Es gibt auch Götzenbilder in Folge der gegenseitigen Berührung und Gemeinschaft des menschlichen Geschlechts, welche ich wegen des Verkehrs und der Verbindung der Menschen die Götzenbilder des Marktes nenne. Denn die Menschen gesellen sich zu einander vermittelst der Rede; aber die Worte werden den Dingen nach der Auffassung der Menge beigelegt, deshalb behindert die schlechte und thörichte Beilegung der Namen den Geist in merkwürdiger Weise ... Denn die Worte thun dem Verstande Gewalt an, stören Alles und verleiten die Menschen zu leeren und zahllosen Streitigkeiten und Erdichtungen.«
Francis Bacon, Novum Organum Scientarum, Book I, Aphorism XLIII1
Kapitel 1
Marco da Cola, Gentleman aus Venedig, entbietet respektvoll seinen Gruß. Ich möchte von der Reise berichten, die ich anno 1663 nach England unternommen habe, von den Ereignissen, deren Zeuge ich wurde, und von den Menschen, denen ich begegnete, was, wie ich hoffe, für all jene von einigem Interesse ist, die von Neugier heimgesucht werden. Ebenso beabsichtige ich, in meinem Bericht die Lügen jener zu enthüllen, die ich einst, fälschlicherweise, zu meinen Freunden zählte. Ich beabsichtige nicht, mich des langen und breiten schriftlich zu rechtfertigen oder im einzelnen zu erzählen, auf welche Weise ich hintergangen und um das Ansehen betrogen wurde, das mir von Rechts wegen gebührt. Mein Bericht wird, wie ich glaube, für sich selbst sprechen.
Ich werde viel, aber nichts von Bedeutung, weglassen. Ein großer Teil meiner Reisen durch dieses Land war nur für mich interessant und wird hier nicht erwähnt. Viele, denen ich begegnete, waren von ebenso geringer Bedeutung. Jene, die mir in späteren Jahren Schaden zufügten, schildere ich so, wie ich sie damals kannte, und ich bitte den Leser, daran zu denken, daß ich zwar nicht unreif war, aber noch keine Weltklugheit besaß. Sollte meine Erzählung schlicht und töricht scheinen, dann müßt Ihr daraus schließen, daß der junge Mann, der ich vor so vielen Jahren gewesen bin, auch schlicht und töricht war. Ich werde auf mein Bild von damals keine neuen Farbschichten und keinen frischen Firnis auftragen, um meine Fehler oder die Schwäche meiner Zeichenkunst zu verdecken. Ich werde keine Beschuldigungen aussprechen und nicht gegen andere polemisieren; ich werde vielmehr sagen, was geschehen ist, zuversichtlich, daß ich mehr nicht tun muß.
***
Mein Vater, Giovanni da Cola, war Kaufmann und beschäftigte sich während der letzten Jahre seines Lebens mit dem Import von Luxusgütern nach England, das sich, wiewohl ein Land ohne Raffinesse, dennoch von den Nachwirkungen der Revolution zu erholen begann. Scharfsinnig hatte er aus der Ferne erkannt, was die Rückkehr von König Charles II. bedeutete: daß die Riesengewinne dort gewissermaßen wieder auf der Straße liegen würden. Anderen Kaufleuten, die länger zögerten, heimlich zuvorkommend, hatte er in London eine Niederlassung gegründet, um die wohlhabenderen Londoner mit jenen Luxusgütern zu versorgen, die von den puritanischen Eiferern so viele Jahre verboten worden waren. Sein Geschäft blühte; er hatte in Giovanni di Pietro einen guten Mann in London und ging auch mit einem englischen Kaufmann, mit dem er sich die Gewinne teilte, eine Partnerschaft ein. Wie er mir einmal sagte, war es ein gerechter Handel: John Manston war zwar listig und unehrlich, kannte jedoch wie kein zweiter den englischen Geschmack. Wichtiger noch: Die Engländer hatten ein Gesetz verabschiedet, das fremden Schiffen verbot, Waren in ihre Häfen einzuführen, und Manston war ein Weg, diese Schwierigkeit zu überwinden. Solange mein Vater di Pietro am Ort hatte, der die Konten fest im Auge behielt, gab es, wie er glaubte, kaum eine Möglichkeit, ihn zu betrügen.
Er war längst über die Zeit hinaus, in der er direktes Interesse an seinem Geschäft nahm, und hatte schon einen Teil seines Kapitals in Landbesitz in der terra ferma – den ehemaligen Festlandsbesitzungen Venedigs – angelegt, um in das Goldene Buch aufgenommen zu werden. Obwohl selbst Kaufmann, wollte er, daß seine Kinder Gentlemen würden, und riet mir davon ab, mich aktiv in seinem Unternehmen zu betätigen. Ich erwähne das, weil es für mich ein Zeichen seiner Güte war. Er hatte schon früh bemerkt, daß mein kaufmännischer Verstand sehr gering war, und ermutigte mich, mich von dem Leben abzuwenden, das er führte. Er wußte auch, daß der junge Gatte meiner Schwester für die Fährnisse des Handels viel geeigneter war als ich.
Während also mein Vater den Namen und das Vermögen der Familie sicherte, hielt ich mich – meine Mutter war gestorben und meine Schwester nutzbringend verheiratet – in Padua auf, um mir eine oberflächliche Kenntnis artigen Benehmens anzueignen; er war zufrieden, daß sein Sohn unserem Adel angehörte, wollte mich aber nicht so ungebildet wissen, wie es der Adel war. An diesem Punkt und reifer an Jahren – ich wurde jetzt bald dreißig –, wurde ich plötzlich von der brennenden Begeisterung gepackt, Bürger der – wie man sie nennt – Republik der Gelehrtheit zu werden. An diese plötzliche Leidenschaft erinnere ich mich nicht mehr, so völlig ist sie von mir abgefallen, doch die Faszination der neuen experimentellen Naturwissenschaften hielt mich in ihrem Bann. Es war natürlich eher eine Sache des Geistes als die der praktischen Anwendung. Ich sage mit Beroaldus non sum medicus, nec medicinae prorsus exper: In der Theorie der Heilkunde habe ich mich redlich bemüht, nicht mit der Absicht jemals zu praktizieren, sondern um mich selbst zufriedenzustellen. Ich hatte weder den Wunsch, noch hatte ich es nötig, meinen Lebensunterhalt auf solche Weise zu verdienen, obwohl ich, was ich voller Scham gestehe, meinen armen, gütigen Vater hin und wieder damit ärgerte, daß ich sagte, wenn er nicht nett zu mir sei, würde ich mich rächen und Arzt werden.
Ich vermute, ihm war längst klar, daß ich nie dergleichen tun würde und mich lediglich von Ideen und Menschen fesseln ließ, die ebenso aufregend wie gefährlich waren. Die Folge war, daß er keine Einwände erhob, als ich ihm von den Berichten eines Professors schrieb, der, obwohl namentlich Vorlesungen in Rhetorik haltend, einen großen Teil seiner Zeit damit verbrachte, sich über die neuesten Entwicklungen in der Naturwissenschaft zu unterrichten. Dieser Mann war weit gereist und behauptete, daß ernsthafte Studenten von Naturphänomenen die Niederlande und England nicht mehr verächtlich ablehnen dürften. Nach vielen Monaten unter seinen Fittichen steckte ich mich mit seiner Begeisterung an, und da mich in Padua kaum etwas hielt, bat ich meinen Vater, diesen Teil der Welt bereisen zu dürfen. Gütig, wie er war, stimmte er sofort zu, besorgte mir die Erlaubnis, das venezianische Staatsgebiet zu verlassen, und sandte seinem Bankier in Flandern einen Kreditbrief für mich.
Ursprünglich hatte ich den Vorteil meiner Stellung nutzen und den Seeweg nehmen wollen, da ich jedoch, um Kenntnisse zu erwerben, soviel wie möglich sehen sollte, kam ich zu dem Schluß, daß es besser war, mit der Kutsche zu reisen, als mich auf einem Schiff drei Wochen lang mit der Mannschaft zu betrinken. Hinzufügen muß ich, daß ich schwer an der Seekrankheit leide – eine Schwäche, die ich stets sehr ungern zugegeben habe; wenn Gomesius2 auch sagt, sie heile die Traurigkeit des Geistes, habe ich das nie feststellen können. Dennoch verlor ich immer mehr von meinem Mut, der sich fast ganz in Luft auflöste, je länger die Reise dauerte. Nach Leiden waren wir nur neun Wochen unterwegs, doch die Qualen, die ich zu ertragen hatte, lenkten mich völlig von der Aussicht ab, die an mir vorüberzog. Als wir einmal auf halbem Weg über einen Alpenpaß im Schlamm steckenblieben, es in Strömen regnete, ein Pferd krank war, ich selbst Fieber hatte und mein einziger Reisegefährte ein gewalttätig aussehender Soldat war, dachte ich, daß ich lieber den schlimmsten Sturm auf dem Atlantik aushielte als solches Elend.
Doch zurückzukehren hätte ebensolange gedauert wie die Fortsetzung der Reise, und so hielt ich durch, eingedenk des Spottes, der sich über mich ergießen würde, wenn ich beschämt und schwach in meine Heimatstadt zurückkäme. Scham ist, wie ich glaube, das mächtigste Gefühl, das der Mensch kennt; die meisten Entdeckungen und bedeutenden Reisen wurden zu Ende geführt, weil es eine Schande gewesen wäre, hätte man den Versuch abgebrochen. Krank vor Sehnsucht nach der Behaglichkeit und Wärme meines Heimatlandes – die Engländer nennen diese Krankheit nostalgia, die ihrer Meinung nach auf das Ungleichgewicht einer fremden Umgebung zurückzuführen ist – setzte ich meinen Weg fort, übel gelaunt und unglücklich, bis ich in Leiden eintraf, wo ich als Gentleman in die medizinische Hochschule eintrat.
So viel schon wurde über diesen Sitz der Gelahrtheit geschrieben, der für meinen Bericht auch bedeutungslos ist, daß es genügt, wenn ich sage, ich fand zwei Professoren, die Vorlesungen über Anatomie und körpereigene Funktionen hielten und von deren einzigartigem Wissen ich sehr viel profitierte. Ich reiste auch durch die Niederlande und fand treffliche Gesellschaft, vor allem Engländer, die mir ein wenig von ihrer Sprache beibrachten. Ich verließ die Niederlande nur, weil mein guter Vater es mir befahl, aus keinem anderen Grund. Im Londoner Büro gebe es irgendwelche Unregelmäßigkeiten, wie er mir schrieb, und er brauche jemanden von der Familie, der vermittelnd eingreifen könne: Niemand sonst sei vertrauenswürdig. Obwohl mein praktisches Wissen über Handel und Wandel sehr gering war, freute ich mich, als gehorsamer Sohn etwas für ihn tun zu können, entließ meinen Diener, ordnete meine Angelegenheiten und schiffte mich in Antwerpen ein, um nach dem Rechten zu sehen. Am 22. März 1663 traf ich mit nur wenigen Pfund in der Tasche in London ein; die Summe, die ich einem Professor für seinen Unterricht bezahlt hatte, hatte meine Geldmittel fast erschöpft. Doch ich machte mir keine Sorgen, denn ich dachte, ich brauchte nur den kurzen Weg vom Fluß zu meines Vaters Büro zurückzulegen, das sein Vertreter unterhielt, und alles würde wieder in Ordnung sein. Was war ich nur für ein Narr. Ich konnte di Pietro nicht finden, und dieser elende John Manston wollte mich nicht einmal empfangen. Er ist schon lange tot; ich bete für seine Seele und hoffe, daß Gott meine Gebete nicht erhört, denn ich weiß, je länger dieser Mann feurige Qualen leidet, um so gerechter ist seine Strafe.
Ich mußte mich an einen geringen Diener um Auskunft wenden, und dieser Junge sagte mir, der Vertreter meines Vaters sei vor einigen Wochen plötzlich verstorben. Es kam noch schlimmer: Manston hatte sich Vermögen und Geschäft sofort angeeignet und weigerte sich, zuzugeben, daß sie je meinem Vater gehört hatten. Den Anwälten hatte er Dokumente vorgelegt (Fälschungen natürlich), die seine Behauptung untermauerten. Er hatte, mit anderen Worten, meine Familie um ihr ganzes Geld betrogen – jedenfalls um den Teil des Geldes, der in England lag.
Unglücklicherweise wußte der Diener nicht, wie ich vorgehen sollte. Ich konnte Anklage vor dem Friedensrichter erheben, doch da ich außer meiner Überzeugung keinen Beweis hatte, schien das sinnlos zu sein. Ich konnte einen Anwalt konsultieren, doch wenn England und Venedig sich auch in vielen Dingen unterscheiden, in einem sind sie sich gleich – die Anwälte haben eine unersättliche Liebe zu Geld, und Geld war etwas, das ich nicht in ausreichender Menge besaß.
Es wurde auch sehr schnell klar, daß London kein gesunder Aufenthaltsort war. Womit ich nicht die berühmte Pest meine, von der die Stadt noch nicht heimgesucht worden war; ich meine, daß Manston am selben Abend einen gedungenen Spitzbuben zu mir schickte, der mir zeigte, daß mein Leben anderenorts sicherer sein würde. Zum Glück brachte er mich nicht um; tatsächlich machte ich meine Sache bei der Rauferei gut, dank des Honorars, das mein Vater meinem Fechtlehrer bezahlt hatte, und ich glaube, der Halunke verließ den Kampfplatz in einem viel schlimmeren Zustand als ich. Ich nahm mir die Warnung dennoch zu Herzen und beschloß, unsichtbar zu bleiben, bis ich mir über mein weiteres Vorgehen im klaren war. Ich will diese Angelegenheit kaum noch erwähnen, außer um zu sagen, daß ich schließlich den Gedanken an Entschädigung aufgab, und mein Vater zu dem Schluß kam, das Geld, das wir verloren hatten, sei die Kosten nicht wert. Widerstrebend vergaßen wir die Sache, bis wir nach zwei Jahren hörten, daß eines von Manstons Schiffen in Triest vor Anker lag, um das Ende eines Sturms abzuwarten. Meine Familie ließ es beschlagnahmen – die venezianische Justiz ist Venezianern ebenso wohlgesinnt wie die englische den Engländern –, und Schiffskörper und Ladung entschädigten uns wenigstens zum Teil für unsere Verluste.
Die Erlaubnis meines Vaters, sofort abzureisen, hätte meinen Lebensgeistern unendlich gutgetan, denn das Wetter in London konnte den stärksten Mann zur Verzweiflung bringen. Der Nebel, der unablässige, schwächende Nieselregen, die bittere Kälte und der Winterwind, der unbarmherzig durch meinen dünnen Mantel pfiff, stürzten mich in tiefste Niedergeschlagenheit. Nur die Pflicht gegen meine Familie zwang mich zu bleiben, anstatt in den Hafen zu gehen und um eine Passage nach Hause zu bitten. Und anstatt den Weg der Vernunft einzuschlagen, schrieb ich meinem Vater, unterrichtete ihn vom Stand der Dinge und versprach zu tun, was ich konnte, wies jedoch darauf hin, daß ich praktisch wenig erreichen würde, wenn er nicht noch einmal in seine Geldtruhe griff und mir einen bestimmten Betrag zukommen ließ. Ich mußte, das war mir klar, viele Wochen überstehen, ehe er antworten konnte. Und ich besaß noch fünf Pfund, um zu überleben.
Der Professor, bei dem ich in Leiden studiert hatte, hatte mir freundlicherweise zwei Schreiben an Gentlemen mitgegeben, mit denen er im Briefwechsel stand, und da sie meine einzige Verbindung zu Engländern waren, beschloß ich, daß es wohl das beste wäre, wenn ich mich ihrer Fürsorge anvertraute. Daß keiner von beiden in London war, war ein zusätzlicher Anreiz für mich, und so wählte ich den Mann, der in Oxford lebte, da es London am nächsten lag, und entschloß mich, so schnell wie möglich abzureisen.
Die Engländer sind gegen Reisende sehr mißtrauisch und geben sich regelrecht Mühe, das Reisen so schwierig zu machen wie möglich. Auf dem Zettel, der da klebte, wo ich auf die Kutsche wartete, stand, daß die Reise nach Oxford achtzehn Stunden dauern sollte – so Gott wolle, lautete das scheinheilige Postscriptum. Der Allmächtige war an diesem Tag leider nicht willens; Regen hatte einen großen Teil der Straße verschwinden lassen, so daß sich der Kutscher seinen Weg durch etwas suchen mußte, das große Ähnlichkeit mit einem frisch gepflügten Acker hatte. Ein paar Stunden später verloren wir ein Rad, meine Reisetruhe kippte vom Dach, und der Deckel wurde beschädigt. Kurz vor einer trostlosen kleinen Stadt namens Thame brach sich ein Pferd ein Bein und mußte getötet werden. Hinzuzufügen wäre noch, daß wir praktisch bei jedem Gasthaus in Südengland hielten (die Wirte bestechen die Kutscher, damit sie es tun), die Reise daher insgesamt fünfundzwanzig Stunden dauerte und ich um sieben Uhr morgens im Hof eines Gasthauses in der Hauptstraße der Stadt Oxford abgesetzt wurde.
Kapitel 2
Wenn man die Engländer so reden hört (ihre Reputation für Prahlerei haben sie sich schwer erworben), könnte ein unerfahrener Reisender vermuten, daß es in ihrem Land die schönsten Gebäude, die größten Städte und die reichsten, am besten genährten, glücklichsten Menschen der Welt gibt. Ich habe einen ganz anderen Eindruck. An die Städte der Lombardei, der Toskana und Venetiens gewöhnt, kann man nur darüber staunen, wie winzig die Siedlungen dieses Landes sind und welcher Mangel dort herrscht; es ist beinahe menschenleer, und es gibt mehr Schafe als Einwohner. Nur London, Epitome Britannia und ein vortreffliches Handelszentrum, kann sich mit den großen Städten auf dem Kontinent vergleichen; der Rest sind ärmliche Höfe, meist verfallen und voller Bettler, nachdem der Handel nach den jüngsten politischen Unruhen völlig darniederliegt. Obwohl einige Gebäude der Universität wirklich schön sind, gibt es in Oxford nur ein paar Straßen, die es wert sind, besichtigt zu werden, und man kann kaum länger als zehn Minuten gehen, ohne sich zwischen Äckern und Wiesen wiederzufinden.
Ich hatte die Adresse einer bescheidenen Unterkunft im Norden der Stadt, in einer breiten Straße nahe der Stadtmauer; sie wurde von einem ausländischen Kaufmann bewohnt, der früher mit meinem Vater Handel getrieben hatte. Es war ein trauriges Gemäuer, und genau gegenüber wurde ein Haus für ein neues Universitätsgebäude abgerissen. Die Engländer machten ein großes Getue darum; es wurde von einem jungen, ziemlich arroganten Mann entworfen, den ich später kennenlernte und der sich dadurch einen Namen machte, daß er nach dem großen Feuer die Kathedrale von London wieder aufbaute – Christopher Wren. Dieser Mann verdient den Ruf nicht, den er genießt, denn er hat kein Gefühl für Proportionen und kaum das Talent, etwas zu entwerfen, das dem Auge angenehm ist. Dennoch war es das erste Gebäude in Oxford, das nach modernen Grundsätzen ausgeführt wurde und bei jenen, die es nicht besser verstanden, große Aufregung verursachte.
Mr. van Leeman bot mir ein warmes Getränk an, erklärte mir jedoch bedauernd, mehr könne er für mich nicht tun, da er kein Zimmer für mich habe. Das Herz wurde mir noch schwerer, doch wenigstens sprach er eine Weile mit mir, setzte mich ans Feuer und gestattete mir, mich zu säubern und umzukleiden, so daß ich, als ich mich wieder in die Welt hinauswagte, keine so erschreckende Erscheinung mehr war. Er erzählte mir auch einiges über das Land, dem mein Besuch galt. Ich war jämmerlich ahnungslos und wußte über England nur, was ich von meinen englischen Bekannten in Leiden erfahren hatte; wußte eigentlich nur, daß der zwanzigjährige Bürgerkrieg zu Ende war. Van Leeman heilte mich gewissermaßen auch von meiner Einbildung, das Land sei jetzt ein Hafen der Ruhe und des Friedens. Der König sei tatsächlich zurückgekehrt, sagte er, aber wegen seiner Ausschweifungen sehr bald in aller Welt in Verruf geraten. Schon traten der Hader, der zur Regierungszeit seines Vaters zum Krieg geführt hatte, und der Richtblock des Henkers wieder in Erscheinung, und die Zukunftsaussichten waren düster. Kaum ein Tag verging, ohne daß in den Tavernen von Gerüchten über Aufruhr, Intrige oder Rebellion gesprochen wurde.
Das brauchte mich allerdings nicht zu beunruhigen, beschwichtigte er mich. Ein harmloser Reisender wie ich würde viel Interessantes in Oxford finden, das sich rühmen konnte, einige der bemerkenswertesten Gelehrten der Welt zu beherbergen. Er kannte den Honourable Robert Boyle, den Mann, für den ich ein Empfehlungsschreiben hatte, und sagte mir, wenn ich Eingang in die Gesellschaft finden wolle, sollte ich in das Kaffeehaus in der High Street gehen, das einem Mr. Tillyard gehörte und seit Jahren der Treffpunkt des Chemie-Clubs war und wo man sich darauf verlassen konnte, ein warmes Essen vorgesetzt zu bekommen. Ob das nun Hilfe oder Hinweis war, ich brachte mich in Ordnung, bat Mr. van Leeman, mein Gepäck aufzubewahren, bis ich eine passende Unterkunft gefunden hatte, und machte mich in der von ihm angegebenen Richtung auf den Weg.
Zu dieser Zeit war Kaffee in England eine modische Extravaganz, die mit den zurückkehrenden Juden ins Land gekommen war. Für mich war die bittere Bohne natürlich nichts Neues, denn ich trank sie, um meine Milz zu reinigen und meine Verdauung zu fördern, war jedoch nicht darauf vorbereitet, daß sie so in Mode gekommen war; man hatte ihr sogar eigene Gebäude errichtet, wo sie für sehr viel Geld in ungewöhnlich großen Mengen genossen werden konnte. Mr. Tillyards Etablissement, insbesondere, war ein feines, komfortables Lokal, wenn ich auch bestürzt war, daß ich einen Penny entrichten mußte, ehe man mir Einlaß gewährte. Doch es war mir unmöglich, den Armen zu mimen, denn mein Vater hatte mich gelehrt, je ärmer man schien, um so ärmer wurde man. Ich bezahlte mit heiterer Miene und entschied mich dann, mein Getränk in die Bibliothek mitzunehmen, wofür ich noch einmal zwei Pennies entrichten mußte.
Die Gäste eines Kaffeehauses waren sorgfältig ausgewählt, anders als in den Schenken, die auch alles niedrige Volk bewirten. In London, zum Beispiel, gibt es anglikanische und presbyterianische Häuser; Häuser, in denen Nachrichtenschreiberlinge und Dichterlinge sich versammeln, um Lügen auszutauschen, und Häuser, in denen der allgemeine Ton von klugen Männern bestimmt wird, die eine Stunde oder mehr lesen oder im Gespräch verbringen können, ohne daß Unwissende sie beleidigen und Vulgäre sich auf sie übergeben. Das war das Theorem, das meiner Anwesenheit in diesem Gebäude zugrunde lag. Das partum practicum indessen war ein ganz anderes: die Gruppe der anwesenden Wissenschaftler sprang nicht auf, um mich – wie ich gehofft hatte – willkommen zu heißen. Tatsächlich waren nur vier Leute anwesend, und als ich mich vor einem verbeugte – einem gewichtigen Mann mit rotem Gesicht, entzündeten Augen und glatt herabhängenden ergrauenden Haaren –, tat er so, als habe er mich nicht gesehen. Niemand sonst beachtete mich sonderlich, als ich eintrat; man gönnte mir bestenfalls ein paar neugierige Blicke als einem Mann von Geschmack und offensichtlich feiner Lebensart.
Mein erster Versuch, in die englische Gesellschaft Eingang zu finden, schien gescheitert, und ich beschloß, nicht allzuviel Zeit damit zu vergeuden. Was mich aufhielt, war die Zeitung, ein Journal, in London gedruckt und dann im ganzen Land verteilt, eine ganz neuartige Idee. Sie berichtete überraschend offen über verschiedene Angelegenheiten und zwar nicht nur über einheimische, sondern gab auch detaillierte Schilderungen von Ereignissen an ausländischen Orten, die mich sehr interessierten. Später erfuhr ich, daß es harmlose Produkte waren im Vergleich zu früher, als vor einigen Jahren die Leidenschaft für Splittergruppen eine Menge solcher Organe hervorgebracht hatte. Für den König, gegen den König, für das Parlament, für die Armee oder gegen dies und gegen das. Cromwell und dann der zurückgekehrte König Charles taten ihr Bestes um eine Art von Ordnung wiederherzustellen, denn sie mutmaßten mit Recht, daß solches Zeug die Menschen nur verleitet zu denken, sie verstünden die Angelegenheiten des Staates. Etwas Törichteres kann man sich kaum vorstellen, denn es ist offensichtlich, daß der Leser nur über das unterrichtet wird, was er, dem Wunsch des Schreibers entsprechend, wissen soll, und dazu verführt wird, beinahe alles zu glauben. Solche Freiheiten bewirken nichts, verwandeln nur die schmutzigen Schmieranten, die derlei Traktate produzieren, in Männer mit Einfluß, so daß sie umherstolzieren, als seien sie Männer von hohem Wert. Jeder, der je einen dieser englischen Journalisten (so genannt, wie ich glaube, weil sie immer nur für einen Tag bezahlt werden wie gewöhnliche Tagelöhner) kennengelernt hat, wird wissen, wie lächerlich das ist.
Dennoch las ich länger als eine halbe Stunde, gefesselt von einem Bericht über den Krieg auf Kreta, bis klappernde Schritte auf der Treppe und das Öffnen der Tür mich aus meiner Konzentration rissen. Ich blickte kurz auf und sah eine Frau von ungefähr neunzehn oder zwanzig Jahren, mittelgroß, aber unnatürlich schlank von Gestalt; da war nichts von der Rundlichkeit, die wahrer Schönheit zu eigen ist. Tatsächlich fragte sich die medizinische Hälfte meiner selbst, ob sie etwa dem Alkohol zugeneigt war oder sich allabendlich eine Pfeife Tabak zu Gemüte führte. Ihr Haar war dunkel und natürlich gelockt, ihre Kleidung trist (wenn auch gepflegt), und obwohl recht hübsch, hatte sie nichts Ungewöhnliches an sich. Dennoch gehörte sie zu den Leuten, von denen man sich abwendet, nachdem man sie angesehen hat, und die man dann doch wieder ansieht. Zum Teil lag das an ihren Augen, die unnatürlich groß und dunkel waren. Doch noch mehr fiel sie mir wegen ihrer völlig unpassenden Haltung auf. Dieses unterernährte Mädchen hatte das Gebaren einer Königin und bewegte sich mit erstaunlicher Eleganz; solche Eleganz meiner jüngsten Schwester von Tanzlehrern beibringen zu lassen, hatte meinen Vater ein Vermögen gekostet.
Ich beobachtete sie, als sie zielbewußt auf den rotäugigen Gentleman auf der anderen Seite des Raumes zuging, und hörte mit halbem Ohr, daß sie ihn »Doktor« nannte, dann innehielt und einfach stehenblieb. Als sie zu sprechen begann, sah er irgendwie erschrocken zu ihr auf. Mir entging das meiste von dem, was sie sagte – die Entfernung, mein Englisch und ihre leise Stimme verbündeten sich, um mir den Sinn ihrer Worte vorzuenthalten –, aber den wenigen Worten, die ich verstand, entnahm ich, daß sie ihn um ärztliche Hilfe bat. Es war natürlich ungewöhnlich, daß jemand ihres erbärmlichen Standes daran dachte, einen Arzt zu konsultieren, doch ich wußte ja nur wenig von diesem Land. Vielleicht war das hier durchaus üblich.
Ihre Bitte blieb unbeachtet, und das mißfiel mir. Das Mädchen sollte auf jeden Fall auf den ihm gebührenden Platz verwiesen werden; das war nur natürlich. Jeder Mann von Stand mochte sich dazu verpflichtet fühlen, wenn man ihn auf ungebührliche Weise anredete. Doch im Gesichtsausdruck des Mannes war etwas – Ärger, Geringschätzung oder ähnliches –, das mich innerlich empört aufbegehren ließ. Wie Marcus Tullius Cicero uns lehrt, sollte ein Gentleman eine solche Rüge mit Bedauern aussprechen, nicht mit Schadenfreude, die den Sprecher selbst mehr erniedrigt als den Beleidiger zurechtweist.
»Was?« sagte er, sich im Raum umblickend, als hoffe er, niemand werde es sehen. »Hinaus mit dir, Mädchen, sofort.«
Sie sagte wieder etwas mit so leiser Stimme, daß ich ihre Worte nicht hörte.
»Es gibt nichts, was ich für deine Mutter tun könnte. Das weißt du. Jetzt laß mich bitte in Ruhe.«
Das Mädchen hob leicht die Stimme. »Aber, Sir, Ihr müßt helfen. Denkt nicht, ich bitte ...« Dann sah sie, daß er unerbittlich blieb, ihre Schultern sackten unter der Last ihres Fehlschlags nach vorn, und sie ging zur Tür.
Warum ich aufstand, ihr die Treppe hinunter folgte und sie auf der Straße ansprach, weiß ich nicht. Vielleicht trieb mich, wie Rinaldo oder Tankred, ein törichter Anflug von Ritterlichkeit. Vielleicht empfand ich, weil die Welt mir in den letzten Tagen so übel mitgespielt hatte, Mitgefühl für sie. Vielleicht war mir kalt, und ich war müde und durch meine Sorgen so niedergeschlagen, daß es mir sogar akzeptabel schien, eine Person wie sie anzusprechen. Ich weiß es nicht; aber noch ehe sie sich allzuweit entfernt hatte, holte ich sie ein und räusperte mich höflich.
Mit wütendem Gesicht fuhr sie herum. »Laßt mich in Ruhe!« fauchte sie richtig bösartig.
Ich muß reagiert haben, als hätte sie mich geschlagen; ich weiß noch, daß ich mich bei ihrer heftigen Reaktion in die Unterlippe biß und erschrocken »oh!« sagte. »Ich bitte aufrichtig um Vergebung, Madam«, fügte ich in meinem besten Englisch hinzu.
Zu Hause hätte ich mich anders verhalten: höflich, aber mit der Überlegenheit meiner höheren gesellschaftlichen Stellung. Im Englischen beherrschte ich solche Feinheiten natürlich nicht; ich wußte nur, wie ich mich gegen Damen von Stand zu benehmen hatte, daher sprach ich in dieser Weise mit ihr. Da es mir unlieb gewesen wäre, als halbgebildeter Narr dazustehen (die Engländer sind der Meinung, es gebe nur zwei Gründe dafür, daß jemand ihre Sprache nicht versteht – Dummheit oder vorsätzlichen Eigensinn), beschloß ich, meine Sprache am besten mit Gebärden zu untermalen, als beabsichtigte ich tatsächlich solche politesse. Daher verneigte ich mich beim Sprechen in angemessener Weise.
Es war nicht meine Absicht, doch es nahm ihr so ziemlich den Wind aus den Segeln, um eine der nautischen Redewendungen meines geliebten Vaters zu zitieren. Ihr Zorn schwand, als sie nicht getadelt, sondern mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt wurde, und sie sah mich neugierig an.
Nachdem ich in dieser Art begonnen hatte, beschloß ich, so fortzufahren. »Ihr müßt mir vergeben, daß ich mich Euch auf diese Weise nähere, doch ich habe unabsichtlich mitgehört, daß Ihr ärztliche Hilfe braucht. Ist das richtig?«
»Ihr seid Arzt?«
Ich verneigte mich. »Marco da Cola aus Venedig.« Das war natürlich eine Lüge, aber ich war überzeugt, zumindest so kompetent zu sein wie der Scharlatan oder Quacksalber, den sie sonst aufgesucht hätte. »Und wer seid Ihr?«
»Sarah Blundy ist mein Name. Ich nehme an, Ihr seid zu vornehm, um eine alte Frau mit einem gebrochenen Bein zu behandeln, weil Ihr fürchtet, Euch in den Augen Eurer Kollegen selbst herabzusetzen.«
Es war offensichtlich schwierig, ihr zu helfen. »Ein Chirurg wäre besser und geeigneter«, pflichtete ich bei. »Ich wurde jedoch an den Universitäten von Padua und Leiden in der Kunst der Anatomie ausgebildet, und ich habe hier keine Kollegen, daher ist es unwahrscheinlich, daß jemand glauben wird, ich handelte unter meiner Würde.«
Sie sah mich an, schüttelte dann den Kopf. »Ich fürchte, Ihr müßt etwas Falsches gehört haben, danke Euch aber für Euer Angebot. Ich kann nicht bezahlen, denn ich habe kein Geld.«
Ich winkte leichthin ab – und tat zum zweiten Mal an diesem Tag so, als sei Geld völlig nebensächlich für mich. »Ich biete Euch dennoch meine Dienste an«, fuhr ich fort. »Über die Bezahlung können wir zu einem späteren Zeitpunkt sprechen, wenn Ihr es wünscht.«
»Zweifellos«, sagte sie auf eine Weise, die mich verblüffte. Dann sah sie mich so offen und freimütig an, wie die Engländer es häufig tun, und zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht sollten wir jetzt die Patientin aufsuchen«, schlug ich vor. »Unterwegs könnt Ihr mir berichten, was geschehen ist.«
Wie jeder junge Mann war ich eifrig darauf erpicht, die Aufmerksamkeit eines hübschen Mädchens gleich welchen Standes zu erregen, doch meine Bemühungen wurden kaum belohnt. Obwohl sie nicht annähernd so gut gekleidet war wie ich, da man durch den dünnen Stoff ihres Kleides ihre Gliedmaßen sah und ihre Kopfbedeckung gerade noch der Schicklichkeit Genüge tat, schien sie nicht zu frieren und kaum den Wind zu bemerken, der mich wie mit Messern stach. Sie ging auch schnell, und obwohl sie gut zwei Zoll kleiner war als ich, mußte ich mich beeilen, um mit ihr Schritt zu halten. Ihre Antworten waren kurz und einsilbig, was ich auf die Sorge um die Gesundheit ihrer Mutter zurückführte.
Wir gingen zu Mr. van Leeman zurück, um meine Instrumente abzuholen, und ich las auch noch schnell im Barbette nach, denn ich wollte nicht mitten in der Behandlung ein Buch zu Rate ziehen, da dies auf Patienten nicht eben vertrauenerweckend wirkt. Die Mutter des Mädchens war am Abend vorher offensichtlich schwer gestürzt und hatte die ganze Nacht allein gelegen. Ich fragte, warum sie keine Nachbarn oder Passanten gerufen hatte, da ich vermutete, daß die arme Frau kaum in vornehmer Abgeschiedenheit lebte, bekam jedoch keine zufriedenstellende Antwort.
»Wer war der Mann, mit dem Ihr gesprochen habt?« fragte ich.
Auch diese Frage blieb unbeantwortet.
Ich flüchtete mich daher in eine Kälte, die mir angemessen schien, und ging neben ihr durch eine schäbige Straße, Butcher's Row genannt, vorbei an stinkenden Tierkadavern, die im Freien an Haken hingen oder auf groben Tischen auslagen, so daß der Regen das Blut in die Gosse schwemmen konnte, und geriet dann zwischen noch schäbigere Behausungen an einem der Bäche bei der Burg. Es war schrecklich schmutzig dort unten, die Bäche verstopft und ungepflegt, mit allem nur erdenklichen Unrat unter dem dicken Eis. In Venedig haben wir natürlich das Meer, das täglich die Kanäle der Stadt reinigt. Um Englands Flüsse kümmert sich niemand, sie verstopfen sich, ohne daß jemand daran denkt, wie sehr ein bißchen Pflege das Wasser verbessern würde.
Von allen elenden Hütten in diesem Teil der Stadt lebten Sarah Blundy und ihre Mutter in der elendsten: sie war klein, die Fenster mit Brettern vernagelt, das Dach voller Löcher, mit Stoffetzen abgedichtet, und die Tür dünn und schäbig. Drinnen jedoch war alles makellos sauber, wenn auch feucht; ein Beweis, daß sogar unter so ärmlichen Umständen ein Funken Stolz weiterflackern kann. Der kleine Herd und die Bodendielen waren geschrubbt, die beiden wackeligen Stühle ebenfalls, und das wenn auch grobe Bett hatte man poliert. Abgesehen davon gab es im Raum keine Möbel, nur noch die wenigen Töpfe und Teller, die selbst die Ärmsten der Armen brauchen. Etwas brachte mich zum Staunen: ein Regal mit mindestens einem halben Dutzend Bücher machte mir klar, daß irgendwann ein Mann dieses Haus bewohnt haben mußte.
»Nun«, sagte ich so vergnügt wie mein Lehrer in Padua es zu tun pflegte, um Vertrauen einzuflößen, »wo ist denn die Kranke?«
Sie zeigte auf das Bett, das ich für leer gehalten hatte. Unter der dünnen Decke zusammengekrümmt lag ein kleiner, zerbrochener Vogel von Frau, so klein, daß es schwierig war, sich vorzustellen, sie sei kein Kind. Ich näherte mich dem Bett und schlug die Decke zurück.
»Guten Morgen, Madam«, sagte ich. »Wie ich erfahren habe, hattet Ihr einen Unfall. Sehen wir uns den Schaden einmal an.«
Sogar mir war sofort klar, daß es sich um eine ernste Verletzung handelte. Das Ende des gebrochenen Knochens hatte die pergamentdünne Haut durchbohrt und ragte blutig in die Luft. Und als sei das noch nicht genug, hatte irgendein stümperhafter Dummkopf offensichtlich versucht, den Knochen wieder zurückzudrücken, das Fleisch noch weiter aufgerissen und dann die Wunde einfach mit einem schmutzigen Tuch umwickelt, so daß die Fäden im inzwischen gestockten Blut klebten.
»Heilige Maria, Mutter Gottes!« rief ich verärgert, aber zum Glück auf italienisch. »Welcher Stümper hat das getan?«
»Sie selbst«, antwortete das Mädchen, nachdem ich den Satz auf englisch wiederholt hatte. »Sie war ganz allein und hat getan, was sie konnte.«
Es sah wirklich sehr schlimm aus. Selbst bei einem kräftigen jungen Mann wäre die unausweichliche Schwäche nach einer solchen Verletzung sehr groß gewesen. Es bestand die Möglichkeit, daß die Wunde brandig wurde und die im Fleisch hängenden Fäden eine Entzündung hervorriefen. Ich fröstelte bei dem Gedanken, und dann wurde mir bewußt, daß es im Raum bitterkalt war.
»Geht und zündet sofort ein Feuer an«, sagte ich. »Sie muß warm gehalten werden.«
Das Mädchen rührte sich nicht.
»Habt Ihr nicht gehört? Tut, was ich sage.«
»Wir haben nichts, was wir verbrennen können«, sagte sie.
Was konnte ich tun? Es war kaum passend oder meiner würdig, doch manchmal geht die Aufgabe des Arztes über die Behandlung des körperlichen Leidens weit hinaus. Mit leichter Ungeduld nahm ich ein paar Pennies aus meiner Tasche. »Dann geht und kauft ein wenig Holz«, sagte ich.
Sie schaute auf die Pennies hinunter, die ich ihr in die Hand gedrückt hatte, und verließ, ohne sich auch nur mit einem einzigen Wort bei mir zu bedanken, den Raum.
»Und jetzt zu Euch, Madam«, sagte ich, mich wieder der alten Frau zuwendend. »Bald werdet Ihr es schön warm haben. Das ist sehr wichtig. Aber zuallererst müssen wir Euer Bein säubern.«
Ich machte mich also an die Arbeit; zum Glück kam das Mädchen sehr bald mit Holz und ein wenig Glut zurück, um das Feuer anzünden zu können, so daß ich bald heißes Wasser hatte. Ich dachte, wenn ich die Wunde schnell genug säubern und den gebrochenen Knochen in seine ursprüngliche Lage zurückschieben konnte, ohne ihr so viel Schmerz zu bereiten, daß sie daran starb, wenn sie kein Fieber bekam und die Wunde sich nicht entzündete, wenn sie warm gehalten und gut genährt wurde – wenn all das eintraf, würde sie vielleicht am Leben bleiben. Aber es gab viele Gefahren; und schon eine davon konnte sie töten.
Sobald ich begann, schien sie ziemlich munter, was ein guter Anfang war, obwohl bei dem Schmerz, den ich ihr bereitete, vermutlich auch ein Toter aufgewacht wäre. Sie erzählte mir, daß sie auf einer Eisplatte ausgerutscht und schlimm gestürzt war, doch abgesehen davon war sie ebenso wenig mitteilsam wie ihre Tochter, wobei sie natürlich viel mehr Grund dazu hatte.
Vielleicht hätten sich jene, die weniger rücksichtsvoll sind und mehr Stolz besitzen als ich, in dem Augenblick abgewandt, in dem das Mädchen gestand, es habe kein Geld; vielleicht hätte ich gehen können, als klar wurde, daß nicht geheizt werden konnte; gewiß hätte ich mich sogar von vornherein weigern können, an eine medizinische Versorgung der Frau überhaupt zu denken. Man tut das natürlich nicht um seiner selbst willen, muß in diesen Angelegenheiten an die Reputation des Berufes denken. Doch bei aller Rücksichtnahme brachte ich es nicht fertig zu tun, was ich hätte tun sollen. Manchmal ist es nicht einfach, Gentleman und Arzt zugleich zu sein.
Und obwohl ich gelernt hatte, Wunden zu säubern und Knochenbrüche einzurichten, hatte ich noch nie Gelegenheit gehabt, es in der Praxis zu tun. Es war sehr viel schwieriger, als die Professoren uns weisgemacht hatten, und ich fürchte, daß ich der alten Frau starke Schmerzen zufügte. Doch endlich war der Bruch eingerichtet, das Bein verbunden, und ich schickte das Mädchen mit noch einigen Pennies meiner geringen Barschaft um die Ingredienzen für eine Salbe. Während seiner Abwesenheit holte ich ein paar lange Hölzer und band sie an dem verletzten Bein fest, um, wenn möglich, sicherzustellen, daß der gesplitterte Knochen wieder richtig zusammenwuchs, wenn die Frau das Glück hatte zu überleben.
In dieser Phase war ich in keiner guten Stimmung. Was tat ich eigentlich hier, in dieser provinziellen, unfreundlichen, elenden kleinen Stadt, von Fremden umgeben, so unendlich weit fort von allem, was ich kannte, und allen, die mich liebten? Noch ernster war für mich die Frage, was werden sollte – und bis dahin war es nicht mehr weit –, wenn ich kein Geld mehr hatte, um Unterkunft und Essen zu bezahlen?
In meine eigenen verzweifelten Sorgen versunken, ließ ich meine Patientin völlig unbeachtet, denn meinem Gefühl nach hatte ich schon mehr als genug für sie getan, und ertappte mich dabei, daß ich das kleine Bücherregal betrachtete, nicht aus Interesse, sondern um dem armen Wesen den Rücken zu kehren und nicht ansehen zu müssen, was sehr schnell zum Symbol meiner Mißgeschicke wurde. Dieses Gefühl wurde noch durch die Tatsache verstärkt, daß ich fürchtete, meine Bemühungen und Ausgaben würden sich als Vergeudung erweisen: denn obwohl ich jung und unerfahren war, kannte ich schon den Tod, wenn ich ihm ins Gesicht sah, seinen Atem roch und auf der Haut den Schweiß berührte, den er absonderte.
»Ihr seid unglücklich, Sir«, sagte die alte Frau mit schwacher Stimme vom Bett her. »Ich fürchte, ich bin eine große Last für Euch.«
»Nein, nein, überhaupt nicht«, sagte ich bewußt und betont unaufrichtig.
»Es ist sehr freundlich von Euch, das zu sagen. Aber wir wissen beide, daß wir Euch Eure Hilfe nicht bezahlen können, wie Ihr es verdient. Und ich habe Eurem Gesichtsausdruck angesehen, daß Ihr im Augenblick, trotz Eurer Kleidung, auch nicht reich seid. Woher kommt Ihr? Ihr seid nicht aus dieser Gegend.«
Ein paar Minuten später saß ich auf der äußersten Kante eines der beiden wackeligen Stühle neben dem Bett und schüttete mein Herz aus – über meinen Vater, meinen Geldmangel, meinen Empfang in London, meine Hoffnungen und Befürchtungen für die Zukunft. Sie hatte etwas an sich, das derlei Geständnisse ermutigte, beinahe so, als spräche ich mit meiner alten Mutter, nicht mit einer armen, sterbenden englischen Ketzerin.
Sie nickte währenddessen geduldig und redete so weise mit mir, daß ich mich getröstet fühlte. Es gefällt Gott, uns Prüfungen zu schicken, wie Hiob. Unsere Pflicht ist es, sie still zu ertragen, die Fähigkeiten zu nutzen, die er uns gab, damit wir diese Prüfungen bestehen und nie den Glauben daran verlieren, daß Seine Absicht gut und notwendig war. Darüber hinaus gab sie mir den praktischen Rat, Mr. Boyle aufzusuchen, der ein guter Christ und ein Gentleman sei.
Vermutlich hätte ich diese Mischung aus puritanischer Frömmigkeit und impertinentem Rat verächtlich zurückweisen sollen. Aber ich sah, daß sie mich auf ihre Weise entschädigen wollte. Sie konnte mir weder Geld geben noch ihre Dienste anbieten. Was sie mir geben konnte, war Verständnis, und das ließ sie mir reichlich zukommen.
»Ich werde bald tot sein, nicht wahr?« fragte sie, nachdem sie sich meine Klagen lange angehört hatte und das Thema meiner Bedrängnis erschöpft war.
Mein Lehrer in Padua hatte immer vor solchen Fragen gewarnt: nicht zuletzt, weil man sich irren konnte. Er war der Meinung gewesen, kein Patient habe das Recht, dem Arzt solche Gewissensfragen zu stellen; hat man recht, und der Patient stirbt tatsächlich, macht ihn diese Aussicht während der letzten Lebenstage nur verdrießlich. Viel eher, als sich auf ihre bevorstehende Begegnung mit Gott vorzubereiten (ein Erlebnis, das man herbeisehnen, nicht bedauern sollte, würde man meinen), beklagen sich die meisten Leute bitterlich darüber, daß ihnen diese göttliche Gnade zuteil wird. Überdies neigen sie dazu, ihren Ärzten zu glauben. Wenn ich ehrlich sein will, muß ich gestehen, daß ich nicht weiß, warum das so ist; dennoch scheint es so zu sein, daß viele pflichtbewußt gehorchen, wenn ein Arzt ihnen sagt, sie müßten sterben – auch wenn ihnen gar nicht viel gefehlt hat.
»Wir alle sterben, wann es uns bestimmt ist, Madam«, sagte ich ernst, in der vergeblichen Hoffnung, daß sie sich damit zufriedengeben würde.
Sie war jedoch nicht der Mensch, der sich so einfach abspeisen ließ. »Aber manche früher als andere«, antwortete sie mit einem kleinen Lächeln. »Und ich bin bald an der Reihe, oder nicht?«
»Ich kann es wirklich nicht sagen. Kann sein, daß das Bein nicht brandig wird und Ihr Euch erholt. Doch um die Wahrheit zu sagen – ich fürchte, daß Ihr sehr schwach seid.« Ich konnte ihr nicht rundheraus sagen: »Ja, Ihr werdet sterben und das sehr bald.« Doch der Sinn war deutlich genug.
Sie nickte gelassen. »Das habe ich mir gedacht«, sagte sie. »Freudig ergebe ich mich dem Willen Gottes. Ich bin für meine Sarah eine Last.«
Come l'oro nel fuoco, cosi la fede nel dolor s'affina. (Wie das Gold im Feuer, so läutert sich der Glaube im Schmerz.) Mir war kaum danach, die Tochter zu verteidigen, doch ich murmelte, ich sei überzeugt, sie erfülle ihre Pflicht freudigen Herzens.
»Ja«, sagte sie. »Sie ist zu pflichtbewußt.« Sie war eine Frau mit einer Redegewandtheit, die weit über ihren Stand und ihre Bildung hinausging. Ich weiß, daß es nicht unmöglich ist, auch in primitiver Umgebung bei ebensolcher Erziehung ein sanftmütiges Wesen zu entwickeln, doch die Erfahrung lehrt uns, daß dies selten vorkommt. Ebenso wie vornehme Gedanken natürlich vornehme Verhältnisse voraussetzen, beeinflussen Brutalität und Schmutz die Seele auf gleiche Weise. Doch diese alte Frau, obwohl in der elendsten Umgebung, die man sich vorstellen kann, sprach mit einem Mitgefühl und Verständnis, die ich oft bei den vornehmsten Menschen vermißt habe. Daher weckte sie in mir ein ungewöhnliches Interesse für sie als Patientin. Ohne es überhaupt zu merken, sah ich in ihr plötzlich keinen hoffnungslosen Fall mehr. Vielleicht bin ich nicht fähig, sie so weit zu bringen, daß sie dem Tod entkommt, dachte ich grimmig, doch ich werde ihn zwingen, für seinen Gewinn hart zu arbeiten.
Dann kam das Mädchen mit dem kleinen Päckchen der Medikamente zurück, die ich bestellt hatte. Sie starrte mich an, als wollte sie mich herausfordern, sie zu kritisieren, und sagte, ich hätte ihr nicht genug Geld mitgegeben, aber Mr. Crosse, der Apotheker, habe ihr gestattet, zwei Pence schuldig zu bleiben, nachdem sie versprochen hatte, ich würde die Rechnung bezahlen. Darüber war ich sprachlos vor Entrüstung, denn sie schien mich zu tadeln, weil ich sie mit zuwenig Geld aus dem Haus geschickt hatte. Aber was konnte ich dagegen tun? Das Geld war ausgegeben, die Patientin wartete, und es war unter meiner Würde, mich auf einen Streit einzulassen.
Äußerlich unbewegt, nahm ich meinen tragbaren Stößel und Mörser und begann, die Ingredienzen zu verreiben; etwas Mastix, ein Gran Salmiak, zwei Gran Terpentin, einen Schluck weißes Vitriol und je zwei Gran Salpeter und Grünspan. Sobald ich all das zu einer glatten Paste zerstampft hatte, fügte ich, Tropfen für Tropfen, Leinöl hinzu, bis die Mixtur die richtige Konsistenz erreicht hatte.
»Wo ist das Wurmpulver?« fragte ich und suchte in dem Säckchen nach den letzten Ingredienzen. »Gab es keins?«
»Doch«, sagte sie. »Das glaube ich jedenfalls. Aber es hat keinen Sinn, wißt Ihr, deshalb habe ich es nicht gekauft. Ich habe Euch Geld erspart.«
Das war zuviel. Unverschämt behandelt zu werden, war eines, und man war es von Töchtern gewohnt, etwas ganz anderes war es jedoch, wenn die beruflichen Fähigkeiten in Frage gestellt und angezweifelt wurden.
»Ich habe Euch gesagt, daß ich es brauche. Es ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Seid Ihr Arzt, Mädchen? Wurdet Ihr an den besten medizinischen Fakultäten ausgebildet? Kommen Ärzte zu Euch, um Euch um Rat zu fragen?« übergoß ich sie mit Hohn und Spott.
»Ja, das tun sie«, erwiderte sie gelassen.
Ich schnaubte. »Was ist wohl schlimmer – wenn man es mit einer Närrin oder einer Lügnerin zu tun hat?« sagte ich ärgerlich. »Ich weiß es wirklich nicht.«
»Ich auch nicht. Ich weiß nur, daß ich weder das eine noch das andere bin. Wurmpulver auf eine offene Wunde zu tun hieße dafür sorgen, daß meine Mutter das Bein verliert und stirbt.«
»Ach, seid Ihr etwa Galen3? Paracelsus? Vielleicht Hippokrates selbst?« donnerte ich. »Wie dürft Ihr es wagen, die Autorität jener anzuzweifeln, die hoch über Euch stehen? Das ist eine Salbe, die seit Jahrhunderten verwendet wird.«
»Obwohl sie nichts nützt?«
Während dieser Auseinandersetzung hatte ich die Wunde ihrer Mutter mit Salbe bestrichen und frisch verbunden. Ich bezweifelte, daß sie wirken würde, da sie unvollständig war, doch sie mußte genügen, bis ich sie richtig anrühren konnte. Als ich fertig war, richtete ich mich zu voller Höhe auf und stieß mir natürlich den Kopf an der niedrigen Decke. Das Mädchen unterdrückte ein Kichern, was mich noch wütender machte.
»Laßt Euch von mir eines sagen«, erklärte ich mit kaum unterdrücktem Zorn, »ich habe Eure Mutter nach bestem Wissen und Gewissen behandelt, obwohl ich nicht dazu verpflichtet war. Ich komme später wieder, um ihr ein Schlafmittel zu verabreichen und frische Luft an die Wunde zu lassen. Das tue ich, obwohl ich dafür nichts anderes zu erwarten habe als Eure Verachtung, wenn ich auch nicht weiß, womit ich sie verdiene, und der Meinung bin, daß Ihr nicht das Recht habt, so mit mir zu sprechen.«
Sie knickste. »Ich danke Euch, freundlicher Sir. Und mit der Bezahlung sollt Ihr zufrieden sein. Ihr habt gesagt, das könnten wir später regeln, und ich bezweifle nicht, daß wir das tun werden.«
Damit verließ ich das Haus, trat auf die Straße und fragte mich kopfschüttelnd, auf welchen Wahnwitz ich mich so leichtsinnig eingelassen hatte.
Kapitel 3
Ich hoffe, daß dieser Bericht die ersten beiden Stadien meiner Reise erklärt: meine Ankunft in England und in Oxford und den Erwerb der Patientin, deren Behandlung mir später so viel Kummer bereiten sollte. Das Mädchen selbst – was kann ich sagen? Das Verhängnis hatte sie schon gestreift; ihr Ende stand fest, und der Teufel streckte die Klaue nach ihr aus, um sie hinabzuziehen. Ein Mann mit Erfahrung sieht das, kann in einem Gesicht lesen wie in einem offenen Buch und erkennt, was die Zukunft bereithält. Sarah Blundys Gesicht war bereits gezeichnet von dem Übel, das sich ihrer Seele bemächtigt hatte und sie bald zerstören würde. Das sagte ich mir hinterher, und es ist vielleicht wahr. Damals sah ich jedoch nur ein Mädchen, das ebenso unverschämt wie hübsch war, seine Pflichten gegen Höherstehende vernachlässigte und die gegen seine Familie gewissenhaft erfüllte.
Und nun muß ich den Fortgang meiner Reise schildern, der genauso zufällig, wenn auch viel grausamer in seiner Auswirkung war: um so mehr, als es eine Zeitlang schien, als beginne das Glück mir wieder zu lächeln. Ich hatte die Schulden in der Apotheke bezahlt, die Sarah Blundy mir unverschämterweise aufgebürdet hatte; ich wußte, daß man Apotheker auf eigene Gefahr verärgert, wenn man sie nicht bezahlt, denn dann verweigern sie in Zukunft vermutlich ihre Dienste, und nicht nur sie selbst, sondern alle ihre Kollegen meilenweit im Umkreis, so fest halten sie zusammen. Unter den gegebenen Umständen hätte dies das Faß zum Überlaufen gebracht. Und wenn es meinen letzten Penny galt, ich konnte es mir nicht erlauben, in die englische Gesellschaft der Wissenschaften als Mann mit schlechtem Ruf einzutreten.
Ich erfragte also den Weg zu Mr. Crosses Apotheke, ging noch einmal die halbe High Street entlang, öffnete die hölzerne Eingangstür und betrat den warmen Laden. Er war sehr hübsch, so schön angelegt wie alle englischen Geschäfte, mit Theken aus edlem Zedernholz und modernen Messingwaagen. Sogar der Duft von Kräutern und Gewürzen hieß mich willkommen, als ich zielbewußt den polierten Eichenfußboden überquerte, bis ich mit dem Rücken vor dem schönen gemeißelten Kaminsims und dem im Kamin lodernden Feuer stand.
Der Besitzer, ein beleibter Mann in den Fünfzigern, der aussah, als sei er mit dem Leben sehr zufrieden, bediente einen Kunden, der es nicht eilig zu haben schien und, lässig an der Theke lehnend, müßig schwatzte. Er war vielleicht ein, zwei Jahre älter als ich, mit einem lebhaften Gesicht und klugen, wenn auch zynischen Augen unter schweren, gewölbten Brauen. Seine Kleidung war einerseits puritanisch streng und düster, andererseits extravagant modisch. Sie war, anders ausgedrückt, gut geschnitten, aber langweilig braun.
Trotz seiner ungezwungenen Art schien dieser Kunde sehr befangen, und ich merkte, daß Mr. Crosse sich auf Kosten des Mannes amüsierte.
»Sie wird Euch auch im Winter warm halten«, sagte der Apotheker mit einem breiten Grinsen.
Der Kunde verzog das schmerzlich das Gesicht.
»Im Frühling werdet Ihr allerdings ein Netz darüberwerfen müssen, sonst nisten sich die Vögel darin ein«, fuhr Mr. Crosse fort und hielt sich die Seiten vor Vergnügen.
»Kommt schon, Crosse, das genügt«, protestierte der Mann und begann dann selbst zu lachen. »Zwölf Silbermünzen kostet sie ...«
Jetzt bekam Crosse einen richtigen Lachkrampf, und gleich darauf klappten beide, hilflos vor hysterischem Gelächter, zusammen. »Zwölf Silbermünzen!« keuchte der Apotheker, bevor er sich wieder vor Lachen kugelte.
Sogar ich begann belustigt zu kichern, obwohl ich nicht die leiseste Ahnung hatte, worüber die beiden sprachen. Ich wußte nicht einmal, ob es in England nicht als schlechtes Benehmen galt, sich in die Heiterkeit anderer einzumischen, doch das war mir egal. Die Wärme des Ladens und die unverhohlen gute Laune dieser beiden, die sich an die Theke klammerten, um zu vermeiden, daß sie in ihrer Hilflosigkeit zu Boden glitten, brachten mich dazu, mit ihnen lachen zu wollen, die erste menschliche Gesellschaft zu genießen, an der ich seit meiner Ankunft teilhatte. Sofort fühlte ich mich wohler, denn, wie Gomesius sagt, Fröhlichkeit kuriert viele Leidenschaften des Geistes und der Seele.
Mein leises Kichern erregte jedoch ihre Aufmerksamkeit, und Mr. Crosse bemühte sich, zu der würdigen Haltung zurückzufinden, die seinem Stand angemessen war. Sein Gefährte tat desgleichen, beide wandten sich mir zu und sahen mich an; ein paar Sekunden herrschte finsteres Schweigen, dann zeigte der jüngere Mann auf mich, und wieder verloren sie die Kontrolle über sich.
»Zwanzig Silbermünzen!« rief der junge Mann, winkte in meine Richtung und hieb dann mit der Faust auf die Theke. »Mindestens zwanzig.«
Mehr an Vorstellung hatte ich wohl nicht zu erwarten, wie ich vermutete, und verneigte mich mit einiger Vorsicht höflich vor ihnen. Ich erwartete so halb und halb einen gräßlichen Scherz auf meine Kosten. Die Engländer lieben es, Ausländer zu verhöhnen, denn sie halten allein unser Vorhandensein für einen ungeheuren Witz.
Meine Verneigung vor Gleichgestellten – perfekt ausgeführt, mit genau der richtigen Balance zwischen vorgestrecktem linkem Bein und graziös erhobenem rechtem Arm – löste trotzdem wieder eine Lachsalve aus, daher blieb ich mit der ausdruckslosen Miene eines Stoikers stehen und wartete darauf, daß der Sturm vorüberging. Nach einiger Zeit hörte das Glucksen auf, sie trockneten sich die Augen, schneuzten sich die Nasen und taten ihr Bestes, den Eindruck von zivilisierten Menschen zu machen.
»Ich muß Euch um Vergebung bitten, Sir«, sagte Mr. Crosse, der als erster der Sprache wieder mächtig und imstande war, sich ihrer höflich zu bedienen. »Aber mein Freund hier hat sich kürzlich entschlossen, mit der Mode zu gehen und liebt es, mit einem Strohdach auf dem Kopf in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Ich habe mein Bestes getan, ihm zu versichern, daß er sehr vornehm wirkt.« Er begann wieder vor Heiterkeit zu keuchen, und sein Freund riß sich die Perücke vom Kopf und warf sie auf den Boden.
»Endlich wieder frische Luft!« rief er dankbar, während er sich mit den Fingern durch sein dichtes, langes Haar fuhr. »Lieber Gott, das war vielleicht heiß darunter.«
Endlich begriff ich, worum es ging; die Perücke hatte Oxford erreicht – mehrere Jahre nachdem sie im größten Teil der Welt zu einem wesentlichen Teil männlicher Eleganz geworden war. Ich trug selbst eine, für mich ein Zeichen, daß ich mich, sozusagen, in der Welt der Erwachsenen etabliert hatte. Ich sah natürlich, warum sie so große Heiterkeit ausgelöst hatte, obwohl das Verständnis von dem Gefühl der Überlegenheit verdrängt wurde, das ein Mann von Welt empfindet, der provinziellem Denken begegnet. Als ich anfing, meine Perücke zu tragen, brauchte ich ziemlich lange, um mich daran zu gewöhnen; nur der Druck meiner Freunde bewog mich, damit fortzufahren. Und mit den Augen eines Türken oder Inders betrachtet, den es plötzlich zu uns verschlagen hatte, schien es schon ein wenig seltsam, daß ein Mann, von der Natur mit einem eigenen dichten Haarschopf ausgestattet, sich eine Menge davon wegrasieren mußte, um das Haar von jemand anders zu tragen. Aber modische Kleidung ist nicht für unsere Bequemlichkeit gedacht, und da eine Perücke schrecklich unbequem ist, kann man daraus schließen, daß sie sehr modisch war.
»Ich denke«, sagte ich, »daß sie sich angenehmer tragen ließe, wenn Ihr Euer eigenes Haar kürzen würdet, dann wäre nämlich der Druck unter der Matte nicht so groß.«
»Mein eigenes Haar abschneiden? Gütiger Himmel, tut man das wirklich?«
»Leider ja. Wir müssen der Schönheit Opfer bringen, nicht wahr?«
Er versetzte der Perücke einen derben Fußtritt. »Dann laßt mich häßlich sein«, sagte er, »denn damit will ich in der Öffentlichkeit nicht gesehen werden. Wenn das Ding schon bei Crosse Lachkrämpfe verursacht, kann man sich vorstellen, was die Studenten mit mir anstellen würden. Ich hätte Glück, mit dem Leben davonzukommen.«
»Sie sind aber überall sonst große Mode«, erklärte ich. »Sogar die Niederländer tragen sie. Ich denke, es ist eine Frage des richtigen Zeitpunkts. In ein paar Monaten oder vielleicht in einem Jahr werdet Ihr feststellen, daß sie Euch verspotten und mit Steinen nach Euch werfen, wenn Ihr keine tragt.«
»Pah! Lächerlich«, sagte er, hob die Perücke aber dennoch vom Boden auf und legte sie auf die Theke, wo sie sicherer aufgehoben war.
»Ich bin überzeugt, der Gentleman ist nicht hier, um mit uns über Mode zu sprechen«, sagte Crosse. »Vielleicht will er sogar etwas kaufen? Es ist schon vorgekommen.«
Ich verneigte mich. »Nein, ich bin gekommen, um etwas zu bezahlen. Ich glaube, Ihr habt vor kurzem einem jungen Mädchen Kredit gewährt.«
»Oh, das Blundy-Mädchen. Seid Ihr der Mann, den es erwähnt hat?«
Ich nickte. »Sie ist, wie es scheint, mit meinem Geld ein wenig großzügig umgegangen. Ich bin gekommen, um ihre – oder eigentlich meine – Schuld zu begleichen.«
Crosse schnaubte. »Ihr werdet nicht bezahlt werden, wißt Ihr, nicht mit Geld.«
»So scheint es. Doch dafür ist es jetzt zu spät. Nebenbei, ich habe das Bein ihrer Mutter behandelt, und es hat mich interessiert zu sehen, ob ich es überhaupt kann. Ich habe in Leiden sehr viel darüber gelernt, mich aber noch nie an einem lebenden Patienten versucht.«
»In Leiden?« sagte der junge Mann plötzlich aufhorchend. »Kennt Ihr Sylvius – Franciscus Sylvius, den niederländischen Arzt?«
»O ja«, sagte ich. »Ich habe bei ihm Anatomie studiert und habe von ihm ein Empfehlungsschreiben an einen Gentleman namens Mr. Boyle.«
»Warum habt Ihr das nicht gleich gesagt?« fragte er, ging zu der Tür im Hintergrund des Ladens und öffnete sie. Dahinter erblickte ich einen Korridor und eine Treppe.
»Boyle!« schrie er. »Seid Ihr oben?«
»Du brauchst nicht zu schreien, weißt du«, mischte Crosse sich ein. »Ich kann's dir sagen. Er ist nicht da. Ist ins Kaffeehaus gegangen.«
»Oh. Nicht schlimm. Wir gehen zu ihm. Wie heißt Ihr übrigens?«
Ich stellte mich vor. Er verneigte sich ebenfalls und sagte: »Richard Lower, zu Euren Diensten. Arzt. Beinahe.«
Wir verneigten uns noch einmal, und dann schlug er mir auf die Schulter. »Kommt. Boyle wird sich freuen, Euch kennenzulernen. Wir haben uns in letzter Zeit hier oben ein wenig abgeschnitten gefühlt.«
Als wir den kurzen Weg zu Tillyard zurückgingen, erklärte er mir, daß das Ferment intellektuellen Lebens der Stadt nicht mehr so sprudelte wie früher, was an der Rückkehr des Königs lag.
»Aber wie ich gehört habe, liebt es Seine Majestät zu lernen«, sagte ich.
»Das ist richtig, wenn er sich einmal von seinen Mätressen losreißen kann. Das ist der Jammer. Unter Cromwell konnten wir uns hier unseren Lebensunterhalt notdürftig verdienen, während alle lukrativen Ämter im Staat an Metzger und Fischverkäufer gingen. Jetzt ist der König wieder da, und selbstverständlich sind alle, die die Möglichkeit hatten, seine Großzügigkeit auszunutzen, nach London gegangen, und nur der Rest von uns ist noch hier. Ich fürchte, früher oder später werde ich auch versuchen müssen, mir dort einen Namen zu machen.«
»Deshalb die Perücke?«
Er schnitt eine Grimasse. »Ja, wahrscheinlich. Man muß schon irgendwie Aufsehen erregen, um überhaupt bemerkt zu werden. Wren war vor ein paar Wochen hier – ein Freund von mir, feiner Kerl –, herausgeputzt wie ein Pfau. Er plant demnächst eine Reise nach Frankreich, und ich vermute, wenn er zurückkommt, werden wir unsere Augen mit der Hand abschirmen müssen, um ihn anzusehen.«
»Und Mr. Boyle?« fragte ich, und das Herz wurde mir ein wenig schwer. »Er hat – hat er sich entschlossen, in Oxford zu bleiben?«
»Ja, vorläufig. Aber er ist ein Glückspilz. Er hat so viel Geld, daß er nicht wie wir anderen um eine Stellung buhlen muß.«
»Oh«, sagte ich sehr erleichtert.
Lower warf mir einen Blick zu, der mir verriet, daß er genau wußte, was mir durch den Kopf gegangen war. »Sein Vater war einer der reichsten Männer im Königreich und ein leidenschaftlicher Anhänger des alten Königs seligen Angedenkens, was wir auch sein sollten, wie ich vermute. Natürlich hat er eine Menge verloren, aber für Boyle ist noch so viel übrig, daß er die Sorgen gewöhnlicher Sterblicher nicht hat.«
»Ah.«
»Ein sehr angenehmer Mann, wenn man geneigt ist, sich mit den Naturwissenschaften zu beschäftigen, die sein Hauptinteresse sind. Ist das nicht der Fall, wird er Euch selbstverständlich kaum beachten.«





























