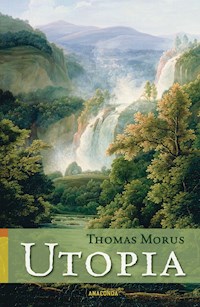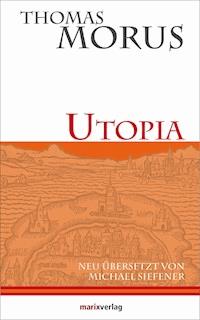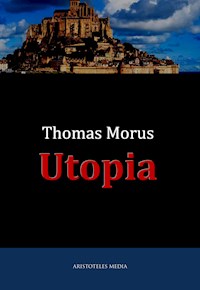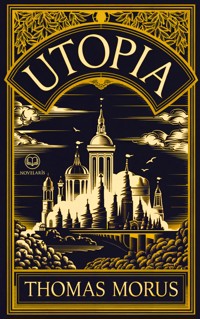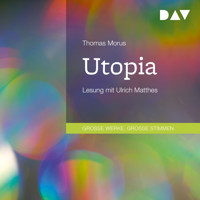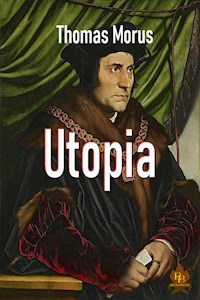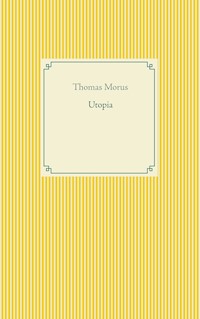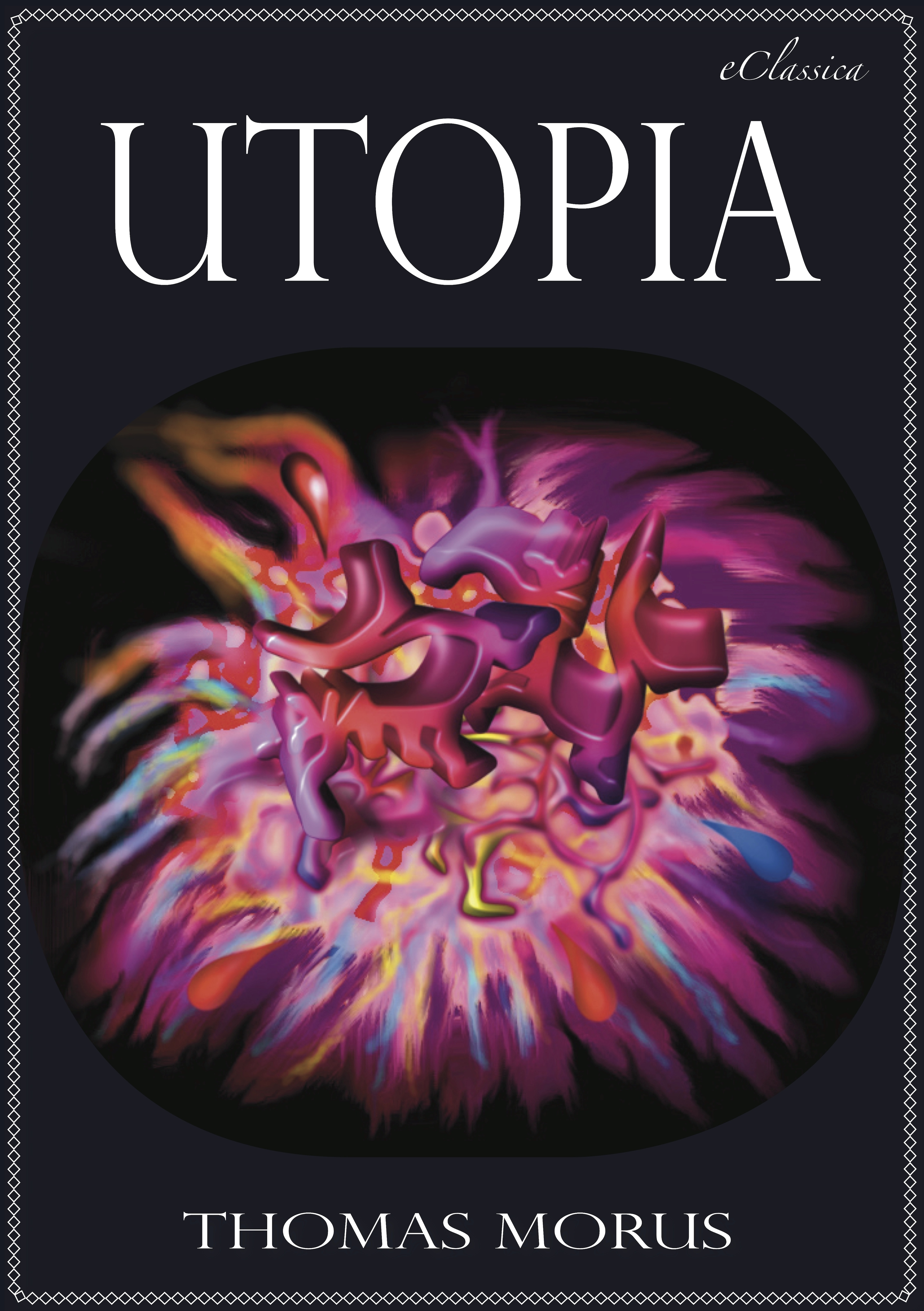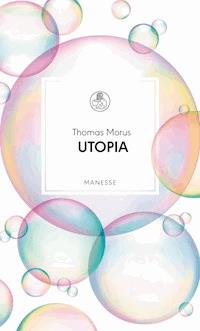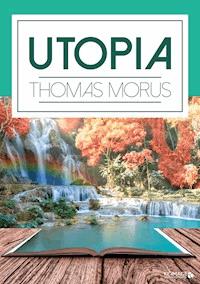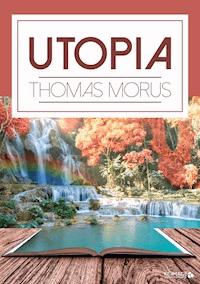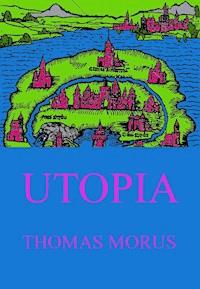0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Der Philosoph und Staatsmann Thomas Morus (1478 - 1535) schildert in seinem bekanntesten Werk, das gleichzeitig auch das wohl wichtigste historische Traktat des zu Ende gehenden Mittelalters ist, eine in weiter Zukunft liegende ideale Gesellschaft. Mit seinem bekanntesten Werk schafft Morus die Grundlage der Sozialutopien. Die Erstveröffentlichung von "Utopia" geschieht auf Betreiben des ebenfalls berühmten Humanisten und persönlichen Freundes Erasmus von Rotterdam Anfang des 16. Jahrhunderts. Morus übt - was zur damaligen Zeit kein geringer Affront ist - Kritik an den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen Europas, insbesondere Englands. Gekleidet ist das aufgezeichnete Gedankenspiel Morus' in den Bericht eines Seemanns, der bei den Utopiern, wie die Einwohner dieses Idealstaates genannt werden, gelebt haben soll. Aufgezeigt werden politische Entscheidungsprozesse, Jurisprudenz, Religionsfreiheit, aber auch soziale Verhaltensregeln und Wirtschaftsfragen. "Auch die, die vom Christentum nichts wissen wollen, machen trotzdem niemanden abspenstig und lassen jeden, der dazu übertritt, unbehelligt." [Abschnitt "Die Religion der Utopier"] Das Buch ist so prägend, dass es gleichsam die Gattung der Utopien begründet. Bedeutende Nachfolger sind "A Modern Utopia" von H. G. Wells, "Ecotopia" von Ernest Callenbach und "Island" von Aldous Huxley. Morus wird nach Intrigen am englischen Königshof eingekerkert, sein Vermögen eingezogen und am 6. Juli 1535 enthauptet - eine vorangehende Folter hat ihm der König Heinrich VIII. erlassen. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Thomas Morus
Utopia
Thomas Morus
Utopia
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954183-19-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Originaltitel
Vorrede zu dem Werke über den besten Zustand des Staates
Thomas Morus grüßt seinen Peter Ägid aufs herzlichste.
Erstes Buch
Rede des trefflichen Raphael Hythlodeus über den besten Zustand des Staates, veröffentlicht von dem erlauchten Thomas Morus, Bürger und Vicecomes der rühmlich bekannten britischen Hauptstadt London.
Zweites Buch
Des Raphael Hythlodeus Rede über den besten Zustand des Staates
Die Städte, namentlich Amaurotum
Die Obrigkeiten
Die Handwerke
Der Verkehr der Utopier miteinander
Die Reisen der Utopier
Die Sklaven
Das Kriegswesen
Die Religion der Utopier
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Das Buch
Der Philosoph und Staatsmann Thomas Morus (1478 - 1535) schildert in seinem bekanntesten Werk, das gleichzeitig auch das wohl wichtigste historische Traktat des zu Ende gehenden Mittelalters ist, eine in weiter Zukunft liegende ideale Gesellschaft.
Morus ist ein humanistischer Autor. Er ist ein Heiliger und Märtyrer der römisch-katholischen Kirche. Mit seinem bekanntesten Werk schafft er die Grundlage der Sozialutopien.
Die Erstveröffentlichung von »Utopia« geschieht auf Betreiben des ebenfalls berühmten Humanisten und persönlichen Freundes Erasmus von Rotterdam Anfang des 16. Jahrhunderts. Die erste deutsche Übersetzung erscheint 1524. Morus übt -- was zur damaligen Zeit kein geringer Affront ist - Kritik an den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen Europas, insbesondere Englands.
Gekleidet ist das aufgezeichnete Gedankenspiel Morus’ in den Bericht eines Seemanns, der bei den Utopiern, wie die Einwohner dieses Idealstaates genannt werden, gelebt haben soll. Aufgezeigt werden politische Entscheidungsprozesse, Jurisprudenz, Religionsfreiheit, aber auch soziale Verhaltensregeln und Wirtschaftsfragen.
Die Utopier bilden eine auf Gleichheit und Rechtstaatlichkeit basierende Gesellschaft, die nach Bildung und Demokratie strebt. Jeglicher Besitz ist bei ihnen gemeinschaftlich, Anwälte sind unbekannt und Kriege werden mit ausländischen Söldnern geführt.
»Auch die, die vom Christentum nichts wissen wollen, machen trotzdem niemanden abspenstig und lassen jeden, der dazu übertritt, unbehelligt.« [Abschnitt »Die Religion der Utopier«]
Das Buch ist so prägend, dass es gleichsam die Gattung der Utopien begründet. Bedeutende Nachfolger sind »A Modern Utopia« von H. G. Wells, »Ecotopia« von Ernest Callenbach und »Island« von Aldous Huxley.
Morus wird nach Intrigen am englischen Königshof eingekerkert, sein Vermögen eingezogen und am 6. Juli 1535 enthauptet -- eine vorangehende Folter hat ihm der König Heinrich VIII. erlassen.
*
Informationen über Gratisangebote und Neuveröffentlichungen unter:
www.null-papier.de/newsletter
Originaltitel
LIBELLUS VERE AUREUS NEC minus salutaris quam festivus de optimo reip. statu, deque nova Insula Utopia autore clarissimo viro Thoma Moro inclutae civitatis Londinensis cive & vicecomite cura M. Petri Aegidii Antverpiensis, & arte Theodorici Martini Alustensis, Typographi almae Lovaniensium Academiae nunc primum accuratissime editus.
Cum gratia & privilegio.
*
Titel der Erstausgabe aus dem Jahre 1516
Vorrede zu dem Werke über den besten Zustand des Staates
Thomas Morus grüßt seinen Peter Ägid aufs herzlichste.
Fast schäme ich mich, mein liebster Peter Ägid, daß ich Dir dies Büchlein über den Staat von Utopien erst nach beinahe einem Jahre schicke. Hast Du es doch ohne Zweifel innerhalb von anderthalb Monaten erwartet, da mir ja, wie Du wußtest, bei diesem Werke die Mühe der Erfindung des Stoffes abgenommen war und ich mir auch in betreff der Gliederung nichts auszudenken brauchte. Denn ich hatte nur das wiederzugeben, was ich mit Dir zusammen Raphael gerade so hatte erzählen hören. Deshalb lag auch kein Anlaß vor, mich hinsichtlich des Stiles abzumühen. Raphael konnte sich ja gar nicht gesucht ausdrücken; denn erstens sprach er, ohne daß er es vorher wußte und sich vorbereiten konnte, sodann ist er, wie Du weißt, im Lateinischen nicht so zu Hause wie im Griechischen, und schließlich kommt meine Rede der Wahrheit um so näher, je mehr sie sich seiner nachlässigen und schlichten Ausdrucksweise nähert, und um die Wahrheit allein muß und will ich mich bei dieser Sache kümmern.
Ich gebe denn auch zu, mein Peter, das, was ich vorfand, hatte mir so viel Arbeit abgenommen, daß fast nichts mehr zu tun übrigblieb. Andernfalls hätte ja auch Erfindung oder Gliederung des Stoffes nicht wenig Zeit und Studium eines nicht unbedeutenden und recht gelehrten Geistes erfordert. Würde man nun nicht bloß eine der Wahrheit entsprechende, sondern auch geschmackvolle Darstellung verlangen, so hätte ich das nicht leisten können, auch wenn ich all meine Zeit und all meinen Eifer aufgewendet hätte. So aber, da diese Schwierigkeiten wegfielen, die zu bewältigen viel Schweiß gekostet hätte, blieb einzig und allein die einfache Aufzeichnung dessen übrig, was ich gehört hatte, und das war wirklich keine Arbeit mehr. Aber selbst zur Erledigung dieser so unbedeutenden Arbeit ließen mir meine übrigen Geschäfte fast noch weniger als keine Zeit. Nehmen mich doch dauernd meine Gerichtssachen in Anspruch. Bald führe ich einen Prozeß, bald bin ich Beisitzer, bald schlichte ich einen Handel als Schiedsrichter, bald entscheide ich einen anderen als Richter, bald besuche ich diesen in einer amtlichen, bald jenen in einer geschäftlichen Angelegenheit. Während ich so fast den ganzen Tag außerhalb meines Hauses fremden Leuten und nur den Rest meinen Angehörigen widme, kann ich für mich, d. h. für meine Studien, nichts erübrigen. Denn komme ich nach Hause, so muß ich mit meiner Frau plaudern, mit den Kindern schwatzen und mit dem Gesinde sprechen. Alles das rechne ich zu meinen Pflichten, weil es erledigt werden muß. Es muß aber erledigt werden, wenn man nicht in seinem eigenen Hause ein Fremdling sein will. Man muß sich überhaupt Mühe geben, so liebenswürdig wie möglich zu denen zu sein, die einem die Natur als Begleiter auf dem Lebenswege vorgesehen oder die der Zufall oder eigene Wahl dazu gemacht hat. Nur darf man sie nicht durch Leutseligkeit verderben und die Diener nicht durch Nachsicht zu seinen Herren werden lassen. Über dem, was ich angeführt habe, geht ein Tag, geht ein Monat, geht ein Jahr hin. Wann also komme ich da zum Schreiben? Und dabei habe ich noch gar nicht vom Schlafen gesprochen und auch noch nicht einmal vom Essen, das bei vielen Leuten nicht weniger Zeit in Anspruch nimmt als der Schlaf, der fast die Hälfte der Lebenszeit für sich beansprucht. Aber für mich gewinne ich nur so viel Zeit, wie ich mir vom Schlafen und Essen abstehle. Weil das nur wenig ist, so habe ich die Utopia auch nur langsam fertiggebracht; weil es aber immerhin etwas ist, so ist sie doch nun endlich fertig geworden, und ich schicke sie Dir zu, damit Du sie liest und mich darauf aufmerksam machst, falls mir etwas entgangen sein sollte. Nun habe ich freilich in dieser Beziehung ziemlich viel Zutrauen zu mir -- ich wollte, mit meinem Geiste und mit meinem Wissen stünde es ebenso wie mit meinem Gedächtnis, das mich nur manchmal im Stiche läßt --, doch ist mein Zutrauen nicht so groß, daß ich annehmen dürfte, mir könnte nichts entfallen sein. Denn auch mein Famulus, Johannes Clemens, hat mich sehr bedenklich gestimmt. Wie Du ja wohl weißt, war er damals dabei, und ich lasse ihn an jeder Unterhaltung teilnehmen, aus der er etwas lernen kann; denn von diesem Schößling, der im Lateinischen wie im Griechischen zu grünen begonnen hat, erhoffe ich dereinst einen guten Ertrag. Soviel ich mich nämlich erinnere, hat Hythlodeus erzählt, jene Brücke von Amaurotum über den Fluß Anydrus sei 500 Doppelschritte lang. Mein Johannes aber meinte, man müsse 200 abziehen; der Fluß sei dort nicht breiter als 300 Doppelschritte. Besinne Dich doch bitte noch einmal darauf! Wenn Du nämlich der gleichen Meinung bist wie Johannes, so will auch ich zustimmen und einen Irrtum meinerseits annehmen. Solltest Du aber selbst Dich nicht mehr besinnen können, so bleibt stehen, worauf ich mich selbst zu besinnen glaube. Wenn ich mich nämlich auch vor jeder falschen Angabe in dem Buche streng hüten will, so ziehe ich doch in Zweifelsfällen die Unwahrheit der Lüge vor, weil ich Tugend höher schätze als Klugheit. Freilich wäre dieser Schaden leicht zu heilen, wenn Du Raphael selbst mündlich oder schriftlich fragen wolltest. Das mußt Du sowieso tun wegen eines anderen Bedenkens, das uns gekommen ist, ich weiß nicht, ob mehr durch meine oder Deine oder Raphaels eigene Schuld. Denn weder ist es uns in den Sinn gekommen, danach zu fragen, noch ihm, es uns zu sagen, in welcher Gegend jenes neuen Erdteils Utopia liegt. Wahrhaftig, wie gern würde ich mit etwas Geld von mir diese Unterlassung ungeschehen machen! Denn erstens schäme ich mich ein wenig, nicht zu wissen, in welchem Meere die Insel liegt, von der ich so viel zu berichten weiß; sodann aber gibt es bei uns den einen und den anderen, vor allem aber einen frommen Theologen von Beruf, der darauf brennt, Utopia zu besuchen, nicht aus eitlem und neugierigem Verlangen, Neues zu sehen, sondern um die verheißungsvollen Keime unserer Religion dort zu pflegen und noch zu vermehren. Um dabei ordnungsgemäß zu verfahren, hat er beschlossen, sich vorher einen Missionsauftrag vom Papste zu verschaffen und sich von den Utopiern sogar zum Bischof wählen zu lassen. Dabei stört es ihn durchaus nicht, daß er sich um dieses Vorsteheramt erst bewerben müßte. Allerdings ist sein Ehrgeiz, wie er meint, deshalb gottgefällig, weil er nicht durch Rücksicht auf Ehre oder Gewinn, sondern durch Rücksicht auf die Religion bedingt ist.
Deshalb wende Dich, mein Peter, ich bitte Dich darum, entweder mündlich, wenn es Dir ohne Umstände möglich ist, oder brieflich an Hythlodeus und sorge dafür, daß in diesem meinen Werke nichts Falsches steht oder nichts Wahres vermißt wird. Und vielleicht ist es besser, ihm das Buch selbst zu zeigen. Einerseits nämlich ist niemand anders ebenso imstande, einen etwaigen Irrtum zu berichtigen, anderseits kann er das selbst auch nur, wenn er durchliest, was ich geschrieben habe. Außerdem wirst Du auf diese Weise merken, ob er damit einverstanden ist, daß ich dieses Buch schreibe, oder ob er ärgerlich darüber ist. Falls er sich nämlich vorgenommen hat, seine Abenteuer selbst aufzuzeichnen, so möchte er vielleicht nicht -- und ich bestimmt auch nicht --, daß ich ihm Duft und Reiz seiner Erzählung im voraus wegnehme, indem ich den Staat Utopia allgemein bekanntwerden lasse. Allerdings bin ich, wenn ich ganz offen sein soll, auch mir selber noch nicht recht im klaren, ob ich das Buch überhaupt erscheinen lasse. Denn der Geschmack der Menschen ist so verschieden, und manche sind so eigensinnig, so undankbar und so unsinnig in ihrem Urteil, daß offenbar die Leute viel glücklicher sind, die in Freude und Frohsinn ihr eigenes Ich befriedigen, als diejenigen, die sich zermürben in dem Bestreben, etwas zu veröffentlichen, was für andere, die wählerisch oder undankbar sind, ein Nutzen oder ein Vergnügen sein könnte. Die meisten haben keinen Sinn für literarische Dinge; viele verachten sie; ein Barbar lehnt alles als schwer ab, was nicht gänzlich barbarisch ist; gelehrte Pedanten verschmähen alles als abgegriffen, was nicht von veralteten Ausdrücken strotzt; manchen gefällt nur das Alte, den meisten nur das eigene Wissen. Dieser ist so mürrisch, daß er von Scherzen nichts wissen will, dieser wieder so fade, daß er keine Witze verträgt; manche sind so plattnasig, daß sie jedes Naserümpfen scheuen wie ein von einem tollen Hund Gebissener das Wasser, andere wieder sind so wetterwendisch, daß sie im Sitzen etwas anderes gelten lassen als im Stehen. Manche sitzen in den Kneipen, urteilen am Biertisch über die Talente der Schriftsteller und verurteilen sie mit großem Nachdruck, ganz wie es ihnen beliebt, indem sie einen jeden in seinen Schriften gleichsam beim Schopfe nehmen und ihn zausen, wobei sie selbst aber vor der Hand in Sicherheit und, wie man so sagt, weit vom Schuß sind. Denn rundum sind sie so glatt und kahlgeschoren, daß sie auch nicht ein Härchen eines guten Mannes an sich haben, an dem man sie fassen könnte. Ferner gibt es Leute, die so undankbar sind, daß sie sich zwar ausgiebig an einem Werke ergötzen, dem Verfasser aber trotzdem keine größere Liebe entgegenbringen. Sie ähneln den unhöflichen Gästen, die sich mit einem üppigen Mahle bewirten lassen und dann gesättigt heimgehen, ohne dem, der sie eingeladen hat, ein Wort des Dankes zu sagen. Nun geh hin und richte für Leute mit so verwöhntem Gaumen, von so verschiedenem Geschmack und noch dazu von so dankbarer und lieber Gesinnung auf Deine eigenen Kosten ein Mahl her!
Aber gleichwohl, mein Peter, besprich, was ich Dir gesagt habe, mit Hythlodeus! Später aber kann man sich ja diese Frage der Veröffentlichung noch einmal überlegen. Sollte er indessen nichts dagegen haben, so will ich bei dem, was die Herausgabe noch erfordert, dem Rate meiner Freunde folgen und vor allem Deinem, da ich nun einmal die Mühe des Schreibens hinter mir habe und jetzt erst verspätet zur Einsicht komme. Lebe wohl, mein liebster Peter Ägid, nebst Deiner guten Frau und behalte mich auch weiterhin lieb, da ja auch ich Dich noch lieber habe, als es sonst meine Gewohnheit ist!
Erstes Buch
Rede des trefflichen Raphael Hythlodeus über den besten Zustand des Staates, veröffentlicht von dem erlauchten Thomas Morus, Bürger und Vicecomes der rühmlich bekannten britischen Hauptstadt London.
Kürzlich hatte der siegreiche König von England Heinrich, der achte dieses Namens, ein mit allen Tugenden eines hervorragenden Fürsten gezierter Herrscher, einige nicht belanglose Meinungsverschiedenheiten mit Karl, dem erhabenen König von Kastilien. Zu den Verhandlungen darüber und zur Beilegung dieser Streitigkeiten schickte mich König Heinrich als Abgesandten nach Flandern, und zwar zusammen mit dem unvergleichlichen Cuthbert Tunstall, den der König erst kürzlich unter überaus starkem und allgemeinem Beifall mit dem Amte des Archivars betraut hat. Über seine Vorzüge will ich nichts sagen, nicht als ob ich fürchtete, infolge unserer Freundschaft könnte mein Urteil zu wenig den Tatsachen entsprechen, sondern weil seine Tüchtigkeit und Gelehrsamkeit größer ist, als ich sie rühmen könnte, und außerdem überall bekannter und berühmter, als daß sie noch gerühmt zu werden brauchte, ich müßte denn, wie man sagt, die Sonne mit der Laterne zeigen wollen. In Brügge trafen wir -- so war es verabredet -- die Beauftragten des Königs Karl, alles treffliche Männer. Unter ihnen befand sich der Präfekt von Brügge, ein hochangesehener Mann, der Führer und das Haupt der Abordnung; ihr Sprecher und ihre Seele jedoch war Georg Temsicius, der Propst von Cassel, ein Redner von einer nicht nur erworbenen, sondern auch angeborenen Beredsamkeit, außerdem ein überaus erfahrener Jurist und im Verhandeln ein vortrefflicher Meister durch seine Begabung und beständige Praxis. Ein und das andere Mal kamen wir zusammen, ohne in gewissen Fragen eine rechte Einigung zu erzielen. Da verabschiedeten sich die anderen für einige Tage von uns und reisten nach Brüssel, um sich bei ihrem Fürsten Bescheid zu holen. Inzwischen begab ich mich -- die Geschäfte brachten es so mit sich -- nach Antwerpen. Während meines Aufenthaltes dort kam häufig außer anderen, aber immer als liebster Besucher, Peter Ägid aus Antwerpen zu mir. Er genießt großes Vertrauen bei seinen Landsleuten und nimmt eine angesehene Stellung ein, verdient aber die angesehenste. Man weiß nämlich nicht, wodurch sich der junge Mann mehr auszeichnet, ob durch seine Bildung oder seinen Charakter; ist er doch ein sehr guter Mensch und zugleich ein großer Gelehrter, außerdem ein Mann von lauterer Gesinnung gegen alle, seinen Freunden gegenüber aber von solcher Herzlichkeit, Liebe, Treue und aufrichtigen Neigung, daß man kaum einen oder den anderen irgendwo findet, den man als einen ihm in jeder Beziehung gleichwertigen Freund bezeichnen möchte. Er besitzt eine seltene Bescheidenheit; niemandem liegt Verstellung so fern wie ihm; niemand ist schlichter und zugleich klüger. Ferner kann er sich so gefällig und harmlos-witzig unterhalten, daß der so angenehme Umgang und die so liebe Plauderei mit ihm zu einem großen Teile mich die Sehnsucht nach der Heimat und dem heimischen Herd, nach meiner Frau und meinen Kindern leichter ertragen ließ; denn schon damals war ich über vier Monate von daheim fort, und in überaus beängstigender Weise quälte mich das Verlangen, sie wiederzusehen.
Eines Tages hatte ich in der wunderschönen und vielbesuchten Liebfrauenkirche am Gottesdienst teilgenommen und schickte mich an, nach Beendigung der Feier von dort in meine Herberge zurückzukehren, da sehe ich Peter zufällig sich mit einem Fremden unterhalten, einem älteren Manne mit sonnverbranntem Gesicht und langem Bart. Der Mantel hing ihm nachlässig von der Schulter herab, und seinem Aussehen und seiner Kleidung nach war er ein Seemann. Sobald mich Peter erblickte, kam er auf mich zu und grüßte. Als ich antworten wollte, nahm er mich ein wenig beiseite und fragte: »Siehst du den da?« Dabei zeigte er auf den, mit dem ich ihn hatte sprechen sehen. »Den wollte ich gerade jetzt zu dir bringen.« -- »Er wäre mir sehr willkommen gewesen«, antwortete ich, »und zwar deinetwegen.« -- »Nein«, sagte er, »vielmehr seinetwegen, wenn du den Mann nur schon kenntest. Denn niemand in der ganzen Welt kann dir heutzutage so viel von unbekannten Menschen und Ländern erzählen, und, wie ich weiß, bist du ja ganz versessen darauf, so etwas zu hören.« -- »Also war meine Vermutung«, sagte ich, »gar nicht so falsch. Denn gleich auf den ersten Blick habe ich ihn als Seemann erkannt.« -- »Und doch hast du dich stark geirrt; er fährt wenigstens nicht als Palinurus, sondern als Odysseus oder vielmehr als Plato. Denn dieser Raphael -- so heißt er nämlich, und sein Familienname ist Hythlodeus -- ist nicht wenig bewandert im Lateinischen und sehr bewandert im Griechischen, und zwar hat er die griechische Sprache deshalb mehr getrieben als die der Römer, weil er sich ganz der Philosophie gewidmet und erkannt hatte, daß auf dem Gebiete der Philosophie im Lateinischen nichts von irgendwelcher Bedeutung vorhanden ist außer einigem von Seneca und Cicero. Dann überließ er sein vom Vater ererbtes Gut, in dem er wohnte, seinen Brüdern, schloß sich -- er ist nämlich Portugiese -- dem Amerigo Vespucci an, um sich die Welt anzusehen, und war dessen ständiger Begleiter auf den drei letzten seiner vier Seereisen, die man schon hier und da gedruckt lesen kann. Von der letzten jedoch kehrte er nicht mit ihm zurück. Er bemühte sich vielmehr darum und erpreßte von Amerigo die Erlaubnis, zu jenen vierundzwanzig zu gehören, die am Ende der letzten Seereise in einem Kastell zurückgelassen wurden. So blieb er denn dort zurück, entsprechend seiner Sinnesart, die mehr nach einem Aufenthalte in fremdem Lande als nach einem Grabmale verlangt. Führt er doch dauernd solche Sprüche im Munde wie ›Unter dem Himmelsgewölbe ruht, wer keine Urne hat‹ und ›Zum Himmel ist es von überall her gleich weit‹. Dieser Wagemut wäre ihm ohne Gottes gnädigen Beistand nur allzu teuer zu stehen gekommen. Nach Vespuccis Abreise durchstreifte er dann zusammen mit fünf Kameraden aus dem Kastell zahlreiche Länder und gelangte schließlich durch einen wunderbaren Zufall nach Taprobane und von dort nach Caliquit. Hier hatte er das Glück, portugiesische Schiffe anzutreffen, auf denen er schließlich wider Erwarten heimkehrte.«
Als Peter mit seiner Erzählung fertig war, dankte ich ihm für seine Gefälligkeit und seine Bemühungen, mir die Unterhaltung mit einem Manne zu ermöglichen, die mir seiner Meinung nach willkommen war, und wandte mich Raphael zu. Wir begrüßten einander, wechselten jene bei der ersten Begegnung mit Fremden allgemein üblichen Redensarten und gingen dann in meine Wohnung. Hier setzten wir uns im Garten auf eine Rasenbank und fingen an, miteinander zu plaudern.
Da erzählte uns denn Raphael, wie er es zusammen mit seinen im Kastell zurückgebliebenen Kameraden nach Vespuccis Abreise angestellt habe, durch Freundlichkeiten und Schmeicheleien allmählich die Zuneigung der Eingeborenen zu gewinnen, nicht nur ohne Gefahr, sondern auch in Freundschaft unter ihnen zu leben und damit auch noch die Gunst und Wertschätzung eines Fürsten -- sein und seines Landes Name sei ihm entfallen -- zu erlangen. In seiner Freigebigkeit -- so erzählte er weiter -- versah dieser ihn und fünf seiner Kameraden reichlich mit Lebensmitteln und Geld für eine Expedition, die sie dann zu Wasser mit Fahrzeugen und zu Lande mit Wagen unternahmen und auf der sie ein höchst zuverlässiger Führer zu anderen Fürsten geleitete, an die sie warme Empfehlungsschreiben mithatten. Dann gelangten sie nach einer Reise von vielen Tagen zu festen Plätzen, Städten und gar nicht schlecht eingerichteten volkreichen Staaten. Zwar liegen unter dem Äquator, wie Raphael erzählte, und von da aus auf beiden Seiten etwa bis zur Grenze der Sonnenbahn wüste und der dörrenden Sonnenglut dauernd ausgesetzte Einöden: Unwirtlichkeit ringsum und ein trostloser Anblick, abschreckend alles und unkultiviert, Schlupfwinkel von wilden Tieren und Schlangen oder schließlich auch von Menschen, die Bestien weder an Wildheit noch an Gefährlichkeit nachstehen. Fährt man aber weiter, so wird alles allmählich milder: das Klima weniger rauh, die Erde von einladendem Grün schimmernd, zahmer die Natur der Lebewesen. Endlich bekommt man Menschen, Städte und feste Plätze zu Gesicht, und unter ihnen herrscht ein ununterbrochener Handelsverkehr, nicht nur untereinander und mit den Nachbarn, sondern auch mit fernen Völkern, und zwar zu Wasser und zu Lande.
Dadurch bot sich für Raphael die Gelegenheit, viele Länder diesseits und jenseits des Meeres zu besuchen; denn jedes Schiff, das ausgerüstet wurde, nahm ihn und seine Begleiter sehr gern mit. Wie er erzählte, hatten die Schiffe, die sie in den ersten Ländern zu sehen bekamen, flache Kiele und Segel aus zusammengenähten Papyrusblättern oder aus Weidengeflecht, anderswo auch aus Häuten. Auf der Weiterfahrt begegneten sie Schiffen mit spitzgeschnäbelten Kielen und Segeln aus Hanf; am Ende war alles so wie bei uns. Die Seeleute waren nicht unerfahren in Meeres- und Himmelskunde. Aber einen außerordentlichen Dank erntete Raphael dafür, daß er sie im Gebrauch des Kompasses unterwies, den sie bis dahin überhaupt noch nicht kannten. Deshalb hatten sie sich auch nur zaghaft ans Meer gewöhnt und vertrauten sich ihm nicht ohne Grund nur im Sommer an. Jetzt aber achten die Seeleute im Vertrauen auf den Magnetstein die Gefahren des Winters gering, allerdings mehr sorglos als gefahrlos. Daher besteht die Gefahr, diese Erfindung, die ihnen, wie man glaubte, großen Vorteil bringen werde, könne infolge ihrer Unvorsichtigkeit große Schäden verursachen.
Was Raphael an den einzelnen Orten, wie er erzählte, gesehen hat, das alles hier mitzuteilen, würde zu weit führen und ist auch nicht der Zweck dieses Buches. Vielleicht werde ich es einmal an anderer Stelle erzählen, besonders alles das, dessen Kenntnis von Nutzen ist, wie z. B. in erster Linie die richtigen und klugen politischen Maßnahmen, die er bei gesitteten Völkern wahrgenommen hat. In betreff dieser Dinge befragten wir ihn nämlich am meisten, und über sie sprach er auch am liebsten, während wir es vorläufig unterließen, uns nach Ungeheuern zu erkundigen, dem Langweiligsten, das es gibt. Denn Scyllen und räuberische Celänonen, menschenfressende Lästrygonen und dergleichen abscheuliche Ungeheuer sind fast überall zu finden, aber Bürger, die in einem vernünftig und weise geleiteten Staate leben, wohl nirgends. Wenn er nun aber auch bei jenen unbekannten Völkern viele verkehrte Einrichtungen wahrgenommen hat, so hat er doch auch nicht weniges aufgezählt, was als Beispiel dienen kann, die Fehler unserer Städte, Nationen, Völker und Herrschaften zu verbessern, und worüber ich, wie gesagt, an anderer Stelle einmal sprechen muß. Jetzt will ich nur seinen Bericht über Sitten und Einrichtungen der Utopier wiedergeben, wobei ich jedoch das Gespräch vorausschicke, in dessen Verlauf ihn eine Wendung dazu veranlaßte, diesen Staat zu erwähnen.
Mit großer Klugheit hatte Raphael aufgezählt, was hier und dort falsch war -- sicherlich war es sehr viel auf beiden Seiten des Ozeans --, dann aber auch, welche Maßnahmen bei uns und ebenso bei jenen anderen verständiger sind. Er hatte nämlich Sitten und Einrichtungen eines jeden Volkes so fest im Gedächtnis, als hätte er an jedem von ihm besuchten Orte sein ganzes Leben zugebracht. Da staunte Peter und meinte: »Ich muß mich in der Tat wundern, mein Raphael, daß du nicht in die Dienste eines Königs trittst; denn das weiß ich zur Genüge: es gibt keinen, dem du nicht sehr willkommen wärest, da du es mit diesem deinen Wissen und dieser deiner Kenntnis von Gegenden und Menschen verstehst, ihn nicht bloß zu unterhalten, sondern auch durch Beispiele zu belehren und ihm mit deinem Rat zu helfen. Auf diese Weise könntest du für dich selbst ausgezeichnet sorgen und zugleich allen deinen Angehörigen sehr nützen.«
»Was meine Angehörigen betrifft«, erwiderte Raphael, »so kümmern die mich wenig; ihnen gegenüber habe ich nämlich, wie ich glaube, meine Pflicht so ziemlich erfüllt. Denn was andere erst, wenn sie alt und krank sind, abtreten, ja sogar auch dann nur ungern, wenn sie es nicht länger behalten können, das habe ich unter meine Verwandten und Freunde verteilt, und zwar zu einer Zeit, da ich nicht mehr bloß gesund und frisch war, sondern sogar schon in jungen Tagen. Sie müßten also, meine ich, mit meiner Freigebigkeit eigentlich zufrieden sein und dürften nicht außerdem noch verlangen und erwarten, daß ich mich ihretwegen einem König als Knecht verdinge.«
»Halt!« sagte da Peter. »Ich meinte, du solltest nicht ein Knecht, sondern ein Diener von Königen werden.«
»Das ist nur ein ganz kleiner Unterschied«, antwortete Raphael.
»Wie du die Sache auch nennen magst«, sagte da Peter, »ich bin jedenfalls der Ansicht, daß das der Weg ist, nicht nur anderen in persönlichem und öffentlichem Interesse zu nützen, sondern auch deine eigene Lage glücklicher zu gestalten.«
»Glücklicher? auf einem Wege, vor dem mir graut?« fragte Raphael. »Jetzt lebe ich, ganz wie es mir beliebt, und das ist, wie ich sicher vermute, bei den wenigsten Fürstendienern der Fall. Es gibt ja auch genug Leute, die sich um die Freundschaft der Mächtigen bemühen. Da sollte man es nicht für einen großen Verlust halten, wenn diese auf mich und den einen oder den anderen meinesgleichen verzichten müssen.«