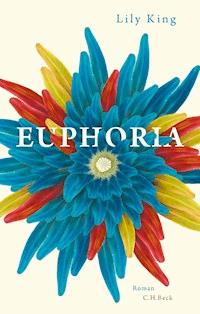16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lily Kings subtiler und herzzerreißender Roman über die tragischunverrückbare Liebe einer Tochter zu ihrem manipulativen Vater zeigt, wie unentrinnbar Bindungen in der Familie sind.
Daley Amory erlebt als Elfjährige die Trennung ihrer Eltern und wie vor allem der charismatische, aber weltanschaulich in den 50er Jahren stecken gebliebene und selbstzerstörerische Vater seine alte Familie schnell durch eine neue ersetzt. Daley gelingt es, ein eigenes Leben, eine Liebesbeziehung aufzubauen, und bleibt doch auf eine gefährliche Weise auf ihren Vater fixiert, auf die Vorstellung, ihm helfen zu müssen. Mühsam muss sie sich aus dieser Verstrickung befreien.
Lily Kings dritter Roman mit seinen faszinierenden und aufwühlenden Charakteren zeigt das ganze psychologische und sprachliche Können der Autorin, die es den Lesern unmöglich macht, sich dem Sog dieser Geschichte zu entziehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über die Autorin
Lily King, geboren 1962, lebt mit ihrer Familie in Maine. Sie veröffentlichte die Romane «The Pleasing Hour», «The English Teacher» und «Father of the Rain» und erhielt u.a. den New England Book Award for Fiction, den Whiting Writers‘ Award und den Maine Fiction Award. Ihr vierter Roman «Euphoria» (C.H.Beck 2015) wurde mit dem neu geschaffenen Kirkus Prize ausgezeichnet und von der New York Times unter die fünf besten literarischen Bücher des Jahres 2014 gewählt. Die deutsche Übersetzung wurde zu einem Bestseller.
Inhalt
I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
9
10
Für Lisa und Apple
Wer ist des Regens Vater? Wer hat die Tropfen des Taus gezeugt?
Hiob 38,28
I
1
Mein Vater singt.
Hoch an Lake Cayugas Ufern stinkt es schauerlich.
Mancher sagt, das ist der See: das ist Cornell, sag ich!
Beim Autofahren singt er immer. Seine Stimme ist tief und verkratzt, vom Rauchen und weil er so oft so laut rumschreit. Sein großer, spitzer Adamsapfel hüpft auf und nieder und drückt sich weiß durch die braune Haut ab.
Er langt herüber zu dem Welpen auf meinem Schoß. «Na, du kleiner Racker? Na, du kleiner Strolch?», sagt er mit seiner Hundestimme, einer freudigen, hoffnungsvollen Stimme, die er nicht oft bei Menschen macht.
Der Hund war eine Überraschung für mich zum elften Geburtstag, der gestern war. Ich habe mir den hässlichsten im ganzen Laden ausgesucht. Mein Vater und der Verkäufer haben mir die reinrassigen Neufundländer hingehalten, lauter wuschlige schwarze Fellbündel, die sie eins nach dem anderen hochgehoben haben, um mich mit ihren breiten, dicken Köpfen an der Backe zu kitzeln. Aber ich bin nicht weich geworden. Bei so einem Hund wäre das Fortgehen nur noch viel schwerer. Ich habe sie weggeschoben und auf den struppigen Mischling für fünfundzwanzig Dollar gezeigt, der schon seit dem Winter in dem Käfig hinten im Eck saß.
Mein Vater hat den letzten Neufundländer zurück in seine Sägespäne gesetzt. «Sie hat Geburtstag», sagte er mit beleidigter Stimme wie ein kleiner Bruder, der selbst nicht Geburtstag hat.
Bis wir im Auto saßen, kam kein Wort mehr von ihm. Dann, bevor er den Motor anließ, hat er den Hund zum ersten Mal angefasst, ihm die Stummelohren fest an den Kopf gedrückt. «Mann, bist du hässlich. Richtig potthässlich bist du. Aber ganz ein Braver, hmm?»
«Von den Hallen Montezumas», schmettert er jetzt zu den Granitblöcken hinaus, die den Highway nach Hause begrenzen, «bis zur Küste Tripolis!»
Das Genesis-Projekt haben wir beide völlig vergessen. Der blaue Bus steht in unserer Einfahrt und versperrt meinem Vater den Weg zur Garage.
«Jesus, Maria und Josef», sagt er mit gespieltem Schluchzen und schlägt die Stirn ans Lenkrad. «Womit hab ich das verdient?» Er schielt zu mir herüber, um sicherzugehen, dass ich lache, dann wimmert er wieder: «Womit hab ich das bloß verdient?»
Wir hören sie, bevor wir sie sehen. Kreischen, Rumsen, Platschen, ein Mädchen quiekt in einer Tour «William! William!», es ist ein einziges Durcheinandergeplärre: «Schau her! Guck mal, was ich kann!»
«Ich sein dein neua Nachba!», sagt mein Vater zu mir mit Grunzstimme.
Ich trage den Welpen, und mein Vater folgt mit dem Hundekorb, den Näpfen und dem Futter. Mein Pool ist nicht wiederzuerkennen. Er ist voll kabbeliger Wellen, wie draußen auf dem Meer, mit Schaumkronen. Die Betonplatten am Rand, die normalerweise heiß und trocken sind und zischen, wenn man sich mit dem nassen Bauch drauflegt, schwimmen von dem ganzen Wasser, das über die Kante geschwappt ist.
Es ist mein Pool, weil ihn mein Vater für mich gebaut hat. An meinem fünften Geburtstag wollte er mit mir in unserem Club schwimmen gehen. Ich hatte meine Füße gerade auf die erste breite Stufe am flachen Ende gesetzt und sah auf die dicken blauen und roten Striche am Grund und das dunkle, tiefe Wasser dahinter, da rief der Bademeister von seinem Hochsitz, Kinder dürften erst in einer Viertelstunde ins Becken. Mein Vater, der schon zwanzig Jahre Mitglied war und bis heute sämtliche Tennisturniere organisiert und gewinnt, erklärte ihm, dass ich Geburtstag hätte.
Der Junge, Thomas Novak, schüttelte den Kopf. «Tut mir leid, Mr Amory», rief er herunter, «sie muss die Viertelstunde warten wie alle anderen auch.»
Mein Vater lachte sein Ich-glaub-ich-spinne-Lachen. «Aber es schwimmt doch keiner!»
«Tut mir leid. So sind die Vorschriften.»
«Weißt du was?», sagte mein Vater. Sein Hals hatte rote Flecken. «Dann bau ich mir eben meinen eigenen Pool!»
Den Nachmittag über hing er mit den Gelben Seiten und einem Block auf den Knien am Telefon, verhandelte mit Bauunternehmern, schrieb Zahlen auf. Als ich abends im Bett lag, drang seine Stimme aus dem Fernsehzimmer herauf. «Die Vorschriften, die Vorschriften!», hörte ich ihn mit Babystimme greinen; wenn dieser Novak-Bengel nicht den Job dort hätte, würden sie ihn im Club gar nicht reinlassen, erklärte er meiner Mutter mehrmals und äffte das «Hallöchen!» nach, mit dem Mrs Novak, die im Drugstore an der Kasse saß, die Leute begrüßte. In den Wochen danach wurden Bäume gefällt, ein Loch wurde gegraben, mit Zement ausgegossen, gestrichen und mit Wasser gefüllt. Daneben entstand ein Häuschen mit Umkleidekabinen, einem Technikraum und einem Klo. An die Klotür hängte mein Vater ein Schild: WIR SCHWIMMEN NICHT IN EUREM KLO – PINKELT IHR NICHT IN UNSEREN POOL!
Meine Mutter, die mit einem rosa Hänger und Sonnenbrille mit ihrem Freund Bob Wuzzy, dem Leiter des Genesis-Projekts, im Gras sitzt, macht mir Zeichen, dass ich herkommen soll. Aber ich halte den Welpen hoch und gehe weiter zum Haus. Ich bin wütend auf sie. Wegen ihr konnte ich keinen Neufundländer nehmen.
«Wuzzy, der Wutz», sagt mein Vater, als er seine Ladung auf der Küchentheke absetzt. «Der Wutzi-Fuzzi.» Er sieht durch das Fenster zum Pool hinaus. «Schau ihn dir an, diesen Fuzzi.»
Mein Vater hasst alle Freunde meiner Mutter.
Charlie, Ajax und Elsie wittern den neuen Hund sofort. Sie umkreisen uns mit peitschenden Schwänzen, und mein Vater scheucht sie ins Esszimmer und drückt die Tür zu. Dann eilt er mit komischen Stelzschritten durch die Küche und schließt auch die Tür zum Wohnzimmer, bevor die Hunde ganz herumgelaufen sind. Sie kratzen an der Tür und winseln, dann lassen sie sich davor auf den Boden plumpsen. Ich setze meinen Hund auf dem Linoleum nieder. Er kommt nicht gleich hoch und flüchtet dann pfeilschnell in die Ritze zwischen Kühlschrank und Wand. Es ist ein warmes Plätzchen. Früher, als ich mich noch hineinzwängen konnte, habe ich mich dort oft versteckt und Spion gespielt. Das Fell des Hündchens steht ab wie Stacheln, seine Haut schlackert, so sehr zittert es.
«Armer kleiner Kerl.» Mein Vater hockt sich vor den Kühlschrank, die langen Beine rechts und links hochgewinkelt wie Froschbeine, seine Knie spitz und knochig durch die Khakihose. «Ist ja gut, du kleiner Strolch. Ist ja gut.» Er dreht sich zu mir um. «Wie soll er heißen?»
Durch das zitternde Hündchen in dem Spalt bekommt das, was ich mit meiner Mutter abgemacht habe, eine ganz neue Realität. Adios, denke ich. Nenn ihn Adios.
Vor drei Tagen hat mir meine Mutter gesagt, dass sie für den Sommer zu meinen Großeltern nach New Hampshire zieht. Wir standen in unseren Nachthemden in ihrem Bad. Mein Vater war schon in die Arbeit gefahren. Ihr Gesicht war ganz glänzig von der Mondtau-Lotion, mit der sie sich jeden Morgen und Abend eincremt. «Ich möchte gern, dass du mitkommst», sagte sie.
«Und was ist mit meinem Segelkurs und dem Mal-Camp?» Ich bin für alle möglichen Sachen angemeldet, die nächste Woche anfangen sollen.
«Segeln kannst du dort auch lernen. Sie wohnen an einem See.»
«Aber nicht mit Mallory und Patrick.»
Sie biss sich auf die Lippen, und in ihren Augen, die braun und rund sind, kein bisschen wie Dads gelbgrüne Schlitze, glitzerten Tränen, also sagte ich Ja.
Mein Vater langt in den Spalt und hebt das Hündchen heraus. «Wir warten erst mal ab, was du für einer bist, und geben dir dann einen Namen, einverstanden?» Das Hündchen kuschelt sich in seine Halsbeuge, schnüffelnd und leckend, und mein Vater lacht sein hohes Kitzellachen, und ich wünschte, er wüsste alles, was passieren wird.
Ich stelle das Hundebett an die Tür und die Näpfe daneben. In einen schütte ich Wasser, den anderen lasse ich leer, weil mein Vater alle Hunde zur gleichen Zeit füttert, um fünf, direkt vor seinem ersten Drink.
Ich laufe hoch und ziehe einen Badeanzug an. Durch das Fenster meines Bruders habe ich Blick auf meine Mutter und Bob Wuzzy, die jetzt auf Stühlen sitzen und Eistee mit dicken Zitronenscheiben und büschelweise Pfefferminze trinken, und auf die Kinder, die herumspritzen und sich schubsen und untertauchen – die Art Getobe, das meine Mutter am Pool normalerweise nie erlaubt. Ein paar springen vom Sprungbrett, aber nicht Köpfer oder Arschbombe, sondern mit den irrsten Verrenkungen, und kurz vor dem Fallen erstarren sie, wie diese Zeichentrickfiguren, die über einen Felsrand laufen und in der Luft weiterspazieren, bis sie zufällig nach unten schauen. Die Größeren machen das zigmal hintereinander, reißen mit ihren Körpern Witze für die anderen unten, die so lachen, dass sie fast untergehen. Wenn sie aus dem Pool klettern und zurück zum Sprungbrett rennen, schimmert das Wasser auf ihrer Haut, die so glatt wirkt wie mit Möbelwachs poliert. «Schwarz» sind diese Kinder alle nicht – braun in lauter verschiedenen Schattierungen, aber nicht schwarz. Ärgert es sie nicht, die falsche Farbe aufgedrückt zu bekommen? Das hätte ich letztes Jahr auch schon gern gewusst. «Sie wollen Schwarze genannt werden», hat mir mein Vater mit Bill Cosbys Fat-Albert-Akzent gesagt. «Komm bloß nicht auf die Idee, sie braun zu nennen. Black is beautiful! Braun ist das Grau’n!»
Das Gras fühlt sich gut an unter meinen Füßen, dicht und pieksig. Ich lege mein Handtuch auf den Stuhl neben meiner Mutter.
«Dass Sonias Gruppe keine Gelder mehr kriegt, hast du gehört, oder?», sagt Bob eben. Bei Bob Wuzzy weiß ich nie, ob er weiß oder schwarz ist. Er hat keine Haare, nicht ein Härchen irgendwo, und karamellfarbene Haut. Als ich meine Mutter deswegen gefragt habe, wollte sie wissen, was für eine Rolle das spielt, und als ich meinen Vater gefragt habe, sagte er, falls er nicht schwarz ist, sollte er es sein.
«Oje», sagt meine Mutter mit ernster Stimme, «das wusste ich nicht.»
«Kevin muss ihnen den Hahn zugedreht haben.»
«Vollidiot», sagt meine Mutter und dann, munterer: «Was macht Maria Tendillo?» Sie spricht den Namen richtig schön spanisch aus. Mein Vater macht sie dafür manchmal nach.
«Die ist seit Freitag wieder auf freiem Fuß. Keine Anklage.»
«Gary ist unschlagbar.» Meine Mutter lächelt. Dann schaut sie zu mir hoch.
«Guten Tag, Mr Wuzzy», sage ich und gebe ihm die Hand.
Er steht auf und schüttelt sie. Seine ist kalt und feucht von dem Eistee. «Wie geht’s dir, Daley?»
«Danke, gut.»
Sie wechseln einen Blick; meine Mutter ist mit meinen Manieren zufrieden. «Hüpf rein, Herzchen», sagt sie.
Heute früh hat sie mir erklärt, dass ich jetzt groß genug bin, um mit ihr zusammen Gastgeberin für das Genesis-Projekt zu sein, dass die Kinder alle grob mein Alter sein werden und ich sie in diesem Neuland willkommen heißen und mithelfen kann, die Wunden zu heilen. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redet. Schließlich meinte sie, ich soll einfach nur nett und freundlich sein und sie einbeziehen.
«Wie kann ich sie einbeziehen, wenn ich ganz allein bin und sie so viele?»
Das war nicht das, was sie hören wollte, aber weil sie Angst hat, ich verrate meinem Vater, dass wir weggehen, hat sie mich nur leise gebeten, auf jeden Fall mit ihnen zu schwimmen.
Ich stehe auf der ersten Stufe und sehe meine Füße vom Wasser vergrößert und bleich unter mir. Nun mach schon, spüre ich meine Mutter denken, aber das geht nicht. Ich kann mich nicht einfach ins Getümmel stürzen. Woher soll ich wissen, ob die anderen mich dabeihaben wollen? Ich kann nur ein höfliches Gesicht machen und abwarten. Die älteren Kinder veranstalten immer noch ihre wilden Sprünge. Die jüngeren sind hier am seichten Ende, mehr wassertretend als schwimmend, ihre Gesichter nach oben gereckt wie Seerosenblätter. In der Ecke führen zwei Mädchen ein Unterwassergespräch. Ein Junge in brauner Badehose schlängelt sich zwischen ihnen hindurch, und sie schießen beide an die Oberfläche und schimpfen auf ihn ein, dabei ist er längst wieder abgetaucht und hört sie nicht. Es sind vier Jungen und drei Mädchen, alle verschieden alt, und ich überlege, ob ein paar von ihnen Geschwister sind. Wahrscheinlich schon, so, wie sie sich gegenseitig anpflaumen. Aber niemand ist beleidigt oder fängt an zu weinen wie ich so oft.
Ich gehe langsam die Stufen hinunter und dann auf Zehenspitzen weiter. Sie sehen nicht zu mir her, aber sie weichen aus, als ich näher komme. Auf der Schräge zum tiefen Ende lasse ich meine Füße unter mir wegrutschen und mich hinabsinken. Es ist kühl und still am Grund, bis ein Körper hereinplatscht, ein Sack voller Blasen. Wenn ich sonst von hier unten hochschaue, ist die Oberfläche nur leicht bucklig, wie die Fensterscheiben im Speicher, aber jetzt schäumt sie weiß. Der Junge in der braunen Badehose schwimmt direkt über mich drüber. Seine Zehen streifen mein Haar, und er quietscht los.
Als ich auftauche, hundspaddelt der kleinste Junge in meine Richtung. Die anderen beobachten uns.
«Ist das dein Pool?», fragt er. Das Wasser glitzert in seinem Haar wie Kristalle.
«Ja.»
«Schwimmst du jeden Tag?»
«Wenn’s draußen warm ist.»
«Aber er ist doch geheizt, oder?» Er schwenkt die Arme hin und her, sodass seine Finger die Oberfläche entlanghüpfen.
«Schon.»
«Ich würde jeden Tag schwimmen», sagt er. «Auch wenn’s zwanzig Grad minus hätte. Ich würde gleich in der Früh reingehen und erst abends wieder rauskommen.»
«Du müsstest aber was essen, sonst stirbst du.»
«Dann würde ich drin im Pool sterben. Ist doch ein super Platz dafür.»
Ich beschließe, ihm lieber nichts von Mrs Walsh zu erzählen, die das offenbar auch fand. Sie hatte einen Herzinfarkt. «Ist das Mrs Walsh, die da dümpelt?», fragt mein Vater manchmal, wenn ich ein Badefloß im Wasser vergessen habe. Meine Mutter findet es nicht komisch.
Das Gespräch ist ins Stocken geraten, und der Junge paddelt weg. Ich fühle mich schuldig und erleichtert zugleich.
Meiner Mutter vergeht das Lächeln etwas, als sie merkt, dass ich rauskomme. Bob erzählt ihr von irgendeiner Benefizveranstaltung, und sie kann ihn nicht unterbrechen, um mich wieder reinzuschicken. Als ich abgetropft bin, laufe ich über den Rasen und die Treppe hoch.
Mein Vater sitzt rauchend im Fernsehzimmer und guckt Baseball, die Red Sox. Ich setze mich im nassen Badeanzug neben ihn. Ihm ist es egal, ob die Schonbezüge sich verfärben. In der Werbepause sagt er: «War’s nicht schön im Wasser?»
«Mir ist kalt geworden.»
Er schnaubt. «Der Pool muss an die dreißig Grad haben, so wie die da sicher reinpinkeln.»
«Sie pinkeln nicht rein.»
Ich warte darauf, dass er sagt, ich klinge genau wie meine Mutter, aber er legt mir nur die warme Hand aufs Bein. «Das war das letzte Mal, dass du das mitmachen musst, Zwerglein. Ich schieb da einen Riegel vor, versprochen.»
Es war so oder so das letzte Mal, denke ich.
Sie kommen nur zwei, drei Samstage jeden Sommer. An den anderen Wochenenden sind sie in den Pools oder an den Privatstränden von anderen Leuten in anderen Städten. «Das Genesis-Projekt», sagte mein Bruder neulich bei seinem Kurzbesuch zwischen Internat und seinen hochgeheimen Sommerplänen und machte eine tiefe, seriöse Fernsehansager-Stimme dazu: «Am Anfang war blaues Chlorwasser in Gärten. Am Anfang waren Trampoline und Mercedesse und edelmütige Hausfrauen in Lilly-Pulitzer-Kleidchen, die gerne etwas abgeben wollten, nur bitte nicht zu viel.» Meine Mutter kicherte. Mein Vater schaute muffig. Wenn er sie aufzieht, lacht sie nie so wie bei meinem Bruder.
Sie schwimmen stundenlang, bis Bob sie alle herauspfeift und ins Poolhaus scheucht, damit sie sich abtrocknen und anziehen. Er und meine Mutter werfen den Grill an, und als die Kohle glüht, legen sie fünfzehn Hamburger auf den Rost. Die Kinder erkunden den Garten, hin und her flitzen sie, von der Seilrutsche rüber zur Schaukel und von da zu dem Apfelbaum mit den niedrigen Ästen. Sie trauen sich Sachen, die ich mich nie trauen würde, hängen kopfüber vom Reifen, während er von einem Baum zum anderen saust, klettern über das schmale Rohr oben am Schaukelgestell und machen Saltos von der Steinmauer um Moms Rosengarten.
Ich beobachte sie durchs Küchenfenster.
«Eine Horde Affen», sagt mein Vater, der sich an der Bar einen Drink mixt.
Sie platzen beinahe vor Energie. Gegen sie komme ich mir wie eine Behinderte vor. Das kleinste Mädchen schlägt sich an einem der Steine, die aus dem Gras hervorschauen, das Knie auf, und die beiden Großen schuckeln es abwechselnd auf dem Arm, küssen es aufs Haar und wischen ihm die Tränen ab. Es klammert sich lange an ihnen fest, und sie schubsen es nicht weg.
«Daley.» Meine Mutter steht an der Fliegentür. «Kommst du bitte raus und isst mit uns?»
«Genau», sagt mein Vater. «Geh und iss mit dem Schwuli und seinen kleinen Freunden.»
Meine Mutter tut so, als hätte niemand was gesagt. Auf den Stufen, ein Stück weg von ihm, legt sie den Arm um mich. Sie duftet immer ganz zart nach Blumen. «Ich weiß, das ist schwer, aber versuch, ein bisschen weniger distanziert zu sein. Das hier ist wichtig, Herzchen», flüstert sie.
Normalerweise esse ich mit Nora zu Abend, aber sie ist für zwei Wochen in Irland, ihre Verwandten besuchen. Das macht sie jeden Sommer, und mir ist es nie recht. Das übrige Jahr wohnt sie bei uns, außer sonntags, wenn sie nach der Kirche rüber nach Lynn zu ihrer Schwester fährt und dort übernachtet. «Lynn, Lynn, du alte Synndenstadt, wo jeder Mensch sein Laster hat», zitiert mein Vater oft, wenn sie abfährt, aber nie so, dass sie es hört. Sie ist streng katholisch, und sie fände so etwas nicht witzig. Ich war schon an vielen Sonntagabenden mit bei ihrer Schwester. Sie essen Koteletts und spielen Karten und gehen früh schlafen. An Sünde ist bei ihnen in Lynn nicht zu denken. Auf ihrer Kommode bei uns hat Nora ein Foto stehen, sie und mein Vater auf einem Felsen am Meer. Sie ist achtzehn, und mein Vater ist eins. Er hält sich mit beiden Händen an ihrer Hand fest. Ursprünglich hatte Dads Mutter sie nur für einen Urlaub in Maine angeheuert, aber am Ende des Sommers ging sie mit ihnen nach Boston und blieb die ganzen neun Jahre, bis mein Vater aufs Internat kam. Als mein Bruder Garvey geboren wurde, hatte sie eine Stellung bei einer Familie in Pennsylvania, aber als dann ich kam, war sie frei. Nach dem Essen gucken Nora und ich auf ihrem Bett fern, Mannix und Hawaii Fünf-Null, wir beide schon im Bademantel. Dann bringt sie mich ins Bett, und wir beten jedes Mal «Müde bin ich, geh zur Ruh» und das Vaterunser, das aber in ihrer Kirche einen anderen Schluss hat. Meine Mutter sagt, wenn wir weg sind, bleibt Nora hier und kümmert sich um meinen Vater, der nicht mal ein Ei kochen kann.
Der Name Garvey kommt nicht von meinen Eltern. Sie haben meinen Bruder Gardiner getauft, nach meinem Vater, und so hieß er mein ganzes Leben, bis er aufs Internat kam und als Garvey zurückkehrte. Meine Mutter hat sich dagegen zu sperren versucht, aber sie hatte keine Chance. Bei seiner Abschlussfeier vor ein paar Wochen nannte ihn sogar der Direktor Garvey.
Wir sitzen in einem gezackten Kreis auf dem Rasen. Das Kleid meiner Mutter ist zu kurz, um damit im Schneidersitz zu sitzen, deshalb hat sie die Beine zur Seite geklappt, sodass sie ein bisschen zu Bob Wuzzy hinlehnt. Ich denke daran, wie das für meinen Vater aussehen muss, der mit seinem Glas am Küchenfenster steht.
Bob lässt uns reihum unsere Namen sagen, aber danach fällt uns nichts mehr ein. Nicht mal die beiden Erwachsenen schaffen es, ein Gespräch am Laufen zu halten. Wir essen unsere Hamburger, dann fragt Bob: «Wer will alles Sardinenbüchse spielen?», und sie rufen: «Ich, ich!» Ich weiß, dass mein Vater es lieber hätte, wenn ich reingehen und mich zu ihm setzen würde, aber meine Mutter fixiert mich streng.
Wir dürfen uns nicht jenseits der vorderen und hinteren Einfahrt verstecken, sagt Bob, und auch in keinem der Gebäude auf dem Gelände. Man könnte denken, er redet von einer Fabrikanlage. Dann bestimmt er ein Mädchen namens Devon, das sich als Erstes verstecken soll. Wir anderen zählen laut bis fünfzig und verschlucken so viele Vokale und Silben vor Hast, dass es ein Gefühl ist, als würde man in riesigen Sätzen die Treppe runterrennen. Dann verteilen wir uns, um Devon zu finden, ohne dass einer von den anderen es mitkriegt. Ich bin mir sicher, ich finde sie als Erste, weil ich mich hier auskenne und alle guten Verstecke weiß. Zuerst gehe ich vor zu den Rhododendren, dann zu dem kleinen Brunnen im Rosengarten. Als Nächstes schaue ich hinter dem Granitblock neben der Straße nach. Bald sind auch alle anderen verschwunden, alle bis auf den kleinen Jungen namens Joe, meinen Freund aus dem Pool.
«Suchen wir da drüben», rufe ich ihm zu und zeige auf die kleinen Kiefern hinterm Pool, aber Joe trottet in die andere Richtung.
Auf Höhe der Hinterveranda höre ich plötzlich ein Rascheln. Sie haben sich alle unter der Treppe zusammengepfercht, in diesem engen, dunklen, spinnwebigen Loch, das mir noch nie so recht geheuer war. Als ich näher komme, ist das Gezischel ihrer Stimmen so laut, dass ich mich frage, wie ich zweimal an ihnen vorbeilaufen konnte, ohne sie zu bemerken. Ich bücke mich und krieche zu ihnen hinein. Damit ich ganz reinpasse, muss ich mich richtig zwischen sie quetschen. Wir schwitzen alle, unsere Haut klebt. Ihr Gezischel ist verstummt. Niemand sagt mehr ein Wort. Es ist, als würden sie alle die Luft anhalten. Ich zermartere mir das Hirn nach einer Bemerkung, einem von Patricks schrägen Sprüchen, der uns alle zum Kichern bringt. Draußen im dämmrigen Garten fängt der kleine Joe zu weinen an, und Bob Wuzzy befiehlt uns, rauszukommen.
Der Junge, der Devon als Erster gefunden hat, versteckt sich, und die anderen laufen los und zählen. Ich stehle mich die Verandastufen hoch.
Mein Vater isst ein Minutensteak mit dick A-1-Soße darüber. Große Schweißperlen stehen ihm auf Stirn und Nase, wie immer, wenn er sein Abendessen isst. Er stiert geradeaus, und ich bin mir unsicher, ob er mich überhaupt bemerkt.
«Du bist ’ne Brave, weißt du das, Zwerglein?» Seine Worte schlittern eine Spur seitwärts.
Als er aufgegessen hat, mixt er sich noch einen Drink. Er gibt mir zwei winzige essiggetränkte Zwiebeln aus dem Glas ab. In vier Tagen wohne ich nicht mehr bei ihm. Wenn wir im Herbst nach Ashing zurückkommen, sagt meine Mutter, mieten sie und ich unsere eigene Wohnung, und ich komme nur noch am Wochenende hierher.
Draußen muss das Spiel zu Ende gegangen sein, kein Laut dringt mehr durch die Fliegentür. Dann flammt die Poolbeleuchtung auf, die kleinen pilzförmigen Lämpchen im Gras und die große Unterwasserleuchte unter dem Sprungbrett. Gestalten strömen aus dem Poolhaus und platschen ins Wasser. Mein Vater wird ganz starr bei dem Geräusch.
Er trinkt seinen Martini aus, das Eis klimpert, als er noch den letzten Tropfen in sich hineinkippt. Dann stellt er das leere Glas auf die Küchentheke. «Ich hab eine Idee», sagt er.
Ich sage nie Nein zu den Ideen meines Vaters, so wie ich auch zu den Ideen meiner Mutter nie Nein sage. Wenn mein Vater von mir gewollt hätte, dass ich mit ihm weggehe, dann hätte ich genauso Ja gesagt. Mein Bruder sagt ständig Nein zu allem, wenn er hier ist, und verdirbt damit nur allen die Laune.
Wir ziehen uns auf der Veranda aus. Das Hündchen ist bei uns und wuselt um unsere Knöchel; es spürt, dass etwas im Busch ist.
«Un, deux, trois», zählt mein Vater. Französisch kann er vom Angeln in Quebec. «Los!»
Er sprintet auf den Pool zu, seine langen Tennisspielerbeine weit ausgreifend auf dem borstigen Gras, ein Muskelknubbel oben an jeder Wade, seine Schenkel dünn und straff, sein Hintern hoch und flach und weiß leuchtend im Dunkeln, seine langen Arme aufblitzend beim Laufen, der rechte stärker als der linke, weil das Handgelenk einbandagiert ist. Er bewegt sich wie niemand sonst in unserer Familie, fließend wie Wasser. Als er den Pool erreicht, fängt er zu grunzen an. Er schwenkt nach rechts, weg von der Ecke, wo meine Mutter und Bob Wuzzy mit ihrem Eistee sitzen, und prescht das Stück Rasen zwischen dem Pool und der Gartenmauer entlang.
Ein Junge, der sich auf meinem roten Schwimmfloß treiben lässt, sieht uns als Erster.
«Blitzer!», schreit er.
Mein Vater setzt über die kleinen Pilzlämpchen, eins nach dem anderen, sein Grunzen wird lauter, er krümmt die Arme einwärts, macht einen Buckel. Er umrundet das tiefe Ende, in dem grünlichen Schein des Pools zeichnen sich die Adern und Muskeln auf seinem kraftvollen, sehnigen Körper ab wie Silberstränge.
Alle Kinder schreien jetzt durcheinander, sie johlen und patschen auf das Wasser und lachen so, dass sie sich am Beckenrand festhalten müssen.
Den Platz meiner Mutter an der Ecke hat er sich bis zum Schluss aufgespart. Nun nimmt er Kurs auf sie, spurtet am Poolhaus vorbei auf ihren Liegestuhl zu, seine Eier wild baumelnd, sein Pimmel wie der eines kleinen Jungen, mausegroß. Er hat die Arme jetzt vollends gekrümmt, kratzt sich die Achselhöhlen, grunzt ihr ein «Uuuuu-uuuuu-uuuuu» ins Gesicht und ist verschwunden.
Meine Mutter schaut einen Moment lang, als hätte man sie aus einem Flugzeug geworfen. Dann ringt sie sich ein Lächeln für Bob ab, der um der Kinder willen so tut, als wäre es ein seltsamer, aber harmloser Streich. Als sie jedoch mich sieht, brennt bei ihr eine Sicherung durch. Sie macht einen Satz aus ihrem Stuhl, um mich zu packen, aber ich bin schnell und glitschig ohne meine Kleider. Die harten Grasstängel stechen mir in die Fußsohlen, die feuchte Nachtluft streicht durch die Härchen auf meinen Armen und zwischen meinen haarlosen Schenkeln hindurch. Auch mein Körper ist jungenhaft, meine Brustwarzen zwei winzige, feste Knöpfchen, heute Nacht bin ich fast so geschmeidig und wendig und flink wie mein Vater. Meine Lunge pumpt wie wild. Ich will nie aufhören zu rennen, bis in alle Ewigkeit will ich das Brennen meiner Bauchmuskeln und das Ziehen in meiner Kehle spüren, will mit meinem nackten Elfjährigenkörper unter den Sternen dahinjagen, so anmutig und schnell wie ein Reh im Wald.
Lachend und keuchend erreichen wir beide die Veranda, stehen da zwischen unseren am Boden verstreuten Kleidern, unser Hündchen umkreist uns mit verzückten Sprüngen, mein Vater grinst bis über beide Ohren, und er schaut mich an, als ob er mich liebt, mich so liebt, wie er sein ganzes Leben niemanden geliebt hat.
2
Einen Tag, bevor meine Mutter und ich aus Ashing wegfahren, radle ich zur Baker’s Cove. Der Strand dort ist schmal, und bei Ebbe riecht er brackig, deshalb sind wir in der Baker’s Cove meistens für uns. Wenn man ein Stück um die Felsen herumklettert, kann einen vom Weg aus keiner sehen.
Mallory hat die Larks von ihrer Mutter dabei, ich die L&Ms von meinem Vater und Gina die Marlboros, die ihr Vater raucht. Patrick sagt, seiner Mutter sind die Zigaretten ausgegangen, und Neal sagt, seine Eltern rauchen beide nicht. Niemand glaubt ihm. Das ist das erste Mal, dass Neal Caffrey mit uns runter zur Bucht kommt. Ich weiß nicht, wer ihm Bescheid gesagt hat.
«Du bist doch nur zu feige zum Klauen», sagt Teddy und holt ein silbernes Etui mit Mentholzigaretten heraus.
«Mein Vater hat Asthma», sagt Neal. Er nimmt sich eine von Teddys Salems und klappt das Etui zu. «Wer ist G.E.R.?»
Alle schauen wir auf die schnörkeligen Initialen, die in das Silber graviert sind. Teddy heißt mit Nachnamen Shipley.
Er zuckt die Achseln. «Doch egal.» Er zieht seinen Schuh aus. «Was ist jetzt, spielen wir?»
«Ich will erst fertig rauchen», sagt Mallory. Sie sieht genau wie ihre Mutter aus, wenn sie raucht, die freie Hand unter den Arm geklemmt, den sie zum V abgeknickt hält, die Zigarette nie mehr als ein paar Zentimeter von ihrem Mund.
Die Jungen wollen immer nur sie küssen, also warten sie.
Die Luft ist heiß und dumpf, aber ab und zu weht vom Wasser ein Schwall Kühle heran. Man kann ihn kommen sehen, ein Runzeln weit draußen auf der Meeresoberfläche wie von einem riesigen dunklen Flügel. Danach wird alles wieder hell und glatt. Neals Locken sind ganz zerzaust. Ich war noch nie verliebt, aber ein bisschen bin ich es in Neal, glaube ich, und mein Herz klopft eine Spur schneller als sonst. Ich darf Patrick nicht anschauen, weil ich weiß, dass er es weiß. Für so was hat er einen Riecher.
«Wer fängt an?», fragt Teddy.
«Ich.» Mallory drückt ihre Zigarette an einem Stein aus und bindet sich die Haare ganz geschäftsmäßig zu einem Pferdeschwanz.
Sie dreht Teddys Bootsschuh. Als er anhält, zeigt die Spitze auf mich, und alle lachen. Sie dreht noch mal. Jetzt zeigt er zwischen Patrick und Gina.
«Wenn er zwischen zwei Leute zeigt, hast du freie Wahl», sagt Teddy.
«Patrick», sagt sie, und Patrick verdreht die Augen. Er tut immer so, als fände er Geküsst-Werden grässlich.
Sie beugen sich zueinander vor, und ihre Lippen treffen sich flüchtig. Mallory sagt, ihr ist Patrick am liebsten, weil seine Lippen so schön trocken sind.
Es geht im Uhrzeigersinn. Nach Mallory ist Neal dran. Er dreht den alten, schlammverkrusteten Schuh mit beiden Händen. Schlingernd kommt er zum Stillstand, die Spitze zeigt ganz klar auf mich.
Neal steht richtig auf und kommt zu mir herum, zieht mich an der Hand hoch und küsst mich. Es ist ein warmer Kuss, nicht ganz so kurz wie der von Mallory und Patrick. Meine Hand lässt er als Letztes los. Mein Gesicht fühlt sich flammend rot an, und ich halte den Kopf gesenkt, bis das Brennen aufhört.
Gina küsst Teddy. Teddy küsst Mallory. Dann bin ich an der Reihe. Neal, Neal, Neal, bettle ich, aber der Schuh zeigt auf Teddy.
«Hattrick!», sagt er, weil er uns jetzt alle drei durch hat.
Ich bringe es schnell hinter mich. Seine Lippen sind nass und rissig, wie aufgeweichtes Brot.
Als Neal das nächste Mal dran ist, zeigt der Schuh zwischen Gina und Teddy.
«Du darfst wählen», sagt Gina hoffnungsvoll.
«Daley.»
Und dieses Mal führt er mich ein Stück von den anderen weg, fast bis zu den Bäumen.
«Hast du ein Bett da hinten?», fragt Teddy.
«Ich mag keine Zuschauer», sagt Neal. Und zu mir, leiser: «Stört es dich, dass ich wieder dich genommen habe?»
Ich schüttle den Kopf. Ich will ihm sagen, dass ich es gehofft habe, aber ich bringe die Worte nicht hervor, ehe er mich küsst, länger; sogar den Mund öffnet er dabei ein klein wenig.
«Das war schön», sagt er.
«Ja.» Alles fühlt sich so merkwürdig an, als wäre ich in das Leben von jemand anderem spaziert.
«Teddy hat gesagt, ihr trefft euch hier jede Woche.»
«Das ist jetzt erst das dritte Mal.»
«Kommst du nächste Woche?»
«Weiß noch nicht.»
«He, hört auf zu quasseln. Ich bin dran», sagt Gina. «Und Patricks Oma will mit ihm im Strandclub zu Mittag essen.»
Alle sehen jetzt zu uns her. «Versuch’s, ja?», sagt er leise.
Kurz danach löst das Spiel sich auf. Wir rauchen noch ein paar Zigaretten und beobachten die Möwen, die Muscheln auf die Steine herabfallen lassen und sich um die zerdepperten Stücke zanken.
«Stellt euch vor, ihr müsstet so euer Leben verbringen», sagt Patrick.
«Ich würde mich von einem Felsen stürzen», sagt Teddy.
«Könntest du aber nicht, weil du ja eine Möwe wärst», sagt Gina. «Deine Flügel würden einfach zu schlagen anfangen. Macht ihr dieses Jahr den Segelkurs?»
«Jep», sagt Teddy. «Und du?»
«Wir alle drei.» Sie zeigt mit dem Daumen auf mich und Mallory.
«Glaubt ihr, irgendein Tier in der Geschichte der Tiere hat je Selbstmord begangen?», fragt Neal.
«Nein. Ihre Hirne sind so klein, dass sie nicht mal kapieren, wie bescheuert ihr Leben ist», sagt Teddy.
Ich weiß nicht, ob es an den Zigaretten liegt, dass ich mich so komisch fühle, aber alle erscheinen endlos weit weg. Wenn ich etwas sagen würde, müsste ich schreien, damit sie mich verstehen.
Als wir aufbrechen, lasse ich die anderen vorausfahren. Die fünf nehmen die ganze Straße ein, so wie sie eiern und schlängeln. Ich drehe mich zur Bucht um. Ich dachte, ich hätte den ganzen Sommer zum Rauchen und Schuhedrehen. Eine Möwe landet neben dem Pflaumenkern, den Teddy ausgespuckt hat, pickt zweimal danach und fliegt wieder auf. Das Wasser steigt jetzt, kriecht an den muschelverkrusteten Felswänden hoch. Neal schaut durch die Lücke zwischen seinem rechten Arm und dem Lenker seines Zehngangrads zu mir zurück, ganz nebenher, als würde er nur runter auf sein Bein schauen.
In der Einfahrt setzt meine Mutter bei meinem Fahrrad den Schraubenschlüssel an. Ich habe sie noch nie mit einem Werkzeug aus der Garage gesehen. Sie bekommt beide Räder problemlos ab und lädt sie zusammen mit dem Rahmen auf unsere Taschen im Kofferraum ihres Cabrios. Um ihren Kopf ist ein Tuch gebunden wie zur Gartenarbeit. Ihre Bewegungen sind zügig und sicher, wie einstudiert. Sie drückt den Kofferraumdeckel ein paarmal herunter, und als er schließlich einrastet, lacht sie auf, obwohl nichts komisch ist.
Manchmal, wenn sonst keiner es einrichten kann, fährt mich eine Lehrerin von der Schule nach Hause. So ein Gefühl ist das jetzt: als würde mich ein Lehrer, ein Fremder, irgendwohin fahren.
«Steig ein, Süße», sagt sie.
Das hässliche Hündchen scharrt an der Fliegentür. Wenn mein Vater heimkommt, werden die Zeitungen, mit denen ich die Küche ausgelegt habe, voll sein mit seinen grellgelben Pfützen und weichen Haufen. Erst vor einer Stunde musste ich ihm versprechen, den Hund die meiste Zeit über im Freien zu lassen.
«Du musst ihn ganz doll loben, wenn er sein Geschäft draußen macht», hat mein Vater gesagt. Er hatte den Anzug an, den er im Sommer fast immer zur Arbeit trägt, hellbraun mit blassblauer Krawatte; sein Haar mit dem sauber gezogenen Rechtsscheitel war noch feucht nach dem Duschen. «Du musst sagen: Braver Junge, braver Junge, braver Junge, so» – und er rieb mir Bauch und Rücken gleichzeitig, schnell und mit so viel Kraft, dass er mich praktisch vom Boden hochhob.
Ich lachte und sagte: «Okay, okay.» Trotzdem hielt ich mich noch ein bisschen an seinen Armen fest, Füße in der Luft.
«Und du glaubst, das schaffst du?»
«Ja.»
Er hat breite Hände, knochig und braun, mit abgekauten Nägeln und blaugrünen, knotig hervortretenden Adern. «Also dann», sagte er, und ich küsste diese Hände und ließ los.
Bei meiner Mutter im Auto ist immer der Nachrichtensender eingestellt. «Nur fünf Tage nach Abschluss seiner Rundreise durch den Nahen Osten», sagt der Sprecher, «ist Präsident Nixon zu Beratungen mit den westeuropäischen Regierungschefs in der belgischen Hauptstadt Brüssel eingetroffen. Am Donnerstag reist er von dort weiter nach Moskau.»
Meine Mutter redet mit dem Radio. «Ja, lauf nur davon, Dick. Lauf davon, aber das wird dir nichts nützen.»
An der großen Kreuzung schaue ich die Bay Street entlang. Mallorys Haus ist das große weiße gleich an der Ecke, Patrick wohnt in der letzten Einfahrt links, gegenüber vom Strandclub. Sie werden nachher beide bei mir anrufen, aber niemand wird abheben.
«Während die Maschine des Präsidenten heute den Atlantik überquerte, bestätigte sein Arzt den Reportern, dass er nach wie vor an einer Venenentzündung im linken Bein leidet. Der Präsident wisse von dieser Erkrankung, die auch unter dem Namen Phlebitis bekannt ist, bereits seit mehreren Wochen, habe aber Stillschweigen darüber angeordnet, sagte sein Arzt.»
Meine Mutter schnaubt das Armaturenbrett an.
Wir fahren durch die Stadt. Im Park werden schon die Karussells für den Jahrmarkt aufgebaut, der jeden Sommer für eine Woche hierherkommt. Männer laden riesige bunte Metallteile von den Anhängern und setzen sie auf dem Gras ab. Da, wo die großen runden Calypso-Gondeln mit ihren hohen Rückenlehnen und roten Ledersitzen verstreut liegen, fängt eigentlich das Baseballfeld an. Wenn erst alle Fahrgeschäfte und Buden und die Pizza- und Schmalzgebäckstände an ihrem Platz sind, wird von dem alten Park nichts mehr zu erkennen sein. Ein paar kleine Kinder schauen vom Zuschauergerüst aus zu wie wir früher.
Das Stadtzentrum ist klein, nur eine einzige Straße mit Geschäften. Neals Mutter arbeitet manchmal im Strickladen. Ihr Auto steht auch jetzt davor, ein orangefarbener Ford Pinto mit einer kleinen Delle in der Fahrertür. Der Gegenverkehr ist zäh, das sind die Touristen, die zum Ruby Beach wollen. Leute winken uns – Mrs Callahan und Mrs Buck –, aber meine Mutter nagt an ihrer Lippe und hört den Nachrichten zu und achtet nicht auf sie. Als wir den Highway erreichen, nimmt sie meine Hand und tritt hart aufs Gas.
Wir legen eine Essenspause bei Howard Johnson’s ein. Ich mag die frittierten Muscheln dort, weil es nur die Hälse sind, nicht die Bäuche. Bei den Bäuchen würgt es mich immer. Aber auf meinem Teller liegt so ein riesiger Berg. Sie sehen wie dicke frittierte Würmer aus. Ich kriege nur drei herunter. Meine Mutter isst auch nicht viel von ihrem Club-Sandwich. Die Kellnerin fragt, ob sie uns den Rest einpacken soll, aber wir schütteln beide den Kopf.
«Wir schaffen das schon, du und ich», sagt meine Mutter und reibt mir den Arm.
«Ich weiß», sage ich, und sie macht ein erleichtertes Gesicht.
Als wir wieder im Auto sitzen, lässt sie mich eine Kassette einlegen. Ich spiele John Denver, das Lied über das Federbett von seiner Großmutter. Ich spiele es immer wieder, bis sie mich bittet, aufzuhören. Es macht mir jedes Mal gute Laune, dieses Lied, die ganzen Kinder und Hunde und das Schweinchen, wie sie zusammen im Bett liegen.
Wir kommen nach New Hampshire. Bis zu ihrer Hochzeit, mit neunzehn, hat meine Mutter jeden einzelnen Sommer ihres Lebens am Lake Chigham verbracht. Sie sagt, ich war auch schon dort, aber ich habe keine Erinnerung daran. Ich sehe meine Großeltern nur bei uns zu Hause vor mir, an Thanksgiving oder an Weihnachten, auf Stühlen sitzend. Stehend kann ich sie mir gar nicht vorstellen.
Nach einer Weile fahren wir vom Highway ab und weiter auf einer schmaleren Straße, und dann auf einer noch schmaleren. Die Bäume scheinen immer höher zu werden. Wir kommen zu einem Schotterweg mit einem kleinen weißen Schild mit blauer Schrift: CHIGHAM POINT ROAD. Darunter, ganz klein geschrieben: Privatweg.
Meine Mutter holt tief Luft und sagt im Ausatmen: «Da wären wir.»
Ich schaue den Weg entlang. Es sind keine Häuser zu sehen, nur Bäume – Kiefern und Ahorn –, die jedes bisschen Sonne aussperren.
«Erinnerst du dich jetzt?», fragt meine Mutter.
«Nein.»
Wir biegen in den Weg ein. Er ist sehr lang, Einfahrten führen von ihm weg, lange Einfahrten, die man nur daran erkennt, dass an die Baumstämme Holzbretter mit Nachnamen darauf genagelt sind. Manchmal ahnt man durch Bäume und Büsche und Unterholz den dunklen Umriss eines Hauses oder Wasserglitzern. Wir folgen einer der letzten Einfahrten und parken neben einem braunen Auto. Das Haus, ein dunkelbraunes Holzhaus, steht nur ein paar Meter vom See entfernt, der glatt ist und so hell nach der dunklen Straße, dass es mir in den Augen wehtut.
«Wieder daheim», sagt sie mit einem Seufzer.
Mein Großvater kommt heraus. Sein Mund ist verkniffen, als ob ihn etwas wütend macht. Eilig steigt er die Verandastufen herunter, und meine Mutter rennt regelrecht auf ihn zu, und sie umarmen sich fest. Meine Mutter stößt ein Geräusch aus, und Grindy sagt: «Schscht, schscht, ist ja gut», und streichelt ihr übers Haar, bis das Kopftuch auf den Boden fällt. Sie sagt etwas Leises, und er sagt: «Ich weiß. Das weiß ich doch. Du hast es dreiundzwanzig Jahre versucht, das reicht.»
Er winkt mich mit einem Arm zu sich her, und als ich nahe genug bin, zieht er mich an sie beide heran und gibt mir einen Kuss auf die Stirn.
Nonnie wartet schon an der Tür, als wir mit unseren ganzen Taschen hereinkommen. Sie küsst uns beide auf die Wange. Ihre Haut ist flaumig, und sie riecht nach diesen kleinen Säckchen, die man in die Schubladen legt, damit die Wäsche nicht müffelt. Sie ist nicht meine richtige Großmutter, erzählt mir meine Mutter an diesem Abend, als wir in unseren nebeneinanderstehenden Betten liegen. Das habe ich nicht gewusst. Jetzt stellt sich heraus, dass ich meine echte Großmutter gar nicht kenne. Sie lebt in Arizona, und meine Mutter hat sie zuletzt gesehen, als Garvey ein Baby war.
Nonnie hat ein junges Gesicht, aber ihre Haare sind alt, völlig weiß. Sie trägt sie hochgesteckt, nur wenn man morgens früh genug in die Küche kommt, sieht man sie manchmal noch in ihrem Bademantel aus blauem Plaid und mit offenem, frisch ausgebürstetem Haar, das ihr bis zur Taille herabfällt. Den Rest des Tages ist es versteckt, geflochten und hinten am Kopf aufgerollt.
Beim Abendessen streitet Grindy mit meiner Mutter über Nixon. «Diese ganzen Zeugenaussagen und Anhörungen legen doch nur alles lahm! Diese lächerlichen Tonbänder! Dass sich das Land diesen Unsinn anhören muss! Wir befinden uns mitten in einer schweren Rezession. Lasst den Mann die Dinge anpacken, die wirklich zählen.»
«Nichts zählt so viel wie das hier, Dad. Politiker müssen Rechenschaft ablegen. Sonst ebnen wir nur dem nächsten Hitler den Weg.»
Grindy schüttelt den Kopf. «Kindchen», sagt er, aber dann wird seine Stimme scharf. «Untersteh dich und wirf Richard Nixon in einen Topf mit Adolf Hitler. Untersteh dich. Richard Nixon wusste nichts von Watergate.» Meine Mutter will etwas einwenden, aber er hält die Hand hoch. «Er wusste nichts davon, und seine einzige Schuld besteht darin, dass er seine eigenen Männer vor dem Gefängnis bewahren will. Du bist naiv, Kindchen. Es gibt immer interne Spionage. Immer. Diese Leute fliegen irgendwann auf. Aber der Präsident muss sich wieder seiner eigentlichen Aufgabe widmen und regieren können.»
Meine Mutter macht ein Gesicht, als säße mein Vater vor ihr. Nonnie fragt, ob jemand noch Bohnen möchte.
Nach dem Essen guckt mein Großvater die Red Sox. Ich stehe hinter seinem Sessel und poliere ihm mit dem Ärmel die Glatze. Ich bin fasziniert von ihrer Blankheit, von den weißen Altersflecken, den braunen Altersflecken. Meine Mutter sagt, ich soll ihn in Frieden lassen, aber er sagt, nein, es ist ein angenehmes Gefühl. Die dünne Schicht blanker bräunlicher Haut riecht wie Pilze, bevor man sie in den Topf gibt. Als ich ins Bett gehe, legt er mir die Hände über die Ohren und pflanzt mir einen harten, stachligen Schmatz auf die Stirn.
Mein Vater weiß, wo wir sind, behauptet meine Mutter, aber dann kann ich nicht verstehen, warum er noch nicht angerufen hat oder hergekommen ist. Immer wieder einmal hebe ich den Hörer ab, um zu kontrollieren, ob das Telefon noch geht, dann lege ich wieder auf. Er muss dermaßen wütend auf mich sein.
Auf der Karte der Seen im Esszimmer meiner Großeltern ist unser See rot umringelt. Unsere Landspitze sieht wie ein kleiner Blinddarm aus, der vom Nordufer herabbaumelt.
«Du fühlst dich wie in einem Bunker», sagt meine Mutter zu jemandem am Telefon, wahrscheinlich ihrer Freundin Sylvie. «Es kommt keinerlei Licht durchs Fenster. Wenn du die Sonne sehen willst, musst du auf den See hinausrudern.»
Oben im Flur hängt ein Foto, auf dem meine Mutter in einem weißen Bikini auf dem Steg steht und sich am Bein kratzt. Das Weiß lässt ihre Haut sehr braun aussehen, und sie lächelt. Im Hintergrund warten ein paar Freundinnen im Wasser auf sie. Diese Freundinnen machen bis heute hier Urlaub, mit ihren eigenen Familien jetzt, und meine Mutter rätselt in unserem Zimmer mit den schrägen Wänden darüber, wie sie es aushalten: Sommer für Sommer, Jahr um Jahr, mit immer denselben Leuten, denselben Cocktailpartys, dem Picknick am Unabhängigkeitstag, dem Squaredance im August, den endlosen Gedenkgottesdiensten für all die alten Leute, die über den Winter gestorben sind.
Schließlich schleppt meine Mutter ein Mädchen namens Gail für mich an. Sie kommt auch in die sechste Klasse, wirkt aber viel älter. Ich nehme sie mit rauf in unser Zimmer und zeige ihr meine Platten.
«Du bist echt dünn», sagt sie und misst mein Handgelenk mit zwei Fingern. Sie zieht eine Schachtel Zigaretten heraus, und wir rauchen ein paar oben auf dem Dachboden neben einer alten Schneiderpuppe. Der Geschmack erinnert mich an Neal und den Kuss mit ihm.
Ab da kommt sie fast jeden Tag. Außer mir gibt es hier keine Mädchen in ihrem Alter. Wenn es regnet, spielen wir im Wohnzimmer Schnapsen oder Leben und Tod, und bei gutem Wetter schwimmen wir raus zu dem Floß, das für alle Familien auf der Landzunge da ist, oder spielen Tennis auf dem holprigen Platz im Wald. Sie stellt mich den anderen Kindern vor. Die meisten sind um irgendwelche Ecken mit mir verwandt, was sie mir aber nicht abnehmen. Vielleicht interessiert es sie auch einfach nicht. Obwohl keine Schule ist, merke ich gleich, dass Gail zu den Beliebten gehört. Sie hat diese Ausstrahlung, die so viel mehr zählt als Hübschsein. Ich halte mich an sie, folge ihr wie der Schwanz seinem Drachen, dankbar für dieses unerklärte Band zwischen uns.
Nach zwei Wochen ruft mein Vater an, als wir beim Abendessen sitzen. Nonnie hebt ab und kommt schnell zurück.
«Es ist Gardiner.» Sie ist an der Tür stehen geblieben, um die Reaktion meiner Mutter abzuwarten.
«Ich weiß nicht, ob das klug ist», sagt mein Großvater, aber meine Mutter erhebt sich und geht zum Telefon, das im Wohnzimmer unter der Treppe steht. Sie redet so leise, dass wir fast nichts verstehen, aber ihr steifer, gerader Rücken und die Art, wie sie den Hörer ein Stück vom Ohr weghält, sagen genug. Als sie mich ruft und mir den schweren schwarzen Hörer in die Hand drückt, sagt mein Vater zu mir, ich soll heimkommen.
«Das ist das, was ich möchte. Dass du und deine Mutter wieder heimkommen.» Seine Stimme ist hoch, ein bisschen, als würde er irgendwen nachmachen, aber er macht niemanden nach, er weint fast. Ich rieche ihn, rieche das Steak und die A-1-Soße und die kleinen Zwiebeln in seinem Glas.
Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Nach einem langen Schweigen sagt er, dass er den Welpen Scratch genannt hat und dass Mallory und Patrick gestern zum Schwimmen da waren. Seine Stimme wird immer normaler, und er erzählt mir, dass er heute Nachmittag mit Scratch beim Tierarzt war. Scratch hat vier Spritzen bekommen und war so was von brav.
«Er ist hier bei mir», sagt er, «er sitzt gleich neben mir und lässt dich grüßen, und er will auch, dass du heimkommst, Zwerglein.»
«Ich versuch’s, Dad.»
Als ich eingehängt habe, sehe ich seine Hände vor mir und die Schweißperlen auf seiner Nase, und er fehlt mir so, dass es sich anfühlt, als würde mir jemand die Haut abziehen.
Im Esszimmer beschwert sich meine Mutter über ihn und über die Martinis; offenbar hat er inzwischen ja mit einem Anwalt gesprochen, sagt sie, und soll jetzt so tun, als wollte er sie zurückhaben. «Wartet’s nur ab», sagt meine Mutter, «er wird einen Brief schreiben. Er wird es schriftlich festhalten.»
Meine Großmutter sieht, dass ich zuhöre, und fragt, ob jemand noch von dem Hühnchen möchte.
Ich schreibe an Mallory, Patrick und Neal Caffrey. Mallory antwortet als Erste. Ihr Brief hat die Form einer Giraffe:
Patrick schreibt als Nächster, auf einer türkisen Karte, bei der oben in Prägeschrift sein Name steht.
Liebe Daley,
ich habe dieses Briefpapier zu Weihnachten gekriegt und es noch nie vorher benutzt. Irgendwie finde ich es kindisch. Wir baden ziemlich viel in Deinem Pool. Ich hoffe, das macht Dir nichts aus. Es ist heiß hier. Mr Amory und ich haben neues Chlor und einen neuen DPD-Test besorgt. Danach waren wir noch bei Payson’s und haben ein Verlängerungskabel und Reißzwecken gekauft. Wann kommst Du zurück? Der Jahrmarkt ist wieder weg. Elyse hat in der Riesenkrake gekotzt. Alles war voll. Gestern sind wir dreimal gekentert.
Viele Grüße von
Patrick
Die Wochenendbesorgungen hat mein Vater sonst immer mit mir gemacht. Als wir das letzte Mal bei Payson’s waren, hat er mir eine runde Schlüsselkette gekauft, so eine dicke silberne, wie die Hausmeister in unserer Schule sie haben, die man sich an den Gürtel haken kann, mit einem kleinen harten Knopf in der Mitte, den man drückt, damit sie sich aufrollt. Ich habe sie daheim vergessen, und als ich Patricks Brief lese, heule ich Rotz und Wasser wegen dieser dämlichen Schlüsselkette.
Dann schreibt mein Vater, wie meine Mutter es vorausgesagt hat, einen Brief an sie und mich gemeinsam, in dem er uns bittet, zurückzukommen. Er hat einen von den weißen Briefbogen vom Wohnzimmerschreibtisch benutzt, auf denen in Rot unser Name und die Adresse stehen. Der Brief ist mit blauem Kuli geschrieben, und er hat so fest aufgedrückt, dass es sich auf der Rückseite fast wie Blindenschrift anfühlt. Er schreibt, dass er uns vermisst und uns liebt und dass wir nach Hause kommen und wieder mit ihm zusammenleben sollen. Meine Mutter erlaubt mir, den Brief in der Außentasche meines Koffers aufzuheben. Sie antwortet ihm nicht. Ich schon, aber ich will nicht so klingen, als ob ich schöne Ferien hätte, aber auch nicht so traurig, dass er sich Sorgen um mich macht, deshalb wird es ein schlechter, langweiliger Brief. Er schreibt nicht zurück.
Nach dem Brief von meinem Vater fängt Nora an, mir Karten mit Blumen oder Rotkehlchen vorne drauf und kleinen Versen innen drin zu schicken. Einer geht so:
Der kleine Vogel zwitschert: «Piep!
Ich weiß da wen, der hat Dich lieb.»
Sie unterschreibt mit Immer Deine Nora.
Ich warte auf einen Brief von Neal. Fast jeden Morgen begleite ich meinen Großvater zum Chigham General Store, wo er den Boston Globe und für mich eine Schachtel Zimtbonbons kauft. Dann gehen wir in das kleine Postamt auf der anderen Straßenseite. Hinter dem Schalter sitzt eine Frau, die Mavis heißt und bei allem, was mein Großvater zu ihr sagt, errötet. Ich stelle mich jedes Mal anderswohin in dem kleinen Raum – wenn ich haargenau am richtigen Platz stehe, denke ich, dann wird im Postfach meines Großvaters ein Brief von Neal liegen. Mein Großvater plaudert mit Mavis, fünf Minuten, zehn Minuten, und scheint überhaupt nicht zu bemerken, wie tiefrot ihre flaumüberzogenen Wabbelbäckchen glühen. Dann endlich zieht er den Schlüssel aus der Tasche und geht hinüber zu Fach Nummer 5, und ich starre auf die Dielenbretter vor meinen Füßen, bis ich das Türchen zuklicken höre, und mein Herz klopft wie irr, und erst wenn feststeht, dass von Neal nichts gekommen ist, beruhigt es sich langsam wieder.
Ende Juli besucht uns mein Bruder mit seiner neuen Freundin Heidi.
«Hermey!», sagt er und hebt mich hoch und drückt mich. Er ist unrasiert und mieft ein bisschen. «Hermey ist ja eine Riesin geworden! Und noch krisselhaariger, wenn das überhaupt geht!» Er findet, ich sehe aus wie Hermey, der kleine Spielzeugmacher bei Rudolph mit der roten Nase, der lieber Zahnarzt wäre.
«Das ist von der feuchten Luft», sage ich und versuche, die Kräusel platt zu drücken.
Er stellt uns Heidi vor. Sie hat lange glatte Haare und klare grüne Augen. Er hat sie Ende Juni auf einer Party in Somerville kennengelernt, wo er den Sommer über wohnt.
«Welches Datum?», frage ich, als wir nach dem Essen auf der Couch sitzen.
«Keine Ahnung. Montag, jedenfalls.»
«Am vierundzwanzigsten.» Sie gibt meinem Bruder einen Klaps.
«Aua», sagt er, aber es tut ihm nicht echt weh.
«Einen Abend, bevor wir aus der Myrtle Street weggegangen sind», sage ich. Alles teilt sich für mich in Vorher und Nachher.
«Ich heirate sie, Daley», sagte er, als sie einmal auf dem Klo ist. Er legt sich beide Hände an den Kopf und drückt zu. «Shit. Ich heirate sie.»
Als sie zurückkommt, schlingt er beide Arme um sie, tatscht an ihren Haaren rum und lacht in ihren Hals. Ich habe ihn noch nie mit einem Mädchen erlebt. Bis jetzt hat er immer nur irgendwelche Freunde mit heimgebracht, mit denen er das ganze Wochenende in seinem Zimmer gehockt und Gitarre gespielt und kleine Papiervierecke um etwas gerollt hat, was wie bröslige Erde aussah. Sie haben Platten aufgelegt, von denen ich noch nie gehört hatte, Kühlschrank und Speisekammer bis auf den letzten Krümel leer gefuttert, und das war’s bis zum nächsten Mal. Aber bei Heidi ist Garvey völlig anders. Er ist lieb und sanft und fragt sie ständig, was sie denkt und was sie möchte.
«Ihn hat’s richtig erwischt», sagt meine Mutter.
Wir liegen in unseren Betten und hören sie drüben in Heidis Zimmer murmeln. Meine Mutter erzählt mir von ihrer ersten Liebe. Sie hat ihn in einem ihrer Sommer hier kennengelernt. Er war bei ihrem Cousin Jeremy zu Besuch. Jeremy kenne ich. Seine Haut ist so ledrig, dass er jetzt schon wie ein alter Mann aussieht. Er will immer, dass wir Kinder mit ihm segeln gehen, aber man muss nur einmal an der falschen Leine ziehen, schon schnauzt er einen an. Jeremys Freund hieß Spaulding. Er hatte meine Mutter von Jeremys Veranda aus beobachtet.
«‹Du bist ja eine Hübsche›, hat er einfach zu mir gesagt, auf so eine gedehnte Art, weil er aus Georgia kam, und das hat mich neugierig gemacht. Ich war vierzehn. Ich bin zu ihm auf die Veranda geklettert. Als wir zum ersten Mal abends ausgingen, sagte ich zu ihm, dass ich mir vorkäme wie in einem Roman. So ein Gefühl war das mit ihm. Das ist das Gefühl, das ich immer habe, wenn ich mich verliebe.»
Garvey und Heidi haben zu reden aufgehört und machen jetzt andere Geräusche. Ich weiß, was das ist, aber es klingt, als würden sie beide auf dem Bett herumspringen, was mir immer verboten wird.
«Ein Glück, dass Grindy inzwischen so taub ist», sagt meine Mutter.
Am nächsten Tag rudern wir mit einer Riesenportion Fried Chicken zu einer Insel mitten auf dem See. Beim Picknick leckt mein Bruder Heidi das Fett von den Fingern, bis meine Großmutter sie beide daran erinnert, dass es auch Servietten gibt. Hinterher drehen sie eine Runde um die Insel. Meine Großeltern machen die Runde andersherum, Schuhe an den Füßen, Arm in Arm, aneinandergelehnt, redend. Meine Mutter in ihrem gelben Bikini und der riesigen Sonnenbrille liest die Zeitung und diskutiert mit ihr wie immer. «Eine Lücke von fünf Minuten und achtzehn Sekunden auf dem neuesten Tonband. Was für ein Skandal!»
Für einen Sekundenbruchteil denke ich, dort auf der Titelseite ist mein Vater – die gebeugte Haltung, die schweren Brauen, die kleinen Augen –, aber es ist Nixon, der von der Eisentreppe seines Flugzeugs winkt.
Spät am Abend laufen Garvey, Heidi und ich bis vor zur Hauptstraße, wo der Himmel sich öffnet, und er ist so übersät von Sternen, dass ich Mühe habe, Kassiopeia und den Großen Wagen zu finden. Ich schaue hinauf, und sie scheinen zurückzuweichen, aber so fühlt sich diesen Sommer alles an; alles scheint wegzurücken von mir. Heidi erklärt mir, dass es die meisten Sterne, die wir sehen, schon nicht mehr gibt. Sie sind gestorben. Aber weil sie so weit weg sind und ihr Licht so lange braucht, um bis zu uns zu gelangen, können wir sie immer noch sehen, auch wenn sie gar nicht mehr da sind.
«Gibt es denn gar keine neuen?», frage ich.
«Doch, aber die sehen wir noch nicht.»
Ich biege den Kopf zurück und starre die toten Sterne an. Es ist ein unheimlicher Gedanke, dass wir das Licht von etwas sehen, das nicht existiert. Das Leben ist gar nichts, das ganze Weltall ist gar nichts. Von mir bleibt nicht mal ein Fünkchen Licht, wenn ich sterbe. Ich reiße meinen Blick los, schaue vor mir auf die Erde, aber es hilft nichts. Nirgends sind Straßenlaternen. Irgendwie kann ich nicht durchatmen. In meinen Händen und dann auch den Armen kribbelt es, als wären sie eingeschlafen, als würde fast kein Blut mehr darin fließen. Eine halbe Sekunde später, ohne jeden Grund, rast plötzlich mein Herz, viel schneller als jemals im Postamt, so schnell, dass es eigentlich nur noch explodieren kann. Ich sterbe. Ich weiß es ganz sicher. Ich gehe weiter, aber am liebsten würde ich mich zu einer Kugel zusammenrollen und um Hilfe betteln, bis jemand kommt und das Gefühl vertreibt. Mein Bruder und Heidi sind ein Stück vor mir, und es sieht aus, als würden sie über die Kante einer hohen Felswand hinauslaufen, und ich weiß, ich muss sterben, aber ich kann nicht nach ihnen rufen. Meine Stimme ist weg. Ich verschwinde. Sie schlagen den Weg zurück zur Landspitze ein. Ich befehle meinen Beinen, ihnen zu folgen.
«Blödsinn», höre ich Garveys Stimme.
«Wenn ich’s doch sage!»
Mein Bruder lacht, und einen Moment lang klingt er genau wie mein Vater. Er tippt ihr an die Stirn. «Was hast du da drin? Marshmallows?»
«Es stimmt wirklich. Mein Dad und ich sind oft im Dunkeln spazieren gegangen, und er hat mir alles über die Sterne erklärt.»
«Der Frittenbrater als verkappter Astronom?»
Sie haut ihn. Fest. Er lacht, dann haut er genauso fest zurück.
Ich kriege nicht richtig Luft. Mein Herz hört nicht auf zu rasen. Ich spüre gar keine Pause zwischen den einzelnen Schlägen mehr.
«Leck mich doch», sagt Heidi und rennt weg.
«Garvey», beginne ich. Ich will ihm sagen, dass er mich ins Krankenhaus bringen muss.
«Sie meint es nicht so», sagt er. «Sie kriegt nur manchmal einen kleinen Koller.»
Dass er mit mir redet, hat etwas Beruhigendes. «Sie ist nett», sage ich. Meine Stimme klingt komisch, wie aus einer Blechdose. Aber ich hoffe, dass er trotzdem weiterredet, und das tut er. Er erzählt mir, dass sie dieses Muttermal an der Hüfte hat, das ihn völlig wild macht, und dass sie küsst wie ein brünstiger Katzenwels.
Als wir beim Haus ankommen, ist sie nicht da. Garvey ruft nach ihr, und sie antwortet von weit weg. Schließlich finden wir sie: Sie sitzt vor Cousin Jeremys Haus im Gras.
«Alle diese Einfahrten sehen gleich aus», sagt sie.
Mein Bruder beugt sich vor, und sie zieht ihn zu sich herunter, und ich warte nicht ab, was danach kommt. Ich sage mir, dass ich wohl doch nicht sterbe, und laufe zurück zu meinen Großeltern.