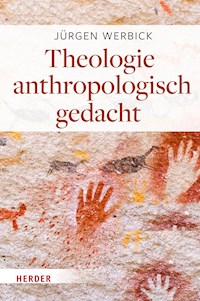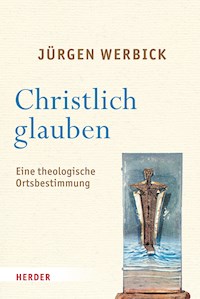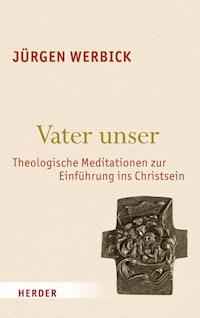
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Vaterunser ist das Grundgebet des Christentums. Aus ihm erschließt sich, was Christsein und Christwerden bedeutet, was die Christen herausfordert und bewegt, von welcher Hoffnung sie erfüllt sind. Mit seiner Auslegung der Vaterunser-Bitten führt Jürgen Werbick in das christliche Beten und den christlichen Glauben ein. Er nimmt die Herausforderungen auf, in die man hineingerät, wenn man den Wortlaut der Bitten Ernst nimmt und ins Gebet zu nehmen versucht. So erschließt er Gottes personal-überpersonale Wirklichkeit, deren guter Wille den Menschen als Lebensaufgabe und Lebensverheißung erfahrbar werden kann. Das Buch gibt Rechenschaft von der Hoffnung, die die Glaubenden erfüllt. Es führt ein in eine dieser Gotteshoffnung entsprechende, von ihr "beseelte" Weise des Menschseins, die sich geborgen weiß in Gottes unerschöpflich-kreativer Lebens- und Liebesmacht. Eine beeindruckende Einführung in den christlichen Glauben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Werbick
Vater unser
Theologische Meditationenzur Einführung ins Christsein
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2011
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
unter Verwendung der Bronzearbeit von Egino G. Weinert,
D 50068 Köln: „Seesturm (schlafender Jesu)“ – Nachdruck verboten
Datenkonvertierung eBook: le-tex publishing services GmbH
ISBN (E-Book) 978-3-451-33675-1
ISBN (Buch) ISBN 978-3-451-33252-4
Theologische Meditationen:Einführung ins Christsein
Glaubensgewissheit?
„Was ist elender als die Ungewissheit?“1 Aber was ist selbstverständlicher als die Ungewissheit? Dass wir uns auf ein „unerschütterliches Fundament“ (René Descartes2) gründen, von aller Ungewissheit befreit unser Lebenshaus bauen, unsere Heimat finden und bewohnen könnten, wer wird das selbstgewiss sagen? Aber weniger wird man von Gewissheit nicht erwarten dürfen. „Gewissheit gewinnen heißt: Heimat erlangen“, endlich wieder zuhause zu sein. Gewissheit ist – so Eberhard Jüngel – „der vertraute Aufenthalt bei dem, was mir gewiss ist. Gewissheit zu haben im Blick auf etwas besagt: bei diesem ein- und ausgehen können.“3 Dann sind wir heimatlos, Nomaden auf der Suche nach Gewissheit. Bei der Suche, die schon vergessen hat, dass sie Suche nach Gewissheit ist?
Oder bietet der Glaube diese Heimat, nicht als Selbst-, sondern als Gottesgewissheit? Eine Gewissheit, die ein- und ausgehen darf bei dem, dessen sie gewiss ist; nicht zweifelnd draußen herumirren muss auf der Suche nach dem zweifel-los Verlässlichen? „Wer zweifelt, glaubt nicht.“4 Wer glaubt, zweifelt nicht. Er wohnt in der Gottesgewissheit, muss nicht orientierungslos bleiben zwischen den vielen Versprechungen, die einem mehr oder weniger wohlfeile Gewissheits-Wohnungen offerieren. Ist es so?
Der Glaube schließt den Zweifel aus. Aber die Glaubenden können ihn kaum draußen halten: weil der den Zweifel überwindende Glaube nicht ganz selbstverständlich-zweifellos in ihnen wohnt; weil sie so oft nur Gäste sind in der Wohnung der Gottesgewissheit, in der die unruhige Suche endlich nachhause gekommen wäre. Einführung in den Glauben: Wenn das als Einführung in die Realität und den „Vollzug“ des Glaubens durch die Glaubenden – in ihr Christsein – gemeint sein soll, dann kann es nicht die Beschreibung der Wohnung sein, in welcher der Glaube bei sich und bei Gott zuhause ist. Dann kann eine Einführung nur bei den Versuchen begleiten, sich in den Glauben einzuleben, in ihm heimisch zu werden; dann kann von ihr auch nicht erwartet werden, dass sie die Zweifel aus dem Haus des Glaubens einfach hinauswirft. Sich in den Glauben einleben bedeutet, auch mit den Zweifeln leben zu lernen, allerdings ohne ihnen das Feld – die Wohnung – zu überlassen.
Ob die Metapher des Im-Glauben-zuhause-Seins es überhaupt trifft? Oder ist das Sich-Einleben in den Glauben eher das Vertrautwerden mit einer bestimmten Art des Unterwegsseins, mit einer Herausforderung, die uns gut unterwegs sein lässt? Die Vertrautheit mit einer Hoffnung? Mit einer guten Hoffnung unterwegs: ein geradezu kirchentagstaugliches Motto. Kann es über dieser Einführung stehen?
Hoffnung: nicht in einer Gewissheit zuhause, sondern von einer Vision auf den Weg gebracht, herausgefordert, sich in diese Vision hineinzuwagen, sich in sie zu „investieren“. Dynamik kommt besser als das Bleiben und Wohnen. Führt sie tatsächlich weiter – so dass man versuchen sollte, in sie einzuführen, mit ihr „anzustecken“? Das wäre ja auch wieder reichlich viel verlangt von einer „papierenen“ Einführung. Aber dies vermag sie vielleicht: in die christliche Praxis eines hoffnungsvollen Unterwegsseins so einzuführen, dass einleuchten kann, wohin sich diese Praxis unterwegs weiß und warum Christen der Überzeugung sind, dass sie auf gutem Weg und mit einer guten, für sich selbst sprechenden Hoffnung unterwegs sind.
Ob nicht auch in solcher Hoffnung Glaubensgewissheit „wohnt“? Sie ist ja nicht das vage Kalkül, ein Investment in diese Vision werde sich womöglich auszahlen, sondern das Ergriffensein von einer Herausforderung, der man nicht mehr ausweichen kann – weil man erfahren hat, dass man so auf rechte Weise hofft, dass man sich dieser Hoffnung anvertrauen darf. Die Gewissheit mag vielfach weniger „greifbar“ sein, als man es sich wünschte, weit angefochtener, als man es gelassen ertragen könnte. Aber in und aus ihr lebt eben doch, was den Glauben bewegt und die Hoffnung immer wieder neu aufleben lässt: Glaubend weiß ich, woher ich bin, worin ich lebe und bin und woraufhin – wofür – ich leben kann, wohin ich unterwegs bin. Ich „weiß“ es, ohne es auch nur im Geringsten ermessen zu können. Aber das hoffe ich: Es ist unendlich größer als alles, was ich ermessen kann, nicht kleiner. Das also bewegt die Hoffnung: der Glaube, dass ich auf das unendlichwohltuend Größere hoffen und eben nicht das Weit-Weniger oder Gar-Nichts gewärtigen muss.
Wie haben sich Christinnen und Christen in diese Hoffnung, in diesen Glauben eingelebt? Im Gebet, in diesem Gebet vor allem, das sie das Herrengebet nennen. In das Christsein einführen heißt Vertrautmachen damit, wie Christen sich in die Hoffnung des Glaubens hineingebetet und eingelebt haben, in ihr soviel Gewissheit gesucht und auch gefunden haben, dass sie ihren Weg durch die Abgründe ihres Lebens weiter gehen konnten; heißt, Auskunft darüber geben, warum sie der Überzeugung sein konnten, so auf rechte Weise zu hoffen und in ihrer Hoffnung die Wahrheit ihres Lebens zu berühren. Im Vaterunser geschah dieses Vertrautwerden, vielfach auch dieses Berühren. So besteht die Veranlassung, sich ihm anzuvertrauen, um in den christlichen Glauben eingeführt zu werden. Aber dürfen wir überhaupt hoffen? Auch noch unseren kühnsten Hoffnungen trauen? Oder beginnt nicht gerade damit das Unheil des Menschen? Dürfen wir hoffen, wenn wir der Erde treu bleiben, dem Kampf um das Lebenkönnen in ihr, den Erfahrungen der Tödlichkeit des Lebens, der Gleichgültigkeit unserer Welt gegen unsere Wünsche nach Geborgensein und Vollendetwerden? Oder ist gerade die Hoffnung mit ihrer „Fähigkeit, den Unglücklichen hinzuhalten“, das „Übel der Übel“; die End- und Jenseits-Hoffnung vor allem, welche die Leidenden durch eine Hoffnungs-Perspektive aufrecht erhält, der „durch keine Wirklichkeit widersprochen“ und die ja auch durch kein „einzelnes wirklich eintretendes Glück“ überholt werden kann?5
Dürfen wir hoffen?
Das ist der religionsskeptische Generalverdacht gegen die großen Hoffnungen wie gegen alle diejenigen, die sie hegen und pflegen: Allzu anspruchsvolle Hoffnungen führen weg von den Kämpfen, die wachen Sinnes heute bestanden werden müssen und Präsenz verlangen; sie betäuben gegen die Enttäuschungen, durch die man realitätsfähig werden muss. In den Glauben und seine Hoffnung einführen, heißt das nicht: wegführen von den Kampfplätzen, an denen heute das Leben gewonnen werden muss oder verloren geht; wegführen auch von den guten Orten, an denen es heute genossen, ausgeschöpft und verteidigt werden könnte, gesucht und verteidigt werden müsste? Glaube und Hoffnung: sind sie die großen Verführer der Menschen?
Eine Alternative wäre ja schon, die menschlichen Hoffnungen so weit zu ermäßigen, dass sie den Hoffenden eine realistische Handlungsperspektive vorgeben – sie von der großen Transzendenz abzuziehen und an die „mittleren“ oder „kleinen Transzendenzen“ zu heften: an politischmenschliche Befreiung, den Kampf um etwas mehr Gerechtigkeit, an das Sehnsuchtsziel eines guten Lebens in einer erfüllenden mitmenschlichen Beziehung. Der Kursverlust der großen religiösen Glaubenstraditionen mag viel mit dieser Zurücknahme des Hoffnungshorizonts zu tun haben;6 und mit der fast schon selbstverständlichen Unterstellung, dass die „kleinen“ und „mittleren“ Transzendenzen verloren geben oder gering schätzen müsste, wer sich weiterhin an die große Transzendenz hält.
Aber ist das nicht ganz aus der Perspektive derer gesehen und gesprochen, die es aufgegeben haben, in die große Transzendenz hineinzuhoffen und sich in sie hineinzuwagen; gesehen aus der Beobachterperspektive der „religiös Unmusikalischen“7 und distanziert Zuhörenden oder Zuschauenden, denen das Teilnehmen an den großen Hoffnungen – die Teilnehmerperspektive – irgendwie abhanden kam? Und ernsthaft weiter nachgefragt: Werden denen, die die großen Hoffnungen der Religionen authentisch – im Geist dieser religiösen Traditionen – mithoffen, die kleinen Transzendenzen tatsächlich unwichtig oder bedeutungslos, weil sie „mehr“ erhoffen, womöglich zu viel erhoffen? Wer sich biblisch-christlich von Jesus Christus selbst, so wie das Neue Testament ihn bezeugt, in die Hoffnung seines Gottesglaubens einführen lässt, der wird an die Orte geführt, an denen Menschen um die Fülle ihres Lebens ringen und ihr auf die Spur kommen wollen. Dafür, dass sie ihr auf die Spur kommen, weiß der Jesus des Johannesevangeliums sich gesandt (vgl. Joh 10,10). Wer sich von Jesus in die Glaubenshoffnung auf den Gott Israels hineinführen lässt, der gibt die Hoffnung darauf nicht verloren, dass Gerechtigkeit größer sein kann als alle Gerechtigkeit, die aus dem Bemühen der Frommen entspringt (vgl. Mt 5,20) – größer aber auch als die den Armen aufgezwungene Gerechtigkeit zum Vorteil der Reichen; der gibt die Hoffnung darauf nicht verloren, dass sich an Unterdrückung und Ausbeutung, am Unglück der Kleinen und an den lebensfeindlichen Einstellungen der Sünder noch etwas ändern kann.
Wer für sich und für andere unermüdlich und „unersättlich“ hofft, setzt auf die Möglichkeit der Veränderung im Großen und im Kleinen. Darin ist die Hoffnung unteilbar. Sie wäre nicht Hoffnung, sondern bloßes Kalkül, wenn sie nur auf den eigenen Vorteil setzte. Sie ist nicht bis ins Innerste Hoffnung, sondern schon von der Resignation verdorben, wenn sie nicht auf die Veränderung jetzt ihr Augenmerk richtet, sondern für irgendwann oder gar vom „Jenseits“ erst eine nennenswerte Besserung erwartet. Wer die Hoffnungs-Energie so „kanalisieren“ wollte, dass sie nicht mehr in alle Ritzen eines verfehlten und geschädigten Lebens eindringen könnte, um das Verriegelte aufzusprengen und die Resignation wegzuspülen; wer die Hoffnung aufsparen wollte für den „höchsten“, erst im Himmel zugänglichen „eigentlichen“ Gegenstand der Hoffnung, der würde sie ums Leben bringen, weil er sie aus dem Leben hier und jetzt herauszuhalten versuchte und dieses Leben sich selbst überlassen würde.
Die Hoffnung kann nur stark werden, wenn sie jetzt schon ihr Werk tun und die Menschen bewegen darf. Genau in diesem Sinne ist sie, jedenfalls in der Glaubensperspektive, unteilbar und nur so unendlich fruchtbar: Sie vermehrt sich gleichsam, sie teilt sich mit, wenn man aus ihr lebt. „Falsche Hoffnungen“ sind nicht solche, die an falsche Hoffnungsinhalte geheftet wären, sondern solche, die in falscher Weise hoffen; die sich nicht bereit halten für das Neue und Umwälzende, das geschehen kann und immer wieder neu geschieht, wenn die Hoffnung an das von ihr Erhoffte rührt, gar unendlich von ihm überholt wird.8
Einführung in den christlichen Glauben soll an den Punkt hinführen, an dem sich erschließt, was Christsein und Christwerden bedeutet, was die Christen wohltuend herausfordert und bewegt. Deshalb versucht sie Rede und Antwort zu stehen, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in den Glaubenden ist und sie erfüllt (vgl. 1 Petr 3,15) – wenn und insoweit sie ihnen geschenkt wurde.9 Sie ist Einführung in die biblisch-christliche Gotteshoffnung, in die rechte Art zu hoffen; Einführung aber auch in eine dieser Gotteshoffnung entsprechende, von ihr „beseelte“ Weise des Menschseins. Die Frage: Was ist der Mensch? entscheidet sich ja daran, woraus der Mensch lebt, ob und wie und welche Hoffnung ihm zugänglich geworden ist.10
Die rechte Art zu hoffen
Die Hoffnung der Menschen ist getroffen und auf die Probe gestellt von mehr oder weniger schmerzlichen Erfahrungen in dieser Welt: Es muss sich etwas ändern, wenn es gut werden soll mit meinem Leben und mit dem Leben in unserer Welt. Hervorgerufen und getragen ist menschliches Hoffen – wenn ich denn aus ihm leben kann – von einer wie auch immer erlangten und gewachsenen Zuversicht, dass sich ändern lässt bzw. dass sich ändern kann, was unseren Widerspruch und das brennende Verlangen hervorruft, es möge anders werden. In glücklichen Augenblicken nur hofft man darauf, dass es so bleibt, wie es jetzt Gott sei Dank ist. Hier muss die Hoffnung sich behaupten gegen die Angst vor der Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit unseres Glücks. In der Zukunft aber liegt, was über das Erfülltwerden unserer Hoffnung entscheidet. Hoffenden Herzens, handlungs-, ja kampfbereit wollen wir in die Zukunft hineingehen; neugierig darauf, was aus unserer Hoffnung wird: wie sie sich erfüllt und verändert, wie sie überholt wird, hoffentlich in eine neue, größere Hoffnung hinein.
In den nächsten Augenblick, in den Tag, in die Lebenszeit hineingehen, die sich jetzt öffnet, und kommen lassen, was auf mich zukommt; in dem, was da auf mich zukommt, suchen, was mir fehlt, oder in ihr dem auf der Spur bleiben, was ich schon gefunden habe, es nicht verlieren; mit dem Kommenden darum kämpfen, dass sich ändert, was nicht fortdauern darf; von dem, was kommt, nicht dazu gebracht werden, meine Hoffnung verloren zu geben; mit ihm darum ringen, was aus dieser Hoffnung werden muss und werden kann: all das gehört offenkundig mit hinein in die rechte Art zu hoffen. Ich vertraue mich dem an, was kommt, ohne ihm blind zu vertrauen. Ich weiß ja jetzt noch nicht, ob es mir „entgegenkommt“ oder mich überrollt, wo und wie es mich zum Kampf fordert, was es mir öffnen und schenken oder zumuten wird, was ich von dem, das da auf mich zukommt, ergreifen oder dankbar annehmen kann und was ich zurückweisen, wogegen ich mich bis ans Ende meiner Kräfte zur Wehr setzen muss. Soweit meine Hoffnung reicht, nehme ich die Herausforderung an, mich dem anzuvertrauen, was kommt, und mit ihm zugleich den Kampf darum auszukämpfen, dass es mir und uns gut tut, dass es für uns und unendlich weit darüber hinaus gut ist oder gut wird. Die rechte Art zu hoffen lebt davon, dass es neben der Bereitschaft, den Kampf aufzunehmen, auch Grund gibt, sich dem anzuvertrauen, was auf mich und auf uns zukommt; sie lebt dann selbstverständlich von der Weisheit der Unterscheidung, die das Vertrauenswürdige nicht mit dem Misstrauen und Widerstand Verdienenden vermischt oder verwechselt.
Was auf mich zukommt, fordert mich heraus. Versuche ich, es „auszusitzen“ oder zu vermeiden, in mir „sitzen zu bleiben“, bis es vorüber ist,11 geht es rücksichtslos über mich hinweg. Wenn ich mich nicht mit ihm einlasse, nehme ich nicht mehr teil an dem, was mit mir geschieht, kommt es nur noch über mich. Sich mit dem einzulassen, was jetzt auf mich zukommt, bedeutet aber, hinauszugehen ins Offene, bedeutet, etwas mit mir geschehen zu lassen; lässt es darauf ankommen, sich nicht mehr in der Hand zu haben. In die Hände von Menschen zu fallen, die mich ausnehmen wollen oder für ihre eigensüchtigen Zwecke missbrauchen, das kann mich ruinieren. Ihr Zugriff kann mich, wenn er bis zum Äußersten und bis ins Innerste geht, um mein Selbst bringen, um mein eigenes Leben und Wollen. Ich muss mich hüten, ihnen so ungeschützt in die Hände zu fallen. Schon alltäglich-mitmenschlich ist also dauernd neu zu entscheiden, was ich mit mir machen lasse und wo ich mich gegen den Missbrauch und die Missachtung meines Selbstseins und Selbstwollens zur Wehr setzen muss.
Um wie viel dramatischer stellt sich diese Frage, wo ich mich in der „Hand“ von Mächten und Dynamiken weiß, von denen ich gar nicht erwarten kann, dass sie mir wohlwollend entgegenkommen, wenn sie über mich kommen. Oder stellt sie sich hier gerade noch so, dass es um die minimalen Möglichkeiten geht, die mir bleiben, mir einen Schonraum zu erhalten? Es wäre grenzenlos naiv, sich in die Hände der Menschen fallen zu lassen oder sich solchen Mächten anzuvertrauen, die das Vertrauen der Menschen seit jeher missbrauchen und ihr Misstrauen seit jeher verdienen. Wäre es da eine Glaubens-Alternative zu sagen: „Wir wollen lieber JHWH, dem Herrn, in die Hände fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß; den Menschen aber möchte ich nicht in die Hände fallen“ (2 Sam 24,14)?
Sich Ihm anvertrauen?
Die Frage hat eine kaum zu überbietende innerbiblische Dramatik. Der Anti-Text zum eben aus dem 2. Samuelbuch zitierten steht im Hebräerbrief: „Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen“ (10,31). Steht Gott auf Seiten der furchtbaren Mächte und Instanzen, denen man nicht in die Hand fallen möchte? Ist Er ihr Verbündeter, gar ihr „Integral“? Der Autor des Hebräerbriefs wird das nicht behaupten wollen, eher das Gegenteil. Er setzt die „furchtbare Formel“ glaubens-pädagogisch ein: als Drohung, damit die Christusgläubigen in den ersten Verfolgungen nicht „zurückweichen und verloren gehen“, sondern „glauben und das Leben gewinnen“ (Hebr 10,39). Diese Pädagogik erscheint uns Heutigen eher zweifelhaft. Sie bringt den Gott und Vater Jesu Christi und der mit ihm Glaubenden ins Zwielicht. Auch der Hinweis, Gott sei nach dieser Passage im Hebräerbrief ja nur als gerechter Richter „furchtbar“ – nur für die „Zurückweichenden“ und vom Glaubenden Abfallenden –, ändert das Bild für uns Heutige eher geringfügig. Wäre er dann nicht doch für uns alle, fast ausnahmslos, furchtbar? Zuerst und vor allem zu fürchten, kaum zu unterscheiden von den anderen furchtbaren Mächten; allenfalls danach – wenn der Tag seines Schreckens vorüber ist – ein gnädiger Gott, aber eben nur für jene, die Seine „Vergeltung“ (Hebr 10,30 etwa mit Jes 35,4) überstanden haben?
In dieses Zwielicht darf der Gott und Vater Jesu Christi nicht geraten. Vielleicht sehen wir das heute deutlicher. Das Zutrauen, das die Beter des Psalms 31 sagen ließ: „In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr du treuer Gott … In deiner Hand liegt mein Geschick; entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfolger“ (Verse 6 und 16), mag für viele Juden und Christen über die Jahrhunderte hinweg kaum noch erschwinglich gewesen sein. Der, Dem die Menschen es oft genug an der Grenze ihres Zutrauenkönnens entgegenbringen, trägt aber nach den jüdisch-christlichen Glaubensüberlieferungen nicht die Züge eines Rächers, der zuerst zu fürchten ist.12 Christinnen und Christen werden in der Angefochtenheit ihres Zutrauens auf den Gekreuzigten schauen und sich immer wieder neu fragen, ob sie mit ihm den Psalm 31 beten können; ob sie mit ihm den Gebets-Weg von der Klage des Psalms 22 (Vers 1: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage?“; vgl. Mk 15,34) zum An-Vertrauenswort des Psalms 31 (vgl. Lk 23,48) finden.
Sich einem Anderen anvertrauen: Es gibt keinen höheren Vertrauenserweis, keinen größeren Vertrauens-„Vorschuss“ unter Menschen. Aber auch keine größere Zumutung. Es ist ja nur der Anfang, dass ich um sein Gehör bitte – und er mir sein Ohr leiht; dass ich ihn teilhaben lasse an meiner Suche, meinem Finden und Verlieren; dass ich ihn mitnehme auf meinen Wegen und Irrwegen. Wenn er sich bitten und in Anspruch nehmen lässt, wird er sich nahegehen lassen, was ich mit ihm teilen will, wird er sich mitnehmen lassen. Was er von mir „weiß“, lässt ihn nicht unberührt. Und ich kann nicht mehr darüber verfügen, was er damit macht; was aus meinem Leben wird, wenn er es teilt. Das kann mein Glück sein; aber auch mein Untergang. Das Wagnis liegt ebenso auf seiner Seite: Worauf lässt er sich ein, wenn er sich mitnehmen lässt? Wie wird er davon in Mitleidenschaft genommen?
Geben und Nehmen, ohne dass absehbar wäre, wohin das führt, das bedeutet sich anvertrauen. Unberührt bleibt keiner und keine der Beteiligten – bis dahin, dass zuletzt unentscheidbar, aber auch unwichtig wird, wer sich wem „zuerst“ anvertraute.
Wer sich einem Menschen anvertraut, riskiert den Vertrauensbruch. Und das Risiko ist umso größer, je mehr ich mich dabei ausliefere. Sich ausliefern macht abgründig wehrlos. Wehrlos darf ich mich nicht machen, wo ich es mit Mächten und Menschen zu tun habe, die auf mein Leben zugreifen und seine Richtung bestimmen wollen. Was da auf mich zukommt, darf nicht über mich verfügen. Darf Er es, Der in allem auf mich zukommt, was mich zuinnerst ergreift, herausfordert und in Anspruch nimmt; der Gott, Dessen Zukunft auch meine Zukunft wäre? Wie kann ich dann wissen, dass Er – in alldem? – auf mich zukommt? Und wie Er auf mich zukommt? Ich kann es nicht wissen. Und ich kann mir auch nicht im Vorhinein sicher sein, wann Er auf mich zukommt – wie in dem, was auf mich zukommt, um meinetwillen und um Gottes willen unterschieden werden muss: zwischen den Zumutungen, derer ich mich erwehren, mit denen ich kämpfen muss, und Seinem Da-Sein, dem ich mich anvertrauen, Seiner Zukunft, auf die hin ich mich öffnen darf.
Glauben bedeutet nach den biblischen Zeugnissen, sich Gottes Zukunft anzuvertrauen – und realisiert sich in der Fähigkeit zu entdecken, wie Er mich in meine Zukunft hineinführen und wo Er mich im Gegensatz dazu herausfordern will, den Zumutungen menschenfeindlicher Mächte zu widerstehen. Nicht die willenlose Unterwerfung unter das mir Widerfahrende ist hier gefragt, sondern das kluge Glaubensurteil darüber, wo Seine und meine gute Zukunft anfängt, wo Er sie mit mir anfängt und ich mich Ihm anvertrauen darf, und wo mich das fortdauernde Unheil zu überwältigen droht, so dass ich ihm den Kampf ansagen muss.
Die biblischen Glaubenszeugnisse führen ein in die Kunst, hier treffsicher zu unterscheiden. Sie bezeugen ja, wie Gott Menschen so angerührt hat, dass sie Ihn von den menschenund zukunftsfeindlichen Mächten unterscheiden und sich Ihm anvertrauen konnten. Er zeigte sich ihnen so, dass sie Ihn identifizieren und dass sie Ihm auf den Wegen folgen konnten, auf denen Er ihnen den Zugang zu Seiner Zukunft öffnen wollte. Als solche werden sie in der Bibel überliefert: als „Norm-Überlieferungen“ der Gottes-Unterscheidung, als Offenbarungs-Zeugnisse. In ihnen wird zunächst einmal offenbart, wie und warum Menschen dazu kamen, sich Ihm anzuvertrauen; wie Er ihnen – oft genug im Ringen mit ihrem Unwillen und Unverständnis – an-vertrauenswürdig wurde. In diesen Texten wird dann aber auch offenbar, wie Er sich von denen in Mitleidenschaft nehmen lässt, die Ihn in ihr Leben hineinziehen und in Anspruch nehmen, oft ohne sich Ihm und Seiner Zukunft wirklich anzuvertrauen; wie Er Er selbst bleibt, sich als der erweist, der für die Menschen da sein und Rettung sein will (vgl. Ex 3,14). So offenbart Er sich: als der An-vertrauenswürdige, Glaubwürdige, der das kluge Urteilsvermögen der Menschen mit der Frage heimsucht, ob es Ihn in all dem, wovon Menschen in Anspruch genommen werden, unverwechselbar als die schlechthin verheißungsvolle Wirklichkeit für die Menschen identifizieren kann.
In den christlichen Glauben einzuführen, kann eigentlich nur heißen, in diese Unterscheidungskunst einzuführen – anhand der Zeugnisse, in denen Er inmitten all dessen, was Menschen angeht und herausfordert, unterscheidbar wurde und sich den Menschen als anvertrauenswürdig erwies; unter Inanspruchnahme des menschlich-vernünftigen Urteilsvermögens, das unablässig nach überzeugenden Wahrheits-Kriterien suchen muss: nach Kriterien zur möglichst treffsicheren und wohl begründeten Unterscheidung zwischen dem für die nächste Wegstrecke oder gar definitiv Verlässlichen und dem Trügerischen, auf das man sich eben nicht verlassen, dem man sich nicht anvertrauen darf. In die Wahrheit des christlichen Glaubens einführen heißt nachzeichnen, warum Christinnen und Christen sich diesem Gott anvertrauen: dem Gott, wie er in den biblischen Zeugnissen identifizierbar und anvertrauenswürdig wird. Damit ist nicht gesagt, dass dieser Gott ein anderer sei als der in anderen religiösen Traditionen erfahrene. Aber es wird hier auf die Zeugnisse der Bibel und der christlichen Glaubensüberlieferung Bezug genommen, um sich von ihnen in die Identifizierbarkeit und Anvertrauenswürdigkeit Gottes einführen zu lassen.
Diesen Gott als anvertrauenswürdig zu erfahren, setzt die Selbsterfahrung voraus, mich auf das für mich Entscheidende hin nicht selbst in der Hand zu haben, sondern mich von dem zu empfangen, dem ich mich anvertrauen will. Dem ich mich so anvertraue, traue ich zu, dass es bei Ihm mit mir und auf alle anderen hin gesehen gut werden kann, dass Er einsteht für das Gute, über das hinaus ein Besseres gar nicht gedacht werden kann.13 Ich traue Ihm – um mit Kant zu sprechen – das höchste Gut, das höchste Gute zu. Aber anders als nach Kants transzendentalphilosophischem Gedankengang wende ich mich Ihm zu, vertraue ich mich Ihm an in der Glaubenshoffnung, durch Ihn und in Ihm in dieses Gutsein hinein-verwandelt zu werden, über das hinaus nichts Besseres gedacht werden kann; nicht an meiner Selbstbestimmung vorbei, sondern über sie hinaus und in ihr; auch in dem, was meiner Selbstbestimmung vorausliegt und was von ihr nicht mehr zu bestimmen ist, sie aber nicht durchkreuzt, sondern zu dem Ziel kommen lässt, jenseits dessen für sie kein Ziel mehr liegen kann.
In ihre äußerste menschliche Zuspitzung gerät solches Sich-Zuwenden und Anvertrauen-Wollen, ja Anvertrauen-Müssen angesichts des Todes. Ich werde mich end-gültig aus der Hand geben müssen. Und die Tragfähigkeit meines Glaubens-Zutrauens wird sich daran entscheiden, ob ich mich – in welcher Bewusstheit und Ausdrücklichkeit auch immer – den Gebetsworten des Psalms 31 anvertrauen kann, den Worten, die das Lukasevangelium als Jesu letztes Gebet zitiert: „Vater, in deine Hände gebe ich mein Pneuma hin“: übergebe ich, was mich beseelt, was mich ausmacht (23,4614). Werden diese Worte in die äußerste Glaubensbereitschaft einführen, Ihm zu überlassen, wie es mit meinem Pneuma in Ihm und durch Ihn gut werden kann, so gut, dass es gar nicht besser werden kann? Werden sie Ihm überlassen können, was in der Begegnung mit Ihm aus mir und meinem „Pneuma“ wird? Werden sie Ihn dann – und jetzt schon im Blick auf das jetzt vor mir Liegende und mir am Ende hoffentlich Bevorstehende – in diesem Sinne als meinen und unseren Vater ansprechen können?
Jesu letztes Gebet zum Vater verweist auf das Gebet, das er seinen Jüngern und damit allen Christinnen und Christen mit auf ihren Weg gegeben hat: das Vaterunser. Die nun folgenden Überlegungen versuchen, sich von den einzelnen Gebets-„Bitten“ des Vaterunsers in das rechte Gottes-Zutrauen einführen zu lassen und einzuführen. Und das nicht nur deshalb, weil kein Theologe und keine Predigerin von sich – von den eigenen Erfahrungen und Begabungen – ausgehend in das rechte Gott-Zutrauen einführen könnten und ihnen deshalb gar nichts anderes übrig bleibt, als sich an Jesu Wort zu halten. Das Vaterunser bietet sich als Einführung in den christlichen Gottesglauben auch deshalb an, weil es nach Auskunft der Experten für das Neue Testament die Verkündigung Jesu aufs Zentrale und Entscheidende hin verdichtet und weil es gültig in Sprache bringt, wie Menschen in der Nachfolgespur Jesu Christi sich nach dem „Vater“ ausstrecken, dem sie sich glaubend anvertrauen; weil sie so betend zur Sprache bringen, wer ihnen dieser göttliche Vater ist. Dem Beten zu diesem göttlichen Vater nachdenkend will diese Einführung im heutigen Lebens- und Erfahrungszusammenhang und auf heutiges Fragen und Nachdenken hin gesprochen zur Sprache bringen, was den Gott kennzeichnet, dem Christinnen und Christen sich glaubend anzuvertrauen suchen – und was sie deshalb von Ihm erhoffen, aber auch: dass sie es von Ihm erhoffen dürfen. In diesem Sinne ist das Vaterunser die „Einübung im Christentum schlechthin“ (Wolfgang Huber15).
Einführen – Hinführen
Sich zur Einführung in den christlichen Glauben wie zur Einübung ins Christsein an das Grundgebet der Christinnen und Christen anschließen, heißt aber auch, die Frage stellen, ob sich dieses Gebet heute noch sprechen lässt: als Gebet, als ein Text, mit dem ich mich identifiziere, in den ich mich betend einbringe. Das Beten ist ja der Ernstfall der Übernahme eines vorgegebenen Textes in die Verantwortung der ersten Person Singular. Kann ich so sprechen? Dass wir so sprechen, dass die Kirchen von altersher so sprechen, mag diese Verantwortung der ersten Person Singular in die Glaubensverantwortung einer Überlieferungsgemeinschaft einbetten, nimmt mir meine Verantwortung aber nicht ab. Das erfahren die Menschen heute vielleicht bedrängender als je zuvor, da die guten Worte auch in den Kirchen oft so schrecklich missbraucht wurden. Im Gebet müssen die Worte auf die Goldwaage gelegt werden. Es muss ernst und immer wieder neu er-wogen werden, welches Gewicht sie für mein Leben haben, ob sie meine Worte werden können – wie sie ihrem Missbrauch entrissen werden können, so dass es meine Worte sein können. Diese Erwägung ist aber der Grundvollzug einer Einführung und des Sich-einführen-Lassens in den christlichen Glauben. Wie auch immer die Erwägung schließlich ausfällt – gewogen und zu leicht befunden oder: Worte voller Lebens- und Hoffnungsgewicht – nur in ihr bekommt man es als Teilnehmer dieser Erwägung und nicht nur als ihr desengagierter Beobachter mit dem spezifischen Gewicht christlichen Glaubens zu tun. So lade ich zu dieser Erwägung ein.
Wenn ich die „Textsorte“ bestimmen sollte, der sich das Folgende zurechnen ließe, fällt mir nur der wenig treffsichere Begriff „theologische Meditation“ ein. Meditation: in die Mitte stellen und darum herumgehen, in immer weiteren Kreisen vielleicht; die Vaterunser-Bitten in die Mitte stellen und sich durch sie herausfordern lassen, auf sie hin Erfahrungen und Nachdenken zu konzentrieren. Theologische Meditationen: die Theologie kommt ins Spiel, wenn es darum geht, das Nachdenken auf diese Mitte hin zu konzentrieren und herauszufinden, wie von ihr bis in die vordringlichen Lebens- und Denkherausforderungen der Gegenwart hinein Konzentration ausgehen kann – und was von solcher Konzentration ablenkt, weil es im Vordergründigen und Unsachgemäßen hängen bleibt.16 Wege der Konzentration zu bahnen: auf das, wovon das Vaterunser spricht; und die Konzentration auf das Lebensentscheidende nachzuvollziehen, die von den Einzelbitten des Vaterunsers ausgeht, das ist die hoch gespannte Absicht der nachfolgenden Texte. Sie holen sich jeweils andere biblische Texte zu Hilfe; nicht um von der Konzentration auf den Grundvollzug des Christseins, das Beten im Sinne Jesu Christi, abzulenken, sondern um es in den Zusammenhang zu bringen, in den es ursprünglich gehört: in den Zusammenhang des Gottes-Zutrauens des zur Gott-Vertrautheit erwählten Volkes Israel.
Wohin aber führen die Einführungen in den christlichen Glauben, die uns die Vaterunser-Bitten, die Gebetsanrede zuvor, der Lobpreis und das Amen am Ende gewähren?
An den Ort der rechten Welt-Anschauung; dahin, wo man die Welt und die Menschen in ihr mit dem Blick des Vaters „im Himmel“ und des zu ihm betenden Gottes- und Menschensohnes würdigt.
An den Ort, wo sich Himmel und Erde berühren, von wo aus Gottes Segen in die Welt kommen und neu lebendig machen will, was ihr in der Schöpfung gegeben ist.
In die Hinwendung zu einer Gotteszukunft, die inmitten des unabwendbar zu Ende Gehenden anfängt und – mit den sterblichen Menschen – nicht aufhören wird anzufangen.
In die Wahrnehmung Gottes als personal-überpersonaler Wirklichkeit, deren guter Wille den Menschen erfahrbar und zur Herausforderung werden kann, im Mitwollen dieses guten Willens die Freiheit der „Kinder Gottes“ zu entdecken und zu bewähren.
Zur sachgemäßen Bestimmung des Verhältnisses von Endlichem und Unendlichem, Vorletztem und Letztem, die dem
jetzt
Notwendigen und Hilfreichen Aufmerksamkeit zuwendet, es also nicht zur
quantité négligeable
macht.
In die Erfahrung, aus der Vergebung zu leben und anderen Menschen durch Vergebung Leben zu schenken; in die Erfahrung, sich nicht verdienen, aber weitergeben und teilen zu können, woraus wir leben.
In eine Wahrnehmung des Bösen, die die „Übergriffigkeit“ des Bösen in der Welt klar vor Augen hat und sich im Vertrauen auf Gottes Zukunftsmacht dennoch nicht zur Resignation versuchen lässt.
Zur dankbaren Freude darüber, nicht nur in die endlose Dynamik des Verbrauchens und Verbrauchtwerdens verwickelt und in ihr aufgebraucht zu werden, sondern in Gottes unerschöpflich-kreative Lebens- und Liebesmacht „eingeborgen“ zu sein.
Diesen Wegweisungen gilt es zu folgen. Sie führen christlich offenkundig zum rechten Beten und Glauben und Hoffen.
Anmerkungen
1 Martin Luther, De servo arbitrio, Luthers Werke in Auswahl, hg. von O. Clemen (Bonner Ausgabe), Bd. 3, Berlin 61966, 99,25.
2 Vgl. René Descartes, Meditationes de Prima Philosophia – Meditation über die Erste Philosophie, übersetzt und herausgegeben von G. Schmidt, Stuttgart 1986, Erste Meditation (62– 65).
3 Gottesgewissheit, in: ders., Entsprechungen: Gott – Wahrheit – Mensch. Theologische Erörterungen, München 1980, 252–264, hier 253.
4 Ebd., 263.
5 Vgl. Friedrich Nietzsche, Der Antichrist, Aphorismus 23, in: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hg. von G. Colli und M. Montinari, München – Berlin 1980 (KSA), Bd. 6, 190.
6 Für diese Unterscheidung in kleine, mittlere und große Transzendenzen und die These, der Transzendenzbezug verlagere sich zunehmend von den großen auf die mittleren, vgl. Thomas Luckmann, Privatisierung und Individualisierung. Zur Sozialform der Religion in spätindustriellen Gesellschaften, in: Karl Gabriel (Hg.), Religiöse Individualisierung und Säkularisierung. Biographie und Gruppe als Bezugspunkte moderner Religiosität, Gütersloh 1996, 17–28.
7 Als religiös unmusikalisch bezeichnete sich mehrfach Jürgen Habermas (etwa in seiner Friedenspreisrede von 2001, in der er auch in einschlägigem Sachzusammenhang die Unterscheidung von Beobachterperspektive und Teilnehmerperspektive geltend machte; vgl. Jürgen Habermas, Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001. Laudatio: Jan Philipp Reemtsma, Frankfurt 2001, 19). Er griff damit eine Formel auf, die vermutlich Max Weber geprägt und ebenfalls als Selbstaussage gebraucht hatte (Brief an F. Tönnies, Max Weber Gesamtausgabe, Bd. II 6, Tübingen 1994, 65). Vgl. Hans Reinhard Seeliger, Religiöse Musikalität, in: Theologische Quartalschrift 187 (2007), 246f. Mir scheint allerdings, dass Habermas nicht in dem Sinne religiös unmusikalisch ist, dass er die Hoffnungen der Christen überhaupt nicht nachvollziehen könnte, dass sie ihm nichts bedeuten würden. Er kann sie vielleicht nicht teilen. Das heißt aber nicht, dass er sich nur in der Beobachterperspektive hielte. Vielleicht, ja wahrscheinlich ist die Unterscheidung von Teilnehmer- und Beobachterperspektive gar nicht vollständig.
8 Die Hoffnungsdimension des christlichen Glaubens hat Jürgen Moltmann für die Theologie des 20. Jahrhunderts exemplarisch herausgearbeitet; vgl. sein Buch: Theologie der Hoffnung, erstmals München 1964, seither in vielen Auflagen.
9 Dieser Conditionalis ist alles andere als harmlos. Er müsste glaubende Menschen davor bewahren, mit ihrer Hoffnung apologetisch-triumphierend als „argumentatives Pfund“ zu wuchern. „Der Mensch braucht Gott, sonst ist er hoffnungslos“, so sagt Papst Benedikt XVI. in seiner Enzyklika Spe salvi (Ziffer 23). Es wäre schlicht sachwidrig, wenn dieser Satz als Behauptung über die Hoffnungslosigkeit aller Weisen, ohne den Gott der Bibel zu leben, verstanden würde. Glaubenden Menschen steht das Urteil über solche Lebensweisen umso weniger zu, als sie selbst über den Grund ihrer Hoffnung nicht wie über ihr eigenes, wohlerworbenes Verdienst sprechen, sondern eben nur dankbar bekennen und Rechenschaft geben können, wenn er sich ihnen schenkt und ihnen Hoffnung begründet.
10 Es ist bekanntlich Immanuel Kant gewesen, der die beiden Fragen: Was dürfen wir hoffen? und: Was ist der Mensch? miteinander verknüpft hat. Sie haben ihr eigenes philosophisches Recht neben der erkenntniskritischen Frage: Was können wir wissen? und der ethischen Frage: Was sollen wir tun? Vgl. von Kant: Logik, in: Werke in 12 Bänden, hg. von W. Weischedel, Wiesbaden 1960, Bd. VI, A 25.
11 In ihrem Gedicht „Bitte“ spricht Hilde Domin eindrucksvoll von der Sinnlosigkeit dieses Versuchs:
„Wir werden eingetauchtund mit den Wassern der Sintflut gewaschen,wir werden durchnässtbis auf die Herzhaut.
Der Wunsch nach der Landschaftdiesseits der Tränengrenzetaugt nicht,der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten,der Wunsch, verschont zu bleiben,taugt nicht.
Es taugt die Bitte,dass bei Sonnenaufgang die Taubeden Zweig vom Ölbaum bringe.Dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei,dass noch die Blätter der Rose am Bodeneine leuchtende Krone bilden.
Und dass wir aus der Flut,dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofenimmer versehrter und immer heilerstets von neuemzu uns selbst entlassen werden“(Hilde Domin, Gesammelte Werke, Frankfurt a. M. 1987).
12 Dabei ist freilich einzuräumen, dass das Motiv der Rache und der Vergeltung JHWHs in alttestamentlichen Texten meist als hoffnungsvolle Perspektive „eingespielt“ wird. Für das von Verfolgern bedrängte Volk gilt: JHWHs Rache rettet und befreit aus „unverdienter“ Not; vgl. meinen Beitrag: Jahwes „Rache“ rettet, in: Der Prediger und Katechet 124 (1985), 558 – 561.
13 Damit ist eine Formulierung aufgegriffen, die seit dem „Gottesbegriff“ des Proslogions von Anselm von Canterbury immer wieder neu aufgegriffen und umformuliert worden ist; vgl. Proslogion 2.
14 Die Anrede „Vater“ ist hier der Gebetsformel des Psalms 31 hinzugefügt.
15 Vgl. Wolfgang Huber, Die Bedeutung von Spiritualität und Riten für die Zukunft des Christentums, in: Mitteilungen des Cartells Rupert Mayer, Juni 2008, 5 –20, hier 14.
16 Um die theologische Konzentration auf das im Herrengebet Ausgesprochene nicht zu sehr zu stören, sind Sachdiskussionen weitgehend in die Fußnoten ausgelagert. Hier finden sich Hinweise auf weiterführende Literatur und abweichende theologische Positionierungen.
I. Vater unser im Himmel(Gen 18,20–32; Lk 11,1–13; Röm 8,15–17)
„Jesus betete einmal an einem Ort;und als er das Gebet beendet hatte,sagte einer der Jünger zu ihm:Herr lehre uns beten,wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat“
(Lk 11,1).
„Der Geist selbst bezeugt es unserem Geist,dass wir Kinder Gottes sind.Wenn aber Kinder, so auch Erben –Erben Gottes, Miterben Christi,wofern wir mitleiden,um auch mitverherrlicht zu werden“
(Röm 8,16–17).
Beten lernen?
Beten führt ins Innerste und ins Äußerste, in den Ursprung, aus dem die Menschen immer wieder neu Subjekt werden, zum Ich- wie zum Du-Sagen herausgefordert werden – und in die Gemeinschaft. Man lernt und beginnt es, indem man in Glaubenstraditionen hineinwächst, mitbetet, sieht, wie andere beten. Die bei ihm waren und mit ihm zogen, sahen, wie Jesus betete. Selten nur trauen wir uns hinzuschauen, wenn Menschen beten. Es käme uns indiskret vor. Die Jünger Jesu schauen hin. So möchten sie beten können, voller Kraft und innerer Sammlung. Ihr Meister soll sie beten lehren, wie der Täufer Johannes seine Jünger beten lehrte. Wir erwarten kaum von den religiösen Experten, dass sie uns beten lehren. Meist wissen wir gar nicht, wie sie beten. Sie lassen uns nicht zuschauen und „reinschauen“ – von wohltuenden Ausnahmen abgesehen; Karl Rahner gehörte zu ihnen; und Martin Buber.1
Aber kann man das überhaupt lernen: ein Beten voller Kraft und Sammlung? Kann man es lernen, mit den elementaren Gebetsverlegenheiten zurechtzukommen: mit der ratlosen Frage, was das denn nützt? Kann man zurechtkommen mit den ins Leere gesprochenen Worten ohne Antwort und Resonanz; mit dem schlechten intellektuellen Gewissen, beim Beten etwas ganz Naives zu tun: Gott zu behelligen mit meinen kleinen und großen Sorgen? Wer könnte uns lehren, es mit dem Beten dennoch zu versuchen? Menschen, die wir beten sehen und denen wir zutrauen, dass das Beten bei ihnen von innen kommt und hindurchgeht durch alle Zweifel und Verlegenheiten, hindurchgeht durch ihr Leben, so dass wir es ahnend sehen können – ohne dass sie uns etwas vormachen oder „andemonstrieren“ wollen.
Damit fängt es immer wieder an, das Beten-Lernen. Andere haben damit angefangen; und ich staune, wenn ich sie beten sehe. Es geht leichter, wenn ich mitgenommen werde beim Beten, wenn andere es schon angefangen haben und ich mich anschließen darf. So ist es ja schon mein ganzes Leben lang: dass ich mich anschließen und meine Gebetsverlegenheiten mitbringen kann, nicht mit ihnen allein bleiben und nicht in ihnen geistlich verhungern muss. Glaube und Hoffnung und damit auch das Beten sind – so sagt es Fulbert Steffensky – „zu schwer für den Einzelnen. Man muss sich vergesellschaften, um zu leben“.2 Man muss sich zum gemeinsamen Gebet zusammenfinden, um den Mut zu fassen, dem allgegenwärtigen Zweifel standzuhalten.3 Vater unser: keiner ist allein, wenn er mit dem Beten anfängt, wenn er von dieser Anrede Gebrauch zu machen und sich selbst darin auszusprechen versucht.4
Wie kann ich beten?
Aber dann kommt es unvermeidlich doch zu der Frage: Wie kann ich beten? Ich bin es ja, der für sein Beten die Verantwortung übernehmen und den Mut aufbringen muss, damit anzufangen. Es fehlt meist nicht an den „guten Texten“. Das ja mitunter auch – man erinnere sich an die papierenen oder kunstgewerblichen Texte, die uns in der Liturgie oder in geistlicher Literatur so häufig zugemutet werden. Es fehlt noch viel mehr am guten Anfang. Wie kann ich es anfangen?
Vater unser im Himmel, so fängt Jesus an vorzubeten. Jetzt könnte man sich Informationen darüber holen, was Jesus gemeint haben könnte mit „im Himmel“ (oder wörtlich: „in den Himmeln“), Informationen über das „antike Weltbild“; Informationen auch darüber, warum das so nur bei Matthäus steht, nicht aber bei Lukas; Informationen schließlich darüber, warum Jesus lehrt, Gott mit „Vater“ anzureden. All das könnte beim Beten irgendwann weiterhelfen. Aber es wird mir kaum helfen, damit anzufangen. Lassen wir Jesus zuerst ganz unmittelbar zu uns sprechen, zu mir!
Im Himmel
Diese Unendlichkeit! Ein Mensch der Antike im ländlichen Palästina konnte sich das wohl noch weniger vorstellen als wir heute: das Welt-All, in dessen unendlichen Weiten man sich nur verloren vorkommen kann, weniger als ein Staubkorn. Bezogen auf die Zeiträume des Alls blitzt mein Leben kaum eine Nanosekunde auf, um sofort wieder zu verlöschen. In der Perspektive dieser Unendlichkeit bin ich ein Nichts, beinahe. Und Er, wenn Er Gott ist, Er ist der Herr dieses Alls. Es ist, weil Er es wollte. Auf Seinen guten Willen geht es zurück. Ist es nicht grenzenlos naiv – oder vermessen –, wenn ich Ihn anspreche: Mein Vater? Wenn ich Ihn ins Gespräch zu ziehen versuche über all das, was mich bedrängt, was mir fehlt?
Ich rede ja nicht nur von den großen Anliegen, die die ersten drei Bitten des Vaterunsers bestimmen: dass Gottes Name geheiligt werde, Sein guter Wille geschehe und das Reich Seiner Gerechtigkeit endlich komme. Ich rede von meinem Alltag; ich rede von dem, was mich leben ließe und mir doch so oft fehlt: Nahrung fürs Leben, für ein Leben, das ich gern lebe. Ich spreche von dem, was mich niederdrückt und an den Rand meiner Kräfte bringt: Schuld, Teufelskreise des Bösen, aus denen ich so wenig entrinnen kann. Ich spreche von meiner Mutlosigkeit, meiner Sisyphus-Existenz – hier unten auf der Erde, in den Niederungen, die kaum jemand wahrnimmt, eben nur von meinem und deinem Alltagsleben unter einem Himmel, der sich unendlich fern und unendlich teilnahmslos über allem Leben und Streben und Sterben und Totsein hinstreckt.
Vater
Zu Dem, Der die Himmel umfasst und hervorgehen ließ, zu Ihm soll ich Vater sagen – oder Mutter, darauf kommt es hier nicht entscheidend an.5 Zu Ihm darf ich kommen mit dem, was mich heute umtreibt. Er hat ein Ohr dafür. Er nimmt es wichtig. Es bedeutet Ihm etwas. Das ist kaum zu glauben. Völlig unvorstellbar. Verglichen damit sind alle weiteren Unvorstellbarkeiten und Verlegenheiten des Glaubens kaum der Rede wert. Wer zu beten anfängt, der versucht sich am Kaum-Verstehbaren. Er versucht einen Perspektivenwechsel.
Da ist die Perspektive der Beobachter. Sie nehmen in den Blick und analysieren, was sich in den unendlichen Zeit-Räumen abgespielt haben mag, noch abspielen könnte. Die Naturwissenschaften weisen uns ein in diese Beobachterperspektive, in der wir uns nur wie ein Fast-Nichts vorkommen werden. Aber immerhin sind wir es ja, die sich zu dieser Perspektive aufschwingen können. Wenn wir in ihr verharren, werden uns die Worte „Vater unser“ unsinnig erscheinen. In dieser Perspektive gibt es nur „Fakten“ – in unendlichen Räumen und Zeiten verschwindende Größen. Und wir selbst sind eine dieser verschwindenden Größen, kaum des Hinschauens wert; quantité négligeable, beim Blick aufs Große und Ganze zu vernachlässigen. Jesus ruft uns in die andere Perspektive: Es gibt eine Innenseite der Wirklichkeit, unsere Innen-Welt, die Innen-Welt Gottes, seines unendlichen Wohlwollens. Die Welt-Perspektive bloßer Beobachtung, in der es ganz und gar nicht auf mich ankommt, in der es praktisch keinen Unterschied macht, ob es mich gibt, was ich bin, erhoffe, erleide, was mir Freude macht – diese Weltperspektive ist nicht alles. Er nämlich, Er lässt es auf mich und auf jeden von uns unendlich ankommen.
Beten lehren hieße „über alles Worthafte hinaus: sich hinwenden lehren.“ Nicht die Abwendung muss sein, die Abwendung des beobachtenden Blicks von der Welt der Tatsachen, sondern darin und darüber hinaus die Hinwendung. Das All der Tatsachen und Fakten aber „bietet einem für den Akt der Hinwendung keinen Anhalt mehr. Nicht in die Ferne, nur in eine nicht mehr mit dem Weltraum koordinierbare Nähe und Vertrautheit hin kann sie geschehen.“ Und so ist hier „das erste, das aus dem Akt [der Hinwendung] selber hervorgehende Wort […] an den Vater gerichtet; erst danach wird der Herr der Basileia angerufen; so ist die Folge auch im jüdischen Gebet.“6
Größenwahn oder Gottvertrauen?
Es gibt nicht wenige, für die ist dieser Gebetsglaube nichts anderes als die kranke Ausgeburt des Größenwahns – oder der Hilflosigkeit von Menschen, die es nicht aushalten, angesichts unendlicher Weiten und Zeiten fast nichts zu sein. Aber wenn ich selbst fast nichts bin, wie könnte ich da die „Fast-Nichtse“, die die anderen wären, noch wichtig nehmen? Auch bei ihnen würde es ja fast keinen Unterschied machen, ob sie sind oder nicht und wie es um sie steht.
Der Gebetsglaube glaubt gegen das Fast-Nichts an. Er glaubt daran, dass es auf dich, auf mich, auf sie ankommt, weil Er es auf uns ankommen lässt. Der Betende nimmt sich ein Herz – und nimmt sich so wichtig, dass er Gott anzusprechen wagt, den Unendlichen, Unermesslichen. Es ist fast unbegreiflich, dass er das tut und das zu glauben wagt:7 den Unendlichen, der ein Herz für uns hat; und dass die Wirklichkeit eine Innenseite hat, in der es darauf ankommen kann; und dass wir uns ein Herz nehmen, zu Ihm zu beten, weil Er ein Herz für uns hat – eine Innenwelt, in der die Verlorenheiten in den unendlichen Erstreckungen der Räume und Zeiten bedeutungslos werden angesichts der Intensität, in der wir uns von Ihm ergreifen lassen und Ihm uns zuwenden können; angesichts des In-Seins in Ihm, in Seiner unendlichen Lebens-Intensität. Es ist fast unbegreiflich, dass Er uns „sieht“, mich und dich und ihn und sie ansieht – und sich nahegehen lässt, was er „sieht“. Es sich so nahegehen lässt, dass wir in Seiner Gegenwart und Zuwendung leben können.
Teilnehmerperspektive
Aber schon der Name Gottes sagt das: Ich bin der Ich bin da für euch und unter euch (Ex 3,14). Der „Ich bin für euch da“ nimmt teil an unserem Leben, hält sich nicht wie ein Beobachter heraus. Seine Perspektive ist die Teilnehmerperspektive.8 Und Er ruft uns in die Teilnehmerperspektive, in die Perspektive der Teilhabe an Seinem guten Willen – der Teilhabe an Seinem guten Geist, dem Geist der Kindschaft, „in dem wir rufen: Abba, Vater!“ (Röm 8,16). Nur in dieser Teilnehmer- und Teilhabeperspektive, die der Abba seinen „Kindern“ und „Erben“ (vgl. Vers 17) erschlossen hat, ist Gott da; nur im Anteilnehmen, im Mithandeln mit Ihm ist Er für uns da, handelt Er an uns und mit uns in der Welt. Wenn es nur ums „desengagierte“ Beobachten geht (Charles Taylor9), wenn wir uns heraushalten aus der Teilnehmer- und Teilhabeperspektive, ist Er nicht da. Er kann gar nicht da sein, wenn sich die, für die Er da ist, nur als die desengagierten und distanzierten Beobachter verstehen, die Ihm irgendwie auf die Schliche kommen wollen. Er ist nur für die da, die Augen haben wollen für Seine Spur in dieser Welt und Ihm in dieser Spur auf Seinem Weg durch die Welt nachzufolgen versuchen. Sind wir – dazu erwählt, Töchter und Söhne Seines Geistes zu sein – nicht da, wo dieser Geist uns beseelen kann und wohin er uns führen will, so sind wir ein Fast-Nichts, bedeutungslos, gesichtslos. Bei Gott, unserem Vater, haben wir ein Angesicht und Ansehen. Vor Ihm haben wir Würde.
Gesicht zeigen
Gott selbst zeigt Gesicht. Für die Christen ist es Jesus von Nazaret, der Christus, das Mit-uns-Sein Gottes in Person, in dem Gott Sein Gesicht zeigt. In ihm nimmt Gott teil am Leben, Leiden und Sterben der Menschen. In ihm ist Gottes teilnehmendes Dasein eine mitmenschliche Person geworden. Jesu göttlicher Vater ist nicht nur der in Seiner Unendlichkeit absolut Unzugängliche, der Ganz-Andere. Jesus zeigt Ihn ganz konkret mitmenschlich; er zeigt Sein Gesicht. Und der Vater, zu Dem er betet, lässt sich nahegehen, wie die Menschen Ihm ihr Gesicht zeigen: ihre Innenwelt, die Innenwelt ihrer Sehnsucht und ihres Scheiterns, ihres Leidens und ihrer Lebensfreude – ihre „Seele“.
„Wenn wir“ – so Romano Guardini – „das Antlitz eines Menschen anschauen, dann sehen wir darin, was in seiner Seele vor sich geht: den Respekt, die Zuneigung, den Hass, die Angst […]. Für sich kann man die Seele nicht sehen. Sie übersetzt sich aber in den Leib, und darin wird sie sichtbar. Der Menschenleib – Gestalt, Antlitz, Miene, Gebärde – ist die Erscheinung der Seelenwirklichkeit“.10 Die Seele, die Innenwelt eines Menschen sieht nur, wer in sein Gesicht sieht und sich davon berühren lässt. Nur so kommunizieren wir von Seele zu Seele: Wir nehmen an der Welt der anderen teil und betrachten sie nicht nur als Dinge in einer Umwelt; wir nehmen sie als Menschen wahr, die sich zeigen, aber auch sich verbergen und verweigern, sich inszenieren, schließlich doch sich uns öffnen können. Wir würdigen sie als Teilnehmer am gemeinsamen Leben und wollen selbst Teilnehmer sein, auch da noch, wo wir uns abgrenzen und den Blick abwenden, weil wir den Anblick nicht aushalten. Vom Gesicht des anderen bin ich aus der desengagierten Beobachtung in die Teilhabe und ins Teilnehmen gerufen. Das zeigt sich gerade da, wo ich ein Gesicht nur beobachte und dabei vom Blick des oder der anderen lieber nicht ertappt werden möchte. Das bloße Beobachten eines Gesichts bleibt unangemessen, weil wir im Gesicht das Innerste eines Menschen berühren und das gar nicht dürfen, ja gar nicht einmal können, wenn wir nur beobachten und taxieren.
Man kann im „Äußerlichen“ bleiben. Das Gesicht ist ja auch Materie. Das Innerste begegnet im Medium der Physis, worin es sich ausdrückt; sich ausdrückt in einem Äußeren, das es sich nicht aussuchen konnte, an dem es leiden mag, das es inszeniert und modelliert, damit man möglichst eine „gute Figur“ macht. Der bloße Beobachter sieht nur, was man von außen sieht. Er sieht nicht ins Herz. Gott, der Vater, sieht ins Herz, in die Seele, da Er sich – als Teilnehmer – nahegehen lässt, was den Menschen zuinnerst bewegt. Er steht dafür ein, dass mein Innerstes gewürdigt bleibt, auch wenn ich als „Gegenstand“ der beobachtbaren Außenwelt längst vergangen bin. Vor Ihm und für Ihn habe ich ein unverwechselbares Gesicht, das ich Ihm in meinem Beten zeigen darf: ein Antlitz, das erbittet, von Ihm „gesehen“ zu werden; ein Anruf, der darauf hoffen darf, gehört zu werden.