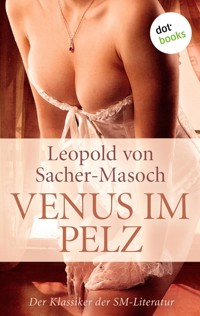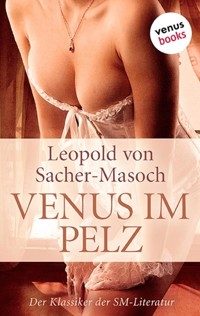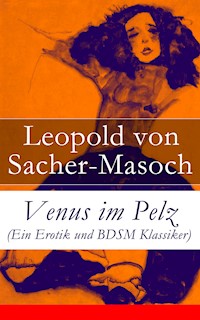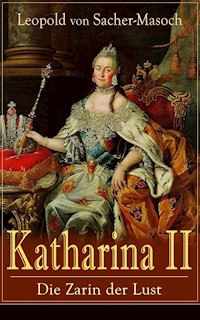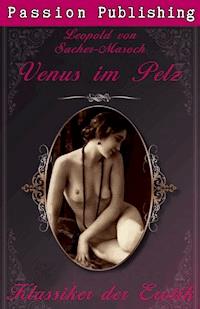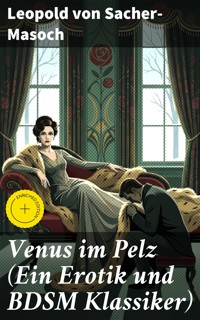0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Erotik bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer erbarmungslosen Liebe. Venus im Pelz ist eine Novelle (1870) von Leopold von Sacher-Masoch. Er beschreibt darin die extremen Wechselbäder der Gefühle, die der »Sklave« Severin durch seine Herrin Wanda erfährt. Mit Autobiographie des Autors. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Leopold Von Sacher-Masoch
Venus im Pelz
Mit Autobiografie des Autors
Leopold Von Sacher-Masoch
Venus im Pelz
Mit Autobiografie des Autors
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 3. Auflage, ISBN 978-3-954180-72-1
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Eine Autobiografie
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Erotik bei Null Papier
Die 120 Tage von Sodom
Justine
Erotik Früher
Fanny Hill
Venus im Pelz
Juliette
Casanova – Geschichte meines Lebens
Gefährliche Liebschaften
Traumnovelle
Die Memoiren einer russischen Tänzerin
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
»Gott hat ihn gestraft und hat ihn in eines Weibes Hände gegeben.«
Buch Judith 16. Kap. 7.
I.
Ich hatte liebenswürdige Gesellschaft.
Mir gegenüber an dem massiven Renaissancekamin saß Venus, aber nicht etwa eine Dame der Halbwelt, die unter diesem Namen Krieg führte gegen das feindliche Geschlecht, gleich Mademoiselle Cleopatra, sondern die wahrhafte Liebesgöttin.
Sie saß im Fauteuil1 und hatte ein prasselndes Feuer angefacht, dessen Widerschein in roten Flammen ihr bleiches Antlitz mit den weißen Augen leckte und von Zeit zu Zeit ihre Füße, wenn sie dieselben zu wärmen suchte.
Ihr Kopf war wunderbar trotz der toten Steinaugen, aber das war auch alles, was ich von ihr sah. Die Hehre hatte ihren Marmorleib in einen großen Pelz gewickelt und sich zitternd wie eine Katze zusammengerollt.
»Ich begreife nicht, gnädige Frau«, rief ich, »es ist doch wahrhaftig nicht mehr kalt, wir haben seit zwei Wochen das herrlichste Frühjahr. Sie sind offenbar nervös.«
»Ich danke für euer Frühjahr«, sprach sie mit tiefer steinerner Stimme und nieste gleich danach himmlisch, und zwar zweimal rasch nacheinander; »da kann ich es wahrhaftig nicht aushalten, und ich fange an zu verstehen –«
»Was, meine Gnädige?«
»Ich fange an das Unglaubliche zu glauben, das Unbegreifliche zu begreifen. Ich verstehe auf einmal die germanische Frauentugend und die deutsche Philosophie, und ich erstaune auch nicht mehr, dass ihr im Norden nicht lieben könnt, ja nicht einmal eine Ahnung davon habt, was Liebe ist.«
»Erlauben Sie, Madame«, erwiderte ich aufbrausend, »ich habe Ihnen wahrhaftig keine Ursache gegeben.«
»Nun, Sie –« die Göttliche nieste zum dritten Male und zuckte mit unnachahmlicher Grazie die Achseln, »dafür bin ich auch immer gnädig gegen Sie gewesen und besuche Sie sogar von Zeit zu Zeit, obwohl ich mich jedes Mal trotz meines vielen Pelzwerks rasch erkälte. Erinnern Sie sich noch, wie wir uns das erstemal trafen?«
»Wie könnte ich es vergessen«, sagte ich, »Sie hatten damals reiche braune Locken und braune Augen und einen roten Mund, aber ich erkannte Sie doch sogleich an dem Schnitt Ihres Gesichtes und an dieser Marmorblässe – Sie trugen stets eine veilchenblaue Samtjacke mit Fehpelz2 besetzt.«
»Ja, Sie waren ganz verliebt in diese Toilette, und wie gelehrig Sie waren.«
»Sie haben mich gelehrt, was Liebe ist, Ihr heiterer Gottesdienst ließ mich zwei Jahrtausende vergessen.«
»Und wie beispiellos treu ich Ihnen war!«
»Nun, was die Treue betrifft –«
»Undankbarer!«
»Ich will Ihnen keine Vorwürfe machen. Sie sind zwar ein göttliches Weib, aber doch ein Weib, und in der Liebe grausam wie jedes Weib.«
»Sie nennen grausam«, entgegnete die Liebesgöttin lebhaft, »was eben das Element der Sinnlichkeit, der heiteren Liebe, die Natur des Weibes ist, sich hinzugeben, wo es liebt, und alles zu lieben, was ihm gefällt.«
»Gibt es für den Liebenden etwa eine größere Grausamkeit als die Treulosigkeit der Geliebten?«
»Ach!« – entgegnete sie – »wir sind treu, so lange wir lieben, ihr aber verlangt vom Weibe Treue ohne Liebe, und Hingebung ohne Genuss, wer ist da grausam, das Weib oder der Mann? – Ihr nehmt im Norden die Liebe überhaupt zu wichtig und zu ernst. Ihr sprecht von Pflichten, wo nur vom Vergnügen die Rede sein sollte.«
»Ja, Madame, wir haben dafür auch sehr achtbare und tugendhafte Gefühle und dauerhafte Verhältnisse.«
»Und doch diese ewig rege, ewig ungesättigte Sehnsucht nach dem nackten Heidentum«, fiel Madame ein, »aber jene Liebe, welche die höchste Freude, die göttliche Heiterkeit selbst ist, taugt nicht für euch Modernen, euch Kinder der Reflexion. Sie bringt euch Unheil. Sobald ihr natürlich sein wollt, werdet ihr gemein. Euch erscheint die Natur als etwas Feindseliges, ihr habt aus uns lachenden Göttern Griechenlands Dämonen, aus mir eine Teufelin gemacht. Ihr könnt mich nur bannen und verfluchen oder euch selbst in bacchantischem Wahnsinn vor meinem Altar als Opfer schlachten, und hat einmal einer von euch den Mut gehabt, meinen roten Mund zu küssen, so pilgert er dafür barfuß im Büßerhemd nach Rom und erwartet Blüten von dem dürren Stock, während unter meinem Fuße zu jeder Stunde Rosen, Veilchen und Myrten emporschießen, aber euch bekommt ihr Duft nicht; bleibt nur in eurem nordischen Nebel und christlichem Weihrauch; lasst uns Heiden unter dem Schutt, unter der Lava ruhen, grabt uns nicht aus, für euch wurde Pompeji, für euch wurden unsere Villen, unsere Bäder, unsere Tempel nicht gebaut. Ihr braucht keine Götter! Uns friert in eurer Welt!« Die schöne Marmordame hustete und zog die dunkeln Zobelfelle um ihre Schultern noch fester zusammen.
»Wir danken für die klassische Lektion«, erwiderte ich, »aber Sie können doch nicht leugnen, dass Mann und Weib in Ihrer heiteren sonnigen Welt ebenso gut wie in unserer nebligen, von Natur Feinde sind, dass die Liebe für die kurze Zeit zu einem einzigen Wesen vereint, das nur eines Gedankens, einer Empfindung, eines Willens fähig ist, um sie dann noch mehr zu entzweien, und – nun Sie wissen es besser als ich – wer dann nicht zu unterjochen versteht, wird nur zu rasch den Fuß des anderen auf seinem Nacken fühlen –«
»Und zwar in der Regel der Mann den Fuß des Weibes«, rief Frau Venus mit übermütigem Hohne, »was Sie wieder besser wissen als ich.«
»Gewiss, und eben deshalb mache ich mir keine Illusionen.«
»Das heißt, Sie sind jetzt mein Sklave ohne Illusionen, und ich werde Sie dafür auch ohne Erbarmen treten.«
»Madame!«
»Kennen Sie mich noch nicht, ja, ich bin grausam – weil Sie denn schon an dem Worte so viel Vergnügen finden – und habe ich nicht recht, es zu sein? Der Mann ist der Begehrende, das Weib das Begehrte, dies ist des Weibes ganzer, aber entscheidender Vorteil, die Natur hat ihm den Mann durch seine Leidenschaft preisgegeben, und das Weib, das aus ihm nicht seinen Untertan, seinen Sklaven, ja sein Spielzeug zu machen und ihn zuletzt lachend zu verraten versteht, ist nicht klug.«
»Ihre Grundsätze, meine Gnädige«, warf ich entrüstet ein.
»Beruhen auf tausendjähriger Erfahrung«, entgegnete Madame spöttisch, während ihre weißen Finger in dem dunkeln Pelz spielten, »je hingebender das Weib sich zeigt, umso schneller wird der Mann nüchtern und herrisch werden; je grausamer und treuloser es aber ist, je mehr es ihn misshandelt, je frevelhafter es mit ihm spielt, je weniger Erbarmen es zeigt, umso mehr wird es die Wollust des Mannes erregen, von ihm geliebt, angebetet werden. So war es zu allen Zeiten, seit Helena und Delila, bis zur zweiten Katharina und Lola Montez3 herauf.«
»Ich kann es nicht leugnen«, sagte ich, »es gibt für den Mann nichts, das ihn mehr reizen könnte, als das Bild einer schönen, wollüstigen und grausamen Despotin, welche ihre Günstlinge übermütig und rücksichtslos nach Laune wechselt –«
»Und noch dazu einen Pelz trägt«, rief die Göttin.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Ich kenne ja Ihre Vorliebe.«
»Aber wissen Sie«, fiel ich ein, »dass Sie, seitdem wir uns nicht gesehen haben, sehr kokett geworden sind.«
»Inwiefern, wenn ich bitten darf?«
»Insofern es keine herrlichere Folie für Ihren weißen Leib geben könnte, als diese dunklen Felle und es Ihnen –«
Die Göttin lachte.
»Sie träumen«, rief sie, »wachen Sie auf!« und sie fasste mich mit ihrer Marmorhand beim Arme, »wachen Sie doch auf!« dröhnte ihre Stimme nochmals im tiefsten Brustton. Ich schlug mühsam die Augen auf.
Ich sah die Hand, die mich rüttelte, aber diese Hand war auf einmal braun wie Bronze, und die Stimme war die schwere Schnapsstimme meines Kosaken, der in seiner vollen Größe von nahe sechs Fuß vor mir stand.
»Stehen Sie doch auf«, fuhr der Wackere fort, »es ist eine wahrhafte Schande.«
»Und weshalb eine Schande?«
»Eine Schande in Kleidern einzuschlafen und noch dazu bei einem Buche«, er putzte die heruntergebrannten Kerzen und hob den Band auf, der meiner Hand entsunken war, »bei einem Buche von – er schlug den Deckel auf, von Hegel – dabei ist es die höchste Zeit zu Herrn Severin zu fahren, der uns zum Tee erwartet.«
»Ein Seltsamer Traum«, sprach Severin, als ich zu Ende war, stützte die Arme auf die Knie, das Gesicht in die feinen zartgeäderten Hände und versank in Nachdenken.
Ich wusste, dass er sich nun lange Zeit nicht regen, ja kaum atmen würde, und so war es in der Tat, für mich hatte indes sein Benehmen nichts Auffallendes, denn ich verkehrte seit beinahe drei Jahren in guter Freundschaft mit ihm und hatte mich an alle seine Sonderbarkeiten gewöhnt. Denn sonderbar war er, das ließ sich nicht leugnen, wenn auch lange nicht der gefährliche Narr, für den ihn nicht allein seine Nachbarschaft, sondern der ganze Kreis von Kolomea4 hielt. Mir war sein Wesen nicht bloß interessant, sondern – und deshalb passierte ich auch bei vielen als ein wenig vernarrt – in hohem Grade sympathisch.
Er zeigte für einen galizischen Edelmann und Gutsbesitzer wie für sein Alter – er war kaum über dreißig – eine auffallende Nüchternheit des Wesens, einen gewissen Ernst, ja sogar Pedanterie. Er lebte nach einem minutiös ausgeführten, halb philosophischen, halb praktischen Systeme, gleichsam nach der Uhr, und nicht das allein, zu gleicher Zeit nach dem Thermometer, Barometer, Aerometer, Hydrometer, Hippokrates, Hufeland, Plato, Kant, Knigge und Lord Chesterfield; dabei bekam er aber zu Zeiten heftige Anfälle von Leidenschaftlichkeit, wo er Miene machte, mit dem Kopfe durch die Wand zu gehen, und ihm ein jeder gerne aus dem Wege ging.
Während er also stumm blieb, sang dafür das Feuer im Kamin, sang der große ehrwürdige Samowar, und der Ahnherrnstuhl, in dem ich, mich schaukelnd, meine Zigarre rauchte, und das Heimchen im alten Gemäuer sang auch, und ich ließ meinen Blick über das absonderliche Geräte, die Tiergerippe, ausgestopften Vögel, Globen, Gipsabgüsse schweifen, welche in seinem Zimmer angehäuft waren, bis er zufällig auf einem Bilde haften blieb, das ich oft genug gesehen hatte, das mir aber gerade heute im roten Widerschein des Kaminfeuers einen unbeschreiblichen Eindruck machte.
Es war ein großes Ölgemälde in der kräftigen farbensatten Manier der belgischen Schule gemalt, sein Gegenstand seltsam genug.
Ein schönes Weib, ein sonniges Lachen auf dem feinen Antlitz, mit reichem, in einen antiken Knoten geschlungenem Haare, auf dem der weiße Puder wie leichter Reif lag, ruhte, auf den linken Arm gestützt, nackt in einem dunkeln Pelz auf einer Ottomane; ihre rechte Hand spielte mit einer Peitsche, während ihr bloßer Fuß sich nachlässig auf den Mann stützte, der vor ihr lag wie ein Sklave, wie ein Hund, und dieser Mann, mit den scharfen, aber wohlgebildeten Zügen, auf denen brütende Schwermut und hingebende Leidenschaft lag, welcher mit dem schwärmerischen brennenden Auge eines Märtyrers zu ihr emporsah, dieser Mann, der den Schemel ihrer Füße bildete, war Severin, aber ohne Bart, wie es schien um zehn Jahre jünger.
»Venus im Pelz!« rief ich, auf das Bild deutend, »so habe ich sie im Traume gesehen.« – »Ich auch«, sagte Severin, »nur habe ich meinen Traum mit offenen Augen geträumt.«
»Wie?«
»Ach! Das ist eine dumme Geschichte.«
»Dein Bild hat offenbar Anlass zu meinem Traum gegeben«, fuhr ich fort, »aber sage mir endlich einmal, was damit ist, dass es eine Rolle gespielt hat in deinem Leben, und vielleicht eine sehr entscheidende, kann ich mir denken, aber das weitere erwarte ich von dir.«
»Sieh dir einmal das Gegenstück an«, entgegnete mein seltsamer Freund, ohne auf meine Frage einzugehen.
Das Gegenstück bildete eine treffliche Kopie der bekannten »Venus mit dem Spiegel« von Titian in der Dresdener Galerie.
»Nun, was willst du damit?«
Severin stand auf und wies mit dem Finger auf den Pelz, mit dem Titian seine Liebesgöttin bekleidet hat.
»Auch hier ›Venus im Pelz‹«, sprach er fein lächelnd, »ich glaube nicht, dass der alte Venetianer damit eine Absicht verbunden hat. Er hat einfach das Porträt irgendeiner vornehmen Messaline gemacht und die Artigkeit gehabt, ihr den Spiegel, in welchem sie ihre majestätischen Reize mit kaltem Behagen prüft, durch Amor halten zu lassen, dem die Arbeit sauer genug zu werden scheint. Das Bild ist eine gemalte Schmeichelei. Später hat irgendein ›Kenner‹ der Rokokozeit die Dame auf den Namen Venus getauft, und der Pelz der Despotin, in den sich Titians schönes Modell wohl mehr aus Furcht vor dem Schnupfen als Keuschheit gehüllt hat, ist zu einem Symbol der Tyrannei und Grausamkeit geworden, welche im Weibe und seiner Schönheit liegt.
Aber genug, so wie das Bild jetzt ist, erscheint es uns als die pikanteste Satire auf unsere Liebe. Venus, die im abstrakten Norden, in der eisigen christlichen Welt in einen großen schweren Pelz schlüpfen muss, um sich nicht zu erkälten. –«
Severin lachte und zündete eine neue Zigarette an.
Eben ging die Türe auf und eine hübsche volle Blondine mit klugen freundlichen Augen, in einer schwarzen Seidenrobe, kam herein und brachte uns kaltes Fleisch und Eier zum Tee. Severin nahm eines der letzteren und schlug es mit dem Messer auf. »Habe ich dir nicht gesagt, dass ich sie weich gekocht haben will?« rief er mit einer Heftigkeit, welche die junge Frau zittern machte.
»Aber lieber Sewtschu –« sprach sie ängstlich.
»Was Sewtschu«, schrie er, »gehorchen sollst du, gehorchen, verstehst du«, und er riss den Kantschuk, welcher neben seinen Waffen hing, vom Nagel.
Die hübsche Frau floh wie ein Reh rasch und furchtsam aus dem Gemache.
»Warte nur, ich erwische dich noch«, rief er ihr nach.
»Aber Severin«, sagte ich, meine Hand auf seinen Arm legend, »wie kannst du die hübsche kleine Frau so traktieren!«
»Sieh dir das Weib nur an«, erwiderte er, indem er humoristisch mit den Augen zwinkerte, »hätte ich ihr geschmeichelt, so hätte sie mir die Schlinge um den Hals geworfen, so aber, weil ich sie mit dem Kantschuk erziehe, betet sie mich an.«
»Geh’ mir!«
»Geh’ du mir, so muss man die Weiber dressieren.«
»Leb’ meinetwegen wie ein Pascha in deinem Harem, aber stelle mir nicht Theorien auf –«
»Warum nicht«, rief er lebhaft, »nirgends passt Goethes ›Du musst Hammer oder Amboß sein‹ so vortrefflich hin wie auf das Verhältnis von Mann und Weib, das hat dir beiläufig Frau Venus im Traume auch eingeräumt. In der Leidenschaft des Mannes ruht die Macht des Weibes, und es versteht sie zu benützen, wenn der Mann sich nicht vorsieht. Er hat nur die Wahl, der Tyrann oder der Sklave des Weibes zu sein. Wie er sich hingibt, hat er auch schon den Kopf im Joche und wird die Peitsche fühlen.«
»Seltsame Maximen!«
»Keine Maximen, sondern Erfahrungen«, entgegnete er mit dem Kopfe nickend, »ich bin im Ernste gepeitscht worden, ich bin kuriert, willst du lesen wie?«
Er erhob sich und holte aus seinem massiven Schreibtisch eine kleine Handschrift, welche er vor mir auf den Tisch legte.
»Du hast früher nach jenem Bilde gefragt. Ich bin dir schon lange eine Erklärung schuldig. Da – lies!«
Severin setzte sich zum Kamin, den Rücken gegen mich, und schien mit offenen Augen zu träumen. Wieder war es still geworden, und wieder sang das Feuer im Kamin, und der Samowar und das Heimchen im alten Gemäuer und ich schlug die Handschrift auf und las:
»Bekenntnisse eines Übersinnlichen«, an dem Rande des Manuskriptes standen als Motiv die bekannten Verse aus dem Faust variiert:
»Du übersinnlicher sinnlicher Freier, Ein Weib nasführet dich!«
Mephistopheles.
Ich schlug das Titelblatt um und las: »Das Folgende habe ich aus meinem damaligen Tagebuche zusammengestellt, weil man seine Vergangenheit nie unbefangen darstellen kann, so aber hat alles seine frischen Farben, die Farben der Gegenwart.«
Gogol,5 der russische Molière, sagt – ja wo? – nun irgendwo – »die echte komische Muse ist jene, welcher unter der lachenden Larve die Tränen herabrinnen«.
Ein wunderbarer Ausspruch!
So ist es mir recht seltsam zumute, während ich dies niederschreibe. Die Luft scheint mir mit einem aufregenden Blumenduft gefüllt, der mich betäubt und mir Kopfweh macht, der Rauch des Kamines kräuselt und ballt sich mir zu Gestalten, kleinen graubärtigen Kobolden zusammen, die spöttisch mit dem Finger auf mich deuten, pausbäckige Amoretten reiten auf den Lehnen meines Stuhles und auf meinen Knien, und ich muss unwillkürlich lächeln, ja laut lachen, indem ich meine Abenteuer niederschreibe, und doch schreibe ich nicht mit gewöhnlicher Tinte, sondern mit dem roten Blute, das aus meinem Herzen träufelt, denn alle seine längst vernarbten Wunden haben sich geöffnet und es zuckt und schmerzt, und hie und da fällt eine Träne auf das Papier.
Lehnstuhl, Lehnsessel oder Armsessel <<<
Der Begriff Feh bezeichnet das graue Fell des russischen Eichhörnchens. <<<
Elizabeth Rosanna Gilbert auch bekannt als Lola Montez (✳ 17. Februar 1821 in Grange, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland; † 17. Januar 1861 in New York) war eine irische Tänzerin und eine Geliebte König Ludwigs I. von Bayern, der sie 1847 zur Gräfin Marie von Landsfeld erhob. <<<
Kolomea oder Kolomyja ist eine Stadt in der westukrainischen Oblast Iwano-Frankiwsk am linken Ufer des Flusses Pruth. <<<
russischer Schriftsteller (1809–1852) <<<
II.
Träge schleichen die Tage in dem kleinen Karpatenbade dahin. Man sieht niemand und wird von niemand gesehen. Es ist langweilig zum Idyllenschreiben. Ich hätte hier Muße, eine Galerie von Gemälden zu liefern, ein Theater für eine ganze Saison mit neuen Stücken, ein Dutzend Virtuosen mit Konzerten, Trios und Duos zu versorgen, aber – was spreche ich da – ich tue am Ende doch nicht viel mehr, als die Leinwand aufspannen, die Bogen zurechtglätten, die Notenblätter liniieren, denn ich bin – ach! nur keine falsche Scham, Freund Severin, lüge andere an; aber es gelingt dir nicht mehr recht, dich selbst anzulügen – also ich bin nichts weiter, als ein Dilettant; ein Dilettant in der Malerei, in der Poesie, der Musik und noch in einigen anderen jener sogenannten brotlosen Künste, welche ihren Meistern heutzutage das Einkommen eines Ministers, ja eines kleinen Potentaten sichern, und vor allem bin ich ein Dilettant im Leben.
Ich habe bis jetzt gelebt, wie ich gemalt und gedichtet habe, das heißt, ich bin nie weit über die Grundierung, den Plan, den ersten Akt, die erste Strophe gekommen. Es gibt einmal solche Menschen, die alles anfangen und doch nie mit etwas zu Ende kommen, und ein solcher Mensch bin ich.
Aber was schwatze ich da.
Zur Sache.
Ich liege in meinem Fenster und finde das Nest, in dem ich verzweifle, eigentlich unendlich poetisch, welcher Blick auf die blaue, von goldenem Sonnenduft umwobene hohe Wand des Gebirges, durch welche sich Sturzbäche wie Silberbänder schlingen, und wie klar und blau der Himmel, in den die beschneiten Kuppen ragen, und wie grün und frisch die waldigen Abhänge, die Wiesen, auf denen kleine Herden weiden, bis zu den gelben Wogen des Getreides hinab, in denen die Schnitter stehen und sich bücken und wieder emportauchen.
Das Haus, in dem ich wohne, steht in einer Art Park, oder Wald, oder Wildnis, wie man es nennen will, und ist sehr einsam.
Es wohnt niemand darin als ich, eine Witwe aus Lwow, die Hausfrau Madame Tartakowska, eine kleine alte Frau, die täglich älter und kleiner wird, ein alter Hund, der auf einem Beine hinkt, und eine junge Katze, welche stets mit einem Zwirnknäuel spielt, und der Zwirnknäuel gehört, glaube ich, der schönen Witwe.
Sie soll wirklich schön sein, die Witwe, und noch sehr jung, höchstens vierundzwanzig, und sehr reich. Sie wohnt im ersten Stock und ich wohne ebener Erde. Sie hat immer die grünen Jalousien geschlossen und hat einen Balkon, der ganz mit grünen Schlingpflanzen überwachsen ist; ich aber habe dafür unten meine liebe, trauliche Gaisblattlaube, in der ich lese und schreibe und male und singe, wie ein Vogel in den Zweigen. Ich kann auf den Balkon hinaufsehen. Manchmal sehe ich auch wirklich hinauf und dann schimmert von Zeit zu Zeit ein weißes Gewand zwischen dem dichten, grünen Netz.
Eigentlich interessiert mich die schöne Frau dort oben sehr wenig, denn ich bin in eine andere verliebt, und zwar höchst unglücklich verliebt, noch weit unglücklicher, als Ritter Toggenburg und der Chevalier in Manon l’Escault, denn meine Geliebte ist von Stein.
Im Garten, in der kleinen Wildnis, befindet sich eine graziöse kleine Wiese, auf der friedlich ein paar zahme Rehe weiden. Auf dieser Wiese steht ein Venusbild von Stein, das Original, glaube ich, ist in Florenz; diese Venus ist das schönste Weib, das ich in meinem Leben gesehen habe.
Das will freilich nicht viel sagen, denn ich habe wenig schöne Frauen, ja überhaupt wenig Frauen gesehen und bin auch in der Liebe nur ein Dilettant, der nie über die Grundierung, über den ersten Akt hinausgekommen ist.
Wozu auch in Superlativen sprechen, als wenn etwas, was schön ist, noch übertroffen werden könnte.
Genug, diese Venus ist schön und ich liebe sie, so leidenschaftlich, so krankhaft innig, so wahnsinnig, wie man nur ein Weib lieben kann, das unsere Liebe mit einem ewig gleichen, ewig ruhigen, steinernen Lächeln erwidert. Ja, ich bete sie förmlich an.
Oft liege ich, wenn die Sonne im Gehölze brütet, unter dem Laubdach einer jungen Buche und lese, oft besuche ich meine kalte, grausame Geliebte auch bei Nacht und liege dann vor ihr auf den Knien, das Antlitz gegen die kalten Steine gepresst, auf denen ihre Füße ruhen, und bete zu ihr.
Es ist unbeschreiblich, wenn dann der Mond heraufsteigt – er ist eben im Zunehmen – und zwischen den Bäumen schwimmt und die Wiese in silbernen Glanz taucht, und die Göttin steht dann wie verklärt und scheint sich in seinem weichen Lichte zu baden.
Einmal, wie ich von meiner Andacht zurückkehrte, durch eine der Alleen, die zum Hause führen, sah ich plötzlich, nur durch die grüne Galerie von mir getrennt, eine weibliche Gestalt, weiß wie Stein, vom Mondlicht beglänzt; da war mir’s, als hätte sich das schöne Marmorweib meiner erbarmt und sei lebendig geworden und mir gefolgt – mich aber fasste eine namenlose Angst, das Herz drohte mir zu springen, und statt –
Nun, ich bin ja ein Dilettant. Ich blieb, wie immer, beim zweiten Verse stecken, nein, im Gegenteil, ich blieb nicht stecken, ich lief, so rasch ich laufen konnte.
Welcher Zufall! Ein Jude, der mit Fotografien handelt, spielt mir das Bild meines Ideals in die Hände; es ist ein kleines Blatt, die »Venus mit dem Spiegel« von Titian, welch ein Weib! Ich will ein Gedicht machen. Nein! Ich nehme das Blatt und schreibe darauf: »Venus im Pelz«.
Du frierst, während du selbst Flammen erregst. Hülle dich nur in deinen Despotenpelz, wem gebührt er, wenn nicht dir, grausame Göttin der Schönheit und Liebe! –
Und nach einer Weile fügte ich einige Verse von Goethe hinzu, die ich vor kurzem in seinen Paralipomena1 zum Faust gefunden hatte.
An Amor!
»Erlogen ist das Flügelpaar, Die Pfeile, die sind Krallen, Die Hörnerchen verbirgt der Kranz, Er ist ohn’ allen Zweifel, Wie alle Götter Griechenlands, Auch ein verkappter Teufel.«
Dann stellte ich das Bild vor mich auf den Tisch, indem ich es mit einem Buche stützte und betrachtete es.
Die kalte Koketterie, mit der das herrliche Weib seine Reize mit den dunklen Zobelfellen drapiert, die Strenge, Härte, welche in dem Marmorantlitz liegt, entzücken mich und flößen mir zugleich Grauen ein.
Ich nehme noch einmal die Feder; da steht es nun:
»Lieben, geliebt werden, welch ein Glück! Und doch wie verblasst der Glanz desselben gegen die qualvolle Seligkeit, ein Weib anzubeten, das uns zu seinem Spielzeug macht, der Sklave einer schönen Tyrannin zu sein, die uns umbarmherzig mit Füßen tritt. Auch Simson, der Held, der Riese, gab sich Delila, die ihn verraten hatte, noch einmal in die Hand, und sie verriet ihn noch einmal und die Philister banden ihn vor ihr und stachen ihm die Augen aus, die er bis zum letzten Augenblicke von Wut und Liebe trunken auf die schöne Verräterin heftete.«
Ich nahm das Frühstück in meiner Gaisblattlaube und las im Buche Judith und beneidete den grimmen Heiden Holofernes um das königliche Weib, das ihm den Kopf herunterhieb, und um sein blutig schönes Ende.
»Gott hat ihn gestraft und hat ihn in eines Weibes Hände gegeben.« Der Satz frappierte mich.
Wie ungalant diese Juden sind, dachte ich, und ihr Gott, er könnte auch anständigere Ausdrücke wählen, wenn er von dem schönen Geschlechte spricht.
»Gott hat ihn gestraft und hat ihn in eines Weibes Hände gegeben«, wiederholte ich für mich. Nun, was soll ich etwa anstellen, damit er mich straft?
Um Gottes willen! Da kommt unsere Hausfrau, sie ist über Nacht wieder etwas kleiner geworden. Und dort oben zwischen den grünen Ranken und Ketten wieder das weiße Gewand. Ist es Venus oder die Witwe?
Diesmal ist es die Witwe, denn Madame Tartakowska knickst und ersucht mich in ihrem Namen um Lektüre. Ich eile in mein Zimmer und raffe ein paar Bände zusammen.
Zu spät erinnere ich mich, dass mein Venusbild in einem derselben liegt, nun hat es die weiße Frau dort oben, samt meinen Ergüssen. Was wird sie dazu sagen?
Ich höre sie lachen.
Lacht sie über mich?
Vollmond! da blickt er schon über die Wipfel der niederen Tannen, welche den Park einsäumen, und silberner Duft erfüllt die Terrasse, die Baumgruppen, die ganze Landschaft, so weit das Auge reicht, in der Ferne sanft verschwimmend, gleich zitternden Gewässern.
Ich kann nicht widerstehen, es mahnt und ruft mich so seltsam, ich kleide mich wieder an und trete in den Garten.
Es zieht mich hin zur Wiese, zu ihr, meiner Göttin, meiner Geliebten.
Die Nacht ist kühl. Mich fröstelt. Die Luft ist schwer von Blumen- und Waldgeruch, sie berauscht.
Welche Feier! Welche Musik ringsum. Eine Nachtigall schluchzt. Die Sterne zucken nur leise in blassblauem Schimmer. Die Wiese scheint glatt, wie ein Spiegel, wie die Eisdecke eines Teiches.
Hehr und leuchtend ragt das Venusbild.
Doch – was ist das?
Von den marmornen Schultern der Göttin fließt bis zu ihren Sohlen ein großer dunkler Pelz herab – ich stehe starr und staune sie an, und wieder fasst mich jenes unbeschreibliche Bangen und ich ergreife die Flucht.
Ich beschleunige meine Schritte; da sehe ich, dass ich die Allee verfehlt habe, und wie ich seitwärts in einen der grünen Gänge einbiegen will, sitzt Venus, das schöne, steinerne Weib, nein, die wirkliche Liebesgöttin, mit warmem Blute und pochenden Pulsen, vor mir auf einer steinernen Bank. Ja, sie ist mir lebendig geworden, wie jene Statue, die für ihren Meister zu atmen begann; zwar ist das Wunder erst halb vollbracht. Ihr weißes Haar scheint noch von Stein und ihr weißes Gewand schimmert wie Mondlicht, oder ist es Atlas? Und von ihren Schultern fließt der dunkle Pelz – aber ihre Lippen sind schon rot und ihre Wangen färben sich, und aus ihren Augen treffen mich zwei diabolische, grüne Strahlen und jetzt lacht sie.