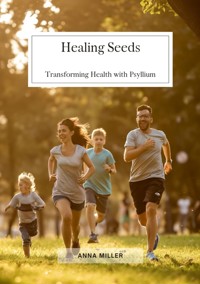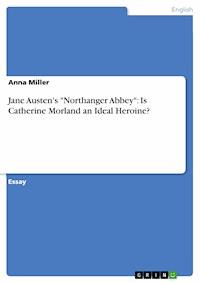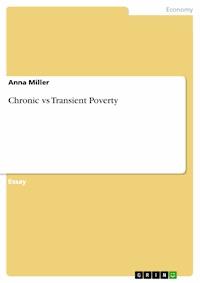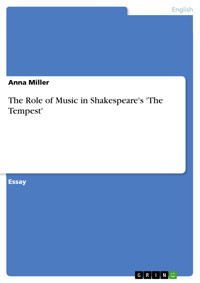10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Endlich digitale Balance finden Anna Miller hat DEN Ratgeber für eine digitale Ernährungsumstellung geschrieben. Sie greift neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie, Neuropsychologie, Motivations- und Beziehungsforschung auf und stellt das Digitale in einen größeren Zusammenhang. Dieses Buch gibt konkrete Tipps und Übungen an die Hand, damit wir uns unseres eigenen Umgangs und Konsums mit Smartphone und Bildschirm bewusst werden und gleichzeitig eine neue Vision für ein gutes Leben entwickeln können. Denn was wir uns eigentlich alle wünschen, ist in den letzten Jahren zu kurz gekommen: Fokus, Energie, Kreativität, Nähe und echte Verbundenheit. Zeit, uns das alles zurückzuholen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
verbunden
Die Autorin
Anna Miller, geboren 1987, ist Journalistin, Autorin und Expertin für digitale Achtsamkeit. Sie hat einen Master-Abschluss in Positiver Psychologie und schreibt regelmäßig über Gesellschaftsthemen – unter anderem für das SZ Magazin, Zeit Online, den Stern, die NZZ am Sonntag und die Republik. Sie spricht auf Podien und im TV über psychische Gesundheit und berät Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen zum Thema Verbundenheit im digitalen Zeitalter.
Das Buch
Anna Miller hat den Ratgeber für die digitale Ernährungsumstellung geschrieben. Sie greift aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie, Neuropsychologie, Motivations- und Beziehungsforschung auf und stellt das Digitale in einen größeren Zusammenhang. Dieses Buch gibt konkrete Tipps und Übungen an die Hand, sich seines eigenen Umgangs und Konsums mit Smartphone und Bildschirm bewusst zu werden und gleichzeitig eine neue Vision für ein gutes Leben zu zeichnen. Denn was wir uns eigentlich alle wünschen, ist in den letzten Jahren zu kurz gekommen: Fokus, Energie, Kreativität, Nähe und echte Verbundenheit. Zeit, uns das alles zurückzuholen!
Anna Miller
verbunden
Wie du in digitalen Zeiten wieder Platz schaffst für Dinge, die dir wirklich wichtig sind
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, MünchenInnenabbildungen: © Frederike SchreweAutorinnenfoto: © Peter HauserE-Book-Erstellung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-2846-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
VORWORT
ENDLICH VERBUNDEN.
FALSCH VERBUNDEN
Warum du das Digitale liebst. Und was es dich kostet.
Warum du schlafloser, ängstlicher und schmerzanfälliger bist.
Warum du dich einsam fühlst, obwohl du ständig verbunden bist.
Warum du Dinge, die dir wichtig sind, nicht anpackst.
Warum du dich schlechter konzentrieren kannst.
Warum wir echte Verbundenheit brauchen: Die Wissenschaft des Glücks
Was hat dein digitaler Konsum mit Glück zu tun?
Was Verbundenheit wirklich bedeutet
NEU VERBUNDEN
Wie du in digitalen Zeiten wieder Platz schaffst für Dinge, die dir wirklich wichtig sind.
1. Mach dich startklar für deine Reise
2. Gib deinem Leben Halt und Struktur
3. Nähre deinen Körper
4. Beruhige deinen Geist
5. Liebe leidenschaftlich und sicher
6. Finde neue Freunde
7. Erziehe starke Kinder
8. Lerne, fokussiert zu arbeiten
9. Erlaube deiner Kreativität Raum
10. Übernimm Verantwortung für andere
NACHWORT
DANK
Anhang
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Motto
Uns Mutigen gehört die Welt.
VORWORT
No, we don’t need more sleep. It’s our souls that are tired, not our bodies. We need nature. We need magic. We need adventure. We need freedom. We need truth. We need stillness. We don’t need more sleep, we need to wake up and live.
– Brooke Hampton
Unverbundenheit ist mir vertraut. Vielleicht suche ich gerade deshalb so sehr nach Verbindung. Nach menschlicher Nähe, nach Wärme und Geborgenheit. Nach diesem Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein, aus dem ich nicht mehr herausfalle. Seit ich denken kann, versuche ich, mich zu verbinden. Nicht nur, weil ich Unverbundenheit kenne. Sondern schlicht, weil ich ein Mensch bin.
Wir Menschen sind Verbindung. Wir existieren, weil sich ein Ei und ein Spermium zusammengetan haben. Weil zwei Menschen sich begegnet sind. Nicht bloß oberflächlich, sondern durchdringend. Wir wachsen in einem Bauch, umgeben von Wasser, wir spüren alles, was unsere Mutter spürt. Unsere Körper bestehen aus Millionen von Nervenbahnen und Blutbahnen, wir sind ein unendliches Geflecht. Es gehört zu unserer Natur, dass wir andere Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Wir sind keine Inseln. Wir hätten alleine nie überlebt. Und wir werden krank, wenn wir uns längere Zeit einsam fühlen. Wir hängen so sehr an unseren Schulfreunden, dass wir uns mit ihnen zusammen blaue Strähnen in die Haare machen lassen oder tagelang nicht essen, wenn sie uns hänseln. Wir würden alles dafür tun, geliebt zu werden. Kontakt ist für uns so wichtig wie Wasser und Nahrung. Und für unser Gehirn ist soziale Zurückweisung das Gleiche wie eine körperliche Verletzung. Die gleichen Areale sind aktiv. Menschliche Zurückweisung tut physisch weh.
Deshalb lieben wir das Internet. Weil es uns Verbindung verspricht. Klar, da ist die Zeitersparnis, die Ungebundenheit von Zeit und Ort, da sind die leichteren Prozesse. Wir können auf Bali am Strand liegen und am Computer arbeiten. Wir können über unsere geografischen und uns vertrauten Grenzen hinweg Menschen daten, die unsere eigene innere Lebensrealität so viel besser verstehen. Und wenn wir gerne einen Vibrator kaufen würden, müssen wir uns nicht mehr mit rotem Kopf in einem Laden beraten lassen, auf die Gefahr hin, dass der Nachbar dort auch grad einkauft, sondern können alles mehr oder weniger anonym nach Hause schicken lassen.
Doch das Digitale macht uns das Leben nicht bloß leichter und Abläufe schneller oder gibt uns, wenn die Langeweile uns befällt, ein paar lustige Spiele wie Candy Crush an die Hand. Das Digitale lässt uns auch fühlen. Lieben. Begehren. Miteinander sprechen. Deshalb haben diese Geräte, allen voran unser Smartphone, einen so hohen Stellenwert in unserem Leben. Weil es nicht bloß unser digitales Portemonnaie ist oder unser digitales Zugticket, sondern auch: unser Datingportal, unser Familien-Chat, unsere Freundschaftsliste, unser Fotoalbum, unser digitales Präsentationsfenster für die Follower-Welt. Wir verbringen über 40 Prozent unserer Wachzeit im Internet; ein Drittel dieser Zeit in den sozialen Medien.1 Unser Smartphone ist längst unser verlängerter sozialer Arm. Unsere primäre Kommunikationsquelle. Und immer öfter auch unser Gradmesser für unsere soziale Eingebundenheit.
Wenn jetzt jemand auf dich zukommen, die Hand ausstrecken und dich fragen würde: Magst du mir das Handy geben, für einen Tag, zwei Wochen, einen Monat? Was würdest du tun? Du würdest wohl nicht damit rausrücken wollen. Warum nicht? Was ist es, was dich hält?
Ich würde es nicht loslassen wollen, weil es mich mit meinen Freunden verbindet. Mit meinem Partner. Mit meinen eigenen Gedanken, die ich in mein digitales Notizbuch geschrieben habe. Mit meinen Erinnerungen an den Sommerurlaub, in Form von Fotos, die ich mir an einem Regentag anschaue, wenn ich im Bus durch die Stadt fahre und sonst nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Ich würde es auch nicht aus der Hand geben wollen, weil ich Angst hätte, dass meine Vorgesetzten meine Unerreichbarkeit nicht akzeptieren würden. Dass mir soziale Sanktionen drohen. Menschen, die sich von mir abwenden, Arbeitgeber, die mir den Job kündigen.
Ich hätte Angst, dass jemandem, den ich liebe, etwas zustößt und ich nicht erreichbar war. Ich würde es nicht aus der Hand geben wollen, weil ich mich mit der Musik, die es spielt, in Stimmung bringe. Mich mit Netflix regelmäßig davon ablenke, dass ich mich gerade einsam fühle und nicht so recht weiß, was ich mit meinem freien Abend eigentlich anstellen soll. Weil ich mich manchmal vor meinen eigenen Gedanken fürchte und vor der emotionalen Leere, die mich überkommt, wenn ich alleine zu Hause bin und es mir schwerfällt, zu akzeptieren, dass mein Leben an einem Dienstagabend aus nicht viel Aufregendem besteht, schon gar nicht aus etwas, das sich später für einen Social-Media-Post eignen könnte.
Dieses Gerät, von dem einige noch sagen, es sei doch bloß ein Telefon, ist für die meisten von uns schon lange existenziell geworden. Ein Ausdrucksmittel, ein Kommunikationsmittel, eine Ablenkungs-, eine Abschottungsmaschine.
Im Digitalen liegt unsere größte Chance. Und unser größter Fluch. Denn was uns verbindet, absorbiert uns auch. Je mehr wir versuchen, im Digitalen mit allen verbunden zu bleiben, desto öfter sind wir nicht mehr wirklich da. Physisch und emotional nicht mehr präsent im Raum, in dem wir uns gerade befinden. Je mehr digitale To-dos noch abzuarbeiten sind, desto stärker fühlen wir den Drang, immer weiterzumachen. Zwei Minuten Warten an der Bushaltestelle werden zu einem Slot, der sich organisieren, durchstrukturieren, abarbeiten lässt. Fünf Minuten Langeweile werden zu einem Raum, der uns unerträglich leer scheint, der gefüllt werden könnte mit Onlineshopping, YouTube-Tutorial, der Sprachnachricht an eine Freundin.
Oft verbinden wir uns so sehr mit unseren Geräten und all den Möglichkeiten, die sie bieten, dass die Verbundenheit zu uns selbst und der Welt um uns herum auf der Strecke bleibt. Wir scrollen morgens als Erstes eine Timeline runter und merken 20 Minuten später, dass wir eigentlich aufs Klo müssen. Wir wälzen uns nachts um zwei schlaflos in unseren Betten, weil wir uns mit unseren Partnern per WhatsApp gestritten haben und grade keinen Weg finden, real und physisch Frieden zu schließen. Wir lassen die Gitarre seit Monaten in der Ecke stehen oder machen die Jogging-Runde um den Block schon wieder nicht, weil wir so lange online waren, dass es zwischenzeitlich draußen begonnen hat, zu regnen.
Wir können uns dank des Smartphones in unserer Hosentasche immer und überall verbinden, mit dem ganzen Internet, der ganzen Welt, können suchen und finden und sprechen und liken. Und dabei ganz vergessen, dass wir grade auf einer Waldlichtung stehen. Auf dem Klo sitzen. Essen in uns aufnehmen. Jemand mit uns spricht. Unser Kind unseren Blick sucht. Sich gerade Wut in uns anbahnt.
Wenn ich in einem Satz zusammenfassen müsste, warum wir unsere Beziehung zur Digitalisierung verändern müssen, ist es das: dass wir alle hier sind, aber nicht wirklich da. Dass sich eine Gleichzeitigkeit über alles in unserem Leben gelegt hat, die uns oft jede Willenskraft raubt, uns einzulassen. Auf den Moment, uns selbst, einen anderen Menschen, eine Tätigkeit.
Das macht etwas mit uns. Und unseren Leben. Nicht nach zwei Stunden. Nicht nach zwei Tagen. Doch nach Monaten und Jahren. Unsere digitale Dauerpräsenz beeinflusst im Kern alles, was wir für ein glückliches und erfülltes Leben brauchen: unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unsere Verbundenheit mit der Natur, unsere Spiritualität, unseren Fokus, unsere Kreativität, unser Sexleben.
Genau hier setzt dieses Buch an. Es soll dir helfen, deine digitale und deine analoge Verbundenheit wieder in Einklang zu bringen. Das Digitale nachhaltig zu nutzen. Das bedeutet, es so zu nutzen, dass es dir physisch, emotional und psychisch hilft, voranzukommen und Abstand von dem zu gewinnen, was dich zu sehr absorbiert. Damit du dich eingebettet und geliebt und inspiriert fühlen kannst statt überfordert und ausgelaugt. In diesem Buch werden wir uns anschauen, was du brauchst, um zufrieden zu sein, wie du dafür wieder mehr Platz schaffst und warum digitale Balance das Fundament eines guten, präsenten Lebens ist.
Du wirst lernen, wie du digital achtsamer sein kannst, wieder mehr Kreativität in dein Leben holst, wie du deine Beziehungen stärken und deinen Fokus finden kannst. Mit und trotz Smartphone und Co. Denn die Digitalisierung geht nicht mehr weg. Im Gegenteil: Sie wird all unsere Lebensbereiche in Zukunft noch stärker durchdringen. Gerade deshalb ist es so wichtig, uns zu fragen: Was macht das mit mir? Wie will ich meine Zeit auf dieser Welt verbringen? Was tut mir gut? Und wie sieht eine Gesellschaft aus, die Digitalisierung nachhaltig und menschlich gestaltet?
Nimm dieses Buch als Inspirationsquelle, als Stütze, als Vorlage, als Gedankenanstoß. Nimm für dich heraus, was dir hilft, dich im Digitalen nachhaltiger und gesünder zu bewegen. Viele von uns beschäftigen ganz ähnliche Themen – und doch ist jedes Leben anders. Insofern: Lass weg, was dich nicht anspricht, arbeite und denke weiter, wo du dich wiederfindest. Behalte aber bitte einen offenen Geist – und lies auch in Kapitel rein, die dir vielleicht zuerst etwas fremd erscheinen.
Die Welt dreht sich weiter, und wir sind immer auch Zeugen unserer Zeit und Kinder unserer Realität. Wir als Individuen wachsen und verändern uns genauso schnell wie die Digitalisierung. Und so ist dieses Buch auch eine Momentaufnahme und eine mögliche Sichtweise auf das Thema, die ich im Verlauf des Jahres 2022 zusammengestellt, aufgeschrieben und zwischen zwei Buchdeckel gelegt habe. Neue Fakten, Zahlen und Studien zur Frage, was das Digitale mit dem Menschen macht und der Mensch aus dem Digitalen, erblicken in hohem Tempo das Licht der Welt. Der Diskurs ändert sich laufend. Dieses Buch wurde außerdem von einer Frau in ihren Dreißigern geschrieben, einem Millennial, der den größten Teil seines Lebens in einem westlich geprägten Kontext gelebt hat, freiberuflich, urban, studiert. Und sosehr ich mir das wünsche, es ist mir nicht möglich, eine Realität abzubilden, die weit außerhalb meiner eigenen liegt. Wenn du dieses Buch als umfassend, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit verstehst und Platz lässt für alternative Realitäten, die genauso wertvoll sind, kannst du die Digitalisierung und die Welt neu denken.
Dieser Text beinhaltet zahlreiche Erkenntnisse und Tipps, die wirklich helfen, die sich auf aktuelle Forschung stützen – und an die ich glaube und die ich erfolgreich erprobt habe. Wir tendieren aber auch dazu, uns selbst optimieren zu wollen, unser Schicksal als veränderbar zu betrachten in der Überzeugung, dass es jeder schaffen kann, wenn man nur hart genug an sich arbeitet. Lies dieses Buch also auch kritisch und mit dem Mut und der inneren Weisheit, dass du deinem eigenen Gefühl trauen kannst und dass manchmal die größte Rebellion gegen einen Zustand darin besteht, ebenso seine hässlichsten Seiten zu umarmen.
Ja, in großen Teilen soll dieses Buch dich zwar dazu animieren, deinen Geräten nicht mehr obsessiv Aufmerksamkeit zu schenken, ihnen einen Teil ihrer Sogkraft auf dich zu nehmen. Doch manchmal liegen die Rebellion und Freiheit des Lebens auch einfach darin, acht Stunden im Bett eine total bescheuerte Serie zu schauen, Junkfood zu essen oder Kette zu rauchen oder zu fluchen oder mal nicht zurückzuschreiben, obwohl man doch höflich sein wollte, kurz: darin, einfach mal drauf zu pfeifen, was vernünftig wäre und was digital nachhaltig. Hauptsache, du tust es bewusst. Weil du genau dadurch, dass du deine Grenzen herausforderst und in deinem digitalen Umgang auch deinen Spaß findest, selbstbewusster und reifer damit umgehen kannst. Und dich damit dem riesigen Perfektionsdruck und der vermeintlich moralisch korrekten Richtung entziehen kannst, die überall, vor allem in digitalen Räumen, gepredigt wird. Nimm dieses Buch also ernst, dich selbst aber genauso.
Und zuletzt: Achtsamer Umgang mit Digitalisierung ist ein Lebensweg. Es ist nicht anders als mit einer Beziehung, mit einer Ernährungsumstellung, damit, dass du zufriedener, gütiger, fleißiger, sportlicher werden willst: Alles ist ein Prozess. Digitale Achtsamkeit hat nicht so viel damit zu tun, wie lange du online bist, sondern vielmehr, wie wertvoll die digital verbrachte Zeit dir scheint. Klar, du wirst ganz konkret Tipps bekommen und mit Fragen konfrontiert werden. Das ist der Zweck eines Ratgebers im eigentlichen Wortsinn: Er gibt Rat. Und doch geht es am Ende nicht bloß um konkrete Ziele als vielmehr um einen neuen Zugang zum Thema. Darum, dass du beginnst, dein digitales Leben aktiver zu gestalten, besser Grenzen zu setzen, dich rechtzeitig auszuloggen, wenn du was anderes brauchst als digitales Dauerrauschen. Dass du lernst, hin- und herzupendeln zwischen Erholung und Aktivität, zwischen digitaler Effizienz und analogem Erleben. Dass du lernst, zu spüren, was dir guttut, welche Art von Leben du leben willst und wie du mit dem Digitalen nachhaltig umgehen kannst. So, dass es dir nützt, dich aber nicht konsumiert.
Die Bildschirme, die sich zwischen uns gelegt haben, können wir nicht wieder entfernen. Doch wir können entscheiden, sie öfter wegzulegen. Pausen vom Digitalen machen. Uns so organisieren, dass wieder mehr Zeit und Raum bleibt für anderes. Wir können Prozesse optimieren und einiges weglassen. Wir können unsere Haltung zum Leben und zu Verbundenheit verändern und uns aktiv darum bemühen, in eine bessere digitale Balance zu kommen. Und uns dazu entscheiden, unsere digitalen Gewohnheiten so zu verändern, dass wir wieder mehr Zeit, Energie, Lebensfreude und echte Verbundenheit spüren. Wissen, was wir vom Leben wollen. Und am Ende auch: glücklicher sind. Alles ist in Balance. Schwarz und Weiß, Licht und Schatten, Liebe und Hass, Verbundenheit und Trennung, Analog und Digital.
ENDLICH VERBUNDEN.
WIE ICH MICH INS DIGITALE VERLIEBTE UND MICH DARIN VERLOR.
Das mit mir und dem Internet fing sehr schön an. Fast schon wie eine Liebesgeschichte. Über viele Jahre schien alles gut zwischen uns. Bis sich etwas verschob. Langsam, fast unbemerkt. Ich beginne also damit, dir von meiner Jugend zu erzählen, von meinem ersten Mobiltelefon, meiner ersten Liebe. Weil ich finde, dass es wichtig ist, zu verstehen, woher wir kommen, um zu wissen, wohin wir gehen wollen. Nimm meine Geschichte als Anfangspunkt für deine Reise. Vielleicht fragst du dich dabei immer mal: Wie war das bei mir?
Rausch
1997 kauft meine Mutter einen Macintosh, wir sind eine der ersten Familien mit so einem Gerät im Dorf, sie kauft einen zweiten Bildschirm im A4-Format, vertikal, damit sie die ganze Seite Word-Dokument vor sich sieht, ohne zu scrollen. Die Festplatte fasst um die 100 Megabyte, wir können nicht ins Internet, irgendeiner gibt mir eine AOL-CD und sagt, damit kommst du rein, ich installiere die CD auf dem Computer und lösche meiner Mutter dabei alle Dateien vom PC, und noch immer kann ich nicht ins Internet.2
Ein paar Monate später kommt dann der Elektriker, er verlegt eine Leitung, es macht dieses Geräusch, das Einwählgeräusch, ewiges Rauschen, verbunden, nun, mit der Welt, ich logge mich in einem Online-Chat ein und lege mir ein Pseudonym zu, ich schreibe meine ersten Worte in einen Messenger, meine Mutter heizt nicht in dem Raum, in dem der PC steht.
Vielleicht ist es Absicht, damit ich nicht zu lange bleibe, vielleicht lohnt es sich nicht, diesen Raum auch noch zu heizen, es ist ja nicht so, als wäre dieser Raum zum Wohnen da. Darin steht ja nur ein PC, kein Grund, sich hier länger aufzuhalten, wer würde den Großteil seines Lebens zwischen einem PC und einem Drucker verbringen wollen, es gibt ja noch die Küche und das Wohnzimmer und das Schlafzimmer und den Garten und die Nachbarschaft und eine Welt, da draußen, ein Leben, da heizen wir doch den PC-Raum nicht.
Ich werde angewiesen, den PC runterzufahren, wenn ich fertig bin, und dann ein Stück braunen Stoff über den Bildschirm und die Tastatur zu legen, damit der Staub sich nicht fängt. Ich darf vor dem Gerät nicht essen und nichts trinken, ich muss schauen, dass die Tastatur sauber bleibt, und wenn ich fertig bin, soll ich die Leitung wieder freigeben, und sowieso, bleib nicht lange, zehn Minuten vielleicht.
Ich lege mir eine E-Mail-Adresse zu. [email protected], mein Name, mein Geburtsjahr und die Endung, jetzt gehöre ich auch zur Welt, zum Internet, zum world wide web.
Lustigerweise kam irgendwer drauf, dieses Netz, das Internet, das WLAN, gleich zu taufen wie das, was wir unter Menschen die ganze Zeit tun, wonach wir uns sehnen und wovon wir oft nicht genug kriegen können. Sie nennen es connection, »Verbindung«. Internet connection.
2000, ich drücke den Knopf, den kleinen Knopf am oberen Ende des Geräts, Nokia 3210, manchmal spiele ich Snake, bis meine Augen müde werden. Ab und zu stehle ich mich in mein Zimmer und krame das Gerät unter meinem Kopfkissen hervor und schaue, ob eine Nachricht gekommen ist, manchmal ist da eine, und wenn sie von einem Jungen ist, den ich während der Ferien kennengelernt habe, schlägt mein Herz kurz etwas schneller. Ich bange, ich bange auf die nächste Nachricht, mag er mich noch? Meine Mutter weiß nichts von diesem Gerät. Ich habe es hinter ihrem Rücken gekauft. Sie würde so was nicht wollen, Eltern eben, spießig und alt und verstehen nichts von Fortschritt.
Ich sitze immer länger im unbeheizten Raum, in welchem unser PC steht. Manchmal sagt meine Mutter, ich hänge zu lange vor dem Bildschirm rum, doch ich sage ihr, dass das nicht stimmt. Manchmal fragt mich meine Mutter, was ich da alles tue, was daran so interessant sein soll, und ich rolle mit den Augen und sage, Mama, das verstehst du nicht, du bist halt alt.
Manchmal fragt mich meine Mutter, ob ich zum Essen komme, und ich sage dann, gleich, gleich, und dann komme ich lange nicht, und das Essen wird kalt, und alle sind schon fertig, aber mir macht das nichts aus, weil ich jemandem zu antworten hatte. Vielleicht wird das Liebe, er hat mich nach meinem Namen gefragt und ob ich bald wieder online komme, und dann haben wir uns verabredet, vielleicht treffen wir uns sogar mal, und wenn nicht, macht das nichts, weil, miteinander schreiben ist schon aufregend genug, und ich habe etwas, wovon ich nachts träumen kann, sein Name ist Jan.
2005 kaufe ich mir ein besseres Handy, ich mache einen neuen Vertrag, mehr SMS, länger telefonieren, eine Flatrate, sie kostet mich ein Vermögen, aber das ist es mir wert, so viel kommunizieren, wie ich will. Und dieses sichere Gefühl, mit der Zeit zu gehen, ihr davonzurennen, sagen zu können: Klar, schau mal, hab das Gleiche wie du, in Blau, wusstest du nicht, dass es das jetzt in Blau gibt? Klar, in Zürich gekauft, an der Löwenstrasse, im größten Handyshop der Schweiz, und du so, noch immer nicht mit der Welt verbunden?
Melanie macht das erste Bild von mir, in einem Wald, wie ich mit Manuel knutsche. Danke fürs Schicken, hdl. Der Akku hält die ganze Woche.
2007 stellt sich ein großer dünner Mann mit schwarzem Rollkragenpullover auf eine ebenso schwarze Bühne und hält eine sehr gute Präsentation. Ich bin 20 Jahre alt, ich habe Abitur gemacht, habe die erste eigene Wohnung bezogen. Wenn ich etwas kaufen will, dann gehe ich in einen Laden, wenn ich ausgehen will, in eine Bar. Ich bezahle mit dem Geld, das in meiner Tasche liegt, und sehe den Menschen, der gerade physisch vor mir steht.
2009 kaufe ich mein erstes Smartphone. Das Gerät in meiner Tasche wird zu meinem Türöffner in eine neue Welt, zum Erkennungsmerkmal der jungen Generation, der Menschen, die verstehen, was Wandel ist, und ihn mitgestalten wollen. Ich höre Musik damit, ich schreibe Notizen, ich stelle die ersten Bilder auf Facebook. Ich verbinde mich in den sozialen Medien mit den ersten Freundinnen, die im Ausland studieren. Wir feiern gegenseitig virtuell unsere Geburtstage. Wenn ich als Journalistin einen Artikel recherchieren muss, dann google ich die Informationen, viele Anrufe erübrigen sich. Ich kaufe mir einen Laptop, klappe ihn im Zug auf meinen Knien auf und schreibe meine Texte auf dem Weg zum nächsten Gespräch, ich fühle mich frei und unabhängig und effizient. Ich kann von überall aus arbeiten. Mal kurz nachschauen, wenn ich einen Namen vergessen habe. Alle meine Termine in einen digitalen Kalender eintragen.
Ich liebe es, mich zu verbinden. Da draußen so viele Menschen zu finden, die Gleichgesinnte sind, im Kampf für den Feminismus. Online so viele Likes für meine Kampfparolen zu erhalten, während bei Familienfeiern die alten sexistischen Witze erzählt werden und ich mir vorkomme wie aus einer anderen Welt. Ich liebe es, Filme und Serien auf Englisch zu konsumieren, zu Hause, in meinem Bett, während andere Leute sich zu festgelegten Zeiten irgendwelche schlechten Produktionen in deutscher Synchronisation anschauen müssen, weil sie nichts anderes kennen als Kino und analoges Fernsehen. Googeln zu können, wie ich ein Ei koche, wann Erdbeeren Saison haben und wie ich sie am besten einfriere, wenn ich zu viel davon habe. Meinem Freund Sprachnachrichten zu schicken. Ausschlafen zu können bis zwölf, weil ich weiß, dass ich abends um zehn noch am Text arbeiten kann. Solche Dinge.
Niemand, der mit dem Internet aufgewachsen ist, würde es wieder verlieren wollen. Warum auch? So viel Schönes hat es uns gebracht. So viel Zeitersparnis. So viel Freiheit.
Kater
2016, ich bin seit vier Jahren selbstständig, ich antworte bis kurz vor Mitternacht auf E-Mails, obwohl das niemand von mir verlangt, und fühle mich wichtig dabei, ich klappe im Zug und im Café und in irgendwelchen Landbeizen meinen Laptop von Apple auf und gehe über den Hotspot meines iPhones ins Netz. Ich schere mich nicht darum, ob Leute am Nebentisch grade essen wollen und mein Hämmern auf der Tastatur sie in ihrem Gespräch stört.
Die ständige Erreichbarkeit ist mein neues Statussymbol, es soll meinen Auftraggebern suggerieren, dass ich immer liefere, dass ich potent bin, jung und willig, dass ich die Zukunft bin, eine Frau, die mühelos mit allem mithält und in einer Geschwindigkeit Beobachtungen abliefert, die jedem Online-Redakteur gefallen. Sollen sich doch andere weigern, Videos zu drehen und sich eine Social-Media-Präsenz aufzubauen, sollen sie ignorant darauf bestehen, dass es nur um Inhalte geht und null um Egos, Namen und Identitäten. Derweil arbeite ich an meiner corporate identity – ich muss mich zur Marke machen, das ist mir längst klar.
Der Druck, dem ich mich aussetze, den ich selbst erzeuge, ist enorm geworden. Keine Ahnung, wann das angefangen hat. Vielleicht mit der Anzahl Apps, die ich runtergeladen habe, immer mehr. Oder der Anzahl Social-Media-Profile. Vielleicht bin ich auch einfach älter geworden, habe begonnen, zu arbeiten. Möchte was aus mir machen. Meine Artikel in die Welt tragen. Das ist doch im Grunde alles nicht verwerflich, ich bin schließlich ein guter Mensch, ich will helfen, Menschen eine Stimme geben. Also verausgabe ich mich. Gerne. Die Anerkennung, die ich dafür kriege, tut mir gut. Ich poste meine Artikel auf Social Media. Ich erhalte die ersten Likes für meine Arbeit, beginne, mir zu überlegen, was ich wann wie darstelle, damit es professionell wirkt. Währenddessen stellen sich Chefredakteure in den Newsrooms vor die Belegschaft und sagen: Schaut auf die Klicks, seid schneller als die Konkurrenz. Schreibt was ins Internet, auch wenn wir noch keine Belege haben, besser irgendwas als gar nichts.
Irgendwie sind meine Tage kürzer geworden, irgendwie ist digital immer mehr zu tun. Immer mehr Leute wollen was von mir, die digitale Aufgabenliste wird immer größer, und ich beginne meine Tage schon damit, dass ich mich von meinem Smartphone wecken lasse, die Timelines durchscrolle, die E-Mails checke, noch bevor ich überhaupt richtig wach bin, manchmal scrolle ich 20 Minuten am Stück, obwohl ich doch noch gar nicht auf dem Klo war. Manchmal stehe ich in Unterhosen in der Küche und checke eine Mail, wo ich doch eigentlich die Milch für den Kaffee schäumen sollte, ich starre so lange in mein Smartphone, dass der Kaffee kalt wird und ich nicht mal merke, wie sehr ich friere, ohne Kleidung, oder dass mich so jemand sieht, am Fenster. Manchmal übt das Digitale einen solchen Sog aus, dass ich vergesse, zu essen. Dann schlinge ich stehend oder in den Bildschirm starrend irgendwas in mich rein und schlucke so hastig, dass ich danach Sodbrennen habe.
Wenn ich in einen Club gehe, dann hoffe ich, dass ich nicht so betrunken bin, dass ich nicht mehr weiß, was ich tue. Weil ich Angst davor habe, dabei gefilmt zu werden. Der Film dann im Netz. Mein Leben, digitalisiert und außer Kontrolle. Und nichts, was ich tun könnte. Niemand, der das löscht. Jeder Moment der Unachtsamkeit könnte einer sein, der mich für immer an den Pranger stellt. Manchmal bin ich kurz davor, meinem Freund ein Nacktbild zu schicken. Ich tue es dann doch nicht.
Ich mache die ersten Auslandsreisen, ich fliege nach Indien, nach Marokko, nach Italien, ich fliege nach Israel. Ich steige ins Flugzeug und muss den Flugmodus reinmachen, dann ist lange Zeit nicht viel los. Ich schaue mir an Bord ein paar Filme an und lese ein paar Seiten in einer Zeitschrift, ich betrete nach der Landung fremden Boden und schaue, dass ich an einem Taxistand ein Taxi kriege, verstehe kein Wort dieser Männer, die versuchen, mir die Welt zu erklären, und fahre erst mal ins Hotel.
Ich versuche manchmal, das WLAN-Passwort nicht mitzuschreiben, die Damen an der Rezeption strahlen mich dann immer an und sagen begeistert, schauen Sie, gratis WLAN, ganz schnelles, im Zimmer! Im Restaurant, auch am Pool! Auch am Strand! Wir wollen sichergehen, dass es Ihnen an nichts fehlt. Das Wasser kostet 2,50 Euro in der Minibar, dasjenige aus dem Wasserhahn dürfen Sie nicht trinken, aber das Internet, das ist kostenlos.
Manchmal, wenn ich mein Handy absichtlich im Hotelzimmer lasse, um mal ein wenig Abstand zwischen mich und das Internet zu bringen, und dann offline am Pool liege, wünschte ich mir plötzlich, ich könnte meine Beine fotografieren, sie sehen grade so schlank aus, die Sonne steht günstig, golden hour, ich spanne die Haut an und ändere den Winkel, wenn ich jetzt ein Foto mache und es hochlade, bewundern mich die Leute und denken, so schlank bist du, Wahnsinn, guapa, schön!!!, dann werde ich zurück ins Hotel gehen und für ein paar Tage weniger essen. Manchmal gehe ich doch das Handy holen und versinke dann darin, Dutzende Bilder von meinen Beinen zu machen, ich mache so lange Bilder von ihnen, dass ich gar nicht merke, wie die Luft sich abkühlt, bis ich plötzlich aufschaue und um mich herum kein Mensch mehr, alle schon beim Essen. Ich lasse das Handy immer seltener im Zimmer liegen.
2018 fällt die Roaming-Schranke in Europa. Nie wieder ohne Handy am Strand. Nie wieder Sonnenuntergang ohne Livestream. Nie wieder an einem Ort, an dem ich schulterzuckend sagen kann: Sorry, ich war leider nicht erreichbar, sorry, war einfach dort und nicht auch noch hier.
Wenn ich daheim aus dem Haus gehe, nehme ich mein Smartphone immer öfter mit, ich könnte in Gefahr geraten, mich verirren, Hilfe brauchen. Ich habe Angst, so ganz ohne Telefon, ich rede mir dann ein: Wenn dir jetzt was passiert, dann bist du selber schuld, hast ganz allein auf dich vertraut, wie töricht. Und ich muss erreichbar sein. Vielleicht stirbt auch plötzlich Opa, und ich war nicht da, als der Anruf kam. Das würde ich mir nicht verzeihen.
Und sowieso, mein Chef liest heute meinen Artikel, vielleicht sind noch Fehler drin, wer geht schon am helllichten Tag spazieren und macht Pause, ich sollte am PC sitzen, sollte am Handy kleben. Ich muss eingekaufte Produkte bezahlen, ich muss Tickets vorweisen können, ich muss mir Notizen machen, ich muss Leuten antworten, ich muss Wege googeln, ich muss Verbindungen checken, ich muss Einkaufslisten schreiben, ich muss Bilder machen, ich muss Musik hören, ich muss Schuhe bestellen, ich muss mein Leben managen.
Frühling 2020, meine Freundinnen und ich treffen uns zum Brunch, alle lassen ihre Handys auf dem Tisch liegen, alle lassen die Vibration an, alle schauen nach, wenn was reinkommt. Ich sage, dass ich das nicht höflich finde. Dass ich mir wünschen würde, dass wir alle mal unsere Smartphones in der Tasche lassen und uns zuhören und mal da sind und nicht immer woanders. Eine Freundin zieht mich nach dem Brunch zur Seite und sagt mir: Hör mal, du bist doch nicht die Zeugen Jehovas, hör auf damit, das vertragen die Leute schlecht.
Aber irgendwie hat dann doch die Zeit gefehlt für Sport. Und für diese große Aufgabe, die ich mir zum Ziel genommen hatte, vor ein paar Wochen. Ich habe viel abgearbeitet, Mails, Anrufe, Slack-Nachrichten, bin aber kaum zu was anderem gekommen. Abends ziehe ich mir öfter Serien rein, an manchen Tagen finde ich das toll, an anderen versuche ich, mich zu was anderem zu zwingen, mal wieder Gitarre üben oder endlich die Geburtstagskarte für meine Oma zeichnen, verschiebe das alles dann aber irgendwie aufs Wochenende.
Ich merke derweil, dass es mir jetzt nicht mehr reicht, bloß alle Stunde mal aufs Smartphone zu schauen oder bloß zwei Nachrichten am Tag zu kriegen. Obwohl ich allen gesagt habe, dass ich sowieso nicht in der Stadt bin, eigentlich bin ich grad zelten an einem See und könnte mein Leben genießen, und doch, ich sitze im Halbschatten in einem Campingstuhl, halte ungläubig mein Smartphone in der Hand und starre auf den Bildschirm und drücke irgendwelche Apps und checke den Wetterbericht und scrolle durch eine Timeline und checke an einem Sonntag meinen Kontostand, weil mein System es nicht mehr gewohnt ist, keinen Input zu kriegen, und vor allem: die Frequenz meiner Kommunikation runterzufahren.
Irgendetwas in mir gerät dabei in Panik. Ich frage mich plötzlich, was diese digitale Stille zu bedeuten hat, ob ich jetzt rausgefallen bin aus diesem digitalen Dauerstrom, weil mich niemand mehr liebt und alle mich vergessen, weil ich ja nicht vor ihnen stehe, wir sind ja alle nur noch selten gleichzeitig im gleichen Raum, da ist auch kaum mehr jemand, dem du jeden Sonntag in der Kirche zuverlässig über den Weg läufst. Wenn wir digital nicht mehr verbunden bleiben, wie dann überhaupt noch?
Oktober 2020, der Dokumentarfilm The Social Dilemma trendet weltweit. Er handelt davon, dass diese ganze Social-Media-Sache eine gewollte Massenabhängigkeit ist, dazu da, ein paar wenige Menschen auf der Welt sehr reich zu machen und uns alle emotional und seelisch sehr arm.
Facebook wird für das Jahr 2020 fast 86 Milliarden US-Dollar Umsatz vermelden.3 Trotz Datenschutz-Skandalen ein Höchstwert. 98 Prozent des Umsatzes durch Werbung generiert.4 Die wir uns anschauen, wenn wir online sind. Die mehr kostet, wenn wir länger online sind.
Ich sage allen meinen Freunden, sie sollen den Film schauen. Verschicke den Link über WhatsApp. Lösche gleichzeitig meine Netflix-App von meinem Smartphone. Überlege mir wieder mal, WhatsApp ganz zu löschen. Klicke drauf. Sehe die Benachrichtigung des Dienstes, der mir erklärt, dass alle meine Daten unwiderruflich gelöscht werden, alle Bilder, alle Nachrichten, alle Sprachnachrichten, alle Zeichnungen, alle meine Gefühlsduseleien, alle Hilfeschreie in die Nacht hinein, all die Stunden, in denen ich meinen Freundinnen virtuell die Hand gehalten hab, all die Momente, in denen ich Herzen zugeschickt bekam oder ein GIF, das mir die Welt bedeutete, weil all das von ihm kam, von seiner Nummer, von seinem Telefon. Bist du sicher, dass du deinstallieren willst, Anna? Ich klicke auf Nein.
November 2020, inmitten der Pandemie, plus 30 Prozent tägliche Smartphone-Nutzungsdauer weltweit5, über die Hälfte aller Smartphone-Checks weniger als 30 Sekunden lang.6 Anstieg der Suchanfrage »how to get your brain to focus«: 300 Prozent.7
Aus meinem Leben mit ein bisschen Onlinezeit ist spätestens seit Ausbruch der Pandemie ein Onlineleben geworden. Der durchschnittliche US-amerikanische Jugendliche verbringt alleine am Smartphone, andere Bildschirme nicht mit eingerechnet, sieben Stunden seiner Wachzeit. Täglich. Verbringen wir rund zwei Stunden täglich auf Social Media und leben wir so, bis wir 90 Jahre alt sind, waren das über 17 Jahre unseres Lebens.8 Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne liegt bei nicht viel mehr als sechs Minuten.9 Hallo? Bist du noch dran?
Nullpunkt
Ende 2020 sitze ich in einem alten Pfarrhaus in den Schweizer Bergen, auf über 1000 Meter über Meer. Hier komme ich immer her, wenn ich was zustande bringen will, einen großen Brocken Text wie diesen hier, beispielsweise. Vielleicht, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich dem Rauschen der Stadt und dem Rauschen des Digitalen überhaupt noch was entgegensetzen könnte, bliebe ich, wo ich bin. Vielleicht brauche ich solche Orte der Langsamkeit, der Stille, der Höhe, um überhaupt noch etwas hinzukriegen.
Es hat sich Schnee in die Äste der Bäume gelegt, die Anfahrt war mühsam und lange, im Dorf riecht es nach Brennholz, und hier drin, in diesem Haus: kein 4G. Ich packe meinen Koffer aus und checke alle paar Minuten, ob nun Signal kommt, es kommt keins. Plötzlich ergreift mich eine unerklärliche Leichtigkeit. Als würde die Welt von meinen Schultern fallen. Vielleicht werde ich wirklich nicht verbunden sein, hier oben, über Tage nicht. Und nichts, was ich dagegen tun müsste, nichts, was ich dagegen tun könnte. Bloß ein Mal habe ich mich in den letzten Jahren so frei gefühlt wie an diesem Tag. Als mir vor ein paar Jahren das Smartphone geklaut wurde, ausgerechnet in der Silvesternacht. Die nächsten Tage waren alle Geschäfte zu. Vier Tage lang hatte mein Leben keine zweite Ebene mehr, ich existierte nur noch hier, es existierte nur noch das, was gerade um mich herum war, es war das gleiche Gefühl wie als Kind in den Sommerferien in Italien, wenn ich, eingewickelt in den kleinen Elefanten-Bademantel, nach dem Baden im Meer in der Sonne lag und einschlafen konnte und wusste, dass mich irgendwann jemand wecken wird und ich einfach vor mich hindösen kann, jetzt, hier, in Sicherheit.
Ich gehe schlafen und träume schlecht.
Bevor ich hier hochgefahren bin, habe ich meine Arbeitgeber darüber informiert, dass ich in meiner Abwesenheit digital nicht erreichbar sein werde. Einer von ihnen hat einen Skype-Termin angesetzt, und ich sagte ihm, ich sei nicht da, ich hätte dann auch kaum Internetzugang, der Mann hatte dann diese Betroffenheit in der Stimme und meinte ganz sanft: Hast du denn E-Mail-Zugang, wenigstens E-Mail-Zugang? Und ich antwortete, ja, den hätte ich, aber ich will ihn nicht, ich will ihn bewusst nicht. Ich werde die ganze Woche nicht erreichbar sein und werde dreist über meine Zeit verfügen, werde mich von der Welt verabschieden, mich verschlucken lassen. Niemand wird mich einfach erreichen können und was von mir wollen und mich rausreißen und mich einspannen. Der Mann am anderen Ende der Leitung wartete verdutzt, dann lächelte er hörbar in den Hörer hinein und sagte: Ach, so ist das, ja, hm, das müsste ich auch mal machen, dann lachte er nervös und sagte: Aber weißt du, das geht nicht. Das würde nicht gehen.
Derweil liest Bill Gates mehrere physische Bücher die Woche, spaziert durch Wälder und schreibt in Räumen ohne digitale Hilfsmittel mit Stiften Gedanken an Wände.10 Halten Celebrities, die auf Instagram Millionen von Followern haben, weiter ihre Sticker mit dem Slogan Social Media can seriously harm your mental health in die Kamera, um dann offline zu gehen, während ihre Assistenten rund um die Uhr posten. Entfernen die CEOs die Farbe von ihren Bildschirmen, grayscale mode, damit sie dem Signalrot, das dem Menschen evolutiv bedingt Intensität und Gefahr signalisiert und jetzt für alle Arten von Benachrichtigungen eingesetzt wird, die Kraft nehmen. Während die CEOs im Silicon Valley ihre Kinder in Waldorfschulen und Montessori-Kindergärten schicken – damit sie dort Natur haben und kreativen Gestaltungsraum –, hängt der Rest der Welt am Strom, als sei dieser ein Bluttransfusionsbeutel.11
Ich denke darüber nach, wie es sich mit Zeit und Raum verhält und was Freiheit eigentlich bedeutet, und ich glaube, Freiheit bedeutet bald Unauffindbarkeit. Sie wird etwas sein für die wenigen Privilegierten, die es sich leisten können, nicht mit dem Strom zu schwimmen, nicht zu konsumieren, selber kein Produkt mehr zu sein. Während wir anderen bereitwillig an unseren Geräten hängen und alles von uns preisgeben, werden diejenigen, die es sich leisten können, Zeit haben und verloren gehen und verschluckt sein, und niemand wird wissen, wo sie gerade sind und was sie tun und wie sie sich fühlen, sie werden weiter Hinterausgänge nehmen und hohe Zäune um ihre Häuser bauen und Assistentinnen einstellen, die ihre Onlinepräsenzen pflegen, während sie sich zurückholen, was sich niemand mehr zurückholt, die Hoheit über unser Sein, the right to disconnect.12
Irgendwann, in diesem Pfarrhaus sitzend, denke ich, ich werde ohne Internet durchdrehen, schon bald. Ich stehe auf und wandere umher wie ein Tiger, ich nehme immer wieder das Smartphone in die Hand und starre drauf und warte ungläubig ein paar Sekunden und halte den Atem an und hoffe, dass da doch ein Signal ist, bis ich merke, dass ich nichts erhalten habe, keine Nachricht, kein Emoji. Nichts, was mein Leben für immer verändert.
Am liebsten würde ich wegrennen, doch ich habe keine Alternative, als weiter zu schreiben. Weil es hier nichts zu machen gibt, nichts zu sehen, nichts zu konsumieren. Es gibt Berge, Gras, einen Baum vor dem Haus und ein paar lange Wege. Und ich weiß, dass mein System, so überreizt und so voller Gier nach dem nächsten neuen Input, etwas Zeit brauchen wird, um sich an diese Einöde zu gewöhnen.
Irgendwann, nach ein paar Tagen, schaue ich aus dem Fenster und sehe die Berge und das garstige Wetter vor meinem Haus und betrachte alles ganz in Ruhe. Ich nehme einen tiefen Atemzug und beobachte, wie mein Atem ganz ruhig fließt. Dass ich grad nicht mehr meine, zu sterben, weil ich seit einer Stunde nicht mehr nachgeschaut habe, ob mich jemand erreichen wollte. Ich bin offline. Auch im Kopf. Am Nullpunkt. Komplett bei mir. Endlich.
In genau diesem Moment, in den Bergen, völlig frei und losgelöst von allen digitalen Zwängen, sozusagen zwangsberuhigt, erkenne ich: Ich habe ein Problem. Ein viel größeres, als ich mir je hätte eingestehen wollen. Und ich muss diesen einen Satz aufschreiben, hinschreiben, weil ich ihn sonst nicht glaube.
Ich bin abhängig. Nicht von meinen Geräten. Nicht von diesem schwarzen Ding, das sich nicht mehr regt. Oberflächlich betrachtet schon. Doch: Diese Obsession greift viel tiefer. Ich bin süchtig nach Dingen, die dort drinstecken. Die ich mir ankonditioniert habe, mit jedem Klick, mit jedem Swipe, mit jedem Like. Ich bin süchtig nach Anerkennung geworden. Abhängig davon, geliebt zu werden. Ich bin abhängig davon, alles im Griff zu haben. Besessen davon, mich von meiner besten, zuverlässigsten Seite zu zeigen. Mich von meinen Gefühlen abzulenken, die mich überkommen, wenn ich allein mit mir bin. Und dieses Ding da drüben ist mir ein treuer Komplize, der mich überall dort rausholt, wo es unangenehm zu werden droht. Und der mich erfolgreich von mir selbst ablenkt, wenn ich grade nichts Unangenehmes fühlen will. Der immer mit einer kleinen Überraschung auf mich wartet. Mir keine Langeweile lässt. Mich beschäftigt hält. Mich permanent mit Aufgaben überschüttet. Mit Pflichten und mit dem Gefühl, alles im Griff zu haben. Der mich erfolgreich verbindet. Und mich oft, immer öfter, erfolgreich trennt. Von allem, was um mich herum passiert. Und auch oft von dem, was gerade in mir drin passiert.
Kann ich denn bloß ganz bei mir sein, wenn ich von der Welt dazu gezwungen werde, mich digital geschlagen zu geben? Kann ich nur bei mir sein, wenn ich kein Smartphone mehr in meiner Nähe habe, keinen Bildschirm mehr vor meinem Auge, wenn es um das Alles oder Nichts geht, wenn das ewige Rauschen für immer aus meinem Leben verbannt wird? Kann ich mich nur abgrenzen und von all diesen digitalen Verlockungen verabschieden, wenn ich im Nachhinein eine gute Ausrede habe?
Ich kann das alles nicht auf die Digitalisierung schieben. Sie ist nicht das Problem an sich. Sie ist bloß das Vergrößerungsglas in unsere Seele. Ein Multiplikator für unsere Sehnsüchte, Ängste und Marotten. Ein Speicher für alle unsere Erinnerungen und eine Projektionsfläche für unsere Wut, Trauer, unsere Freude. Wollen wir lernen, mit dem Digitalen in unserem Leben umzugehen, es achtsam einzusetzen, es nachhaltig einzusetzen, müssen wir den Mut haben, uns uns selbst zu stellen.
Es reicht nicht, alle paar Monate in die Berge zu fahren und dort mein Smartphone abzustellen. Es wird nicht reichen, mich darauf zu verlassen, dass irgendwer das Internet abstellt. Ich werde es nicht schaffen, ein digital achtsames Leben zu führen, wenn ich umzingelt bin von all-inclusive Highspeed-Internet und nicht weiß, wo meine eigenen Grenzen liegen. Wenn ich nicht weiß, was mich an Social Media eigentlich süchtig macht. Warum ich prokrastiniere. Und warum ich am Ende des Tages so viel öfter netflixe als mich bewege.
Will ich weniger am Bildschirm sitzen, muss ich beginnen, mich zu fragen: Was tue ich stattdessen? Wie soll sich mein Leben anfühlen? Welche Menschen tun mir gut? Was will ich machen, aus der Zeit, die mir gegeben ist? Woher kriege ich die Bestätigung, wenn ich sie mir nicht im Netz hole? Und wie gebe ich sie mir selbst?
Diese Fragen sind schwierig. Weil sie Lücken offenbaren. Bereiche, in denen mir etwas fehlt. Weniger scrollen hieße, mehr zu leben. Doch wie soll dieses Leben überhaupt aussehen? Und habe ich den Mut dazu? Wann fühle ich mich mit Menschen verbunden, und wann fühle ich mich in einem Raum voller Leute unendlich allein?
Vielleicht weiß ich gar nicht, was ich an einem freien Abend tun will. Manchmal habe ich Angst, vor die Tür zu gehen. Manchmal kann ich mir nicht eingestehen, dass ich seit Jahren mit irgendwelchen Leuten nach Feierabend Cocktails trinke, aber eigentlich viel lieber ab und an mal alleine im Wald spazieren gehen würde, es dann aber doch nicht tue, weil ich Schiss habe, alleine einen Berg hochzulaufen. Vielleicht habe ich nicht den Mut, meinem Chef zu sagen, dass ich es nicht in Ordnung finde, nach 20 Uhr noch seine Mails zu lesen.
Jetzt, hier, am Nullpunkt, erinnere ich mich an die Worte eines Freunds: Wer auf den Berg klettert, der war erst oben und hat den Gipfel erklommen, wenn er wieder unten ist. Wer in den Urlaub fährt, war erst dort, wenn er wieder zu Hause ist. Und ich habe erst eine digitale Balance entwickelt, wenn ich, zurück im Alltag, noch immer digitale Grenzen wahren kann. Das Smartphone abschalten nach einem langen, von E-Mails dominierten Tag. Wenn ich auf Social Media einen Beitrag poste und dann nicht alle fünf Minuten nachschauen gehe, wie viele Likes der Beitrag inzwischen hat. Weil ich mir ein Leben aufgebaut habe, einen Selbstwert, eine Verbundenheit, die größer ist als mein digitaler Raum. Und ich so digital und analog in Einklang sein kann, digital achtsam, zufrieden statt überfordert.
Hier, am Nullpunkt, erinnere ich mich auch an die Wissenschaft der Positiven Psychologie. An all die guten Ratschläge und Studien und Erkenntnisse, die sich damit beschäftigen, wie ein Mensch glücklich wird. Was ihn zufrieden macht. Wofür es sich zu leben lohnt. Jetzt, hier, am Nullpunkt, verstehe ich endlich, dass mein digitales Verhalten sehr viel mit meinem realen Leben zu tun hat.
FALSCH VERBUNDEN
Warum du das Digitale liebst. Und was es dich kostet.
Keine Technologie der Welt könnte unser Verhalten so gut und nachhaltig steuern, wenn da nicht so viel Psychologie involviert wäre. Die großen Internetfirmen, die was von uns wollen, haben Hunderte Ingenieure, Psychologinnen und Verhaltensökonominnen angestellt, um die menschlichen Schwächen auszuleuchten – und sie sich zunutze zu machen. Von Gamification, also der Art und Weise, wie die Apps designt sind und unseren Spieltrieb ansprechen, bis hin zu Farbwahl und Belohnungssystemen, wenn wir dranbleiben: Unser Verhalten wird durch diese Anreize bewusst gesteuert.
2006 hat ein Wunderkind des Silicon Valley, Aza Raskin, etwas sehr Kleines erfunden, das bald sehr wichtig wurde: den infinite scroll.13 Ein bisschen Code, ein riesiger Schritt fürs Geschäft. Denn der Infinite Scroll bedeutet eine Timeline, die niemals aufhört. Das weckt in uns den Drang, das Internet zu Ende zu scrollen, doch das Internet lässt sich nicht zu Ende scrollen. Wir wissen das. Und doch scrollen wir täglich 173 Meter weit.14
Aza Raskin sagte ein paar Jahre später einem französischen TV-Sender: Etwas zu erfinden, das alles leichter macht, bedeutet nicht das Beste für die Menschheit. Um dann anzufügen: Das unendliche Scrollen, das hat er selbst berechnet, koste täglich 200.000-mal die Lebenszeit eines Menschen.15 Diese Funktion allein. Inzwischen finden wir den Infinite Scroll nicht bloß auf Social Media. Sondern auch bei Onlineshops, bei Zara zum Beispiel.
Doch Aza Raskin war nicht allein. Er wurde flankiert von anderen, sehr intelligenten Menschen, die anfangs dachten, das, was sie programmierten, würde der Menschheit dienen. Sie weiterbringen. Tristan Harris beispielsweise, der ehemalige Design-Ethiker von Google. Auch er setzt sich mittlerweile mit verschiedenen Initiativen und Projekten, beispielsweise seiner Organisation Center for Humane Technology,16 für einen nachhaltigeren Umgang mit Technologie ein. Und vor allem dafür, dass die Technologie so gebaut wird, dass sie dem Menschen dient.