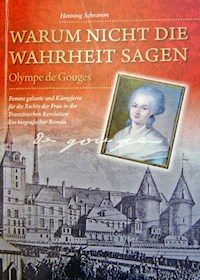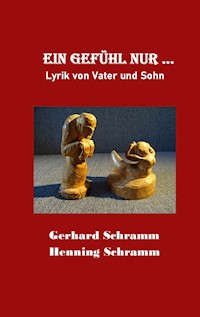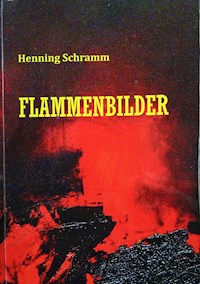Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Grundlage biografischer Quellen und gesicherter historischer Fakten zeichnet der historische Roman ein Bild von Deutschland und der deutschen Gesellschaft im 20. Jahrhundert, in der Argwohn und Verdächtigungen Vertrauen korrumpierten und so einen der Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie unterhöhlten. Der Roman nähert sich so der Frage, wie es damals zu der nationalsozialistischen Katastrophe kommen konnte, und er schärft den Blick für gegenwärtige Tendenzen in der Gesellschaft. »Mit der Geschichte zweier deutscher Familien im Verlauf dreier Generationen beschreibt Henning Schramm anschaulich die psychische Gemengelage zwischen den Generationen, wie sie sich nach zwei verlorenen Weltkriegen und dem Zivilisationsbruch des Holocausts und des industriell organisierten Völkermords entwickelt hat. Sie trägt zum Verständnis dessen bei, was die Verletzungen, Verrohungen und brutalen Grausamkeiten dieser schrecklichen Zeitgeschehnisse in den Seelen der beteiligten Menschen an Narben hinterlassen hat.« Auszug aus dem Vorwort von Heipe Weiss (Literaturkritiker und Autor) Informationen zum Autor und seinen Buchveröffentlichungen finden Sie unter: www.henningschramm.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
»Er beobachtete wie Argwohn und Verdächtigungen Vertrauen korrumpierten und so einen der Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie unterhöhlten. Sie ebneten faschistoidem Denunziantentum den Weg. Der Faschist, dachte Kurt, rupft sein Huhn, die Demokratie, Feder für Feder, so dass die Schmerzen der Unfreiheit möglichst erträglich bleiben. Er kommt mit eher kleinen Schritten daher. Faschismus lebt von der Angst der Menschen. Angst tut weh.«
Hitlers Terror-Regime und die bleiernen Anfangsjahre der Bundesrepublik werfen ihre Schatten auf den erfolgreichen Wissenschaftler Paul Quirnheim und den Genossen Kurt Bärnbach. Die Kinder der beiden schicksalhaft miteinander verwobenen Familien kämpfen Ende der 60er Jahre gemeinsam für mehr Demokratie und gegen das Vergessen der Nazi-Vergehen. Sie werden mit Quirnheims Vergangenheit konfrontiert und geraten in einen tragischen Konflikt, der in einer Katastrophe endet.
Der historische Roman orientiert sich an realen Biografien. In der furchtbarsten Epoche der neueren Geschichte entfaltet das Geschehen entlang dieser historischen Vorbilder ein Panorama von Schuld, Fanatismus, Hoffnung, Karrieredenken, Widerstand und Sühne.
Informationen zum Autor und seinen Buchveröffentlichungen finden Sie am Schluss des Buches und unter: www.henningschramm.de
Für meine Tochter
und ihre Generation,
denen die hier beschriebene Zeit
fern erscheinen mag,
die aber doch so nah ist.
Nur wenn,
was ist,
sich ändern lässt,
ist das,
was ist,
nicht alles.
Theodor W. Adorno
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Heipe Weiss
Prolog
: Der Tod ist eine Frage des Lebens (1968)
Erstes Kapitel
: Edmund Quirnheim 1900 – 1919
Zweites Kapitel
: Paul Quirnheim 1924 – 1933
Drittes Kapitel
: Kurt Bärnbach 1933 – 1938
Viertes Kapitel
Paul Quirnheim 1933 – 1945
Fünftes Kapitel
Kurt Bärnbach 1938 – 1946
Sechstes Kapitel
Paul Quirnheim 1946 – 1955
Siebtes Kapitel
Kurt Bärnbach 1946 – 1965
Achtes Kapitel
Mila Bärnbach und Filip Quirnheim 1965 – 1968
Nachwort
Zeittafel
Vorwort
Väter und Söhne, ein Jahrtausendthema. Zumindest seit Hildebrand und Hadubrand. Dass die aufeinander folgenden Generationen sich gegenseitig nicht mehr verstehen können, wie es Iwan Turgenjew 1861 exemplarisch für das 19. Jahrhundert in Russland beschreibt, mag sich historisch immer wieder ereignen, wenn soziale Brüche oder Zeitenwenden sich abzeichnen. Oft ist der Anlass für solche aufbrechenden existentiellen Spannungen zwischen Eltern und Kindern eine nicht verarbeitete gesellschaftliche Katastrophe, wie sie in der Regel Kriege darstellen, insbesondere verlorene Kriege. Kriege, das institutionalisierte gegenseitige Abschlachten verfeindeter Massen, hinterlassen unvermeidlich bei den Überlebenden schwere seelische Verwüstungen, Schuldgefühle und Traumata, nicht bewältigbare innere Konflikte und Zerrissenheit. Bezeichnend ist zumeist für die Veteranen solcher staatlich organisierten Massaker das Unvermögen, über die erlebten und oder selbst begangenen Grausamkeiten mit den Angehörigen reden zu können. Das müsse man mit sich selber ausmachen, so die gängige Verdrängungsformel – da sei Mann Soldat, da schweigt er sich aus. Die verdrängten Schuldgefühle der Eltern wirken sich allerdings auch unausgesprochen auf die Kinder, und mutatis mutandis gar auf die Enkel aus, und unerwartet tritt so, ein oder zwei Generationen später, das überwunden geglaubte wie neugeboren mit Urkraft wieder ans Licht, als Unheil, gleichsam aus der Tiefe der Geschichte.
Eine Geschichte, wie sie Henning Schramm in seinem Roman ‚Verdacht und Vertrauen‘ erzählt, beschreibt anschaulich die psychische Gemengelage zwischen den Generationen, wie sie sich in der letzten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts nach zwei verlorenen Weltkriegen und dem Zivilisationsbruch des Holocausts und des fabrikmäßigen, industriell organisierten Völkermords entwickelt hat – insbesondere in Deutschland, dem Land der Täter, zwischen der Generation der Täter und der ihrer Kinder.
Was nach den Massakern des ersten Weltkriegs unbewältigt begann, die Suche nach Heilung der zugefügten seelischen Verletzungen durch die Kriegsereignisse, und sich schließlich als öffentliches Bekenntnis zur Krankheit eines geliebten Führers (und stellvertretenden Übervaters) äußerte, – denn alle wussten, dass der „Führer“ krank war, warum sonst hätten sie „Heil Hitler!“ gerufen – führte nach den Gräueln des zweiten Weltkrieges bei den Überlebenden zum Versuch, Frieden zu finden, ihr Heil zu suchen in der fantasierten Idylle, der heilen Welt der Kleinfamilie, die sich schon bald für die jüngere Generation eher als kleine Hölle darstellte. Das Schweigen der Eltern, insbesondere das Schweigen der Väter, mag mit ursächlich als Erklärung dienen, weshalb der gesellschaftliche Bruch in den Jahren um 1968 so gravierende Spuren bei den Beteiligten hinterlassen hat – die verschwiegenen Schuldgefühle der Elterngeneration, die angeblich von nichts gewusst hatte, wurden gewissermaßen nahtlos auf die nachfolgende Generation übertragen – die nicht eingestandene Schuld wurde den Kindern gleichsam aufgehalst.
‚Verdacht und Vertrauen‘, die Familiengeschichte zweier deutscher Familien im Verlauf dreier Generationen im zwanzigsten Jahrhundert, mag zum Verständnis dessen beitragen, was die Verletzungen, Verrohungen und brutalen Grausamkeiten dieser schrecklichen Zeitgeschehnisse in den Seelen der beteiligten Menschen an Narben hinterlassen haben.
Heipe Weiss
Oberursel, November 2019
Prolog
Der Tod ist eine Frage des Lebens (1968)
Kann man einen Menschen lieben und ihn gleichzeitig für seine Taten verachten? Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage hatte sich in ihm gleichsam festgekrallt und fraß sich immer tiefer in ihn hinein.
Filip drehte sich eine Zigarette und schaute absichtslos aus dem Fenster auf die Menschen hinunter, die in der belebten Straße schlenderten und nichts von seinen inneren Qualen ahnten. Bilder von der Trauerfeier und der anschließenden Beisetzung seines Vaters tauchten vor seinem inneren Auge auf.
Er ging zu seinem Schreibsekretär und fischte das Manuskript aus einer Schublade. Er überflog nochmals die Trauerrede, die Adolf Krieger anlässlich des plötzlichen, unfassbaren Todes seines Vaters, Paul Quirnheim, gehalten hatte, und blieb an einem Abschnitt gegen Ende der Rede hängen:
So reich das Werk ist, das er hinterlässt – vieles bleibt ungesagt, was er uns noch zu sagen gehabt hätte. Paul Quirnheim, 1910 geboren, ist nur achtundfünfzig Jahre alt geworden. Er hatte sein Lebenswerk noch nicht vollendet. Gerade begann die wissenschaftliche Welt ihm große und größte Ehren als Zeichen der Anerkennung und des Dankes anzubieten. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass er für den diesjährigen Nobelpreis im Gespräch war. Sein wissenschaftliches Leben fiel in eine Zeit umwälzender biologischer Erkenntnisse, zu denen er durch seine Arbeit wesentliche Beiträge geleistet hat. Man wird ihn stets als einen der Begründer des modernen Wissenschaftszweiges der molekularen Biologie im Gedächtnis behalten.
Für alle, die ihn persönlich kannten, steht neben seinem Werk der liebenswerte, bescheidene, musische Mensch, der humorvolle Freund, der gute, immer hilfreiche Kamerad. Er schätzte die moderne Malerei und malte selbst. Er fertigte Holzschnitzereien an und hat eine Reihe von schönen Gedichten hinterlassen. Man spürte aus allem, was er machte, seine Liebe zum Leben. Wahrlich ein Mensch, der alle, die ihn kannten, bereicherte, und der Welt und seiner Familie ein reiches Erbe hinterlassen hat. Wir werden ihn nie vergessen.
All das, was der Weggefährte, Mentor und Förderer seines Vaters gesagt hatte, war richtig, dachte Filip. Aber es war doch nicht die ganze Wahrheit. Die wurde der Öffentlichkeit vorenthalten. Sein Vater hatte schwere Schuld auf sich geladen und Filip verstand den Menschen, den er zeitlebens verehrt hatte, nicht mehr.
Erstes Kapitel
Edmund Quirnheim 1900 – 1919
Das Fremde war ihm fremd geblieben.
Von Neugier und Abenteuerlust getrieben, zog es Edmund Quirnheim hinaus in die Welt. Nach seinem Dienstjahr beim 2. Grenadier Regiment No.101, König von Preußen Kaiser Wilhelm reiste er zunächst nach Argentinien, Paraguay und Brasilien. Als ihm sein Cousin eine Teilhaberschaft in seiner Firma in Japan anbot, nahm er sofort an. Auf dem Dampfschiff ‚France’ fuhr er von Brasilien über Bahia und Dakar nach Marseille. Nach einem kurzen Besuch bei seinem Vater in Hamburg bestieg Edmund in Genua den Reichsdampfer ‚König Albert‘ und erreichte nach einer Fahrt über Port Said, Colombo, Sumatra, Singapur, Shanghai, Nagasaki im Jahr 1900 Hiroshima.
Sein Cousin hatte ihm die damals siebtgrößte Stadt des Landes in den höchsten Tönen beschrieben. Während des Ersten Japanisch-Chinesischen Krieges sei die Stadt Standort des kaiserlichen Hauptquartiers gewesen und in der Folgezeit zu einem militärischen Zentrum des Kaiserreichs Japan geworden. Der Ausbau des Hafens im Jahr 1889 und der Anschluss an die fünf Jahre später fertiggestellte Sanyō-Eisenbahnlinie habe zu einem weiteren Aufschwung der Stadt an der Mündung des Ota geführt.
Edmund war neugierig auf das Land und die Stadt. Er ließ das Unbekannte, das Exotische in den ersten Jahren seines Aufenthalts in Japan ungefiltert in sich eindringen und die ungewohnten Gebräuche und Sitten seines Gastlandes auf sich wirken.
So sehr ihn auch anfangs das Fremde begeistert hatte, mit den Jahren verlor es seine Anziehungskraft. Das sich wiederholende Alltagsgeschehen gerann zur Routine und das wenige Unentdeckte verlor seinen Reiz. Ein diffuses Gefühl der Leere und des Verlassenseins ergriff immer häufiger von ihm Besitz. Wie unter einem Brennglas sah er, was ihn von den Menschen hier unterschied, wer er tief in seinem Herzen war, welche Hoffnungen und Empfindungen er hatte. Die Erfahrung des Fremden führte ihn zu sich selbst. Das unverwechselbar Eigene stellte sich ihm hier in Japan in erster Linie als das vom Fremdländischen unterschiedene dar. Obwohl er häufig das Gegenteil gehört hatte, fühlte sich Edmund umso mehr als Fremder, je länger er in Japan lebte und je genauer er Land und Leute kennenlernte. Er spürte, zunächst noch undeutlich, mehr als jeder in der Heimat Verbliebene tief in sich das, was er das ‚Deutschempfindende‘ nannte.
Nachdem Edmund Quirnheim zwei Jahre als Teilhaber in der Firma seines Cousins gearbeitet hatte, machte er sich erfolgreich selbstständig und zog in Betracht, eine Familie zu gründen. Er hoffte, so das innere Vakuum auszufüllen und ein Stückchen deutsche Heimat in sein Haus am Rande von Hiroshima holen zu können. Die Suche nach einer geeigneten Frau für dieses Vorhaben war ein durchaus schwieriges Unterfangen, da er bei seinen Geschäftsreisen nach Deutschland nie lange in Hamburg weilte und seine Ansprüche an eine Ehefrau und die Mutter seiner zukünftigen Kinder hoch und genau umrissen waren.
Die richtige Frau war für ihn eine Frau mit Prinzipien, die sie bei Bedarf über den Haufen warf, um für ihn da zu sein. Eine präsentable Frau mit Mut, mit dem sie sich nicht brüstete, und Klugheit, mit der sie weder renommierte noch in einen Wettbewerb zu ihm trat. Eine selbständige Frau, die dennoch zu ihm aufsah. Die Richtige war in seinen Augen eine sowohl in der körperlichen als auch seelischen Liebe hingebungsvolle Frau, die Zweisamkeit schätzte und eine gewisse Gewähr dafür bot, ihm viele Kinder zu schenken.
Bei jeder seiner Geschäftsreisen nach Hamburg hielt er fortan stets Augen und alle weiteren Sinne nach dieser Frau offen. Und er war bald erfolgreich bei seinen Sondierungsbemühungen, wie er die Suche nach einer passgenauen Ehefrau hanseatisch-nüchtern seinem Vater gegenüber nannte. Auf einem Empfang des Hamburger Senats lernte er sie schließlich kennen. Er stand vor dem hohen Fenster des Empfangsaals und blickte, die Hände auf dem Rücken verschränkt, auf den fast menschenleeren Platz vor dem Rathaus. Es regnete.
»Guten Abend«, sagte sie. »Ich heiße Eva.«
Im Fenster spiegelte sich eine junge Frau. Er drehte sich zur Seite und sah in ein rundes Gesicht. Tief in den Höhlen vergrabene große Augen. Lachende Augen. Die langen, braunen Haare waren hinten zu einem Knoten gebunden. Ein paar gekräuselte Haarsträhnen fielen ihr in die hohe Stirn.
Sie fragte, was er auf dem Platz Interessantes sehe.
»Nichts, ich schaue nach innen.«
»Oh, dann sind Sie Philosoph.«
Die Stimme gefiel ihm.
»Nein, ich bin Kaufmann.«
»Und was kaufen oder verkaufen Sie?«
»Stoffe, japanische Stoffe.«
Sie ließ wieder ein zartes, dahingehauchtes ‚Oh‘ vernehmen.
»Dann könnte ich bei Ihnen also Stoffe für meine Kleider kaufen?«
»Nein, eigentlich exportiere und importiere ich nur die Stoffe, aber ich würde bei Ihnen gerne eine Ausnahme machen.«
»Denken Sie, dass japanische Stoffe zu mir passen würden?«
Sie drehte sich vor ihm um die eigene Achse. Edmund betrachtete Eva genauer.
»Ja, unbedingt.«
Als sie ihm später wie beiläufig über den Handrücken strich, zuckte er zusammen, und ihm wurde klar, wie lange ihn niemand mehr zärtlich berührt hatte. Sie sprachen und lachten zusammen, tranken ein paar Gläser, und alles fühlte sich gut an.
Eva Krüger hatte sieben Geschwister und war die Tochter eines Professors für Germanistik der Universität Hamburg. Edmund heiratete Eva, nachdem sie sich näher kennengelernt hatten und sie einwilligte, mit ihm nach Japan zu ziehen. Nach kurzer gemeinsamer Zeit in Japan erfüllte sie ihm seinen sehnlichsten Wunsch nach einem Sohn, dem in den folgenden Jahren noch drei Töchter folgen sollten.
Als sein Sohn Paul neun Jahre alt wurde und der Schulwechsel auf ein Gymnasium anstand, hatte Edmund Quirnheim lange mit sich gerungen: Sollte er ihn mit seiner Mutter und den Geschwistern nach Hamburg schicken, um ihm eine deutsche, humanistische Bildung zu ermöglichen? Das war der Wunsch seiner Frau, die trotz der herrschaftlichen Wohn- und Lebensverhältnisse in Japan nicht glücklich war. Oder wäre es besser, Paul weiter unter seiner Obhut zu halten? Deutschland hatte gerade den Krieg verloren. Der Kaiser hatte abgedankt. Sein stolzes Kaiserreich lag in Trümmern. Unsicherheit und Chaos herrschten. Sollte er seinen Sohn in ein von Revolutionen und Unruhen geplagtes Land reisen lassen, allein mit der Mutter und ohne die väterlich schützende und lenkende Hand?
Er beugte sich schließlich dem Wunsch seiner Frau, trotz bleibender Bedenken. Er hoffte, dass sich das Land schnell wieder zu einem starken Staat unter fester Führung entwickeln und die Schmach des Versailler Friedensvertrags aus der Welt schaffen würde.
Jetzt, da Frau und Kinder zurück in die Heimat gereist waren, wurde es einsam um ihn. Er empfand die Andersartigkeit der Asiaten immer häufiger als einen Angriff auf seine Eigentlichkeit, als Störfaktor, der seine inneren Empfindungen verletzte und seiner Sehnsucht nach Eingebundenheit, Liebe, Vertrautheit entgegenwirkte.
Er saß, wie oft, wenn ihn etwas bedrückte und er nach Auswegen suchte, am Rande seines Gartenteiches, in dem Zierfische dicht unter der Wasseroberfläche ihre Kreise zogen. Er verweilte dort schon beträchtliche Zeit, kerzengerade und unbeweglich. Die Hände lagen mit nach oben gerichteten Handflächen auf seinem Schoß. Sein Blick ruhte auf der Blütenpracht der Japanischen Zierkirsche, die als Solitär inmitten des parkähnlichen Gartens auf einem künstlich angelegten, kleinen Hügel stand. Es war die Zeit des Hanami, des ‚Blütensehens‘, das den Frühling und die Zeit des Reifens ankündigte. Die überbordende Blütenpracht von April bis Mai war jedoch nur von kurzer Dauer. Der Gedanke der Flüchtigkeit alles Schönen und Begehrenswerten entfachte bei ihm aufs Neue die Schwermut, die ihn schon den ganzen Tag gefangen hielt. Was er in der Natur sah, Gedeihen, Verfall und Tod, verwob sich in seiner Gedankenwelt zu einer in sich undurchschaubaren Macht, der er hilflos ausgeliefert schien.
Er änderte seine Blickrichtung und sah zu seinem Haus, das ihm als Büro für sein prosperierendes Handelsunternehmen und gleichzeitig als Wohnhaus diente. Die geräumige Villa lag zwischen rot- und weißblättrigen, prächtigen Ahornbäumen, Koniferen und Zierkiefern und war vom Teich aus in seiner ganzen Größe und Pracht erkennbar. Seine traurigen, skeptischen Augen nahmen vorübergehend einen warmen Glanz an und spiegelten seine satte Zufriedenheit und Genugtuung über sein erfolgreiches Geschäftsleben wider, das sich in seinem Haus manifestierte, um dann sogleich wieder alle Helligkeit zu verlieren. Gebaut für eine große Familie war es jetzt still, und abgesehen von den Büroangestellten und dem verbliebenen Hauspersonal, unbelebt. Seelenlos. Ein totes Haus. Kein Kindergeschrei, kein Lachen, kein Türeschlagen, kein vertrautes Gesicht. Selbst der ewig lächelnde Prinz Karl Anton von Hohenzollern erschien ihm ernst. Das Foto hing im Salon des Hauses prominent neben dem Bildnis des entschlossen blickenden deutschen Kaisers und zeigte ihn bei seinem Besuch in Japan, im Kreise der Honoratioren der hiesigen deutschen Kolonie. Edmund stand oft davor und erfreute sich an dem Prinzen, dessen Augen direkt auf ihn gerichtet waren und dessen Wohlwollen allein ihm zu gelten schien.
Damit war es jetzt nach dem verlorenen Krieg vorbei.
Edmund erhob sich und ging in den Club der deutsch-japanischen Gesellschaft. Hier hoffte er, sich ablenken und sich über die neueste Nachrichtenlage in Deutschland informieren zu können. Die ausliegenden, überwiegend konservativen, deutsch-nationalen Zeitungen waren seine tägliche Lektüre. Die mit einiger Zeitverzögerung aus Deutschland eintreffenden Presseerzeugnisse fanden eine willkommene Ergänzung durch aktuellere Berichte und Erzählungen der zahlreichen Besucher des Clubs, die frisch aus Deutschland kamen. Auch neueste Informationen, die auf postalischem Weg Hiroshima erreicht hatten, verbreiteten sich schnell unter den Clubmitgliedern und flossen in die oft hitzig geführten Diskussionen.
In den letzten Monaten, so der allgemeine Tenor der Exildeutschen, waren es überwiegend äußerst alarmierende Meldungen aus der Heimat, die die deutsche Gemeinde in Hiroshima betroffen und tief deprimiert sich selbst überließ: Die kaiserliche Familie war verjagt, das Deutsche Reich, das stolze, und, wie es hieß, im Feld unbesiegte deutsche Militär, die deutschen Kolonien, die deutsche Kultur lagen, von den Siegermächten zertrümmert, darnieder.
Edmund sah seinen Cousin Geert inmitten einer Gruppe von Männern, die um einen niedrigen, runden Mahagoni-Tisch beisammensaßen. Im Hintergrund hing an der getäfelten Wand unter dem Porträt von Kaiser Wilhelm II. die schwarz-weiß-rote Handelsflagge. Er ließ sich erschöpft in einen noch freien, tiefen Ledersessel fallen. Er bestellte bei dem sofort herbeieilenden, japanischen Kellner ein Glas deutsches Bier und eine Zigarre und folgte der lautstark geführten Debatte. Die Herren, gekleidet in schwarze Anzüge mit Binder, trugen ausnahmslos Schnauzbärte, die nur in Nuancen voneinander abwichen. Sie schienen zu keinem anderen Zweck zusammengekommen zu sein, als sich gegenseitig in ihren Meinungen zu bestärken und ihren Unmut über die aktuelle deutsche Politik lautstark äußern zu können.
»Revolutionen haben einem Volk noch nie Glück gebracht. Denken Sie nur an Frankreich, meine Herren. Was hat die Revolution den Franzosen beschert? Die Guillotine und Mord und Totschlag. Dasselbe erleben wir jetzt bei uns in der Heimat«, ließ sich gerade Heiner Taubfels mit polternder Stimme vernehmen und zwirbelte nervös an den Enden seines Kaiser-Wilhelm-Bartes. »Wir sollten uns nicht auf die Werte der Französischen Revolution wie auch nicht auf den Westen insgesamt stützen, sondern uns auf unser deutsches Erbe besinnen. Ihr kennt sicher alle den Altdeutschen Verband. Was er in seinen Satzungen festgeschrieben hat, sollte uns Vorbild sein und hochgehalten werden: die Sprache, die Rasse, die Volksgemeinschaft und das Führerprinzip.«
Per von Brandenfels, Konsul und Präsident der deutsch-japanischen Handelsgesellschaft in Hiroshima, hob beschwörend die Hände in die rauchgeschwängerte Luft.
»Ich sage euch, das Gefasel von Demokratie und Liberalismus führt Deutschland ins Chaos und schließlich in den Abgrund.«
»Und wir müssen das Militär stärken. Es wird schlechtgeredet. Es ist aber der einzige Garant von Stabilität und Ordnung. Unerlässlich. Insbesondere dann, wenn ich an die kommunistischen, sozialistischen und rätedemokratischen Umtriebe denke. Wer soll uns vor diesem Mob schützen, frage ich euch?«, ereiferte sich der aus Kiel stammende Heinz Räter, der ein florierendes Handelsunternehmen mit Kunst und Antiquitäten leitete.
Edmund nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Glas und zog aus der Innentasche seines Jacketts ein Briefkuvert hervor.
»Diesen Brief habe ich vor einiger Zeit von meiner Frau aus Hamburg bekommen. Sie zitiert darin Hindenburg. Eine Äußerung von ihm vor dem Ausschuss der Nationalversammlung für Schuldfragen des Krieges und der Rolle des Militärs. Das sagte er im November letzten Jahres. Es war mir aber neu. Ich erlaube mir deswegen, euch einen kurzen Abschnitt aus dieser Rede Hindenburgs zu zitieren: ‚Der Krieg wäre gewonnen worden, wenn Heer und Heimat zusammengestanden hätten. Stattdessen habe eine heimliche, planmäßige Zersetzung von Flotte und Heer eingesetzt. So mussten unsere Operationen misslingen, es musste der Zusammenbruch kommen. Die Revolution bildete nur den Schlussstein. Ein englischer General sagte mir mit Recht ‚die deutsche Armee ist von hinten erdolcht worden.‘ Soweit Hindenburg. Ich denke, das spricht für sich. Unsere Armee verdient unsere volle Unterstützung.«
Die Runde nickte beifällig mit den Köpfen, als sich vom Nebentisch ein junger Mann erhob, der dem Gespräch offenbar gelauscht hatte. Die Diskutanten sahen ihn fragend und verwundert an. Er stellte sich hinter Edmund, verschränkte seine Hände auf dem Rücken und sprach mit fester, ruhiger Stimme.
»Entschuldigen Sie bitte, meine Herren, dass ich mich in ihr Gespräch einmische. Mein Name ist Kurt Bärnbach. Ich war im Herbst 1918 Adjutant im Stab von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und General Erich Ludendorff. In einer Sitzung der OHL sagte Ludendorff damals gegenüber seinen Stabsoffizieren, dass der Krieg wegen der personellen und materiellen Übermacht der Gegner endgültig verloren sei. Es war der 1. Oktober. Ich erinnere mich deswegen so genau, weil es mein Geburtstag war. Er sagte weiter – und ich habe seine niederschmetternden Worte noch wörtlich im Kopf: ‚Ich habe Seine Majestät gebeten, Frieden zu schließen, der jetzt geschlossen werden muss.‘ Er gab einen ungeschminkten, militärischen Lagebericht, der auch an die Reichstagsfraktion weitergeleitet wurde. Sie war entsetzt, da bisher immer nur von Siegen und der Unbesiegbarkeit des deutschen Heeres berichtet wurde.«
Kurt Bärnbach unterbrach kurz seine Rede und sah nacheinander jedem einzelnen der Tischrunde in die Augen.
»In einem geschickten Schachzug übertrug Hindenburg die Friedensverhandlungen vom Militär, wo sie eigentlich hingehören, auf die Politik. Sie sollte die Suppe auslöffeln, die das Militär ihr eingebrockt hatte. Prinz Max war gezwungen, eine diplomatische Note an die Siegermächte zu schicken, in der die deutsche Regierung den sofortigen Abschluss eines Waffenstillstand zu Lande, zu Wasser und zu Luft ersuchte. Das Ziel der OHL war, sich aus der Verantwortung für den verlorenen Krieg zu stehlen und den Regierungsparteien die Schuld anzulasten. Das war, wie gesagt, schon im Oktober 19181. Die später von Hindenburg in die Welt gesetzte Behauptung der Zersetzung von Flotte und Heer durch die Politik, die angeblich zum Misslingen der Operationen und zum Zusammenbruch geführt haben soll, ist also eine Lüge. Niemand wusste besser als die kaiserlichen Generäle, dass der Krieg unter ihrer Führung bereits verloren war, bevor die Auflösungserscheinungen an der Westfront begannen.«
Der Vorwurf der Lüge gegen einen deutschen Generalfeldmarschall lag bleischwer im Raum. Edmund und seine Freunde sahen sich entgeistert und mit offenen Mündern gegenseitig an. Dann, wie auf ein Kommando, richteten sich fünf Augenpaare auf den bartlosen jungen Mann, der scheinbar unbeeindruckt ihren Blicken standhielt. Heinz Räter erhob sich. Sein Schmiss auf der rechten Stirnseite schwoll rot an, als er seinen Arm wie einen Säbelhieb in Richtung Bärnbach vorstieß. Die Gespräche im Salon verstummten. Es herrschte atemlose Stille.
Bevor Räter zum verbalen Gegenangriff übergehen konnte, sagte Bärnbach, immer noch mit ruhigem, aber messerscharfem Ton:
»Beruhigen Sie sich. Sie werden doch nicht der Wahrheit in die Parade fahren wollen. Wahrheit und Moral brauchen tapfere Männer zu ihrer Verteidigung, gerade in Zeiten, da die Luft voller gefährlicher Infektionsstoffe ist. Der große Dichter Rilke, der sicher auch von Ihnen geschätzt wird, hat gesagt: ‚Nur die Wahrheit steigert die Kraft, den Willen, die Vernunft‘. Geben Sie der Vernunft, der neuen Republik und unserem Reichspräsidenten eine Chance! Hängen Sie das Bild des Kaisers hier an der Wand ab und ersetzen Sie es durch Reichspräsident Ebert. Das wäre eine Haltung von Moral und Würde. Ohne Würde ist der Mensch ein Nichts. Sie wird einem aber nicht wie ein Orden verliehen, jeder muss sie für sich erarbeiten. Ich bitte Sie, meine Herren, töten Sie nicht die Wahrheit schon während der Geburtsstunde der Demokratie!«
Edmund bebte. Unter seinen Füßen schwankte der Boden. Die Gläser auf dem Tisch vibrierten. Zuerst ganz leicht, dann stärker. Das Bier schwappte über den Rand. Es war, als ob die Luft in Schwingung geraten wäre. Mit einem lauten Knall krachte das Bild von Kaiser Wilhelm II. auf den Parkettboden. Edmund starrte zuerst auf das zerstörte Bild, dann auf Bärnbach. Verwirrt, ängstlich. Kurt Bärnbach stolperte. Er blickte hoch zur Decke. Blieb erstarrt stehen, unfähig den Blick davon abzuwenden. Edmund folgte seinem Blick nach oben. Die Paneele der Decke brachen auf. Es knirschte, die Luft kreischte. Bärnbach stürzte. Teile der Deckenverkleidung begruben ihn unter sich. Blut quoll unter seinem Kopf hervor. Aus den Augenwinkeln sah Edmund Gestalten gebückt davonrennen, die Jacken zum Schutz über die Köpfe gezogen. Er stürzte zu Bärnbach, befreite ihn von den heruntergefallenen Paneelen, griff ihn unter die Arme, schleifte ihn ins Freie. Erschöpft ließ er sich auf den gepflegten Rasen fallen und sah, wie Teile des Gebäude unter der Wucht der Erdstöße in sich zusammensackten. Bärnbach lag in seinen Armen und erst jetzt sah er, wie jung dieser war.
1 Siehe hierzu wie zu allen weiteren historischen Ereignissen die ‚Zeittafel‘ im Anhang.
Zweites Kapitel
Paul Quirnheim 1924 – 1933
Paul Quirnheim biss die Zähne zusammen. Seine Lungen brannten, seine Arme schmerzten. Schweißtropfen liefen ihm in die Augen und er sah den Rücken seines Vordermanns nur noch wie durch einen Schleier. Die Anfeuerungsrufe klangen wie ein Echo von weit her, sich immer wiederholend, hohl, unverständlich. Dann plötzlich drang Jubelgeschrei in sein Ohr. Hanno Silberstedts Ruder platschten in das Alsterwasser. Er riss die Arme in die Höhe, die Hände zu Fäusten geballt. Paul blickte nach links und dann rechts. Kein Boot war vor ihnen, als sie über die Ziellinie fuhren. Die Plackerei der letzten Wochen und Monate hatte sich gelohnt.
»Bravo, mein Junge, das hast du gut gemacht. Schade, dass Vater nicht hier sein kann. Er wäre sehr stolz auf seinen Sohn gewesen«, gratulierte ihm seine Mutter.
Anika, seine zwei Jahre jüngere Schwester, schaute ihren großen Bruder hingerissen an. Er war für sie, auch ohne seinen Sieg, viel mehr als ein Bruder. Sie schwärmte für ihn und hätte ihn auf der Stelle geheiratet, wenn er nicht ihr Bruder gewesen wäre. Groß, sportliche Figur, gutaussehend, blaue, manchmal ins grau changierende Augen. Klug, äußerst klug. Sie warf sich ihm an den Hals und küsste ihn vor aller Augen ab. Er blickte, peinlich berührt, über ihre Schulter zu seinen Freunden und Schulkameraden. Er zuckte mit den Schultern und griente sie hilflos an. Als er jedoch bemerkte, wie einige Mädchen ihm Handküsse zuwarfen und ihn anschmachteten, verlor sich sofort der leicht unbeholfen wirkende Gesichtsausdruck und machte einem strahlenden Siegerlächeln Platz.
Gerhild, die Dritte in der Alterspyramide der Geschwister Quirnheim, drängte sich zu ihrem Bruder und sagte schnippisch:
»Das war aber knapp, mein lieber Bruder. Du siehst richtig fertig aus. War anstrengend, was? Aber du hast solch einen strapaziösen Sport freiwillig gewählt, dann musst du die Folge auch mannhaft ertragen. Für mich wäre das nichts.«
»Es würde dir nicht schaden, ein wenig mehr Sport zu treiben. Das ertüchtigt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Nimm dir Anika als Vorbild«, sagte Paul, der mit sich und der Welt versöhnt war, und lachte.
»Da halte ich mich lieber an meine kleine Schwester, die nimmt die Welt spielerisch und nicht so ernst wie du.«
»Otelia ist noch klein, sie darf das. Aber das bleibt nicht so. Ohne Anstrengung und ein wenig Ehrgeiz wird das nichts mit dem Leben. Lass dir das von deinem großen Bruder sagen und schreib es dir hinter die Ohren«, sagte Paul, zwinkerte ihr mit dem rechten Auge zu und gab ihr einen liebevollen Kuss auf den wie mit einem Lineal gezogenen Mittelscheitel ihres blonden Haarschopfs. Die zwei ordentlich geflochtenen Zöpfe, die an den Enden von großen, roten Schleifen zusammengehalten wurden, fielen ihr bis auf die Schulterblätter. Ihr ganzer Stolz. Sie hatte Jahre duldsam gewartet, um diese Haarlänge zu erreichen.
Ein Lautsprecher forderte Paul Quirnheim und Hanno Silberstedt auf, sich beim Veranstalter des Rennens für die bevorstehende Siegerehrung zu melden.
In dieser Zeit glaubte Paul noch daran, dass man mit eigener Tatkraft und eisernem Willen Berge versetzen könnte. Dass er, wenn er eine Sache mit Leidenschaft angehe und von ihr überzeugt sei, Dinge zu etwas Besserem wenden könne. Was es auch sei! Viel später in seinem Leben ging ihm dieser Glaube verloren. Er wurde ihm durch die Gewalt der Verhältnisse ausgetrieben und hatte später Gültigkeit nur noch im engeren Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit. Paul Quirnheim konnte als Fünfzehnjähriger noch nicht ahnen, welche Bedeutung dieser Tag für ihn, für sein Leben haben würde. Er spürte nur Freude und Genugtuung, sah nur den Sieg, die Ehre und die Mädchen, die ihm zuwinkten.
Der ältere Herr im Cut, Zylinder und mächtigem Bismarck-Schnauzer räusperte sich und schaute von seinem Podest über die Binnenalster hinweg in die Ferne, wo die Sonne sich anschickte, unterzugehen.
»Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Senats, liebe Ruderfreunde, ich habe die große Ehre, die Sieger der diesjährigen Hamburger Alster-Ruder-Jugendmeisterschaften zu küren. Die Jungen aus der Untersekunda des Matthias-Claudius-Gymnasiums in Hamburg-Wandsbek haben Großartiges geleistet und sind Vorbild für unsere Jugend. Ich darf jetzt die Sieger im Zweier ohne Steuermann Paul Quirnheim und Hanno Silberstedt bitten, zu mir zu kommen, um den Siegerpokal in Empfang zu nehmen.«
Er winkte die beiden Sportler mit einer ausladenden Geste zu sich und drückte ihnen von seinem Rednerpult herunter die Hand.
»Ihr habt nicht nur euren Eltern und eurer Schule Ehre gebracht, sondern der ganzen Hansestadt Hamburg. Ich weiß, Paul, dass dein Vater, ein ehrbarer und erfolgreicher Hamburger Kaufmann, nicht hier sein kann. Er wäre, wie wir alle, stolz auf dich. Jeder Vater wäre auf solch einen Sohn stolz!
Was für ein Tag ist das heute! Wir werden den 26. April wohl nie vergessen. Ihr habt euren Sieg just an dem Tag errungen, an dem Deutschland den ehemaligen kaiserlichen Reichsfeldmarschall Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten wählt. Hindenburg hat in dieser Wahl gekämpft und wird gewinnen, wie ihr euren Wettkampf gewonnen habt. Ihr, wie auch Paul von Hindenburg, seid verdiente Sieger und euch, der Jugend, wie ihm, dem Erfahrenen und im Alter Gereiften, gehört die Zukunft. Und lassen Sie mich noch hinzufügen: es hat mich besonders gefreut, dass gerade auch die Hamburger Bürger, wie der Wahlkampf gezeigt hat, hinter unserem neuen Staatsoberhaupt stehen und ihn mit großer Mehrheit wählen werden. Wir wünschen ihm an dieser Stelle viel Erfolg und eine entschlossene Hand. Eine Hand, die es gewohnt ist, durchzugreifen und ein Kopf von nationaler Gesinnung, der deutsches Empfinden kennt. Er wird wieder Ruhe und Ordnung in unser Gemeinwesen bringen. Wir hoffen alle auf bessere Zeiten nach dem schweren Jahr 1923. Eingebrannt in unser Gedächtnis sind nicht nur die katastrophale Inflationszeit, die viele Hamburger in den Ruin trieb, sondern auch die Umsturzversuche hier in Hamburg – viele werden sich noch mit Schrecken an den 23. Oktober 1923 erinnern, an dem kommunistische Trupps Hamburgs Polizeistationen und anderen öffentliche Gebäude überfielen –. Sie alle haben sicher auch noch die Revolte von Hitler im November in München, die Separatistenbewegungen und den blutigen Aufstand der Roten Ruhrarmee vor Augen. Nach diesem wahrlich turbulenten Jahr erhoffen wir uns alle von Feldmarschall von Hindenburg friedlichere Zeiten, Ruhe und Ordnung. Mit seiner Präsidentenzeit ist aber auch die Hoffnung verbunden, dass es ihm gelingt, die Macht und den Einfluss des Judentums auf Politik, Wirtschaft und Kultur einzudämmen, die Schmach von Versailles zu tilgen und für das Deutsche Reich den Platz in der Welt zu erkämpfen, der ihm zusteht. Die Wähler werden gleichzeitig mit ihrer Wahl ein Bekenntnis ablegen, wie das Graf Westarp von der DNVP ausgedrückt hat, ein Bekenntnis zu dem Gedanken der Führerpersönlichkeit, ein Bekenntnis zu jener Vergangenheit, die vor 1918 lag. Dafür steht Paul von Hindenburg. Hoch soll er leben!«
Die Zuhörer warfen ihre Hüte in die Luft und feierten Hindenburg.
Der Vorsitzende der Hamburger Rudervereine wandte sich nach dieser Rede an die Zuschauer wieder den Siegern des Wettbewerbs zu.
»Du, lieber Paul Quirnheim, hast mit deinem Sieg gezeigt, was die deutsche Jugend zu leisten in der Lage ist. Du verkörperst unsere Hoffnung und wirst Deutschland unter der kraftvollen Führung von Hindenburg wieder zu einem starken, stolzen Land machen.«
Paul nahm den Pokal in Empfang und reckte ihn in die Höhe. Die Menge klatschte Beifall, der sowohl ihm als auch, wie Paul vermutete, der Rede des Vorsitzenden galt.
Hanno stand abseits und lächelte verlegen. Es war nicht das erste Mal, dass er behandelt wurde, als sei er unsichtbar. Sein Vater, ein angesehener jüdischer Rechtsanwalt, nahm seinen Sohn in die Arme und beglückwünschte ihn. Die Mutter tupfte sich mit ihrem Spitzentaschentuch Freudentränen aus den Augen. Pauls Mutter, die die Szene beobachtet hatte, ging auf die Familie Silberstedt zu. Deren Grundstück, auf dem die Silberstedts schon seit Generationen in einem herrschaftlichen Haus wohnten, lag nur etwa hundert Meter von ihrem entfernt. Sie gab den Eltern und Hanno die Hand und gratulierte zu dem Erfolg.
Hannos Mutter lächelte dankbar.
»Es ist eine schöne Anerkennung für die beiden Jungen. Sie haben so viel dafür gearbeitet und haben sich den Sieg verdient. Wir haben heute Abend zu einer kleinen Feier geladen. Wenn Sie Zeit haben, sind Sie und natürlich Paul herzlich eingeladen.«
»Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Silberstedt. Vielen Dank, aber wir haben für heute schon etwas vor. Vielleicht klappt es ein andermal … ich hoffe, Ihnen und ihrer Familie geht es gut. Wie mir Paul neulich sagte, gehört Hanno mit zu den Besten in der Klasse. Das freut mich für ihn. Sie sind sicher auch stolz auf ihn. Schade, dass Hanno bei der Siegerehrung ein wenig in den Hintergrund gedrängt wurde. Ich hoffe, das hat ihn nicht gekränkt. Er ist ein so freundlicher und netter Junge.«
Frau Silberstedt blickte ihr offen in die Augen, hob die Schultern und ließ sie resigniert wieder fallen.
»Ist schon gut. Er hat den gleichen Anteil am Sieg, aber die öffentliche Anerkennung wird ihm nicht in vollem Umfang gewährt. Er leistet gleichviel hier und in der Schule, aber Bestätigung findet seine Leistung nur in unserer Familie. Es tut mir leid für ihn. Aber wir versuchen, uns über die Ignoranz und Respektlosigkeit nicht mehr aufzuregen. Obwohl es von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Sie glauben gar nicht, was wir uns alles gefallen lassen müssen. Einfache, normale Leute auf der Straße pöbeln uns an. Da wirken dann auch solche Reden wie heute nicht gerade beruhigend.«
Frau Silberstedt hielt kurz inne und blickte zu ihrem Mann, der in das Gespräch eingreifen wollte. Sie ignorierte ihn und wandte sich wieder Eva Quirnheim zu.
»Mein Mann spürt diese Stimmung auch in der Kanzlei. Er hat immer weniger nichtjüdische Klienten. Und, nun ja, das wissen Sie selbst, große Teile des Justizapparats sind antisemitisch und nicht nur ihm nicht wohlgesonnen, sondern auch der neuen Republik nicht. Der Redner eben, übrigens ein Mitglied der DNVP, hatte den Hitlerputsch erwähnt. Was ist mit Hitler seinerseits passiert? Alle wissen es. Es ist gerade mal ein Jahr her, als das Urteil in dem Hochverratsprozess verkündet wurde. Er bekam sogenannte ehrenhafte Festungshaft und wurde nach nicht einmal neun Monaten, am 20. Dezember letzten Jahres, entlassen. In den Augen der Richter wurde Hitler von ‚rein vaterländischem Geist‘ und ‚edelstem selbstlosen Willen‘ getrieben, so wörtlich der Richter. Und das Gericht lehnte es ausdrücklich ab, den österreichischen Staatsbürger Hitler, der so deutsch denkt und fühlt, wegen Hochverrats nach Österreich abzuschieben. Das sagt eigentlich alles über die deutsche Justiz. Der Kaiser ist gegangen, die Generäle und Richter sind geblieben.«
Eva war die Begründung des Urteils nicht bekannt. Sie war konsterniert über das, was sie gerade hören musste. Hitler, in ihren Augen ein unbedeutender Revoluzzer, war es ihrer Meinung nach nicht wert, dass man sich überhaupt Gedanken über ihn machte. Das Wenige, das sie über diesen Menschen wusste, gefiel ihr sowieso nicht. Ungehobelt. Polternd. Proletarisch. Insbesondere galt dies für das Auftreten seiner pöbelnden Hilfstruppen, der SA. Und jetzt wird dieser Mensch von den deutschen Behörden so hofiert! Sie verstand das nicht, wie Politik für sie überhaupt undurchschaubar und unergründlich erschien. Vielleicht war das der Grund, warum Politik sie eigentlich nicht interessierte, und das Terrain dem männlichen Teil ihrer Familie, ihrem Vater, Sohn und Ehemann, überließ. Völlig politikabstinent war sie jedoch nicht. Nachdem die Sozialdemokraten das Frauenwahlrecht erkämpft hatten, und Marie Juchacz im Weimarer Schauspiel vor der Nationalversammlung sagen durfte, ›Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volk sprechen darf, und ich möchte hier feststellen, und zwar ganz objektiv, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat‹, ließ Eva es sich nicht nehmen, bei den ersten Wahlen zum Reichstag ihre Stimme abzugeben. Sie hatte aber ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht die SPD, die ihr die Möglichkeit zur Wahl eröffnet hatte, gewählt hatte, sondern, wie ihr Mann, die industriefreundliche, rechtsliberale Deutsche Volkspartei.
Samuel Silberstedt war es unangenehm, wie sich seine Frau Hanna immer mehr in Rage redete und echauffierte. Er griff jetzt in das Gespräch ein und drängte zum Aufbruch.
»Lassen wir am heutigen Tag doch die Politik beiseite und freuen uns über unsere Jungs.«
Er warf einen raschen Blick zum Himmel.
»Es wird wahrscheinlich gleich regnen und wir sollten uns sputen, wenn wir trockenen Fußes nach Hause kommen wollen. Grüßen Sie bitte ihren Mann von mir, wenn Sie ihm wieder schreiben. Und ich würde mich freuen, Sie, sehr geehrte Frau Quirnheim, bald ein andermal bei uns begrüßen zu dürfen«, sagte er steif und lüftete leicht seinen Hut.
Samuel Silberstedt nahm seine Frau bei der Hand, schob seinen Sohn vor sich her und entfernte sich.
Der Regen kam heftig und blitzartig, so als ob sich die gesamte Binnenalster in einem einzigen Wasserschwall über das Auto ergießen würde. Sie trug an diesem Tag ein kurzes weißes Kleid. Paul starrte auf die weiße Haut ihres nackten Unterarms. Er fühlte einen unwiderstehlichen Drang, die winzigen, zarten Härchen ihres leicht schimmernden Haarflaums zu berühren. Außer dem Trommeln des Regens auf das Fahrzeugdach war es still im Wagen. Ingrid saß neben ihm im Fonds des Autos ihres Vaters Hans Klüver, ein weiterer Nachbar, der Paul angeboten hatte, ihn nach Hause zu fahren. Sie strich mit der Hand über ihren Oberschenkel, um eine Falte ihres Kleides zu glätten. Paul lehnte sich in den Sitz zurück, starrte auf den Nacken ihres Vaters und bemühte sich, seine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Ingrid rutschte an ihn heran.
»Das hast du ganz prima gemacht, Junge. Schade, dass ich keinen Sohn habe. Mädchen sind nun mal zu solchen Leistungen leider nicht fähig«, sagte Hans Klüver in die Stille hinein.
»Dafür können wir Kinder gebären, und wenn ihr Männer uns lassen würdet, könnten wir auch rudern«, sagte Ingrid.
»Das passt nicht zur Frau. Oder findest du es anmutig mit muskelbepackten Oberarmen und Oberschenkeln rumzulaufen?«
Paul beschäftigte sich wieder mit Ingrids seidigem Arm. Sie schob ihre Hände zwischen ihre Oberschenkel. Sie wusste nicht, wohin mit ihnen. Sie rieb ihr Bein an seinem. Nur ganz leicht, wie aus Versehen.
»Nein, es müssen nicht gleich Muskelberge sein. Frauen haben andere Qualitäten und andere Fähigkeiten«, sagte sie mit kecker Stimme und lachte Paul ins Gesicht.
Hans Klüvers Augen zogen sich zu einem winzigen Schlitz zusammen. Über sein rundes Gesicht, das einem Hamster, der sich gerade die Backen mit Körnern vollgestopft hat, ähnelte, legte sich ein andächtiges Lächeln. Er dachte an Helga, seine Helga. Eine gesunde, hübsche Frau, die alle Attribute seiner Sehnsuchtsfrau erfüllte. Erschaffen dazu, die Lust des Mannes zu befriedigen und das reine, edle Erbe von Generation zu Generation weiterzutragen. Das einzige, was zu seinem Glück fehlte, war ein Stammhalter. Die Hoffnung, dass ihm auch dieses Glück noch widerfahren würde, ließ ihn keinen Augenblick zur Ruhe kommen, und er arbeitete mit großer Energie an diesem ersehnten Ziel.
»Ja, Ingrid«, murmelte ihr Vater vor sich hin, »ihr Frauen verfügt in der Tat über andere Fähigkeiten. Wie denkst du darüber, Paul?«
Paul schreckte aus seinen Gedanken auf und lief augenblicklich rot an. Ingrid stupste ihn in die Seite und ließ ihre Hand auf seinem Oberschenkel liegen.
»Sag schon, was magst du an Frauen?«
Paul wurde es heiß. Er blickte auf ihre Hand, die auf seinem Schenkel ruhte, dann in ihr Gesicht, das ihn herausfordernd anstrahlte. Er wollte herausschreien, dass sie das schönste Mädchen sei, das er kenne. Er wollte sagen, dass er hier und jetzt nichts sagen kann, dass es ihm schrecklich peinlich sei, vor ihrem Vater und ihrer Mutter über seine Gefühle zu reden. Aber er sagte stattdessen: »Ich mag kluge Frauen. Ich mag Frauen, die wissen, was im anderen vorgeht, die Antworten kennen, ohne zu fragen. Frauen, die wissen, wann Schweigen beredter ist als jedes gesprochene Wort.«
Ingrid schaute ihn irritiert an.
»Das ist aber viel auf einmal. Darüber muss ich nachdenken. Worte wie Attraktivität, Schönheit, Anmut kamen nicht vor, spielt das für dich keine Rolle?«
»Doch, schon, aber …«
»Findest du mich hübsch?«
Paul würde am liebsten in dem Spalt zwischen ihren Sitzen verschwinden. Warum konnte er jetzt nicht seine Tarnkappe überziehen und der sichtbaren Welt entschwinden, so wie er es häufig in seinen Fantasien tat.
Herr und Frau Klüver drehten beide ihre Köpfe nach hinten und schauten ihn erwartungsvoll an.
Paul wandte sich.
»Ja, doch, schon. Aber, aber … Schönheit ist etwas sehr Intimes, und ich will darüber hier in der Öffentlichkeit nicht sprechen.«
»Aber es sind meine Eltern, keine Öffentlichkeit.«
»Du verstehst mich nicht.«
»Das ist schon in Ordnung, ich verstehe dich«, sagte Frau Klüver über die Schulter und zwinkerte ihm zu. »Komm doch mal zu uns, wenn du Lust hast. Dann könnt ihr alleine miteinander sprechen.«
Paul zuckte bei dem Wort Lust zusammen.
Als er zuhause auf seinem Bett lag, grübelte er, ob er Ingrid brüskiert habe. Er wollte etwas Gescheites sagen und hatte doch nur dummes Zeug geredet. Er ärgerte sich über sich. Wie so oft hatte er nicht die richtigen Worte gefunden, zu kompliziert gedacht und wahrscheinlich alles vermasselt. Er musste an die vielen Kusshände, die ihm erst vor ein paar Stunden zugeworfen worden waren, denken. Er könnte so viele Mädchen haben, mit denen er alle seine Träume erfüllen könnte. Doch er wollte nicht irgendein Mädchen, er wollte allein sie, das attraktivste und hübscheste Mädchen der Welt.
Er überließ sich seinen erotischen Gedankenfluchten, die er nicht mehr zu beherrschen wusste, und ließ sich von den überquellenden Lustfantasien forttragen bis zur erleichternden physischen Erschöpfung.