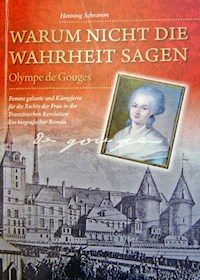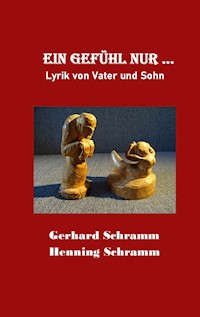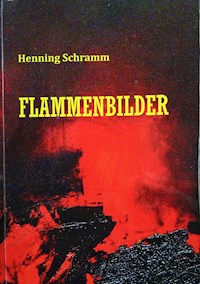6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unser Leben ist stark geprägt von einer imperialen Lebensweise. Der unverhältnismäßige Ressourcenverbrauch, die Konsum- und Produktionsmuster, die Ausbeutung der Natur und der Menschen, die Widersprüchlichkeiten aktueller Lebensformen und die von Kapitalinteressen geformte Ökonomie verhindern vielerorts gutes Leben. Dies fordert uns heraus, die Frage, was gutes Leben bedeutet und die Bedingungen für gutes Leben neu zu denken. Im Mittelpunkt des Buches steht neben der subjektiven Frage nach gutem Leben, wie sie sich jedem individuellen Leben stellt, somit auch die Frage nach den Voraussetzungen und Bedingungen der Transformation von einer imperialen hin zu einer sorgenden Lebensform - einer Gesellschaftsform also, in der gutes Leben für alle möglich ist. Das alltägliche Leben im Beruf, in der Familie, im Bekannten- und Freundeskreis ist von Begrifflichkeiten wie Freiheit, Willensfreiheit, Gerechtigkeit, Demokratie, Fairness, Solidarität, Respekt, Selbstachtung, Würde, Sexualität, Liebe, Tod, Hoffnung durchsetzt. Nicht immer explizit zur Sprache gebracht, aber doch häufig implizit gemeint, gedacht, empfunden und erhofft. Die beispielhafte Aufzählung der Abstrakta und Werte, mit denen sich das vorliegende Buch auseinandersetzt, lässt in Umrissen erkennen, was die Welt und mit ihr die Menschen bewegt. Sie umreißen fundamentale Dimensionen menschlicher Existenz und werfen Fragen auf, mit denen sich alle Menschen unabhängig ihrer Zeit und kulturellen Herkunft auseinandersetzen müssen. Sie sind insofern universell und beleuchten die existenziellen Fragen des Menschengeschlechts nach Sinn und gelingendem Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ÜBER DAS BUCH
Unser Leben ist stark geprägt von einer imperialen Lebensweise. Der unverhältnismäßige Ressourcenverbrauch, die Konsum- und Produktionsmuster, die Ausbeutung der Natur und der Menschen, die Widersprüchlichkeiten aktueller Lebensformen und die von Kapitalinteressen geformte Ökonomie verhindern vielerorts gutes Leben. Dies fordert uns heraus, die Frage, was gutes Leben bedeutet und die Bedingungen für gutes Leben neu zu denken. Im Mittelpunkt des Buches steht neben der subjektiven Frage nach gutem Leben, wie sie sich jedem individuellen Leben stellt, somit auch die Frage nach den Voraussetzungen und Bedingungen der Transformation von einer imperialen hin zu einer sorgenden Lebensform – einer Gesellschaftsform also, in der gutes Leben für alle möglich ist.
Das alltägliche Leben im Beruf, in der Familie, im Bekannten- und Freundeskreis ist von Begrifflichkeiten wie Freiheit, Willensfreiheit, Gerechtigkeit, Demokratie, Fairness, Solidarität, Respekt, Selbstachtung, Würde, Sexualität, Liebe, Tod, Hoffnung durchsetzt. Nicht immer explizit zur Sprache gebracht, aber doch häufig implizit gemeint, gedacht, empfunden und erhofft.
Die beispielhafte Aufzählung der Abstrakta und Werte, mit denen sich das vorliegende Buch auseinandersetzt, lässt in Umrissen erkennen, was die Welt und mit ihr die Menschen bewegt. Sie umreißen fundamentale Dimensionen menschlicher Existenz und werfen Fragen auf, mit denen sich alle Menschen unabhängig ihrer Zeit und kulturellen Herkunft auseinandersetzen müssen. Sie sind insofern universell und beleuchten die existenziellen Fragen des Menschengeschlechts nach Sinn und gelingendem Leben.
Informationen zum Autor und seinen Buchveröffentlichungen finden Sie am Schluss des Buches und unter:
www.henningschramm.de
Für die
wertvollste Person
in meinem Leben
Ich habe mich bemüht,
die Handlungen der Menschen nicht zu verlachen,
nicht zu beklagen.
nicht zu verabscheuen;
ich habe versucht, sie zu begreifen.
Spinoza
Gutes LebenFreiheit, Gerechtigkeit, Solidarität
Inhalt
VORWORT
GUTES LEBEN IST GELINGENDES LEBEN
1
Leben ist das, was uns zu denken gibt
2
Leben als Welterfahrung und gestaltendes Weltbegreifen
3
Leben, um zu sterben?
4
Lebenswille, Liebe, Hoffnung, Tod.
D
er biologisch-evolutionäre Ansatz von Leben
5
Denken und Fühlen
D
er subjektiv-psychologische Ansatz von Leben
6
Was bedeutet ‚Gutes Leben‘?
FREIHEIT
7
Freiheit: Eine Seinsverfassung des Menschen
8
Aufklärung: Bildung, Wissen, Für-Wahr-Halten
9
Freiheit und Vernunft – Vernünftige Freiheit
10
Die Freiheit des Willens
GERECHTIGKEIT
11
Recht und Gerechtigkeit
12
Was ist Gerechtigkeit?
13
Exkurs: Ontogenese des Gerechtigkeitsempfinden
14
Gerechtigkeit als notwendige Bedingung von gutem Leben
DEMOKRATIE
15
Demokratie und Freiheit
16
Gefährdungen der Demokratie und Freiheit
17
Gefährdung der Demokratie durch Sprache
18
Gefährdung der Demokratie durch Missbrauch legaler Macht (Beispiel 1)
19
Gefährdung der Demokratie durch Facebook, Google und Co. (Beispiel 2)
20
Ordnung und Freiheit:
Zwischen Totalitarismus und Anarchie
ANTIZIPATION EINES BESSEREN LEBEN
21
Ökonomie und Demokratie
Zur Notwendigkeit eines neuen solidarischen Gesellschaftsvertrags
22
Perspektiven für eine ‚Sorgende Gesellschaft‘
Sorgelogik versus Profitlogik
ANMERKUNGEN
LITERATUR
VORWORT
Unser Leben ist stark geprägt von einer imperialen Lebensweisei. Imperial im umfassenden Sinn von: sich die Erde, die Natur, andere Völker, andere Menschen untertan machen. Herrschen, beherrschen, durchsetzen – nicht solidarisch teilen und kooperieren. Der unverhältnismäßige Ressourcenverbrauch, der Klimawandel, die Konsum- und Produktionsmuster, die Ausbeutung der Natur und der Menschen, die Widersprüchlichkeiten aktueller Lebensformen und die von Kapitalinteressen geformte Ökonomie verhindern vielerorts gutes Leben. Dies fordert uns heraus, die Frage, was gutes Leben bedeutet und die Bedingungen für gutes Leben neu zu denken. Im Mittelpunkt der dem Buch zugrunde liegenden Überlegungen steht neben der subjektiven Frage nach gutem Leben, wie sie sich jedem individuellen Leben stellt, somit auch die Frage nach den Voraussetzungen und Bedingungen einer Transformation von einer imperialen hin zu einer sorgenden Lebensform – einer Gesellschaftsform also, in der gutes Leben für alle möglich ist.
Leben erscheint im Alltag als eine Abfolge unvermeidlicher, banaler Dinge. Leben ist etwas, um das man sich kümmert, jeden Tag von Neuem. An schlechten Tagen empfindet man seinen Körper als bloß funktionierende Existenz, als bloße Anwesenheit in einem Gesamtgefüge, dem man sich anzupassen hat. Aber der Mensch existiert nicht nur reaktiv durch äußere Einflüsse gelenkt oder durch innere Triebe bestimmt, sondern hat Gefühle, Willen, Leidenschaften, Vernunft, Ideen und Wissensdurst. Er strebt über die reine Existenz hinaus nach Gestaltung seines Daseins, nach Erfüllung seiner Bedürfnisse und seines Wesens. Das macht das Leben schön und spannend und hebt den Homo sapiens über die ihn umgebende Natur hinaus.
Das alltägliche Leben im Beruf, in der Familie, im Bekannten- und Freundeskreis ist von Begrifflichkeiten wie Freiheit, Willensfreiheit, Gerechtigkeit, Fairness, Solidarität, Respekt, Selbstachtung, Würde, Sexualität, Liebe, Tod, Hoffnung durchsetzt. Nicht immer explizit zur Sprache gebracht, aber doch häufig implizit gemeint, gedacht, empfunden und erhofft. Diese Themen besitzen Relevanz nicht nur in der Routine und Enge des Alltagslebens, sondern beherrschen auch die Kunst, die Literatur, den Film und die Malerei, erweitert durch den Blickwinkel des Kampfes des Menschen mit seinem Schicksal, mit der Gesellschaft, seinem Verhältnis zur Natur und Gott und zu anderen Menschen.
Die beispielhafte Aufzählung der Abstrakta und Werte lässt in Umrissen erkennen, was die Welt und mit ihr die Menschen bewegt. Sie umreißen fundamentale Dimensionen menschlicher Existenz und werfen Fragen auf, mit denen sich alle Menschen, unabhängig von ihrer Zeit und kulturellen Herkunft, auseinandersetzen müssen. Sie sind insofern universell und beleuchten die existenziellen Sinnfragen des Menschengeschlechts.
Ich bin mir bewusst, über einen Aspekt des Lebens zu schreiben, den viele große Geister in ihrer jeweiligen Zeit bereits durchdacht und theoretisch und praktisch durchleuchtet haben. Was kann ich dem hinzufügen? Mein Ansinnen ist nicht, diese jeweiligen Denksysteme in Bezug auf ‚gutes Leben‘ weiter zu entwickeln, zu korrigieren oder zu widerlegen. Mir ist etwas anderes im Sinn. Ich möchte sie zusammenführen und gemeinsam mit ihnen meine eigenen Gedanken zu diesem Thema entwickeln und systematisieren. Dazu nutze ich deren mir wichtig erscheinenden Erkenntnisse, Denkansätze und Forschungsergebnisse, verbinde sie mit meinem subjektiven Erkenntnisinteresse, meinem eigenen Wissen und meinen subjektiven Erfahrungen und versuche, das so neu verbundene Ganze zur Sprache zu bringen – wobei das Zur-Sprache-Bringen, das Schreiben zwei Freuden vereint: zu sich selbst und gleichzeitig zu vielen anderen sprechen zu können.
Was ein Leben zu einem guten Leben macht, ist die Liebe, das Vertrauen, die Zuneigung und Nähe von und zu Personen, die Erfahrung eroberter Freiheit und erlebter Gerechtigkeit. Was irritiert und entrüstet, ist u. a. die schreiende soziale Ungerechtigkeit, die zunehmende Rücksichtslosigkeit, die Armut, der Hunger und das unmoralische Vermögen der Reichen dieser Welt.
Auf dem Hintergrund dieses Erlebens, der Unsicherheit, der mangelnden Gerechtigkeit, der offensichtlichen Diskrepanzen und Widersprüchlichkeiten der Welt und existierender Lebensformen, denen jeder Mensch mehr oder weniger ausgesetzt ist, ergeben sich weitere Fragen, die ich in dem Buch aufgegriffen habe: Wie sehen die hegemonialen Produktions- und Konsummustern aus, die in unsere allgemein akzeptierten und institutionell abgesicherten Alltagspraktiken und Lebensweisen eingebettet und oftmals dem Bewusstsein entzogen sind? Welche Vorstellungen von gutem Leben, von Entwicklung und Fortschritt sind damit verbunden? Welchen Herausforderungen ist der Mensch ausgesetzt und wie kann er in Anbetracht des ständigen Wandels und existenziellen Unsicherheiten sein prekäres Leben bewältigen? Was ist eine richtige und falsche Betrachtung, das richtige und falsche Tun, gelungener und nicht gelungener Umgang mit dem Leben?
Die Welt, in der wir leben, ist von Individualismus, Globalisierung, Digitalisierung und einem damit einhergehenden fundamentalen Wandel geprägt. Die Ungewissheit der Zukunft führt zu Unsicherheit. Vertrauen und Gemeinschaft wären die wichtigsten Mittel, um dagegen anzukämpfen. Haben wir dieses Vertrauen, können wir uns auf die Gemeinschaft verlassen? Obwohl ich mit dem Verfassen des Textes zu diesem Buch lange vor der Covid-19-Krise begonnen habe, tritt jetzt gerade zu diesen allgemeinen Faktoren diese fundamentale Krise und verstärkt die in dem Buch thematisierten Ungewissheiten. Die Angst vor dem Virus beherrscht die Politik und die Gesellschaft und verstärkt den Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen. Diese Jetztzeit ist geprägt von massiven Beschneidungen der Freiheit, deren Wichtigkeit man sich erst richtig bewusst wird, wenn man sie verloren hat.
Die Welt ist in Gefahr, nicht nur Anbetracht der Katastrophe der Covid-19-Pandemie, die uns die Zerbrechlichkeit unserer Welt vielleicht im besonderen Maße ins Bewusstsein zu rücken vermag, sondern auch wegen der drohenden Klimakatastrophe und der verheerenden Bilder von Dürre, Flucht, Armut und Vertreibung. All dies macht deutlich, wie weit wir entfernt sind von dem, was gutes Leben definiert. Ich muss mir deswegen die Frage gefallen lassen, wie ich angesichts des globalen Zustands unserer Erde über gutes Leben schreiben kann: Millionen Menschen, die Wasser bräuchten und nicht Worte! Kann man ohne Scham über gutes Leben nachdenken, wenn es vielen ums nackte Überleben geht, wenn sie nicht wissen, wo sie schlafen können und Angst haben, ob sie die Nacht überleben - wenn also so etwas wie gutes Leben für sehr viele Menschen so unendlich weit entfernt scheint? Macht das Denken und Schreiben über Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Solidarität deren Elend kleiner? Es wäre vermessen, das zu glauben. Aber der skizzierte Hintergrund eines schlechten Lebens führt drastisch vor Augen, wie die Welt nicht sein soll und macht die Sinne sensibler und offener für mögliche neue Entwicklungen.
Es zwingt den Menschen, über Existenz und Wesen des Menschen, über das Gemeinschaftliche aller Menschen und die Sinnhaftigkeit menschlichen Seins nachzudenken und Alternativen zu entwickeln, die eine Antwort auf die Frage geben können: Was ist im Leben wichtig, was bedeutet gutes Leben, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, ein gutes Leben führen zu können, und was hindert uns an diesem Vorhaben?
Wie ich oben bereits sagte, nehme ich dabei eine bestimmte Perspektive ein, in der sich immer auch subjektive Überzeugungen und Einsichten spiegeln. Diese Subjektivität soll jedoch nicht als Relativierung des objektiven Wahrheitsgehalts der Erkenntnisse verstanden werden, sondern ist Ausdruck meiner erkenntnistheoretischen Position, nach der es keine absolute Gewissheit geben kann und sich Irrtümer niemals ausschließen lassen, da alle Erkenntnisse nicht endgültig verifiziert, aber gegebenenfalls widerlegt werden können.
Frankfurt, im September 2020 Henning Schramm
i Vgl. zu diesem Begriff: Brand U./Wissen M., Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus, München 2017
I. GUTES LEBEN
1
Leben ist das, was uns zu denken gibt
»Wenn es richtig ist (und es wird wohl richtig sein), dass der Mensch sich vom Tier unterscheidet, so ist alles Menschliche dadurch und allein dadurch menschlich, dass es durch das Denken bewirkt ist.«
Was Georg Wilhelm Friedrich Hegel (17701831) hier über das Menschliche sagt, verweist auf die Essenz menschlichen Lebens. Im Denken und seinem Werkzeug, der Sprache, verbinden sich Innen- und Außenwelt menschlichen Daseins. Empfindungen und Gefühltes, herausgebildet am Beginn allen Lebens, sind nicht nur Regulatoren der inneren Lebenswelt eines Organismus, sondern auch die ursprünglichen Verbindungsscharniere eines Organismus zur Außenwelt.
Der Mensch ist, anders als das Tier, im Allgemeinen diesen Impulsen aus dem Innenbereich des Lebens nicht willenlos unterworfen. Er ist fähig, sie dem Bewusstsein zuzuführen, wo sie dem Denken zur Verfügung gestellt und verarbeitet werden. Er kann Sex haben, ohne sich vermehren zu wollen, er kann den Überlebenstrieb ignorieren und sich in Gefahr bringen oder sich gar selbst töten. Der Mensch ist in der Lage, die Reaktion auf das, was von innen kommt, zu regulieren und zu entscheiden, was in die Außenwelt getragen werden soll oder was nicht. Wir wissen, dass das nicht immer gelingt, wenn man zum Beispiel an die manchmal unbeherrschbaren Gefühlsstürme der Liebe, aber auch an einen erdrückenden, übergroßen Schmerz oder an eine akute, lebensgefährliche Bedrohung denkt. Jedoch ist die grundsätzliche Fähigkeit zur Regulierung vorhanden.
Und der Mensch ist auch fähig, die Außenwelt bewusst an seinem ‚Innenleben‘ teilhaben zu lassen. Er kann steuern, was er anderen preisgeben will und was nicht. Neben Mimik und Gestik hat der Mensch mit der Sprache ein enorm differenziertes und feinfühliges Instrument zur Verfügung, mit dem er mit seiner Umwelt kommuniziert, das heißt ins Gespräch kommt. Mit der Sprache kommt der Mensch aber nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst ins Gespräch und kann so wiederum auf seinen inneren Gefühlshaushalt einwirken.
Gelingendes Leben ist dadurch ausgezeichnet, dass der Mensch bewusst einem anderen die Gefühle, die er empfindet, und die Gedanken, die er hat, äußert, und die anderen Menschen von diesen Gefühlen und Gedanken angesteckt werden und sie miterleben können. Ohne diesen Austausch verkümmert der Mensch. Er braucht einen Resonanzraum, in dem er sich mit den anderen verbunden sieht, wo sich das Erleben und Empfinden von Harmonie im Innenleben wie auch in der Kooperation mit anderen entfalten und im Bewusstsein und im autobiografischen Gedächtnis verankern kann.
Das Leben des Menschen ist ein Kunstwerk, dessen Schöpfer der Mensch ist. Wie der Künstler sich durch sein Kunstwerk mitteilt, teilen sich die Menschen einander durch ihr Leben in Form von Gefühlen, Gedanken, Sprache, in deren Äußerungen ihr Weltverständnis eingebettet ist, mit. Leo N. Tolstoi hat diesen Zusammenhang in seiner 1899 verfassten Schrift ‚Was ist Kunst?‘ so formuliert: »Dank der Fähigkeit des Menschen, die in Worten ausgedrückten Gedanken zu begreifen, kann jeder Mensch alles das erfahren, was die gesamte Menschheit auf dem Gebiet der Gedanken für ihn getan hat, gleich wie er in der Gegenwart vermöge der Fähigkeit, fremde Gedanken zu begreifen, an der Tätigkeit anderer Menschen teilnehmen kann, und selbst, kraft dieser Fähigkeit, die von anderen angeeigneten und in ihm selbst entstandenen Gedanken den Zeitgenossen und den Nachkommen mitteilen kann.«1
Leben ist das, was uns zu denken gibt, wobei sich das zu Denkende aus Bewusstsein und Erfahrung herleitet. Erfahrung im Sinne von Potenz zum Handeln, als Fähigkeit, sein Leben nach eigenem Vermögen tatkräftig zu gestalten, um Wohlbefinden zu erreichen. Die Zeit ändert sich und damit auch der Begriff, der Gehalt, das Empfinden von dem, was Leben ist. Leben ist nichts Dingliches, außer mir Seiendes, auf mich Einwirkendes, sondern steht in Wechselwirkung zwischen dem Bewusstsein des denkenden Subjekts und den anderen Menschen, denen wir im Gespräch begegnen. Leben wird auf diese Weise ständig neu gedacht, ins Gespräch gebracht und reflektiert. Alles Leben findet in Umgebung statt und in Interaktion mit ihr. Nichts existiert unabhängig. In seinem Buch Kunst als Erfahrung schreibt dazu John Dewey: »Kein Lebewesen existiert ausschließlich innerhalb des Bereichs seiner eigenen Haut. Vielmehr stellen seine subkutanen Organe die Verbindung zu dem her, was außerhalb seiner Organe liegt, und um leben zu können, muss es sich dieser Umwelt angleichen – sei es durch friedliche Anpassung, durch Verteidigung, durch Eroberung.«2
Jedes Leben ist in engster Wechselbeziehung mit seiner Umwelt verknüpft und Leben entwickelt sich in der Überwindung einer zeitweiligen Disharmonie zwischen den inneren Antriebskräften eines Organismus und dessen äußeren Lebensbedingungen. So ruft zum Beispiel Mangel an Nahrung ein Gefühl von Hunger oder Durst hervor, das eine Unangepasstheit an die Umwelt signalisiert und einer entsprechenden Anpassung bedarf. Leben strebt nach Ausgleich, Gleichgewicht und Harmonieii und ist dabei fundamental auf eine gelingende Interaktion zwischen Innen- und Außenwelt angewiesen. Veränderungen durchdringen und erhalten einander und geben dem Leben Form, Ordnung und Dauer.
Dissonanz ist die Wahrheit der Harmonie, sagt Adorno. Wahrheit ist in ihrem Wesen Un-Wahrheit, sagt Heidegger. Ein immerwährender Streit zwischen dem, was man sieht, und dem, was verborgen ist. Wahrheit ereignet sich im Scheinwerferlicht des Unverborgenen. Wahrheit ist die Unverborgenheit des Seienden. Um an unserem physiologischem Beispiel zu bleiben: Dissonanz (Hunger) legt offen, was verborgen war (unzureichende Energiequelle). Dies gilt genauso im Bereich geistiger Vorgänge. Dissonanz holt die Wahrheit ins Offene, in die Lichtung (wie Heidegger sich ausdrücken würde). Das ins-Licht-Geholte ist freilich nur ein Teil der Wahrheit des Daseinsganzen. Verbirgt das Licht doch zugleich das, was im Schatten verborgen oder von dem Beleuchteten verstellt ist. Dissonanz gewährt also nur einen Ausschnitt des Blicks in die innere Struktur eines geordneten Ganzen, ebenso wie deren Gefährdungspotenzial.
Die Überwindung der ‚Unordnung‘, der Widersprüche und Dissonanzen und die erfolgreiche Bewältigung von Widerständen oder Konflikten ist tätige Erfahrung und wird vom Organismus belohnt durch positive Rückkoppelung und ‚Wohlempfinden‘, das in unserem Bewusstsein präsent ist. Diese Erfahrung ist jedoch nichts ewig Seiendes, sie ist keine Invariante, sondern ein Ereignis, ein Gespräch, in dem sie fortlaufend verändert wird. Als inneres und als äußeres Gespräch mit der Umwelt trägt diese Welterfahrung nicht nur zur Stabilität des Organismus bei, sondern sichert durch Teilung der akkumulierten Erfahrung mit anderen auch die Ordnung und Beständigkeit anderer Organismen in der Zukunft.
ii Ich werde darauf in Kapitel 5 ‚Denken und Fühlen‘ noch näher eingehen.
2
Leben als Welterfahrung und gestaltendes Weltbegreifen
Das Leben der Menschen ist Ausdruck einer existierenden Welterfahrung. Der Mensch ist nicht nur Natur-, sondern im wesentlichen Geistwesen, nämlich denkendes Wesen. Sein Leben ist nicht nur durch sein Geschick als Naturwesen bestimmt, sondern auch dadurch, wie er seine Welt begreift, in der er heranwächst, erzogen wird und Erfahrungen macht, wie er mit der Welt, die ihn umgibt, interagiert. In diesem Sinn ist menschliches Leben gestaltendes Weltbegreifen und der Mensch Subjekt und zugleich Objekt dieses Prozesses.
Dieses Weltbegreifen und -verständnis teilt der Mensch potenziell mit allen anderen Menschen. Wer mich kennt, wird mich erkennen, sagte Hegel einmal und fasst so diesen Gedanken kurz und prägnant zusammen. Die tätige Erfahrung, die in ein gemeinsames Bewusstsein von Welt und Weltverständnis mündet, das sich im Ich formt und gedacht wird, bildet die Grundvoraussetzung der menschlichen Interaktion, des Sich-verstehen-Könnens, der Empathie – und der Selbsterkenntnis. Bei jedem ist diese Welterfahrung anders, was einen Teil der Einzigartigkeit eines jeden Individuums ausmacht. Aber sie birgt doch auch etwas Allgemeines, allen Menschen Zugängliches, das es ihnen ermöglicht zu interagieren, sich zu erkennen und ins Gespräch zu kommen.
Als neugierige, beobachtende und teilnehmende Bürger sind wir alle aktiver, bewusster Teil einer kommunizierenden Gemeinschaft. Jeder gestaltet im Zusammenleben mit anderen sein Leben entsprechend der normativen Ordnung und den darin eingelagerten adjektivischen und ethischen Komponenten von gutem und schlechtem Leben. Dies führt zu der Frage, was gutes, schlechtes oder böses Leben ist. Ich werde auf die begriffliche Klärung von gutem Leben später ausführlich eingehen. An dieser Stelle möchte ich zunächst ein anderes Problem ins Gespräch bringen.
Die heutigen Gesellschaften sind starken Fliehkräften unterworfen. Die Lebenswelten gehen weit auseinander. Da stellt sich nahezu zwangsläufig die Frage: Gibt es etwas, das der Menschheit gemein ist, das ihr qua Natur mitgegeben ist, etwas, das für jeden Menschen, egal in welcher Gesellschaft er gerade lebt, erstrebenswert ist, etwas, für das es sich lohnt zu leben?
Neuronale Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass positives kooperatives menschliches Verhalten Lust- und Belohnungssysteme aktiviert und so zum Wohlbefinden beiträgt. Die Neurobiologie der Gefühle und Emotionen lässt, so der Neurobiologe Antonio Damasio, »keinen Zweifel daran, dass die Freude und ihre Spielarten der Traurigkeit und verwandten Affekten vorzuziehen ist und sich für Gesundheit und kreatives Entfalten unseres Wesens als zuträglicher erweist.«3
Daraus lässt sich die These ableiten, dass positive Gefühle und Emotionen, die sich uns in einem Empfinden von Freude, von Wohlgefühl, von Gesundheit, von Harmonie und Gleichgewicht, von Erhabenheit und Glück zeigen, der Kern dessen sind, nach dem jeder Organismus strebt, unabhängig davon, wie sie sich in einer konkreten Situation auch äußern mögen, wenn diese augenblickliche Situation zum Beispiel solchen positiven Gefühlsregungen entgegensteht. Ist der Erhalt und die Reproduktion des Lebens der organische, der naturgegebene primäre Trieb alles Lebendigeniii, so sind die im Organismus ablaufenden Vorgänge, die diese positiven Empfindungen hervorrufen und die Lebensfähigkeit des Organismus stützen, die sekundären Triebfedern des Lebens. Dadurch, dass diese Emotionen die physiologischen Lebens- und Reproduktionsprozesse positiv beeinflussen, bilden sie einen wesentlichen Bestandteil des Lebens. Dies gilt in besonderem Maß für das menschliche Leben. Ob und in welchem Maße andere Organismen solche Emotionen entwickelt haben, ist weitgehend ungeklärt. Sicher ist jedoch, dass höhere Säugetierarten in unterschiedlicher Ausprägung diese Art von Empfindungen haben. Beim Menschen ist in dieser Hinsicht nicht nur ein Kulminationspunkt erreicht, sondern er ist darüber hinaus in der Lage, sich diese Emotionen bewusst zu machen und sogar in gewissem Umfang zu steuern.
Die Natur hat keinen Plan zur Förderung des menschlichen Wohlbefindens, doch der Mensch ist in der Lage, solch einen Plan zu ersinnen und die Voraussetzungen für Wohlbefinden und gelingendes Leben zu schaffen.
Spinoza zum Beispiel hielt die Wiederherstellung des durch Seelenqualen verloren gegangenen homöodynamischen Gleichgewichts für eine individuelle und innerliche Aufgabe, die man dadurch lösen kann, indem man durch Spiritualität und geeignetes Denken die richtigen positiven Emotionen und Gefühle erzeugt. Dies ist eine Möglichkeit. Eine andere ist, direkt auf das einzuwirken, was Trauer, Unwohlsein, Krankheit hervorruft und gutes Leben verwehrt.
Das Ausmaß, in dem Menschen in Unmündigkeit lebten, in dem sich Menschen anderen Menschen unterworfen und nicht gewagt haben, ihre eigenen Bedürfnisse und Ansprüche respektvoll zu artikulieren, war in der Vergangenheit immens. Betrachtet man die nationalistisch gefärbte, rechtsradikalrassistische Szene, so scheint heute die in der Demokratie überwunden geglaubte Sehnsucht nach Unterwerfung unter eine Autorität wieder populär zu werden. Es drängt sich dann sogleich die Frage auf, was den Menschen dazu führt, sein Leben anderen Händen anzuvertrauen, statt es in die eigenen zu nehmen. Verstärkt gar die Delegierung von Verantwortung und die Aufgabe von Eigeninitiative das Wohlbefinden? Wenn dem so wäre, was würde das für das Zusammenleben, für die Demokratie und die Freiheit bedeuten? Was für Auswirkungen würde es auf die Gesellschaft haben, wenn für eine Bevölkerungsmehrheit eine positive Korrelation zwischen Wohlbefinden einerseits und Unselbstständigkeit, Untertänigkeit und Autoritätshörigkeit andererseits bestehen würde? Wie würde, wie müsste Politik und Gesellschaft darauf reagieren?
Die vornehmste Aufgabe des kritischen Geistes ist Aufklärung. Aufklärung darüber, wie Unterdrückung den Menschen deformiert, was Freiheit für jeden Einzelnen bedeutet, wie sie erlangt werden kann und was Unfreiheit dem Menschen vorenthält. Der kritische Geist ist aufgefordert, die Un-Wahrheit aus dem Verborgenen herauszuholen und ins Licht zu stellen, sich mit den Mächten auseinanderzusetzen, die Menschen ein gutes Leben verwehren und vernünftige Wege von der Unmündigkeit zur Mündigkeit und Freiheit versperren.
Immanuel Kant4 (1724-1804) hat in seiner epochalen Schrift von 1784 ‚Was ist Aufklärung?‘ formuliert: »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!«
Kant macht sich in der zitierten Schrift Gedanken darüber, warum Menschen, die, anders als Tiere, »von fremder Leitung freigesprochen« sind, »dennoch gerne zeitlebens unmündig bleib(en); und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen?« Und er gibt eine erste Antwort: ›Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen.«
Nach Kant sind die Motive für eine solche Einstellung Faulheit und Feigheit und, so möchte ich hinzufügen, willenlose Unterwerfung unter ein Potpourri mächtiger Gefühlslagen wie Angst, Verzweiflung, Resignation, Mutlosigkeit, Selbstzweifel. Sie lähmen den Verstand und die Vernunft und nehmen der Wahrheit die Luft zum Atmen. Die historische Erfahrung in Deutschland und anderswo scheint die These von Kant zu bestätigen. Es ist offenbar für viele Menschen eine Option, eine erstrebenswerte Alternative, ein Leben in Unmündigkeit führen zu können, wie zum Beispiel die hohe Zustimmungsrate von 88 Prozent zu Hitlers Diktatur am Ende des Jahres 1933 zeigte.
Wir leben heute in einer Demokratie, die wesentlich auf der Mündigkeit ihrer Bürger basiert. Sie garantiert ihnen Freiheit, Sicherheit und Gleichheit und verspricht, den Wohlstand für ihre Bürgerinnen und Bürger zu mehren. Mit diesem Ziel wird suggeriert, dass Wohlstand auch gleichzeitig das Wohlbefinden fördert. Aber, ist es auch so, dass jemand, der im Wohlstand lebt, auch glücklich, ausgeglichen und zufrieden mit sich und seinem Leben ist? Was steckt hinter der Gleichung: Mehrung des Wohlstands gleich Mehrung des Wohlbefindens?
Ökonomen, Soziologen und Psychologen haben versucht, auf der Makroebene einer Gesellschaft Indikatoren zu entwickeln, mit deren Hilfe man Wohlstand und Lebensqualität erfassen und messen kann, um so verschiedene Staaten auf dieses Merkmal hin vergleichen zu können.
Gängiger Gradmesser des privaten wie gemeinschaftlichen Wohlstands ist das Bruttoinlandprodukt (BIP). Eine Steigerung des BIP kennt allerdings nur ›schwarze‹ Zahlen. Sprich: Die Erhöhung der ausgetauschten Geldmenge, egal wie sie zustande kommt. Ökonomen fordern Wachstum an sich, ohne Endzweck. Von Interesse beim BIP ist die Menge der innerhalb eines Jahres ausgetauschten und verkauften Waren, unabhängig von der Art der Waren. André Gorz gibt dazu ein anschauliches Beispiel: Wenn ein Dorf einen Brunnen baut, ist das so geschöpfte Wasser Allgemeingut und der Brunnen das Produkt einer gemeinsamen Arbeit. Er ist die Quelle eines größeren Reichtums der Gemeinde, trägt aber nichts zum BIP bei, da er zu keinem Geldverkehr führt – nichts wird gekauft oder verkauft. Wenn der Brunnen jedoch von einem Privatunternehmer gebohrt und in Besitz genommen wird, der von einem Dorfbewohner für das Wasser, das dieser ihm entnimmt, Geld fordert, dann erhöht sich das BIP und der Eigentümer kassiert die Gebühren.5
Auch Misswertschöpfung, wie zum Beispiel die Kosten, die bei einer Umweltkatastrophe oder einem Autounfall entstehen, schlagen sich positiv in der Bilanz des BIP nieder und tragen zu seinem Wachstum bei. Abgesehen davon, dass die Ungleichverteilung der Wertschöpfung hierbei unberücksichtigt bleibt, liegt es auf der Hand, dass Katastrophen und andere Misswertschöpfungen nicht zum Wohlbefinden einzelner in einer Gesellschaft beitragen. Einziger Gradmesser dieses Ansatzes sind betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Rechnungen unter Einsatz von Arbeit und Kapital, so als ob Selbstverwirklichung nur über den Faktor Arbeit geschehen kann und Einkommen der dominante Faktor für Lebensqualität ist.
Um diesen Unzulänglichkeiten und Verkürzungen in Bezug auf die Messung von Wohlbefinden und Lebensqualität entgegenzuwirken, wurden eine ganze Reihe weiterer Indizes entwickelt, mit deren Hilfe man glaubt, Lebensqualität, Lebenszufriedenheit, angstfreies Sein und Lebensgenuss erfassen zu können.
Nachfolgend einige wenige Beispiele für solche Indizes:
Der Happy Planet Index (HPI)
Im Zentrum dieses Index steht die Messung der Leistungsfähigkeit eines Staates »to produce happy, healthy lives now and in the future«. Der HPI verbindet die Parameter subjektives Wohlbefinden, Lebenserwartung und den ökologischen Fußabdruck zu einem Index. Neu ist die Einführung eines subjektiven Faktors wie Wohlbefinden und die Einbeziehung von Ökologie und Nachhaltigkeit, die die Sorge um den Erhalt der allgemeinen Lebensgrundlagen sowie die Sorge um die nachkommenden Generationen reflektiert. Alle diese Aspekte korrelieren nicht zwangsläufig positiv mit dem Faktor Wirtschaftswachstum, der im BIP im Zentrum steht. Ökologie und Nachhaltigkeit sind sogar deutlich negativ korreliert.
Der Human Development Index (HDI)
Der HDI wurde von dem Nobelpreisträger Amartya Sen entwickelt und setzt sich zusammen aus dem Lebenserwartungsindex (Lebenserwartung bei Geburt), dem Bildungsindex (durchschnittliche Schulbesuchsdauer und voraussichtliche Schulbesuchsdauer in Jahren) und dem Lebensstandard (Bruttonationaleinkommen pro Kopf).
Sen ging bei der Entwicklung dieses Index davon aus, dass gesellschaftlicher Wohlstand nicht allein am Wirtschaftswachstum zu messen sei, sondern immer auch an den Entwicklungsmöglichkeiten allgemein, aber insbesondere auch für die Unterprivilegierten und Schwächsten in einer Gesellschaft. Dieser Index greift wichtige Bedingungen für ein potenziell gutes Leben auf. Er orientiert sich allerdings noch stark an materiellen Faktoren, die weitgehend mit dem BIP und dem privaten und öffentlichen Reichtum eines Landes korrelieren, und stellt wichtige psychologische, ethische und geistige Dimensionen von Wohlbefinden in den Hintergrund.
Der Genuine Progress Indicator (GPI)
Er ist aus dem früheren Index des nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstandsiv hervorgegangen und als ein Wirtschaftsindikator entwickelt worden, der das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ersetzen und eine bessere, realistischere Einschätzung der Leistung von Volkswirtschaften erlauben soll. Er bezieht deswegen die Kosten jener ökonomischen Aktivitäten in die Berechnungen ein, die sich auf die Gesellschaft, wie auch das Leben jedes Einzelnen jetzt und in Zukunft potenziell schädlich auswirken können, wie Ressourcenabbau, Verbrechen, Ozonabbau, zerfallende Familien, Luft-, Wasser- und Lärmverschmutzung, Verlust an Agrarland, Verlust an Feuchtgebieten.
Der Index des guten Lebens (IGL)
Der Index wurde in Ecuador entwickelt mit der Zeit als dessen zentraler Messeinheit. Er versucht, das Verhältnis zwischen materiellem Wohlstand und Wohlbefinden neu zu definieren und eine neue Wohlstandsdefinition zu etablieren. Dafür wurden als Quellen des Glücks neben dem Bestreben nach materieller Absicherung und Gesundheit folgende vier Felder identifiziert: Zeit für selbstbestimmte Arbeit, Muße und Bildung, soziale Beziehungen und Teilhabe am öffentlichen Leben. Bei allen diesen Feldern handelt es sich um relationale Güter, welche auf sozialer Verantwortung, wechselseitiger Anerkennung und Freund- und Partnerschaft basieren. Mit dem Index des guten Lebens wird Zeitwohlstand messbar. Die Frage, wie wir leben wollen, wird zur Frage, wie wir unsere Zeit verbringen wollen. Wohlstand und Wohlbefinden in einer Gesellschaft wird danach beurteilt, wie viel Zeitquanta neben der Absicherung der Grundbedürfnisse für die Generierung und den Genuss relationaler Güter verfügbar sind. Aus dem Leitbild des Zeitwohlstandes, so Hans-Jürgen Burchardt, der den Index genauer untersucht hat, ließe sich »ein konkretes Programm für eine politische Erneuerung ableiten: Zeitpolitik, die öffentlich und partizipativ auf die zeitlichen Strukturen der Menschen Einfluss nimmt, um ihre Chancen auf ein gutes Leben zu erhöhen«.6
All diese Indizes sind aus dem Bewusstsein entwickelt worden, dass gutes Leben und Wohlbefinden mehr sind als eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aus produzierten Gütern und Dienstleistungen, mehr sind als Besitz aus Geld und Vermögen, das in den allermeisten Gesellschaften auch noch sehr ungleich verteilt ist. Dies offenbart ein anderer Index, der Gini-Index, den der italienische Statistiker Corrado Gini schon 1912 entwickelt hat. Der Gini-Koeffizient definiert ein Maß der Ungleichverteilung. Je höher der Gini-Koeffizient ist, desto ungleicher ist die Einkommensverteilung. Deutschland nimmt nach einer Studie der Vereinten Nationen (2017) weltweit mit einem Index-Wert von 29,1 Prozent Rang 19 ein. Frankreich Rang 32 (Index: 32,7), die USA Rang 95 (Index 41,5), das Schlusslicht bildet Südafrika mit einem Index von 63. Der Wert für Deutschland hinsichtlich der Einkommensverteilung scheint auf den ersten Blick akzeptabel. Legt man jedoch den Gini-Index für das Vermögen zugrunde, wird die Ungleichheit deutlich sichtbar. Dieser Index lag im Jahr 2018v bei 79. Die Einkommensungleichheit verschärfte sich in den vergangenen fünfzig Jahren in Deutschland dramatisch. Lag der Anteil der oberen 10 Prozent und der unteren 50 Prozent 1968 mit 30 bzw. 32 Prozent am Nationaleinkommen noch etwa gleichauf, so lag 2013 der Anteil der oberen 10 Prozent bei 40 Prozent und der der unteren 50 Prozent nur noch bei 17 Prozent am Nationaleinkommen. Deutschland gehört zu den Ländern mit den meisten Dollar-Millionären, hinter den USA und Japan. Mit Blick auf das Vermögen sind die Unterschiede noch auffälliger. So besitzen dem DIW zufolge in Deutschland die reichsten 10 Prozent heute mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens (56 Prozent). Die ärmere Hälfte hat dagegen nur einen Anteil von 1,3 Prozent. Und zur Entwicklung der Vermögensschere noch zwei weitere Kennzahlen aus Deutschland: Der Einkommensanteil des obersten Perzentils ist zwischen 1983 und 2013 um knapp 40 Prozent gewachsen, während der Anteil der unteren 90 Prozent um 10 Prozent zurückgegangen istvi.
Es liegt auf der Hand, dass diese eklatante Ungleichheit zum einen von vielen Menschen als ungerecht empfunden wird und zum anderen zeigt, dass offensichtlich vielen Menschen in einem wohlhabenden Land wie Deutschland eine notwendige – wenn auch nicht hinreichende – Bedingung zum guten Leben fehlt: das materielle Fundament. Die Gewährleistung einer solchen materiellen Basis ist ein bedeutender und notwendiger Faktor bei der Suche nach den Voraussetzungen und Bedingungen, ein gutes Leben führen zu können, insbesondere auch dann, wenn man bedenkt, dass mit dem Mangel an materiellen weitreichende immaterielle Faktoren wie zum Beispiel Bildung, Gesundheit, Lebenserwartung, Lebensstandard, kulturelle Teilhabe und angstfreie Zukunft hoch korreliert sind.
Dieser kurze Überblick mag verdeutlichen, dass es zu kurz greift, die kapitalistisch organisierte Ökonomie mit ein paar psychologischen und ökologischen Einsprengseln zu versetzen, und daraus ein Konzept zu entwickeln, das gutes Leben ermöglichen kann. Das Menschenbild, das der gängigen kapitalistischen, ökonomischen Lehre entspringt, und dasjenige, das die Philosophie entwickelt, sind diametral entgegengesetzt. Aus ökonomischer Sicht ist der Mensch und die Arbeit des Menschen Ware und Produktionsfaktor, aus philosophischer Perspektive ist Arbeit, die Veräußerlichung und Objektivierung seiner selbst.7 Daraus leitet sich die Maxime ab, die der Philosoph Hans Jonas so formuliert hat: Handle so, dass die Wirkungen deines Handelns verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.
Ich werde später auf die Kritik der kapitalistischen Ökonomie, die Begrifflichkeit von gutem Leben und die Voraussetzungen und Hindernisse für gutes Leben noch im Detail zurückkommen. Bevor dies geschieht, möchte ich jedoch zunächst auf die grundsätzlichere Frage eingehen, was Leben ist und was die Grundvoraussetzungen für Leben sind.
iii Diesen primären Trieb kann man auch als eine Art Natursinn des Lebendigen bezeichnen.
iv ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare
v Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft, DIW
vi Die weltweite Ungleichheit. Der World Inequity Report, C.H. Beck München 2018, S. 161
3
Leben, um zu sterben?
Im Selbstverständnis des Menschen ist Leben eng mit Tod verknüpft. Wir können uns das Leben ohne das Sterben nur schwer vorstellen (ausgenommen vielleicht die Vorstellung von ewigem Leben im Himmel, vorausgesetzt man ist gläubiger Christ).
Im Gilgameschepos, das vor rund 4000 Jahren im babylonischen Raum verfasst wurde, verfiel der stärkste, tapferste, klügste und befähigtste Mensch seiner Zeit, König Gilgamesch, angesichts des Todes seines besten Freundes Enkidu in höchste Verzweiflung. Er beschloss daraufhin, den Tod zu besiegen und Unsterblichkeit für sich zu erzwingen. Gilgamesch reiste um die Welt und kämpfte gegen alles, was sich ihm in den Weg stellte. Er kam mit leeren Händen nach Hause zurück. Er konnte seine Unsterblichkeit nicht erkämpfen. Aber er hatte gelernt, dass die Götter den Menschen den Tod als ein unausweichliches Schicksal auferlegt haben, dass Leben und Sterben Teil der menschlichen Natur ist.
Die meisten Menschen glauben heute nicht mehr an Götter, die Unvermeidbarkeit des Todes ist geblieben – und die Sehnsucht, fortzuleben, außerhalb des Körpers weiter leben zu können und dem Nichts zu entgehen, dem der Mensch, wie es auf einer Grabinschrift in Pompeji gesagt wird, ausgeliefert ist: »Nach dem Tod gibt es nichts mehr, nur was du siehst, ist der Mensch.«
Was ist der Sinn des Todes? Was gibt dem Leben angesichts des Todes Sinn? Ist der Sinn des Lebens, zu sterben? Ist das Sterben der Grund, warum ich lebe? Ich möchte auf diese, auf den ersten Blick provozierend erscheinenden Fragen im Folgenden näher eingehen, um dann in einem zweiten Schritt das Problem menschlicher Freiheit im Zusammenleben mit der Natur und den Menschen in den Fokus zu rücken.
Wie das auf unserem Planeten existente Leben aussieht, was Leben ist, wie es funktioniert und aufgebaut ist, ist aus biologischer Sicht weitgehend entschlüsselt. Die chemische und die biologische Evolutionstheorie, die Wissenschaftler der Molekularen und Synthetischen Biologie haben auch die grundsätzlichen Fakten hinsichtlich der Entstehung des Lebens aus unbelebter Materie auf den Tisch gelegt. Hoimar von Ditfurth bemerkt dazu in seiner Einleitung zu seinem Buch ‚Der Geist fiel nicht vom Himmel‘: »So, wie die Naturgesetze sind, und so wie die Materie beschaffen ist, war die Entstehung des Lebens – genügend große Zeiträume vorausgesetzt – nicht nur wahrscheinlich, sie war unausbleiblich.«8 Da nur relativ genau datierbare Zeiträume für diese Entwicklung zur Verfügung standen, ist es keinesfalls zulässig, für die Entstehung des Lebens beliebig unwahrscheinliche Zeitstränge anzunehmen. Es muss der Nachweis erbracht werden, dass die evolutionäre Entwicklung lebender Organismen von einfachen Zellstrukturen bis zu den hochkomplexen des Menschen in dem vorgegebenen Zeitrahmen prinzipiell stattfinden konnte. Diesen Nachweis hat der Biochemiker Gerhard Schramm erbracht, indem er die Zeitspanne, die alle beteiligten Moleküle für die entsprechenden Reaktionen benötigten, errechnet hat.9
Aber warum gibt es gerade das existente Leben und kein anderes? Menschlicher gefragt: Lässt sich in der biologischen Ausstattung des Menschen, seinem Körper, Hirn und dem sich daraus ergebenden biologischen Ich, das in die Welt geworfen ist, wie das Sartre ausgedrückt hat, ein Sinn erkennen? Und wenn ja, welcher? Warum ist alles Leben endlich und zum Sterben verurteilt? Die Endlichkeit des Lebendigen mag einer Ameise oder einer Katze ziemlich gleichgültig sein, für den Menschen hingegen ist dies seit jeher eine existenzielle, essentielle Frage, die nicht nur seit Jahrtausenden die Philosophen beschäftigt, sondern das Lebensgefühl eines jeden Individuums prägt.
»Die Freiheit des Menschen ist untrennbar mit dem Bewusstsein der Endlichkeit des Menschen verbunden«, so Karl Jaspers in seiner Schrift Über die Freiheit.10 Die Endlichkeit des Menschen ist die Endlichkeit alles Vitalen. Der Mensch ist angewiesen auf seine Umwelt, auf Nahrung und Sinnesinhalte. Er ist dem Naturgeschehen ausgeliefert: Er muss sterben. »Die Leiche zeigt dem Fühlen und Denken, was jeden erwartet, das Grauen vor ihr ist das älteste.«11
Allein der Mensch weiß unter allen Lebendigen um seine Endlichkeit. Das Todesbewusstsein ist der innerste Kern des Humanen, und unsere Sterblichkeit ist der letzte Grund für die existenzielle Angst, die jedem Menschlichen innewohnt. Die Angst vor dem Nichts, die ›gegenstandslose Angst‹, wie das Sören Kierkegaard ausgedrückt hat.
Der Philosoph Martin Heidegger bezeichnet die Angst als ›Grundbefindlichkeit‹, die sich auf die Erfahrung des Seins als bloßes ›In-der-Welt-sein‹ bezieht. Damit verbunden ist, so Heidegger, das Gefühl der Vereinzelung des Daseins, das wiederum zu einer Empfindung der ›Bedrohlichkeit‹ oder ›Unheimlichkeit‹, des ›Nicht-zuhause-Seins‹ führt. Diese Angst ist ähnlich wie bei Kierkegaard völlig unbestimmt und wird getragen von der Ohnmacht, dem Tod, der dem Menschen vorausläuft und den er antizipieren kann und insofern immer vor Augen hat, hilflos ausgeliefert zu sein.
Aus neurobiologischer Sicht bringt die bloße Aussicht auf den Tod – tatsächlich oder im Vorgriff auf den eigenen Tod oder dem uns nahestehender Menschen – und die antizipierte Konfrontation mit dem Leiden, das mit dem Tod einhergeht, die angestrebte Homöostase ins Ungleichgewicht. Infolgedessen reagiert »der natürliche Drang nach Selbsterhaltung und Wohlbefinden … auf den Zusammenbruch mit dem Bestreben, das Unvermeidliche abzuwenden und das Gleichgewicht wiederherzustellen.«12
Der Mensch sucht nach (Ersatz-)Strategien, den Zusammenbruch der Homöostase aufzuhalten und das seelische Gleichgewicht wieder zu erlangen. Die Ohnmacht dem antizipierten Tod gegenüber, der dem Selbsterhaltungstrieb entgegensteht, besitzt eine tragische, ausweglose Dimension, die ausschließlich dem Menschen zu eigen ist.
Dies ist der eine Aspekt, der den Menschen ›ängstet‹, wie sich Heidegger ausdrücken würde. Ein anderer Aspekt, der zu der ängstigenden Grundbefindlichkeit beiträgt, liegt nach Heidegger in dem Zwang des Menschen begründet, sein Leben gestalten und ›entwerfen‹ zu müssen.13 Der Mensch ist dazu verdammt, zu entscheiden, was er will und