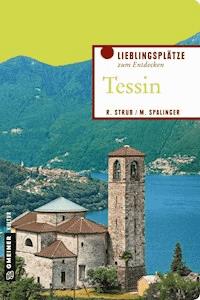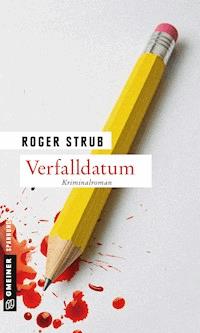
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Tobias Landauer ist ein gefeierter Autor. Doch seine Krimis sind aufgrund der darin geschilderten Brutalität umstritten. Mit seinem aktuellen Buch „Schwarzer Herbst“ begibt er sich auf Lesereise durch die Schweiz. Vor der ersten Veranstaltung kommt es zu Protesten. Während der Lesung erhält er eine SMS mit der Warnung „Das ist kein Spiel. Sag die Tournee ab!“. Weitere Drohungen folgen. Spielt nur jemand mit seiner Angst oder steckt mehr dahinter?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roger Strub
Verfalldatum
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung: Mirjam Hecht
E-Book: Benjamin Arnold
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von:
© jayfish / Fotolia.com
© Anyka / Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4660-3
Widmung
Für Andrea
Prolog
Es war ungewöhnlich heiß an diesem Tag im Juni. 32 Grad Celsius Außentemperatur zeigte das Armaturenbrett des Mietwagens an. Der Hemdrücken des Fahrers war durchgeschwitzt. Zum Glück war die Messe vorbei und er hatte wenigstens die Krawatte ablegen können. Aber trotz der Klimaanlage im Wagen hatte er Schweißperlen auf der Stirn und der Hals blieb wie zugeschnürt. Denn er hatte noch ein anderes Problem. Dieses zwanghafte Gefühl, die Unruhe, die sich anschlich, langsam aufkam; die Bilder im Kopf waren wieder da. Sie hatten ihn völlig in Beschlag genommen, ließen keinen anderen Gedanken mehr zu. Ein einziges Mal hatte er ihnen bisher nachgegeben, hatte getan, was wochenlang in seinem Kopf festsaß und ihm fast den Verstand geraubt hatte. Und nichts war danach passiert. Alles war so weitergelaufen wie bisher. Er war nach Hause geflogen zu seiner Familie, hatte Frau und Kinder geküsst und abends auf der Couch ferngesehen, als wäre nichts geschehen. Danach hatte er für einige Monate Ruhe gehabt. Doch plötzlich war es wieder da gewesen. Das Verlangen, das ihn wie eine Sucht in Beschlag nahm. Er hatte versucht, es in den Griff zu bekommen, indem er sich vor dem Computer entspannte. Zu Hause, im Büro und sogar im Auto. Anfangs alle paar Tage, schließlich mehrmals täglich. Irgendeinmal würde ihn jemand dabei überraschen. Es konnte so nicht weitergehen. Vielleicht sollte er einen Psychologen aufsuchen. Aber dann käme früher oder später zweifellos dieses eine Mal zur Sprache. Und das durfte auf keinen Fall geschehen.
Er steuerte den Mietwagen um den Kreisel in Belp und bog in die Flughafenstrasse ab. Der Asphalt war durch die Hitze aufgeweicht. In seinem Kopf kreisten die Bilder. Er war mit seinen Gedanken nicht auf der Straße. Vor einem Fußgängerstreifen musste er abrupt bremsen. Beinahe hätte er eine Frau mit ihrem Kinderwagen übersehen. Er atmete tief durch, während die Frau schimpfte und mit dem Finger an die Schläfe tippte. Er konnte ihren Redeschwall durch die geschlossenen Fenster zum Glück nicht hören und fuhr wie in Trance weiter. Bald hatte er die letzten Häuser hinter sich gelassen und der kleine Flughafen kam in Sichtweite. Er war gerade am Pistenende vorbeigefahren und näherte sich den Hangars, als er sie sah.
Plötzlich war er ganz ruhig, verlangsamte seine Fahrt. Die Kleine kam aus der Badeanstalt am Fluss, die am Ende des Flughafens lag. Mit schnellen Schritten ging sie hinüber zum Fahrradunterstand, wo sie nach ihrem Gefährt suchte. Er rollte an ihr vorbei. Im Rückspiegel konnte er sehen, wie sie das Fahrrad aufschloss. Dann war sie aus seinem Blickfeld verschwunden.
Sie war zierlich, blond, vielleicht zwölf Jahre alt, trug kurze, knappe rote Pants und ein gelbes Träger-Shirt. Ein Geschenk des Himmels, ein Fingerzeig des Schicksals. Da war sie, die Erlösung, die Erfüllung. Vor sich sah er rechts am Auenwald einen Parkplatz. Er bog rein und parkte den Wagen auf einem freien Feld. Er stieg aus, ließ die Türe offen, machte ein paar Schritte zur Straße hin und schaute sich um. Niemand war zu sehen. Auch der blonde kleine Engel nicht. Er wollte bereits ernüchtert zu seinem Wagen zurückgehen, da sah er das Mädchen auf dem Fußweg zwischen dem Wald und dem Parkplatz auf sich zu radeln. Mit ein paar schnellen Schritten war er beim Weg und traf dort direkt mit dem Mädchen zusammen. Es versuchte auszuweichen, ohne ihn anzuschauen. Er schlang von schräg hinten seinen rechten Arm um den zierlichen Körper und riss es vom Fahrrad. Das Rad fiel neben dem Weg zu Boden. Mit der rechten Hand hielt er dem geschockten Mädchen den Mund zu und trug es auf einen lichten Platz im Auenwäldchen zwischen Flüsschen und Weg. Mit seinem ganzen Körpergewicht kniete er auf dem kleinen Körper und presste ihn auf den feuchten Boden. Mit der freigewordenen Hand drückte er dem Mädchen den Hals zu. Es japste nach Luft und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Schönen Augen, wunderschönen Augen. Er lächelte es an, während die schlanken Beine unter seinem Gewicht hilflos strampelten und die zarten Hände ihn wegzustoßen versuchten. Sein Widerstand war schnell gebrochen. Ein Röcheln drang aus seiner Kehle, die Hände sanken zu Boden und die Beine erschlafften. Der Engel war jetzt ganz ruhig und seine Augen blickten ihn an wie die einer Puppe. Seiner Puppe. Jetzt gehörte sie ihm. Er kniete sich neben sie und streichelte ihr sanft übers Haar. Dann begann er, sie langsam zu entkleiden.
1. Kapitel
Kinder waren die idealen Opfer. Tobias Landauer legte das Buch auf den Schreibtisch. Er war zufrieden. Der ausgewählte Textausschnitt war ein guter Einstieg für die heutige Premieren-Lesung. Die Zuhörerinnen und Zuhörer würden aufgewühlt sein und ihm danach an den Lippen hängen. Er wusste um die Wirkung der getöteten Kinder von seinen zahlreichen bisherigen Lesetourneen. Und vor allem würden die Besucherinnen und Besucher am Schluss der Veranstaltung seine Bücher kaufen. Signierte Bücher. Wie warme Semmeln würden sie über den Ladentisch gehen.
Morde an Kindern verkauften sich am besten, hatte sein Lektor gesagt. Und tatsächlich hatten sie ihm über all die Jahre ein stattliches Einkommen beschert. Reich geworden war er damit zwar nicht. Aber er konnte sich seinen Lebensunterhalt finanzieren und musste sich nicht mit Teenagern oder Studenten herumschlagen. Wäre es nach seinen Eltern gegangen, würde er sich heute am Gymnasium Kirchenfeld abrackern, um irgendwelchen unbegabten und ungezogenen Teenagern, die sich über ihn lustig machen würden, Deutsch beizubringen. Nicht auszudenken, wie er darunter leiden würde. Nein, das war schlicht unvorstellbar. Er hatte trotz der elterlichen Widerstände den richtigen Beruf gewählt.
Tobias Landauer hatte sich schon früh in seiner schriftstellerischen Laufbahn spezialisiert. In seinen Krimis waren ausschließlich Kinder die Opfer grausamer Verbrechen. Sie wurden missbraucht, umgebracht, entführt, eingesperrt, angekettet. Ihre Peiniger waren in der Mehrzahl Männer, die ihre sexuelle Befriedigung suchten, Lösegeld erpressten, Macht auslebten, Rache ausübten oder Unfälle mit Todesfolge verschuldeten. Tobias Landauer hatte erkannt, dass Verbrechen an Kindern bei Leserinnen und Lesern die intensivsten Emotionen auslösten. Darum hatte er sich fortan literarisch dem Morden der Jüngsten unter uns verschrieben. Leserinnen und Leser wurden berührt, empfanden Abscheu und Angst vor dem geschilderten Grauen, wurden gleichzeitig süchtig nach dem Triumph der Gerechtigkeit, der am Schluss die Opfer zwar nicht wieder lebendig machte, aber doch die Beklemmung von der eigenen Brust nahm. Mit diesen Romanen hatte er sich eine treue und stetig wachsende Fangemeinde geschaffen. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen verlegt. Sogar über die Vergabe der Filmrechte wurde derzeit mit einer dänisch-schwedischen Gesellschaft verhandelt.
Natürlich gab es auch Leute, die ihn wegen seiner brutalen Geschichten scharf kritisierten, aber das war ihm egal. Er hatte im Übrigen auch in der realen Welt – das allerdings durfte er nie laut aussprechen – nicht viel für Kinder übrig. Sie waren laut, vorwitzig und ungezogen. Tobias Landauer ließ sich wegen ein paar selbsterklärten Kinderschützern und Sozialromantikern nicht von seinem erfolgreichen literarischen Strickmuster abbringen.
Er schaute auf die Uhr und stellte fest, dass es schon fast halb acht Uhr war. Höchste Zeit also für den Espresso im Quartier-Bistro Royal. Er verließ das Haus und schloss sorgfältig ab. Heutzutage trieb sich weiß Gott allerlei Gesindel herum. Sogar im noblen Kirchenfeldquartier konnte man nicht mehr sicher sein. Vor allem nachts fürchtete er sich in letzter Zeit öfters, wenn er von einer Lesung spät nach Hause kam und von der Bushaltestelle zu Fuß durch die einsamen Straßen zu seinem Haus gehen musste. Vielleicht lag es ja auch an den furchterregenden Geschichten, die er selber schrieb. Ab und zu war das Angstgefühl so präsent, dass er sich vom Hauptbahnhof aus ein Taxi leistete, das ihn dann direkt vor seiner Haustüre absetzte. Aber selbst die fremdländischen Taxifahrer waren ihm nicht geheuer. Die hatten bestimmt alle ihre Familienclans mit kriminellen Brüdern und Vettern, die sie per Handy mit Informationen versorgten: Hallo Ibrahim, ich habe soeben einen wohlhabenden Mann an der Schillingstrasse abgesetzt. Der wohnt da ganz allein.
Tobias Landauer machte wie jeden Morgen seine Runde. Er ging die Schillingstrasse entlang Richtung Dälhölzli und schritt dann zügig die Jubiläumsstrasse hoch bis zur Kapelle, die wahrscheinlich von irgendeiner freikirchlichen Gemeinschaft betrieben wurde. Dann überquerte er die Kirchenfeldstrasse und ging entlang der Luisenstrasse zur Kreuzung Thunstrasse, wo sich sein geliebtes Bistro Royal mit integriertem Bioladen befand. Er genoss diesen Weg bei jedem Wetter. Im Frühling, wenn die Bäume in hellem Grün erblühten, im Sommer, wenn ihm bereits am Morgen die Hitze die Schweißtropfen auf die Stirn trieb. Im Herbst, wenn die Blätter auf den Gehsteigen diesen eigentümlichen fauligen Duft verströmten und der Wind einem den Regen ins Gesicht peitschte. Und im Winter, wenn die bissige Kälte in die Kleider kroch und die ausgeatmete Luft wie Rauch verdampfte. Der Morgen war die beste Zeit, einfach seinen Gedanken nachzuhängen. Ein leerer Magen, Kaffeedurst, offene Sinne, aber noch keine Energie zum Arbeiten. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie, von der Tobias Landauer zufällig in der Zeitung gelesen hatte, war der Mensch morgens zwischen sieben und neun Uhr am wenigsten leistungsfähig. Also war das genau die richtige Zeit für einen Spaziergang, einen Bistrobesuch und ein bisschen Small Talk.
»Guten Morgen, Maria«, sagte Tobias Landauer gut gelaunt, als er den Laden betrat.
»Guten Morgen, Herr Landauer, schon so früh auf den Beinen?«, fragte Maria, obwohl er jeden Morgen um diese Zeit erschien. Es war ein Ritual zwischen ihnen beiden, wie auch Landauers Antwort: »Ihr Anblick erfreut mein müdes Herz, also fällt es mir leicht, aufzustehen. Ich kriege heute einen schwarzen Kaffee, einen Salat mit italienischer Sauce und ein Glas Cranberry-Saft. Dazu eines meiner Brote. Sie wissen ja Bescheid.«
»Aber sicher, Herr Landauer. Das macht dann siebzehn Franken fünfzig.«
Während Tobias Landauer das Geld aus dem Portmonee klaubte, fragte sie: »Wo möchten Sie sitzen? Ich werde Ihnen die Bestellung an den Tisch bringen.«
»Bei dem schönen Wetter setze ich mich draußen hin. Ich kann ein bisschen Farbe vertragen«, sagte er. »Im Gegensatz zu mir sind Sie schon richtig braun gebrannt.«
Maria lächelte freundlich, obschon sie dieser Spruch nervte. Ihre Mutter war Dominikanerin. Sie war also nicht braun gebrannt, sondern war von Natur aus dunkler als Landauer.
Tobias Landauer setzte sich zufrieden in das kleine Gärtchen an der Straßenecke. Er genoss den täglichen Flirt mit Maria. Nicht, dass er ein Frauenheld war. Im Gegenteil. Nur zweimal in seinem bisherigen Leben war es zu körperlicher Nähe zwischen ihm und einer Frau gekommen. Und er hatte sich beide Male dabei nicht besonders wohl gefühlt. Überhaupt war ihm Körperkontakt grundsätzlich unangenehm. So vermied er es zum Beispiel, öffentliche Verkehrsmittel in den Stoßzeiten zu besteigen, weil er das Gedränge Körper an Körper mit all den Gerüchen eklig und unerträglich fand.
Tobias Landauer wäre eigentlich lieber eine Frau gewesen. Das hieß nicht, dass er sich zu Männern hingezogen fühlte. Nein, er kannte keine Begehren in diese Richtung. Er konnte einfach viel besser mit Frauen. Die meisten seiner Bekannten waren weiblich. Er schätzte ihre Zurückhaltung, die Umgangsformen, die emotionale Denkweise. Er war nun einmal nicht der sexbesessene Mann, der dauernd auf Partnersuche war und der um jeden Preis seinen genetischen Stempel hinterlassen musste, so wie es viele der Protagonisten in seinen Büchern taten. Trotzdem war Tobias Landauer durchaus sexuell aktiv, denn er war zumindest ein leidenschaftlicher Onanist. Nach jeder Lesetournee, manchmal auch mittendrin, gönnte er sich zudem als kleine Ausschweifung eine teure Tantra-Massage. Berührt zu werden, ohne selber aktiv werden zu müssen, das konnte sogar er genießen.
Ohne Geschwister als Einzelkind aufgewachsen, blieb er Zeit seines Lebens ein Einzelgänger. Auch während der Schulzeit hatte er nie viele Freundschaften geschlossen. Wenn doch, waren es meistens Mädchen und später Frauen gewesen. Jungs dagegen hatten sich ihm gegenüber distanziert. Für sie war er das ideale Opfer übler Sprüche und Beleidigungen gewesen. Tobias war ihnen zu schöngeistig, zu fleißig, zu angepasst gewesen. Das hatte ihnen Angst gemacht. Also hatten sie mit Aggression reagiert. Tobias Landauer hatte jedoch kaum darunter gelitten. Er führte damals wie heute ein zurückgezogenes Leben. Exzesse waren ihm fremd.
Maria trat mit der Bestellung an seinen Tisch. »So, hier haben wir Ihren Kaffee, den Saft, den Salat und das milchfrei produzierte Brot. Ich wünsche Ihnen guten Appetit und einen schönen Tag.«
»Danke, gleichfalls, Maria. Ich werde den heutigen Tag in der Tat ganz besonders genießen.«
»Gibt es denn einen besonderen Anlass dazu?«, fragte Maria.
»Das kann man wohl sagen. Denn heute Abend startet die Lesetournee zu meinem neuen Buch Schwarzer Herbst. Ich lasse Sie gerne auf die Gästeliste setzen, wenn Sie möchten.«
Maria war sichtlich überrascht. »Leider habe ich heute Abend schon etwas vor«, log sie. »Mein Freund führt mich zum Essen aus.«
Das war eine Vorstellung, bei der es Maria warm ums Herz wurde. Aber leider hatte sie keinen Freund, der so etwas tun würde. Sie war befreundet mit einem Mann, der sie nur dann besuchte, wenn er gerade Lust dazu hatte. Trotzdem stellten sich ihr die Nackenhaare nur schon beim Gedanken auf, eine Lesung als Gast von diesem verschrobenen und angegrauten Landauer zu besuchen. Am Ende regte sich in ihm die Hoffnung, sie würde mit ihm ins Bett steigen.
»Schade, obwohl ich Ihnen natürlich den Abend mit dem glücklichen Auserwählten gönne«, hörte sie Landauer sagen. »Wir machen es anders. Ich werde Ihnen das Buch einfach schenken. Dann können Sie es in Ruhe lesen.«
»Oh, das ist aber nett. Darüber würde ich mich sehr freuen. Sie schreiben dann hoffentlich auch eine Widmung rein«, sagte sie strahlend und hätte am liebsten angefügt: ›Ich werde es auf keinen Fall lesen.‹ Krimis waren nicht ihr Ding. Und schon gar keine, in denen Kinder starben. Sie fand Menschen, die so etwas schrieben, einfach nur beängstigend. Stattdessen sagte sie: »Genießen Sie Ihr Frühstück«, und machte sich schnell davon.
Tobias litt unter Laktose-Intoleranz und musste daher auf einen eingeschränkten Speiseplan achten. Alle Produkte, die irgendwie mit Milch verarbeitet waren, durfte er nicht zu sich nehmen. Und das waren die meisten. Das wurde ihm erst bewusst, als er von einem Tag auf den anderen darauf verzichten musste. Diese Einschränkung führte mitunter zu eigenartigen Kombinationen wie Salat und Kaffee zum Frühstück. Er war aber nicht allein mit dieser Gewohnheit, denn immerhin 1,3 Milliarden Menschen teilten sie mit ihm. Die Chinesen nämlich fanden den Verzehr von Salat frühmorgens empfehlenswert.
Während er die grünen Blätter mit der Gabel aufzuspießen versuchte, überlegte er, was er heute alles noch zu tun hatte. Er musste Didi aufsuchen. Dann Katharina, seine Verlagsassistentin, anrufen. Bei Susanne würde er sich auf dem Rückweg spontan erkundigen, ob sie einen Termin für einen Express-Haarschnitt frei hatte. Das hatte er nämlich wieder einmal vergessen. Wenigstens zur Buch-Vernissage musste er frisch rasiert und mit passablem Haarschnitt erscheinen. So viel Respekt musste sein. Und nach dem Besuch bei der Friseurin wollte er unbedingt noch Sheila anrufen, um mit ihr frühzeitig einen Termin für die Tantra-Massage zu vereinbaren. Ferner wollte er den Tierparkdirektor anrufen, um seine Tierpatenschaft für das kommende Jahr zu erneuern. Das war sein karitativer Beitrag für die Gesellschaft. Obwohl er keine Haustiere um sich haben wollte, waren ihm Tiere näher als die meisten Menschen. Wenn ihm danach war, konnte er sein Patentier im Tierpark besuchen und bewundern. Dadurch entstand zwar auch eine Art Beziehung, aber zwischen ihm und dem Wesen befand sich ein Gitterzaun. Und das war gut so.
Sein nerviger Vater hingegen musste bis morgen warten. Der war im Wohnpark Elfenau gut versorgt. Wie gewöhnlich würde der Alte sowieso nur wieder über das Buch herziehen und ihm Vorhaltungen machen, dass er sein Jurastudium geschmissen und danach auch die Karriere als Gymnasiallehrer hatte sausen lassen. Darauf konnte Tobias Landauer heute gut verzichten. Überhaupt hätte er auf seinen Vater ganz verzichten können. Aber das war eine andere Geschichte.
Zuallererst wollte er nach dem Frühstück gleich Didi, den Musikproduzenten, aufsuchen, um mit ihm den neuen Songtext zu besprechen.
2. Kapitel
Didi hatte die Türe zu seinem Studio in einem Altstadtkeller wie gewöhnlich abgeschlossen, damit nicht Passanten plötzlich im Regieraum auftauchten. Tobias Landauer musste dreimal klingeln, bis Didi, der gerade einen Song abmischte, das Lämpchen an der Decke blinken sah. Es dauerte allerdings etwas länger, bis er seinen massigen Körper schwerfällig aus dem Sessel zwängte und zur Tür schlurfte.
»Ach du bist es«, stellte er fest. »Du hast dich aber nicht angemeldet.« Er ging zurück zum Mischpult und ließ sich in den Sessel fallen.
»Ich bin ab heute Abend auf Lesetournee und wollte vorher noch den neuen Songtext mit dir besprechen«, sagte Landauer.
»Das wird ja auch Zeit«, bemerkte Didi. »Unser Möchtegern-Grönemeyer schiebt nämlich schon eine Panikattacke wegen des fehlenden Textes.« Er meinte damit einen bekannten Berner Sänger, der daran war, ein neues Album aufzunehmen. Dazu kaufte er alles zusammen, was es brauchte: geile Songs, gute Texte, einen erfahrenen Produzenten in der Person von Didi und die besten verfügbaren Studiomusiker. Woher er das Geld dafür hatte, wollte Didi sich nicht vorstellen, und es kümmerte ihn nicht. Hauptsache er wurde im Voraus bezahlt. Überhaupt waren ihm die Personen, mit denen er zusammenarbeitete, meistens zu abgehoben oder zu kaputt, um sie ernst nehmen zu können oder gar mit ihnen befreundet zu sein. Er machte einfach seinen Job gut, so wie Tobias Landauer. Die Berner Musik-Stars alterten rasant, deshalb brauchten sie auch vermehrt Texte, die ihrem Alter entsprachen. Und da war Landauer der Richtige. Der konnte das, der hatte das goldene Händchen dafür. Didi hielt ihn zwar für stockschwul und privat hätte er sich nie mit Landauer gezeigt, aber das mit den Songtexten, das kriegte der einfach hin. Didi las selten. Das einzige Buch, das er von Landauer gelesen hatte, war total pervers gewesen. Didi war sich sicher, dass dieser Typ selber auf Kinder und Sado-Maso-Kram stand. Er war der festen Überzeugung, nur wer so gewickelt war, konnte so glaubhaft darüber schreiben. Eigentlich, so dachte er und hatte es nach reichlichem Konsum von Wodka-Cola sogar mal laut ausgesprochen, eigentlich sollte man solchen Typen wie dem Landauer den Schwanz abhacken und das Licht ausblasen.
»Dann zeig mal her, was du zusammengereimt hast«, forderte er Landauer auf.
Der zog ein Blatt aus einem Klarsichtmäppchen und streckte es ihm entgegen. Didi griff nach dem Papier und begann zu lesen.
Verfalldatum
Geschreddert die Gefühle
Herzblut in der Knochenmühle
Löcher klaffen im Zellenbau
Geballte Wut im Spermienstau
Darmflora im Dauerstress
Hormone tragen Partydress
Würmer laden zum Opernball
Ins Tiefenlager für Psychomüll
Die Fassade sie schuppt
Die Träume zerplatzen
Und das Verfalldatum entpuppt
Wovon alle um mich schwatzen
Ich bin alt
Frontal von hinten in die Stirn
Blutgerinnsel im Zwischenhirn
Zahnsteinhalden und Mandelschleim
Aufruhr im Mikrobenheim
Rachenrotz und Mundfäule
Im Slalom um die Wirbelsäule
Speiseröhren-Achterbahn
Zum Badeplausch im Lebertran
Die Fassade sie schuppt
Die Träume zerplatzen
Und das Verfalldatum entpuppt
Wovon alle um mich schwatzen
Ich bin alt
Gewissensnot in Einzelhaft
Cannabis im Gallensaft
Schwefelblasen im Abflussrohr
Purzelbäume im Innenohr
Geschreddert die Gefühle
Herzblut in der Knochenmühle
Löcher klaffen im Zellenbau
Geballte Wut im Spermienstau
Die Fassade sie schuppt
Die Träume zerplatzen
Und das Verfalldatum entpuppt
Wovon alle um mich schwatzen
Ich bin alt
Alle um mich sehen
Die Uhr bleibt bald stehen
Und ich find’s trotzdem toll
»Aha, du hast das ziemlich ernst genommen mit der Anlehnung an den Altmeister der deutschen Songschreiber. Kommt wirklich sehr poetisch daher und ist gleichzeitig gespickt mit von Hässlichkeit nur so triefenden Bildern«, sagte Didi. »Das gefällt mir sehr gut.«
»Das ist schön und freut mich«, meinte Landauer geschmeichelt. »Aber in erster Linie muss doch dein Star Gefallen daran finden.«
»Dem gefällt es, wenn ich sage, dass es gut ist«, entgegnete Didi. »Die meisten erfolgreichen Sänger sind Marionetten, die nach den Fäden von uns Produzenten tanzen. Sonst wären sie nämlich gar nie in den Charts gelandet.«
Tobias Landauer zog es vor, Didi nicht zu widersprechen. Er hatte keine Lust auf einen Vortrag darüber, wie das Musikbusiness in den Augen von Didi Koller wirklich funktionierte. Er kannte Ähnliches ja selbst aus dem Verlagswesen. Aber ganz so schlimm, wie Didi behauptete, war es bestimmt nicht. Er strich mit dieser Äußerung nur die Bedeutung seiner eigenen Person als Produzent im ganzen Zirkus hervor. Vielleicht verbarg sich dahinter der Frust, dass der Sänger mit Didis Arbeit auf der Bühne die Lorbeeren holte. Tobias Landauer war das hingegen so lang wie breit. Denn wenn der Sänger mit seinem Text einen Hit landete, kassierte Landauer mit. Da konnte schon mal ziemlich viel Geld aus Urheberrechten zusammenkommen. Landauer hatte mit zwei erfolgreichen Songtexten mehr verdient als mit seinem letzten Krimi.
Didi schien seine Gedanken zu lesen. »Warum schreibst du nicht einfach Songs und lässt das mit den Krimis bleiben?«, fragte er unvermittelt.
»Weil die Krimis und die Lesungen meinen Lebensunterhalt finanzieren«, sagte Landauer ein wenig gekränkt. »Zudem sind sie meine Leidenschaft und, angesichts der Erfolge und der vielen Fans, wohl auch nicht allzu schlecht gemacht.«
»Da bin ich, offen und ehrlich gesagt, anderer Meinung. Mir hat das Buch, das ich von dir gelesen habe, überhaupt nicht gefallen. Du schreibst viel bessere Songtexte als Krimis«, konterte Didi. »Und die Sache mit den Kindern, das kann ich echt nicht nachvollziehen.«
»Das ist ein simples Erfolgsrezept, fast ein Marketing-Konzept, Corporate Design sozusagen«, verteidigte sich Landauer leicht gekränkt. »Aber ich möchte eigentlich nicht mit dir darüber debattieren. Niemand wird dazu gezwungen, meine Bücher zu lesen oder gar zu kaufen.«
»So ist es«, sagte Didi und beendete damit den Diskurs. Es entstand eine etwas peinliche Pause. Schließlich war es Didi, der das Schweigen und damit das Eis brach: »Dann werde ich den Song mit ihm aufnehmen, und du hörst ihn schon bald im Radio.« Nach einem Räuspern fügte er noch hinzu: »Vielleicht lassen wir die letzte Zeile weg, die ist meiner Meinung nach überflüssig.«
»Mach, was du willst. Ich bin dann mal weg«, sagte Tobias Landauer gereizt und drehte sich um. Grußlos ging er zur Türe und wartete ab, bis Didi ihm gefolgt und die Zahlenkombination eingetippt hatte.
3. Kapitel
Als er auf der Kirchenfeldbrücke unterwegs in sein Viertel war, rief er mit seinem Handy seine Verlagsassistentin an.
»Hallo, Katharina, ich bin’s, Tobias«, meldete er sich.
»Hallo, Tobias. Alles klar bei dir? Bist du fit für heute Abend?«, fragte Katharina Neuhaus. Sie schien ein bisschen außer Atem zu sein.
»Ja, es geht mir so weit gut. Abgesehen davon, dass ich mich mit unsensiblen Leuten herumschlagen muss.«
»Was ist denn passiert, haben wir etwas vergessen?«, fragte sie betont besorgt.
»Nein, nein, ihr seid richtige Schätzchen«, beschwichtigte Tobias Landauer. »Dieser Musikproduzent, für den ich Songtexte schreibe, der hat mich wieder einmal geärgert. Das ist so ein widerlicher Mensch. Tagein tagaus sitzt der in seinem Kellerstudio und stopft Chips in sich rein. Dazu säuft er literweise Wodka-Cola und wird dabei fetter und fetter. Und genau diese hässliche, langhaarige Kellerassel ohne Manieren hat dann noch die Unverfrorenheit, mich zu kritisieren und zu beleidigen.«
»Du kannst ihn ja in einem deiner nächsten Bücher abmurksen«, meinte Katharina lachend. »Da hast du einen Vorteil gegenüber uns anderen. Du kannst deinen Frust in den Geschichten ausleben und alle und alles, was dich nervt, aus der Welt schaffen. Wir anderen tragen ihn lebenslang mit uns herum.«
»So schlimm ist es nun auch wieder nicht«, entgegnete Tobias. »Wenigstens macht er seinen Job gut. Er ist mit seinen Popstars, oder denen, die sich dafür halten, seit Jahren in den Charts vertreten. Und das bringt schließlich auch mir ordentlich Kohle.«
»Dann sehe ich gar nicht ein, warum du dich beschwerst«, neckte Katharina.
»Schwamm drüber. Der Grund, warum ich dich anrufe, ist ein anderer: Haben sich diese selbsternannten Kinderschützerinnen beruhigt? Oder müssen wir heute Abend mit irgendeiner Aktion rechnen?«
»Sie haben einen ziemlichen Wirbel veranstaltet. Möglicherweise werden sie heute Abend vor Ort sein und versuchen, die Präsenz der Medien für ihre Zwecke zu nutzen. Die Buchhandlung hat sich deshalb überlegt, ob sie einen Sicherheitsdienst engagieren soll.«
»Das wäre mir mehr als recht«, sagte Tobias. »Ich bin solchen Situationen nicht gewachsen. Verbale Gewalt bringt mich völlig aus dem Konzept. Ich stammle nur noch hilflos vor mich hin.«
Katharina dachte unvermittelt an die sprachliche Gewalt seiner Bücher und die blutrünstigen Geschichten. Sie sagte: »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir werden dich vor Attacken jeglicher Art zu schützen wissen.«
»Wann und wo treffen wir uns denn heute vor Beginn der Vernissage?«, fragte Tobias.
»Ich schlage vor, dass wir uns eine Stunde vor Beginn beim Griechen am Falkenplatz treffen. Der liegt ja gleich gegenüber der Buchhandlung. Dort können wir den Ablauf noch einmal in Ruhe durchgehen.«
»Das ist eine gute Idee. Dann sehen wir uns heute um sieben Uhr.« Er bedankte sich und legte auf. Ihm war schmerzlich bewusst, dass er ohne Katharina den ganzen Rummel um seine Person nicht ertragen würde. Ein Glück, dass sie vor gut einem Jahr zum Verlagsteam dazu gestoßen war. Katharina war die gute Fee in dem Laden. Sie war seine persönliche Betreuerin, hielt ihm die Journalisten vom Leib, koordinierte Termine, organisierte seine Lesereisen, buchte Züge, Flüge und Hotels und erledigte nebenbei Anfragen aller Art, die er direkt und ungefragt an sie weiterleitete. Katharina war jung, charmant und hübsch. Das löste viele Probleme von allein.
Inzwischen hatte er den Helvetiaplatz am Ende der Brücke erreicht. Es war beinahe 12 Uhr. Das war die Gelegenheit, bei Susanne in der Thunstrasse vorbeizuschauen. Susanne war seit Jahren Tobias Landauers Friseurin. Sie war für ihn so etwas wie eine Vertrauensperson. Ärzte, Zahnärzte, Friseure und Garagisten wechselte Tobias nie, solange es sich vermeiden ließ. Sie waren ihm wichtige Bezugspersonen. Tobias hatte neben Susanne auch seine Ärztin und Zahnärztin sorgfältig und mit Bedacht ausgewählt. Einen Garagisten hingegen brauchte er bisher nicht, weil er zeitlebens weder einen Wagen noch einen Führerschein besaß.
Susanne war zudem eine Krimifresserin. Sie verschlang wöchentlich zwei bis drei Kriminalromane. Da sie von ihrem bescheidenen Gehalt nicht alle Bücher kaufen konnte, lieh sie diese in der Bibliothek aus. Auch Tobias Landauers Bücher hatte sie alle gelesen. Die letzten allerdings nur noch, weil er ihr Kunde war und sie ihn persönlich kannte. Sie waren ihr zu brutal und sie ertrug kaum, welche Grausamkeiten seinen literarischen Opfern widerfuhren. Es wollte nicht in ihren Kopf, dass ein nach außen hin so charmanter Mensch wie Tobias in seinen Büchern solche Abgründe zu öffnen vermochte. Einerseits machte er ihr deshalb ein bisschen Angst, andererseits übte er eine unerklärliche Faszination auf sie aus. Ihn als Freund zu haben, das allerdings konnte sie sich jedoch nicht vorstellen. Schon beim Gedanken daran kriegte sie eine Gänsehaut. Im Übrigen war er mit seinen 52 Jahren zu alt für sie.
Er betrat genau in dem Augenblick den Salon, als Susanne ihre letzte Kundin verabschiedet hatte und eine kurze Mittagspause antreten wollte.
»Hallo, Susanne, super, dass Sie noch da sind. Sie sind nämlich wieder einmal meine Rettung!«
»Dann werden Sie heute Abend wahrscheinlich eine Lesung haben«, sagte sie. »Und wie immer haben Sie den Besuch beim Friseur hinausgeschoben bis zum allerletzten Augenblick. Das kennen wir beide doch schon. Möchten Sie sich gleich hinsetzen? Denn kurz nach Mittag habe ich bereits wieder eine Kundin.«
»Und es macht Ihnen wirklich nichts aus, dass ich Ihnen Ihre verdiente Pause stehle?«, fragte er.
»Doch natürlich. Aber ich hoffe immer noch auf eine Rolle in einem Ihrer Bücher. Die muss ich mir ja irgendwie verdienen. Vielleicht klappt es auf diese Art und Weise.«
Er erhob theatralisch die linke Hand. »Ich verspreche Ihnen bei der Seele meiner toten Mutter, dass ich Sie diesmal nicht vergessen werde.«
»Sind Sie Linkshänder, Herr Landauer?« Susanne deutete auf seine erhobene Hand.
»Nein, warum meinen Sie?«, fragte er irritiert.
»Dann möchte ich, dass Sie mit der rechten Hand schwören. Ich lasse mich nicht mehr linken.«
»Oh, wenn Sie darauf bestehen.« Er erhob die rechte Hand und ergänzte: »Sie erhalten in meinem nächsten Buch eine Rolle, versprochen.«
»Aber nicht diejenige des Opfers. Die akzeptiere ich auf gar keinen Fall.« Susanne nutzte die Gunst der Stunde. Sie zeigte mit dem Finger auf ihn. »Ich bin eine liebenswürdige Nebenfigur, die ein unschuldiges Kind vor seinem Mörder beschützt.«
Landauer seufzte: »Oh je. Ich verstehe. Auch Sie, liebe Susanne, stimmen ein in den Chor meiner Kritiker.« Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. »Das schmerzt. Aber solange Sie mir nicht mit dem Rasiermesser den Hals aufschlitzen, werde ich damit zu leben wissen.«
»Das überlasse ich den finsteren Gestalten, die in Ihren Geschichten herumgeistern. Ich mache mir doch nicht selber die Hände schmutzig.« Etwas amüsiert deutete sie auf den leeren Stuhl und hieß ihn Platz nehmen. Mit geübten Handgriffen legte sie ihm den Umhang an. »Obwohl, wenn ich Sie so wehrlos vor mir habe …«
Landauer sank in sich zusammen und sagte mit einer Spur von Bitterkeit in der Stimme: »Alle erwarten von mir den größtmöglichen Nervenkitzel. Und was habe ich davon? Die Menschen, die ich am meisten mag, hassen mich dafür.«
»So schlimm ist es nun auch wieder nicht«, entgegnete Susanne und fragte sich, ob Landauer ein einsamer Mensch war. Ein bisschen tat er ihr leid. Sie wollte etwas Nettes sagen, fand aber die passenden Worte nicht. Stattdessen fragte sie: »Wie immer, Herr Landauer?«
»Wie immer«, sagte er und blieb danach stumm wie ein Fisch.
Susanne versuchte, während sie seine Haare befeuchtete, das Gespräch wieder in Gang zu bringen: »Wo lesen Sie denn heute Abend?«
»In der Buchhandlung am Falkenplatz, um 20 Uhr. Danach sind alle zum Apéro eingeladen.« Nach einer kurzen Pause des Zweifels nahm er einen Anlauf und fügte hinzu: »Wenn Sie möchten, kann ich Sie gerne auf die Gästeliste setzen lassen.«
Sie überlegte: »Danke, das ist sehr nett. Aber leider geht das nicht. Heute Abend habe ich meinen Englisch-Kurs. Da darf ich nicht fehlen, sonst bin ich nächste Woche hoffnungslos weg vom Fenster.«
»Okay, dafür möchte ich natürlich nicht verantwortlich sein.«
»Auf jeden Fall aber bin ich beim nächsten Mal dabei. Ich meine, als Protagonistin muss ich ja vor Ort sein, nicht?«, versuchte sie die Stimmung zu heben.
»Daran führt in der Tat kein Weg vorbei«, meinte er kühl.
Zu Hause angekommen, rief er den Tierpark-Direktor an. Seit ein paar Jahren war Tobias Pate eines Wolfs. Im kommenden Jahr wollte er auch die Patenschaft für einen boson bonasus, einen Wisent, übernehmen. Die bulligen Tiere gefielen Tobias. Sie waren wie der Wolf vom Aussterben bedroht, hatten aber dank dem Einsatz vieler Zoos überlebt und konnten sogar wieder ausgewildert werden.
»Guten Tag, Herr Tannhäuser«, sagte er. »Ich habe auf der Website gesehen, dass Sie wieder zahlreiche Patenschaften für Tiere anbieten. Ich möchte für das kommende Jahr meine Patenschaft für den Wolf erneuern und darüber hinaus auch eine solche für den Wisent abschließen. Geht das?«
»Aber sicher, Herr Landauer, das machen wir sehr gerne. Wenn Sie möchten, können Sie direkt auf der Website das Formular ausfüllen.«
»Das wollte ich eigentlich mit dem Anruf umgehen. Können Sie den administrativen Kram nicht für mich erledigen?«, fragte Tobias.
»Doch, das nehmen wir Ihnen gerne ab. Sie sind ja quasi Stammpate bei uns. Haben Sie unsere Kontonummer noch?«
»Ja, die finde ich bestimmt irgendwo.«
»Sie brauchen sie nicht zu suchen, Herr Landauer. Ich sende Ihnen die Rechnung mit der Bestätigung der Patenschaft per Mail. Darin finden Sie alle nötigen Angaben. Sobald der Betrag, das wären dann 1.700 Franken, überwiesen ist, erhalten sie die Urkunden und das Jahresabonnement nach Hause geschickt. Ich danke Ihnen im Namen der gesamten Tierpark-Leitung von ganzem Herzen für Ihr großzügiges Engagement.«
»Ich habe zu danken. Dank Leuten wie Ihnen sind diese Tiere nicht ausgestorben«, meinte Tobias und verabschiedete sich.
Er betrachtete sich im Spiegel und überlegte, was er zur Buch-Vernissage anziehen sollte. Seine gute Laune war verflogen. Er machte sich Sorgen wegen der Aktivistinnen des Kinderschutzvereins. Und es irritierte ihn, dass offensichtlich keiner der Menschen, mit denen er fast tagtäglich zu tun hatte, seine Buch-Vernissage besuchen würde. Lag es tatsächlich an seinen Geschichten? Aber die hatten doch nicht das Geringste mit ihm als Person zu tun. Tobias Landauer war enttäuscht und auch ein bisschen gekränkt. Er startete seinen Computer. Normalerweise würde er vor einem solchen Anlass einen Porno anschauen, um sich zu entspannen. Damit konnte er jeweils sein Lampenfieber senken und es unter Kontrolle bringen. Aber heute hatte er keine Lust, Hand an sich zu legen. Stattdessen loggte er sich in das Mailprogramm ein, um nachzusehen, ob ihm jemand für heute Abend Glück wünschte. Eine Mail von ›Rumpelstilzchen‹ lag im Posteingang. Er runzelte die Stirn und öffnete sie.
Du genießt es, Kinder zu ermorden. Viel Spaß heute Abend. Gruß, Rumpelstilzchen
Tobias Landauer klickte genervt auf Antworten. Und Sie lieben es, Spielchen zu spielen?, schrieb er und wählte Senden.
Kurz darauf erhielt er die Mitteilung, dass seine Antwort unzustellbar sei.
4. Kapitel
Zusammen mit Katharina überquerte er die Straße und ging auf die Buchhandlung zu. Er hatte ein ungutes Gefühl, denn eine größere Gruppe von Menschen, vorwiegend Frauen, hatte sich vor dem Eingang versammelt. Die Umstehenden hielten ein Blatt Papier in den Händen, das von zwei Frauen verteilt wurde. Tobias erkannte eine von ihnen. Es war diese Olivia Zumkehr, mit der er sich kürzlich getroffen hatte. Sie hatte ihn im Namen von betroffenen Eltern gebeten, keine Bücher mehr zu schreiben, in denen Verbrechen an Kindern in derart expliziter Art und Weise geschildert würden. Als er ihr stattdessen einen Geldbetrag pro verkauftes Buch für Ihren Kinderschutz-Verein oder eine Opferhilfe-Gemeinschaft angeboten hatte, war sie erzürnt aufgestanden und gegangen. Die Mitglieder dieser IG Kinder, wie sie sich nannten, versuchten nun offenbar, seine Lese-Tournee zu stören, indem sie vor den Buchhandlungen Flugblätter verteilten. Tobias befürchtete, dass andere Mitglieder zu drastischeren Methoden greifen könnten. Er dachte an Rumpelstilzchen. War diese Mail auch von der IG Kinder verschickt worden?
Als die beiden Frauen ihn sahen, entrollten sie vor dem Eingang ein Transparent, auf dem stand: Landauer tötet Kinder für Geld. Das war krass. Er hatte noch nie im Leben ein Kind angefasst, geschweige denn einem Kind ein Haar gekrümmt. Er fühlte einen unbändigen Ärger in sich hochsteigen. Er wollte gerade etwas entgegnen, da griff Katharina nach seinem Unterarm und stellte sich vor ihn: »Meine Damen, Sie dürfen gerne Ihre Meinung kundtun, auch wenn Ihre Anschuldigung völlig absurd und aus der Luft gegriffen ist. Aber jetzt lassen Sie uns bitte passieren.« Ein Fotograf der Berner Zeitung schoss einige Fotos. Olivia Zumkehr nutzte die Gelegenheit und ergriff das Wort: »Tobias Landauer tötet in seinen Büchern Kinder auf bestialische Weise. Seine Geschichten sind menschenverachtend und …« Weiter kam sie nicht. Der Buchhändler kam mit zwei Security-Leuten aus dem Laden gestürmt. Die packten Olivia Zumkehr und die zweite Frau, hielten ihnen den Mund zu und führten sie unsanft in den gegenüberliegenden kleinen Park ab, wo sie ihnen das Transparent entrissen und es zerstörten. Die anderen, die vor der Buchhandlung auf Einlass gewartet hatten, applaudierten. Danach strömten sie hinter Tobias Landauer und Katharina Neuhaus in das Lokal, wo zwischen den Bücherwänden zahlreiche Stuhlreihen für sie bereit standen. Vorn neben der kleinen Bühne wartete bereits Landauers Verlegerin Milena Marsberger mit der Frau des Buchhändlers. Während die Besucher ihre reservierten Eintrittskarten kauften, begrüßten sich Tobias Landauer und Milena Marsberger. Sie machte ihn mit dem Buchhändler-Ehepaar bekannt und sagte: »Wir freuen uns alle wahnsinnig auf deine Lesung. Diese kleinen Turbulenzen da draußen gehören zum Geschäft. Davon lassen wir uns aber nicht beeindrucken.«
Tobias Landauer lächelte gequält und wäre am liebsten weggelaufen. Aber das konnte er den Leuten, die so viel für ihn taten, nicht antun. Zudem waren die Stuhlreihen inzwischen bereits fast voll besetzt. Er hatte eben nicht nur Kritiker, sondern auch viele Fans.
Milena Marsberger, die Lektorin und Besitzerin des kleinen Berner Verlags fand Landauers Storys genial konstruiert. Als Mutter hatte zwar auch sie ihre Mühe mit der Brutalität in seinen Büchern, aber die Bücher verkauften sich gut. Und der wirtschaftliche Erfolg war für sie als Verlegerin ein vorrangiges Kriterium. Landauer war seit vielen Jahren der erfolgreichste Autor in ihrem Unternehmen. Mit ihm ließ sich darüber hinaus gut und unkompliziert zusammenarbeiten. Zweifellos war er ein seltsamer Spinner. Dahingehend war sie sich mit den Kritikern einig. Sie hatte manchmal Bedenken, dass die Geschichten nicht nur seiner Fantasie, sondern einer kranken Seele entspringen könnten, und hoffte inständig, dass seine Bücher nicht die Realität abbildeten.
Landauer richtete sich auf der kleinen Bühne ein, prüfte das Mikrofon und die Lichteinstellungen. Er war Profi genug und achtete darauf, dass die Scheinwerfer einerseits ihn nicht blendeten, die Buchseiten aber andererseits genügend ausgeleuchtet wurden. Dann schaltete er sein Handy auf stumm und legte es so auf den Tisch, dass er die Uhrzeit auf dem Display erkennen konnte.
In diesem Moment kam jemand mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu und rief: »Tobi, lass dich drücken.« Es war Antonia oder Toni. Wer gerade aktuell war, erkannte man in der Regel erst auf den zweiten Blick. Heute war es offensichtlich Antonia, die ihn in die Arme schloss. Sie oder eben er war eine stadtbekannte Transgender-Persönlichkeit, die nach Lust und Laune als Frau oder als Mann gekleidet auftauchte. Ob sie auch transsexuell war, hatte Tobias noch nie erkundet. Mit ihr oder ihm pflegte er seit einigen Monaten eine enge platonische Freundschaft. Tobias fand einen Körper, halb Frau, halb Mann, grundsätzlich reizvoll. Es waren oft solche Bilder, die er auf einschlägigen Seiten im Internet betrachtete, wenn er onanierte. Darum war es nicht ausgeschlossen, dass er mit Antonia oder Toni irgendwann, wenn sich die Gelegenheit ergab und die Stimmung romantisch genug war, die Grenze überschreiten würde, vorausgesetzt von Antonia bestand Interesse, was er jedoch noch nicht einzuschätzen wusste.
»Das freut mich aber, dass wenigstens du heute hier auftauchst«, sagte Landauer. »Daran erkennt man seine echten Freunde. Alle anderen hatten etwas Besseres vor.«
»Du weißt doch, dass ich immer für dich da bin«, sagte Antonia und küsste ihn auf die Wange. »Es ist mir eine große Ehre, einen so bekannten Schriftsteller zum Freund zu haben.«