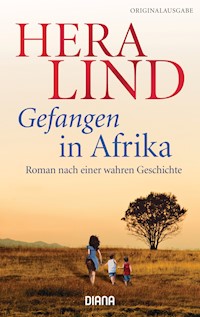9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr Herz gehört einem katholischen Priester – nur die Liebe macht sie stark für einen schier aussichtslosen Kampf gegen Kirche und Konventionen
Carina Kramer ist dreifache Mutter, als sie mit Ende dreißig Witwe wird. Sie sucht Trost in der Kirche und begegnet Pater Raphael von Ahrenberg, der seit über zwanzig Jahren im benachbarten Kloster lebt. Der geweihte Priester hat sich mit Leib und Seele dem Zölibat verpflichtet. Doch Carina bringt alles ins Wanken. Sie ist stark, bodenständig, zugleich zärtlich und einfühlsam. Die gemeinsame Liebe ist geprägt von heimlichen Treffen, gefolgt von umso schmerzhafteren Trennungen. Denn die Kirche lässt Raphael nicht ziehen. Von einem klärenden Gespräch mit dem Bischof kehrt er nicht zurück. Carina steht vergebens am Bahnhof. Und es kommt noch schlimmer: Sie ist schwanger. Werden ihre Widersacher trennen, was Gott zusammengeführt hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Der Roman
Carina Kramer ist dreifache Mutter, als sie mit Ende dreißig Witwe wird. Sie sucht Trost im Glauben und begegnet Pater Raphael von Ahrenberg, der seit über zwanzig Jahren im benachbarten Kloster lebt. Der geweihte Priester hat sich mit Leib und Seele dem Zölibat verpflichtet. Doch Carina bringt alles ins Wanken. Sie ist stark, bodenständig, zugleich zärtlich und einfühlsam. Die gemeinsame Liebe ist geprägt von heimlichen Treffen, gefolgt von umso schmerzhafteren Trennungen. Denn die Kirche lässt Raphael nicht ziehen. Von einem klärenden Gespräch mit dem Bischof kehrt er nicht zurück. Carina steht vergebens am Bahnhof. Und es kommt noch schlimmer: Sie ist schwanger. Werden ihre Widersacher trennen, was Gott zusammengeführt hat?
Lebendig und voller Empathie zeichnet Bestsellerautorin Hera Lind das Porträt einer bedingungslosen Liebe.
Die Autorin
Hera Lind studierte Germanistik, Musik und Theologie und war Sängerin, bevor sie mit zahlreichen Romanen sensationellen Erfolg hatte. Seit einigen Jahren schreibt sie ausschließlich Tatsachenromane, ein Genre, das zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Mit »Hinter den Türen«, »Die Frau, die frei sein wollte«, »Über alle Grenzen« und »Vergib uns unsere Schuld« eroberte sie die SPIEGEL-Bestsellerliste. Ihr Roman »Die Hölle war der Preis«, eine bewegende Geschichte, die im Frauengefängnis Hoheneck in der ehemaligen DDR spielt, stieg sogar direkt auf Platz 1 ein. Hera Lind lebt mit ihrer Familie in Salzburg.
HERA
LIND
Vergib uns
unsere Schuld
Roman nach einer wahren Geschichte
Vorbemerkung
Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch. Es basiert zwar zum Teil auf wahren Begebenheiten und behandelt typisierte Personen, die es so oder so ähnlich gegeben haben könnte. Diese Urbilder wurden jedoch durch künstlerische Gestaltung des Stoffs und dessen Ein- und Unterordnung in den Gesamtorganismus dieses Kunstwerks gegenüber den im Text beschriebenen Abbildern so stark verselbstständigt, dass das Individuelle, Persönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der Figuren objektiviert ist.
Für alle Leser erkennbar erschöpft sich der Text nicht in einer reportagehaften Schilderung von realen Personen und Ereignissen, sondern besitzt eine weite Ebene hinter der realistischen Ebene. Es findet ein Spiel der Autorin mit der Verschränkung von Wahrheit und Fiktion statt. Sie lässt bewusst Grenzen verschwimmen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 12/2019
Copyright © 2019 by Diana Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München
Umschlagmotive: © GettyImages/Julian Elliott,
robertharding, d3sign; Shutterstock/A StockStudio,
Media Whalestock, lunamarina,
Ruzanna Baghdasaryan, ARTEMVOROPAI
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
Zitat [siehe hier] mit freundlicher Genehmigung aus Erich Fried:
Es ist was es ist. Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte
© 1983, 1996 Verlag Klaus Wagenbach Berlin
ISBN 978-3-641-24504-7V004
www.diana-verlag.de
1
Eine ostdeutsche Kleinstadt,
nennen wir sie Thalheim, März 1981
»Nebenan war wohl jemand nicht so beliebt. Das sind ja nur Plastikblumen.« Mit einem Seitenblick auf das Grab rechts von uns bückte sich meine Schwiegermutter und schob einen der prächtigen Kränze in die Mitte der überbordenden Blumenpracht auf dem Grab meines Mannes. Hundert dunkelrote Rosen sprengten den Rahmen dessen, was bei einer Beerdigung hier in der DDR so üblich war. Sorgfältig drapierte Christa die weißen Bänder mit goldener Schrift über dem frisch aufgeschütteten Grabhügel ihres Sohnes. Andächtig las sie vor:
»Ein letzter Gruß zum Abschied.
Deine Frau Carina und die Kinder
Maximilian, Sabine und Tommi«
Obwohl wir ihren Sohn gerade erst beerdigt hatten, lag auch ein Hauch von Stolz in ihrer Stimme.
»Bei Manfred hieß es eben ›Nicht kleckern, sondern klotzen‹.« Sie blinzelte eine Träne weg.
Ich sah den letzten Beerdigungsgästen nach, die den Friedhof verließen. Es waren Hunderte gewesen: Parteigenossen, Freunde, Nachbarn, Ärzte, Krankenschwestern – alle, die ihm während seiner schweren Krankheit beigestanden hatten.
»Es ist schön, dass du es einrichten konntest, Christa.« Liebevoll sah ich meine Schwiegermutter an, die es sich nicht hatte nehmen lassen, für die Beerdigung ihres älteren Sohnes aus dem Westen anzureisen. »Wie schade, dass Georg nicht mitkommen konnte.« Georg war Manfreds jüngerer Bruder, den ich noch nie gesehen hatte. Wahrscheinlich würde ich ihn auch nie kennenlernen, schließlich stand die Mauer zwischen uns.
Christa seufzte. »Er hat keine Einreisegenehmigung bekommen. Du weißt ja, er arbeitet bei einem namhaften Autohersteller der BRD.«
»Ich weiß. Bei Volkswagen in Wolfsburg. Von so etwas können wir hier nur träumen.«
Schweigend standen wir eine Weile am Grab, Schulter an Schulter.
»Wie kommst du jetzt klar, Carina?« Christa wischte sich die Augenwinkel. »Und wie wird es mit den Kindern weitergehen?«
»Wir werden es schon irgendwie schaffen.« Neben aller Trauer und Beklommenheit machte sich auch Erleichterung in mir breit. »Die letzten zwei Jahre seiner Krankheit waren die schwersten meines Lebens.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Christa sah mich mit rot geweinten Augen an. »Du warst immer so ein fröhlicher Mensch, aber nach diesem schweren Schicksalsschlag … Dabei bist du erst sechsunddreißig!« Sie drückte mir den Arm und lächelte unter Tränen. »Danke für alles, was du für meinen Sohn getan hast!«
»Das war doch selbstverständlich!« Noch einmal warfen wir einen Blick auf sein Grab, das so auffallend prächtig war, dass das daneben tatsächlich fast schmucklos wirkte.
Ich straffte die Schultern und atmete tief durch. »Leb wohl, Manfred.«
Manfred war Parteimitglied gewesen. In der Firma, in der ich als Sachbearbeiterin beschäftigt war, war er mein Chef gewesen, anfangs noch mein heimlicher Geliebter, dann mein rechtmäßiger Ehemann und sechzehn Jahre älter als ich. Das war zunächst unfassbar aufregend, andererseits hatte er mich im Laufe unserer achtzehnjährigen Ehe immer nur wie ein kleines Mädchen behandelt. Er war der Vorgesetzte, ich seine Untergebene und später die Kinder seine Befehlsempfänger. Die Krankheit hatte ihn hart und unerbittlich gemacht – und die Kinder und mich mürbe. Schließlich: ein Herzinfarkt und zwei Schlaganfälle mit bleibenden Folgen. Meine Familie hatte diese Ehe nie befürwortet, meine Eltern waren noch nicht mal zu unserer Hochzeit gekommen. Ich seufzte laut.
Es war vorbei. Von nun an würde ich mein Leben wieder selbst in die Hand nehmen.
Langsam verließen Christa und ich den Friedhof. Mit meinem Trabi fuhren wir zu unserer alten Villa am Rande der Kleinstadt, wo die Trauergäste bereits mit den Kindern warteten.
»Es war wirklich eine schöne Trauerfeier. Am meisten hat mich beeindruckt, dass alle Blumen und Kränze echt waren.« Während wir über das Kopfsteinpflaster knatterten, klammerte sich Christa krampfhaft an die Halteschlaufe. Sie schien Angst zu haben, dass der Trabi gleich auseinanderfiel.
Fast musste ich lachen. »Was hast du denn gedacht? Dass sie aus Plaste seien?«
»Na ja, in der DDR ist ja wirklich manches eher schäbig …« Mit einem Blick auf die schmucklosen Häuser fiel sie in verlegenes Schweigen.
»Wir haben immer gut gelebt«, verteidigte ich mich. »Aufgrund von Manfreds politischer Position hat es uns an nichts gefehlt. Er hat sich hier wohlgefühlt, und ich hatte immer so eine positive Einstellung zum Leben, dass mich selbst Plastikblumen nicht unglücklich gemacht hätten!«
Christa schien sich ihrer Vorurteile zu schämen. Schnell wechselte sie das Thema.
»Der Gefangenenchor aus Nabucco, das war sehr … würdevoll.« Sie räusperte sich. »Verdi vom Tonband abzuspielen … War das deine Idee?«
»Ich fand es angemessen. Bei den vielen Menschen in der Trauerhalle.« Ich lächelte schwach. »Du nicht?«
Christa suchte zögernd nach Worten.
»Na ja, ich hätte etwas Christliches erwartet, aber das wäre wohl nicht so passend gewesen?« Mit der freien Hand presste sie die Handtasche an sich. »Andererseits …« Ihre Stimme schwankte. »Manfred war mal so ein frommer Junge! Wir waren ja alle sehr katholisch in Oberschlesien. Ich sehe ihn noch vor mir, an seiner ersten Heiligen Kommunion. Und kurz nach dem Krieg, als wir nach Niedersachsen geflüchtet waren … Ach, das war nicht leicht, die beiden Jungs ohne Vater aufzuziehen.« Sie ließ den Taschenbügel aufschnappen und suchte nach einem Taschentuch. »Mein Mann ist ja im Krieg gefallen, ich war noch früher Witwe als du, und mir hat der Glaube immer Trost und Kraft gegeben. Auch Manfred und Georg fanden Halt in der Kirche. Sie waren Messdiener, bekamen so Struktur und Ordnung und klare Moralvorstellungen nahegebracht.«
Wir hielten vor einer roten Ampel. Ich sah sie von der Seite an und legte die Hand auf ihre.
»Ich weiß, Christa. Aber mit seinem Umzug in die damals neu gegründete DDR hat sich das ja für Manfred erledigt.«
Manfred war von Niedersachsen, wo Christa bereits eine Ausbildungsstelle bei der Polizei für ihn besorgt hatte, spontan mit einem Freund in die gerade neu gegründete DDR gefahren, um dort beim Aufbau zu helfen. Die beiden jungen Männer wurden begeisterte Kommunisten und kehrten nicht mehr in den Westen zurück.
In Thalheim bekam der engagierte Manfred die Möglichkeit, eine Ausbildung im Hochofenbetrieb zu machen und später zu studieren, schon baldarbeitete er als Ingenieur im Hüttenkombinat, trat in die SED ein und konnte so eine Bilderbuchkarriere beginnen. Wie sehr Christa und der kleine Georg, der damals erst zehn war, darunter litten, nun auch noch ihn verloren zu haben, war ihm nicht bewusst. Er hatte den Krieg und die Nachkriegszeit hautnah erlebt und war ganz beseelt von dem Gedanken, einen neuen sozialistischen Staat mitzugestalten. Religion? Fehlanzeige.
»Heute ist in der DDR wirklich kaum noch jemand katholisch«, erklärte ich meiner Schwiegermutter.
»Und du, Mädchen?« Christa drückte meine Hand. »In dieser Trauerphase könnte dir der Glaube doch helfen!«
»Ach Christa.« Ich legte den ersten Gang ein und atmete tief durch. »Das war für uns lange kein Thema.« Feiner Nieselregen hatte eingesetzt, und der Scheibenwischer quietschte auf der beschlagenen Scheibe.
Ich setzte den Blinker und bog in unsere ruhige Seitenstraße ein. Unsere alte Villa lag versteckt am etwas vernachlässigten Stadtpark. »Meine Eltern waren früher auch eifrige Kirchgänger. Und ich verstehe das auch mit dem Halt und der Struktur.« Ich wollte meine Schwiegermutter nicht kränken und suchte nach diplomatischen Worten. »Aber mit der Jugendweihe sind wir automatisch ins hiesige System gerutscht. Meine Schwester und ich sind in guten Anstellungen im Kollektiv tätig, weißt du. Das ist jetzt unser Halt und unsere Struktur. Es geht uns prima, wir sind nicht in der Partei, aber wir sind eben auch keine bekennenden Katholiken mehr. Das wird hier nicht gern gesehen, verstehst du?«
Während ich rückwärts einparkte, schwieg meine Schwiegermutter. Ich öffnete das schmiedeeiserne Gartentor, das leise quietschte. An den Rändern des Gehweges lag schmutziger Altschnee. Wann war dieser Garten zum letzten Mal grün gewesen, wann hatten hier Vögel gezwitschert und wann die Kinder sorglos gespielt? Vor meinem inneren Auge sah ich Manfred im Rollstuhl auf der Terrasse sitzen, uns alle mit seiner schlechten Laune terrorisieren. Manfred war ein schwieriger Patient, ungeduldig mit den Kindern und oft auch ungerecht gegen mich. Plötzlich überkam mich der heftige Wunsch, die kleine alte Villa mit der negativen Energie zu verkaufen und mit den Kindern noch mal ganz neu anzufangen. Aber das behielt ich natürlich für mich, um meine Schwiegermutter nicht zu verletzen. Ich atmete tief durch.
Spontan umarmte sie mich. »Du wirst das schon hinkriegen, Mädchen. Ich werde dir und den Kindern weiterhin Pakete schicken.«
»Danke, Christa. Du bist die beste Schwiegermutter der Welt. Eigentlich ja Ex-Schwiegermutter.« Ich lächelte schwach.
»Ja, aber nur weil Manfred jetzt tot ist, werde ich dich und die Kinder doch nicht im Stich lassen!«
Sie hielt mich ein Stück von sich ab und betrachtete mich liebevoll.
»Und ich wünsche dir von Herzen, dass es irgendwann wieder einen Mann in deinem Leben geben wird. Einen, der auch altersmäßig zu dir passt. Du bist viel zu jung und hübsch, um lange allein zu bleiben.«
Sofort hatte ich einen dicken Kloß im Hals. Welche Ex-Schwiegermutter sagt so liebe Sachen?
»Komm, lass uns reingehen.« Ich drückte Christa die Hand. »Drinnen warten die Trauergäste auf Kaffee und Kuchen.«
Als der Besuch gegangen war, machte sich in unserer maroden Villa eine Mischung aus Erleichterung und bedrückender Stille breit.
»Was ist, Kinder, wollen wir am Wochenende den Garten wieder in Schuss bringen und die Schaukel aufhängen?«
»Kein Bock.« Maximilian schob die langen Haare aus der Stirn und verzog sich in sein Zimmer, wo er lustlos mit dem Tischfußball spielte, den Oma Christa ihm zu seinem siebzehnten Geburtstag aus dem Westen geschickt hatte. »Am besten wir verkaufen die Bude.«
Die vierzehnjährige Sabine saß mit angezogenen Beinen auf dem Sofa und war in ein Pferdebuch vertieft. »Nicht böse sein, Mama, aber da haben wir einfach keine guten Erinnerungen daran. Ständig mussten wir die bescheuertsten Arbeiten verrichten, und Papa hat uns angeschnauzt und herumkommandiert.«
Nur der kleine Tommi begriff mit seinen fünf Jahren noch nicht so recht, was passiert war. Er tollte mit seinen Matchboxautos im Garten herum und machte laute Motorengeräusche – erstaunt, dass ihn niemand zur Ruhe mahnte.
»Darüber habe ich auch schon nachgedacht.« Ich sah mich in den hohen Räumen um. »Und wisst ihr was? Mit dem Geld für das verkaufte Haus richten wir uns eine völlig neue Wohnung ein. Mitten in der Stadt. Nur wir vier. Was haltet ihrdavon?«
Freudiges Indianergeheul war die Antwort. Meine drei Kinder umarmten mich stürmisch. Wir waren frei. Wir würden neu anfangen. Wir würden es schaffen.
2
Thalheim, Juni 1981
Als nunmehr alleinerziehende Mutter arbeitete ich sechs Stunden täglich in einer Abteilung des Werkes, in der auch Wohnungen und Ferienplätze vergeben wurden. Deshalb war es ein Leichtes, schnell eine passende Wohnung im Stadtzentrum zu bekommen.
Durch meinen verstorbenen Mann genoss ich nach wie vor so manche Privilegien. Wir erhielten Witwen- und Waisenrente, den Trabi durfte ich behalten, die Kinder gingen in die Schule, und der Kleine war ganztägig im Hort untergebracht. Alles war nun fußläufig erreichbar, und die Stadtwohnung verfügte über eine sonnige Dachterrasse mit Blick auf die benachbarte Kirche.
Eines Sonntagvormittags telefonierte ich mit meiner Schwiegermutter Christa in Hannover. Wie immer hatte sie mich pünktlich nach der Messe angerufen.
»Wie geht es euch, ihr Lieben?«, fragte sie warmherzig. »Habt ihr den Umzug gut überstanden? Sind unsere Westpakete angekommen?«
»Ja, vielen Dank. Es ist so wunderbar, dass ich alles mit dir besprechen kann. Ich bin so froh, dass ihr uns nicht vergessen habt, Georg und du.«
»Aber wie könnte ich, Carina?« Christas liebe Stimme tat mir unglaublich gut. »Wir wissen, wie anstrengend Manfred sein konnte. Du warst seine große Liebe, auch wenn er dir das nie so richtig zeigen konnte.«
»Schon gut.« Ich steckte mir eine Zigarette an, Peter Stuyvesant aus dem West-Paket meiner Schwiegermutter. Bei Manfred hatte ich nicht rauchen dürfen. »Er war ja auch wirklich ein toller Mann. Die Krankheit hat ihn zermürbt. Und Geduld war eben noch nie seine Stärke.« Gedankenverloren blies ich den Rauch auf die Dachterrasse hinaus. Die weißen Gardinen blähten sich im Wind, und von der nahe gelegenen Kirche schlug es gerade verhalten zur Wandlung. Ein wohltuendes Geräusch. Es erinnerte mich an meine Kindheit.
»Vermisst ihr die Villa am Stadtrand denn nicht? Was machen die Kinder in den Sommerferien?«, erkundigte sich Christa.
»Ehrlich gesagt, vermisst sie niemand von uns.« Ich knipste einige verwelkte Stängel aus meinen Balkonblumen. »Die Kinder und ich genießen es …« – ich wollte nicht taktlos sein, wusste aber, dass ich es ungehindert aussprechen durfte – »… einfach wieder wir selbst sein zu können. Wir gehen regelmäßig ins Schwimmbad und fahren Rad. Die Großen entdecken mit ihren Freunden die Stadt, und Klein Tommi und ich machen es uns hier gemütlich.«
Erstaunt lauschte ich dem feierlichen Gesang, der nun aus der Kirche zu mir herüberdrang. War das »Großer Gott, wir loben dich?« Wie lange hatte ich das nicht mehr gesungen? Eine Gänsehaut überzog mich, und ich spürte eine undefinierbare Sehnsucht.
»Und deine Familie?«, hakte Christa nach. »Haben sich die Wogen inzwischen geglättet?«
Ich drückte die Zigarette aus und rieb mir fröstelnd die Arme.
»Nicht wirklich. Sie haben sich noch nicht mal bei mir gemeldet.«
Seit meiner Hochzeit mit Manfred war das Verhältnis zu meinen Eltern und meiner Schwester Elke sehr abgekühlt. In den Augen meiner Familie war er ein herrschsüchtiger Patriarch gewesen, der mich und die Kinder nur schlecht behandelt hatte. Sie nahmen es mir alle übel, ihn geheiratet zu haben, und unterstellten mir, dass ich es nur wegen der Privilegien getan hätte. Ihre Unterstellung hatte mich sehr verletzt. Während seiner Krankheit hatten sie mir und den Kindern nicht beigestanden, und auch jetzt nach seinem Tod erwarteten sie wohl, dass ich den ersten Schritt machte. So gesehen stand ich meiner Schwiegermutter Christa, die im Westen lebte und die ich genau zweimal im Leben gesehen hatte, nämlich bei unserer Hochzeit und auf der Beerdigung, näher als meiner Familie, die in derselben Stadt lebte. Mit Christa konnte ich ewig telefonieren, und sie nahm regen Anteil an unserem neuenLeben.
»Sag mal, läuten bei dir gerade die Glocken?«
»Ja, wir sind direkt neben die Kirche gezogen, in die ich damals als Kind gegangen bin.«
»Wie schön, Carina! Ich habe hier in der Gemeinde so viele Freunde«, schwärmte Christa. »An Fronleichnam bin ich in der Prozession mitgegangen, das war wunderschön, alles voller Blumen! Pfingsten haben wir einen Seniorenausflug ans Steinhuder Meer gemacht, und das Sommerkonzert mit dem Kirchenchor hat mich so beseelt … ich wünschte, du würdest auch wieder zur Kirche gehen. Es würde dir helfen, mein Kind.«
Während ich die Balkonblumen wässerte, fiel mein Blick erneut auf den benachbarten Kirchturm, über den die weißen Wolken zogen, sodass es aussah, als würde er in meine Richtung fallen. »Ja, das könnte ich eigentlich tun«, hörte ich mich zu meinem eigenen Erstaunen sagen. Bis heute war dieser Kirchturm für mich nichts anderes gewesen als ein Turm, von dem es zu jeder halben und vollen Stunde läutet. Unser Leben in der DDR war schon lange von Atheismus geprägt. Bereits meiner Mutter war mit dem Verlust des Arbeitsplatzes gedroht worden, wenn ich nicht zur Jugendweihe ginge, und so hatte sich unser christlicher Glaube verloren wie Spuren im Sand. Maximilian und Sabine waren zwar noch christlich getauft, aber der kleine Tommi schon nicht mehr.
Und nun schwärmte meine Schwiegermutter von ihrem erfüllten Leben in der Christengemeinde: »Das ist auch eine Familie, Carina, vergiss das nicht!«
Gerade öffneten sich die Kirchentüren, und die festlich gekleidete Gemeinde quoll unter brausenden Orgelklängen heraus auf den Vorplatz. Ich beugte mich über das Balkongeländer. Dazu hatte ich früher gehört, vor so vielen Jahren! Wie schön das gewesen war, vom netten alten Pfarrer an der Kirchentür verabschiedet zu werden. Aber die Frau in der weißen Bluse, war das etwa …?
»Ich muss auflegen, ich habe eine alte Freundin entdeckt! Tschüss Christa, ich melde mich. – Dorothea?!«
Ich winkte zögerlich, und die Gestalt blickte sich suchend um.
»Dorothea! Hier oben!«
Jetzt schaute sie herauf, legte die Hand schützend vor die Augen und erkannte mich! »Carina?! Was machst du denn da oben?«
»Ich wohne hier! Komm rauf!«, bedeutete ich ihr mit beiden Händen.
Mein Herz klopfte, als ich zur Wohnungstür lief und auf den Türöffner drückte. »Dorothea, was für eine Freude!« Sofort lagen wir uns in den Armen, als wären wir die letzten zwanzig Jahre nicht getrennt gewesen.
»Kommst du gerade aus der Messe?«, fragte ich völlig überflüssigerweise, als ich sie in die Wohnung zog. »Ich habe euch singen gehört! Ist das immer noch derselbe Kirchenchor, in dem wir damals gemeinsam waren?« In meine Wiedersehensfreude mischte sich plötzlich ein undefinierbares Schuldgefühl. Im Gegensatz zu mir war Dorothea der Gemeinde immer treu geblieben.
Dorothea, inzwischen an die vierzig, wirkte sehr ernst und hatte schon leichte Falten um die Mundwinkel. Das Mädchenhaft-Sorglose von früher war strengeren Zügen gewichen. Es war sicher nicht leicht, hier als bekennende Christin zu leben. Sie trug das früher zu lustigen Zöpfen geflochtene Haar als strengen Dutt im Nacken.
»Ich habe gehört, dein Mann ist gestorben? Mein herzliches Beileid.«
Sie umarmte mich lange. »Ihr habt ihn ja nicht christlich beerdigt?!«
»Nein. Es war eine sozialistische Bestattung, du weißt schon, in der städtischen Trauerhalle. Die war brechend voll, und meine Schwiegermutter konnte es kaum glauben, dass die Blumen echt waren«, sprudelte es aus mir heraus. »Aber lass uns von alten Zeiten erzählen! Hast du ein paar Minuten?«
Kurz darauf saßen wir schon mit einem Glas Dujardin aus dem schwiegermütterlichen Westpaket auf der Dachterrasse. Dorothea schwang sanft in der bunten Hollywoodschaukel vor und zurück, sie trug einen dunkelblauen Faltenrock, und ihre Füße steckten in praktischen Schnürschuhen.
Im Gegensatz zu mir, die ich mit Stolz westliche Jeans trug, um meine Figur zu betonen, war ihr Mode offensichtlich egal.
»Schön hast du es hier! Tolle Möbel. Sind die Vorhänge neu?«
Im Westfernsehen antwortete die Frau in der Werbung: »Nein, mit Perwoll gewaschen!«, aber das hätte Dorothea nicht verstanden, vielleicht wusch man damit auch nur Pullover.
»Ja, wir haben gut einkaufen können«, antwortete ich vage. Ich wollte ihr nicht gleich auf die Nase binden, dass wir durch den Verkauf der Villa und durch die guten Beziehungen zum Parteisekretär ordentlich im Intershop zugeschlagen hatten.
Schnell trank ich noch einen Schluck Cognac und beugte mich interessiert zu ihr hinüber.
»Wie geht es dir? Bist du verheiratet? Hast du Kinder?« Neugierig musterte ich die ehemalige Kirchenfreundin, mit der ich ganze Predigten verkichert hatte.
»Nein.« Dorotheas Blick glitt über die Fotos von meinen Kindern und über das silbergerahmte Bild von Manfred mit schwarzem Trauerflor über dem Klavier.
»Ich habe nie geheiratet und demnach auch keine Kinder.« Sie zuckte mit den Schultern. »Es hat sich einfach nicht ergeben. Der Richtige war nie dabei.«
Insgeheim fragte ich mich, ob das nicht auch ein bisschen daran lag, dass sie so gar nicht sexy aussah. Aber vielleicht wollte sie auch keine Signale an die Männerwelt senden.
Dorothea hatte wie meine Familie mit Argwohn auf meine Beziehung zu Manfred reagiert. Der war schließlich anfangs noch anderweitig verheiratet gewesen. Als er dann geschieden war, und wir offiziell – wenn auch nicht kirchlich – heirateten, hatte sich Dorothea wie meine Eltern und Elke gänzlich von mir abgewandt.
Und nun saßen wir hier und baumelten mit den Beinen.
Doch nachdem wir die letzten zwanzig Jahre ausführlich hatten Revue passieren lassen, war die alte Vertrautheit wiederhergestellt.
Inzwischen hatte ich einen Eiskaffee gemacht und mit Sprühsahne aus dem Intershop verziert. Sogar Eiswürfel klirrten im Glas.
»Wie kommst du denn zurecht mit deiner Trauer und Einsamkeit?« Dorothea sah mich prüfend an. »Betest du?«
Verlegen rührte ich in meinem Glas. »Du bist heute schon die Zweite, die mich das fragt.«
»Wer noch?«
Ich lachte verlegen. »Meine Schwiegermutter hat mir eben am Telefon von ihrer Kirchengemeinde vorgeschwärmt.« Nachdenklich sah ich den Eiswürfeln beim Schmelzen zu. »Der Glaube gibt ihr so viel Kraft und Trost.«
Dorotheas Gesicht strahlte plötzlich Zuversicht und Wärme aus. »Da kann ich ihr nur beipflichten! Du musst dir doch Gedanken darüber machen, was mit Manfreds Seele im Jenseits passiert!«
»Ähm … nein?« Ehrlich gesagt, war das gerade mein kleinstes Problem. »Ich mache mir viel mehr Gedanken um die Kinder: ob Max wohl eine gute Ausbildungsstelle findet, ob Sabine gut durch die Pubertät kommt und natürlich um meinen kleinen Tommi, der den Tod seines Vaters noch gar nicht richtig begreift.« Ich räusperte mir einen Kloß von der Kehle. »Da fühle ich mich manchmal ganz schön allein gelassen, weißt du! Meine Freunde von früher weinen mir auch keine Träne nach.« Ich zog die Nase hoch und wischte mir verlegen über die Augen.
»Der Herr vergibt allen, die abtrünnig geworden sind!« Dorothea nahm meine Hand und drückte sie. »Finde zu ihm zurück, Carina! Du wirst spüren, wie sehr Gott dich immer noch liebt!« Plötzlich rutschte sie ganz an den Rand der Schaukel, sodass sie fast herausfiel. »Komm, lass uns das Vaterunser beten! Dein Leben wird einen tieferen Sinn bekommen!« Das hatte etwas rührend Komisches, und ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen … oder beten sollte.
»Dorothea …« Das war mir jetzt wirklich unangenehm.
»Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden …«, begann Dorothea inbrünstig.
»Ach Dorothea, ich weiß nicht …« Unwillig entzog ich ihr die Hand. Wie peinlich war das denn! Das ganze Gerede von Gott brachte mich jetzt auch nicht weiter. Ich wäre am liebsten in Tränen ausgebrochen.
»Bitte, überfall mich jetzt nicht so damit. Ich bin die letzten zwanzig Jahre gut ohne deinen Gott ausgekommen.«
Dorothea durchbohrte mich mit ihren Blicken. »Aber jetzt fühlst du dich einsam und allein, das hast du gerade selbst erzählt!«
»Ja schon, aber … Ich habe gar keine Beziehung mehr zu Gott. Ich habe wirklich ganz andere Sorgen.« Was wusste Dorothea schon davon, wie es ist, den Alltag mit drei lebhaften Kindern ganz allein bewältigen zu müssen? Und das als berufstätige Frau?
»Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.«
»Ja, ich weiß, aber vom Singen und Beten werden meine Ängste auch nicht kleiner. Weißt du, wenn ich nachts allein im Bett liege, sehe ich oft die Wände auf mich zukommen …«
Dorothea sah mich an. »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er leitet mich auf grüner Au und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.«
Plötzlich spürte ich, wie mir die Tränen in die Augen schossen. Dorothea hatte meinen wunden Punkt getroffen. Ich fühlte mich allein, ganz auf mich gestellt, und hatte schlaflose Nächte bei der Vorstellung, meine drei Kinder allein großziehen zu müssen. Für mich war das Leben mit sechsunddreißig schon zu Ende!
»Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.«
Wir schwiegen eine Weile, und ich ließ die tröstlichen Worte auf mich wirken.
»Psalm 23«, brach es schließlich aus mir heraus, als hätte jemand auf einen Knopf gedrückt.
»Das weißt du noch?« Dorothea strahlte mich an.
»Ja.« Ich lachte verlegen. »Das kommt jetzt alles wieder hoch.« Ich wischte mir über die Augen. »Haben wir das nicht mal gesungen?«
»An das gesungene Wort erinnert man sich viel besser als an das gesprochene«, bestätigte Dorothea. »Das geht direkt in die Seele. Felix Mendelssohn-Bartholdy hat das ganz wunderbar vertont.«
Sie summte die Melodie, und ich wurde ganz wehmütig.
»Kennst du das andere noch?«, bedrängte ich sie. »Das mit den Engeln?!«
»Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir …«, sang Dorothea.
»Dass sie dich auf den Händen tragen«, fiel ich mit ein. »Dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen…«
Die Erinnerungen überrollten mich wie eine Lawine. Plötzlich war ich wieder das kleine Mädchen, das zwischen seinen Eltern behütet in der Kirche saß und seine Sorgen und Nöte Gott anvertrauen konnte. Und niemand war mir böse, denn ich hatte noch keinen Fehler gemacht.
»Komm doch nächsten Sonntag einfach wieder mit!« Auch Dorothea hatte unser Gespräch sehr bewegt.
»Ich weiß nicht … Sie werden mich dafür verachten, dass ich abtrünnig geworden bin. Da kann man nach so vielen Jahren doch nicht so einfach wieder auftauchen?«
Dorothea legte den Arm um mich. »Doch«, sagte sie schlicht. »Genau dafür ist Kirche da. Du bist herzlich willkommen.«
Als Dorothea weg war, blieb ich völlig aufgewühlt zurück. Was war das denn jetzt gewesen? Wieso hatte mich dieser Psalm so vom Hocker gerissen? Bestimmt war ich als junge Witwe nur besonders anfällig für so eine Gefühlsduselei. Aber ich wollte so gern wieder irgendwo dazugehören …
Die Kinder kamen vom Spielen nach Hause, und schnell ging es wieder um alltägliche Streitereien und Hausfrauenpflichten. Max war aufmüpfig und roch nach Alkohol. Sabine pubertierte heftig und ließ alles stehen und liegen. Und Tommi war ein überfordertes Kleinkind, das ich in der Badewanne erst mal gründlich abschrubben musste, weil er mit dem Fahrrad hingefallen war.
Als ich die Meute dann endlich im Bett hatte und allein im Wohnzimmer saß, überkam mich wieder dieses Gefühl von Einsamkeit, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? War das Zufall oder Fügung, dass wir direkt neben die einzige katholische Kirche im Ort gezogen waren?
Ich biss mir auf die Lippen und horchte tief in mich hinein. Wäre das nicht ein guter Neuanfang? Könnte ich nicht in der Gemeinde wieder Fuß fassen? Würden meine Freunde von früher sich mir wieder zuwenden?
Wie zur Bestätigung läuteten die Abendglocken, und die Amseln in den benachbarten Dachrinnen sangen ihr Lied. Ein plötzlicher Friede breitete sich über mich wie eine weiche Decke. Einer Eingebung folgend stand ich auf, ging auf den Speicher und durchsuchte die Umzugskisten, die ich nicht mehr hatte auspacken wollen. »Alter Kram«, stand darauf. »Zu schade zum Wegwerfen.«
Und da war sie, meine alte Kinderbibel. Auch das dünne ledergebundene Gebetbuch fiel mir in die Hände. Vorsichtig blies ich den Staub vom Einband und blätterte in den dünnen, vergilbten Seiten. Ein vertrauter Geruch schlug mir entgegen, und auf einmal waren die letzten zwanzig Jahre wie weggewischt. Das rote Bändchen markierte eine bestimmte Seite. Wie magisch zog mich die kleine schwarze Schrift an. Mein Daumen fuhr über ein Gebet, das wie für mich geschrieben zu sein schien. Der Text war mir so vertraut, als hätte ich ihn gestern zum letzten Mal gelesen.
»Herr unser Gott, wer auch mit dir gebrochen hat, er kann zu dir zurück. Denn nichts ist unheilbar vor dir, unwiderruflich allein ist deine Liebe. Wir bitten dich, erinnere uns an deinen Namen, damit wir uns zu dir bekehren. Sei unser Vater. Immer von Neuem schenk uns das Leben, wie ein unverdientes Glück, von Tag zu Tag und für alle Zeiten.«
Wie von Zauberhand gelenkt hatten meine Finger genau diese Seite aufgeschlagen. Ich presste das Gebetbuch wie einen verlorenen Schatz an meine Brust und nahm auch die Bibel mit ins Wohnzimmer. Statt wie sonst den Fernseher einzuschalten und auf die erlösende Müdigkeit zu warten, las ich mit wachem Geist und warmem Herzen die Bibelstellen, die mich meine Kindheit hindurch begleitet hatten. Sie brachten etwas Verschüttetes in meiner Seele zum Klingen. Und auf einmal überkam mich eine Zuversicht und Freude, die ich seit frühen Kindheitstagen nicht mehr gekannt hatte. Die Sorgen und Ängste, die Trauer – sie waren wie weggeblasen. Alle Irrungen und Wirrungen glätteten sich wie ein wild rauschender Wasserfall, wenn er in einem tiefen stillen See aufgeht, dessen Wasser so klar ist, dass man bis auf den Grund sehen kann. Da war sie wieder diese undefinierbare Sehnsucht, die ich heute auf dem Balkon gespürt hatte. Die Sehnsucht nach Sinn. Je mehr ich las, desto stärker spürte ich es, dieses unverdiente tiefe Glück, wieder dazugehören zu dürfen. Kompromisslos. Ohne erst um Verzeihung bitten zu müssen.
Und plötzlich formten meine Lippen erst unbeholfen, dann immer flüssiger, das Vaterunser, das ich am Nachmittag noch verweigert hatte. In diesen Worten war ja alles drin!
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.
Auf einmal konnte ich es wieder auswendig. Es war nie verloren gegangen. Es war tief in meiner Seele verankert, und ich konnte es hervorholen, ohne dass es sich fremd anfühlte. Plötzlich fühlte ich mich leicht und frei. Ich spürte die Anwesenheit Gottes, seine helfende Hand, und hatte keine Angst mehr vor dem Alleinsein. Sie würden mich wieder in ihre Gemeinschaft aufnehmen.
Was sollte ich mich grämen und mir Sorgen machen, wenn Gott doch meinen Weg vorgezeichnet hatte! Ich konnte mich doch getrost hineinfallen lassen in seine Liebe. All die Worte aus den Predigten von damals kamen wieder in mir hoch, aber diesmal begriff ich ihren Sinn, denn ich war erwachsen geworden.
3
Thalheim, Juli 1981
Am darauffolgenden Sonntag saß ich tatsächlich neben Dorothea in der Kirche! Einerseits war ich euphorisch über diese plötzliche Wendung in meinem Leben, andererseits war ich doch verlegen. Natürlich spürte ich die Augen der Anwesenden, die prüfend auf mir ruhten. Viele Gemeindemitglieder kannte ich noch von damals. Im Gegensatz zu mir hatten sie ihr Fähnchen nicht nach dem sozialistischen Wind gedreht. Bestimmt mussten sie wegen ihrer christlichen Gesinnung so manches erleiden. Ein bisschen schämte ich mich meiner Vorteile, die ich durch unsere Linientreue errungen hatte. Sie hatten sicher alle keinen Trabi, kein Telefon und erst recht keine schicke neue Wohnung mit Dachterrasse. Vielleicht hatten sie auch schlechtere Jobs, vielleicht durften ihre Kinder nicht studieren. Ich hatte mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
Während wir sangen, spähte ich verstohlen über die licht gewordenen Reihen.
»Alles meinem Gott zu Ehren,
in der Arbeit in der Ruh.
Gottes Lob und Ehr zu mehren,
ich verlang und alles tu.
Gott allein nur will ich geben,
Leib und Seel, mein ganzes Leben!
Gib o Jesu Gnad dazu,
gib o Jesu Gnad dazu!«
Die Melodie war mir so altvertraut wie der Duft von Weihnachten. Beherzt sang ich mit, zuerst mit wackeliger Stimme, dann immer überzeugter.
Auch wenn der eine oder andere mich kurz skeptisch musterte: Niemand zeigte mir die kalte Schulter. Dorothea schien sie bereits alle eingeweiht zu haben: Da kommt eine verlorene Tochter zurück. Erweist euch als wahre Christen. Nehmt sie mit offenen Armen auf. Und das taten sie!
Bei der Wandlung knieten wir andächtig nieder. Es läutete die Glocke, die ich genau vor einer Woche zum ersten Mal wahrgenommen hatte. Der heilige Moment. Mich überzog eine Gänsehaut. Ich starrte auf meine gefalteten Hände, während die Gemeinde murmelte:
»Herr ich bin nicht würdig,
dass du eingehst unter mein Dach,
aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele gesund.«
Natürlich ging ich nicht mit zur Kommunion. Dazu bedurfte es doch einer längeren Zeit der Besinnung. Irgendwann würde ich vielleicht wieder zur Beichte gehen, und wenn ich mich wirklich würdig fühlen würde, auch zur Heiligen Kommunion. Aber so weit war ich noch lange nicht. Es war ein heiliges Sakrament, das man sich erst wieder verdienen musste.
Ich würde auch die Kinder wieder zu Gott und in den Schoß der Kirche zurückführen. Das würde ihnen Heimat geben und ihrer Seele Frieden.
Nach dem letzten Lied »Großer Gott wir loben dich!«, das mir die Tränen in die Augen trieb, schritt ich an Dorotheas Seite wieder ins Freie.
Der Pfarrer, ein untersetzter Herr mittleren Alters mit fast weißen Haaren, nahm beherzt meine Hand und schüttelte sie lange: »Schön, dass Sie da sind, Frau Kramer. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Herzlich willkommen in unserer Gemeinde!«
Mit diesen Worten begrüßten mich auch die anderen Gemeindemitglieder, die plaudernd draußen auf dem Kirchplatz in der Sonne standen.
»Carina! Schön, dass du da bist!«
Keiner sagte: Was willst du denn hier? Oder: Jetzt wo dein Mann tot ist, kommst du wieder angekrochen?! Nein, sie ließen mich ihre sprichwörtliche Nächstenliebe spüren. Als wenn der Julitag nicht schon strahlend genug gewesen wäre, zog sich mein Herz zusammen vor Glück. Es war die richtige Entscheidung gewesen!
Auf einmal war ich nicht mehr allein! Auf einmal tat sich eine ganze Gemeinde für mich auf! Auf einmal spürte ich, wie ich aufgefangen wurde, von einem unsichtbaren Netz der Freundschaft!
»Wer ist der Pfarrer?«, fragte ich Dorothea, die mich die paar Schritte nach Hause begleitete.
»Ein Spätaussiedler aus Schlesien«, gab sie zurück. »Günther Perniok. Netter Mann. Lebt hier mit seiner Haushälterin Eva Maria, ich glaube, das ist seine Schwester.«
»Und woher kannte der mich? Wieso war der so nett zu mir?«
»Jeder Christ ist in unserer Gemeinde willkommen.« Dorothea zwinkerte mir zu. »Ich bin so froh, dich verlorenes Schäfchen wieder in unserer Herde zu haben!«
»Mäh«, machte ich, und dann mussten wir beide lachen.
»Geh du da meinetwegen hin, wenn es dich glücklich macht, Mama. Aber mich kriegst du nicht in die Kirche.« Maximilian schraubte im Garagenhof an seinem Moped herum, als ich wie auf Wolken heimgeschwebt kam, immer noch das Lied auf den Lippen. Mit ölverschmiertem Gesicht spähte er unter seinem schmutzigen Hinterrad hervor: »Du siehst echt cool aus. Solltest dich öfter mal so in Schale werfen! Geiles Kostüm!«
»Aber Max! Gott schaut doch nicht auf die Schale, sondern auf den Kern!« Ich lachte geschmeichelt. Früher hätte es das nicht gegeben, dachte ich, dass am hochheiligen Sonntag Mopeds repariert werden. Aber das ist meine Schuld; ich habe den Kindern keinen Glauben vorgelebt.
»Mir egal, worauf Gott guckt. Ich muss jedenfalls den Bock hier flottkriegen!« Pfeifend kroch Max wieder unter das Rad. »Nachher fahr ich mit meinen Kumpels zum See!«
»Mach das, mein Großer. Aber bitte ohne Alkohol.« Beseelt entschwand ich nach oben in die Wohnung, wo Sabine auf den kleinen Tommi aufgepasst hatte. Einträchtig saßen sie auf der Dachterrasse und spielten »Mensch ärgere dich nicht«.
»Kinder, es war einfach nur wunderschön!« Ich zog meine weißen Handschuhe aus und legte sie sorgfältig auf die Garderobenbank. »Habt ihr nicht Lust, nächsten Sonntag in die Messe mitzukommen?«
»Max sagt, das ist voll langweilig«, krähte Tommi. »Da wird nur gesungen, gebetet und geredet, Kinder verstehen das nicht.«
»Nein, das stimmt überhaupt nicht!« Ich zog meinen kecken Dreikäsehoch zu mir und strich ihm über den Kopf. »Im Gegenteil! Erstens gibt es vor dem Hochamt eine Kindermesse, und zweitens dürft ihr danach im Gemeindehaus spielen! Die Schwester vom Pfarrer hat eine Gitarre und singt mit euch am Lagerfeuer. Wenn du brav bist, kannst du später sogar Messdiener werden!« Ich schilderte dessen Aufgaben in den schillerndsten Farben. »Du darfst zur Wandlung die Glocke läuten und zu besonderen Anlässen den Weihrauchtopf schwenken. Und du hast ein langes weiß-rotes Gewand an!«
Sofort war mein jüngster Sohn Feuer und Flamme. »Da will ich hin!«
»Und du, Sabine, kannst in der Jugendgruppe mitmachen und im Chor mitsingen.«
Und auch meine vierzehnjährige Sabine war noch offen für solche Dinge. Sie sehnte sich ebenfalls nach Gemeinschaft und Geborgenheit. Ich holte meine Kinderbibel hervor, und gemeinsam blätterten wir darin. Die vielen bunten Bilder waren mir so vertraut!
»Wisst ihr, es tut mir furchtbar leid, dass ich euch das jahrelang vorenthalten habe.« Begeistert erzählte ich meinen Kindern die Geschichten und Gleichnisse, an die ich mich noch erinnerte. Beide hingen an meinen Lippen. »Mami, das sollten wir öfter tun. Endlich hast du mal wieder Zeit für uns. Bitte sprich weiter!«
Und so gingen wir am nächsten Sonntag schon zu dritt in die Kirche.
Sabine und Tommi fanden schnell Anschluss bei den Gleichaltrigen. Sie lernten die Lieder und Gebete, spielten im Gemeindehaus und durften sogar die Kollekte einsammeln, was sie mit Freude und Stolz erfüllte.
»Ich möchte so gern Ministrant werden!«, bettelte Tommi.
»Dazu musst du erst mal getauft werden!«, gab ich zu bedenken. »Sabine, du bist ja noch getauft, aber unser Tommi ist ein kleines Heidenkind.« Liebevoll drückte ich meinen blonden Jungen an mich.
Pfarrer Günther Perniok war bereit, meinen jüngsten Spross zu taufen. »Ich kann ihn an Weihnachten in unsere Gemeinde aufnehmen, ganz feierlich, während der Christmette. Er wird unser lebendes Christkind.« Er lächelte gütig.
Mir wurde ganz warm ums Herz. »Das wäre wunderbar!«
»Und auch Sie und Sabine nehmen wir gern wieder im Schoß der Kirche auf, wenn es Ihnen wirklich ernst ist!«
»Das ist es, Herr Pfarrer.«
»Haben Sie Ihr Gewissen erforscht, und fühlt es sich für Sie richtig an?«
»Ja.« Ich nickte voller Überzeugung. »Es ist das Richtige. Es ist wie Heimkommen.«
»Wenn Sie jetzt wirklich wieder den christlichen Glauben leben wollen, sollten Sie aber auch in Ihrem häuslichen Umfeld ein Zeichen setzen.« Mahnend hob der Pfarrer die buschigen Brauen.
»Wie meinen Sie das?«
»In einem christlichen Haushalt sollte ein Kreuz hängen. Sie wollen Ihren Glauben doch nicht verheimlichen? Seien Sie aufrecht und stark wie damals die ersten Christen im alten Rom!«
»Oh.« Ich fasste mir an den Hals. Früher hatte ich sogar eines an einer kleinen goldenen Kette um den Hals getragen. Aber die war genauso verloren gegangen – so wie die anderen sichtbaren Zeichen meines Glaubens.
»Hätten Sie vielleicht eines für mich, Herr Pfarrer? Ich werde es gern in der Wohnung aufhängen. Es darf auch nur ein ganz kleines sein.«
Traurig schüttelte er den Kopf. »Hier in der Diaspora sind Kreuze schwer zu kriegen. Es gibt ja auch keine Devotionaliengeschäfte mehr. Aber im Dorf Lemmerzhagen, neben der ehemaligen Klosterkirche St. Eckhard, ungefähr zwanzig Kilometer südlich von hier … Kennen Sie die Gegend?«
»Ja, vom Wandertag mit der Schule. Da sind doch auch das Tiergehege und ein altes Gasthaus namens Deppe? Da haben wir als Schüler Räuber und Gendarm gespielt!«
Der Pfarrer schmunzelte. »Ja, da liegt auch ziemlich versteckt am Waldesrand ein Priesterseminar. Das kennt kaum jemand, und das ist auch besser so. Aber da würde ich es mal versuchen.« Er lachte schelmisch. »Fahren Sie mit Ihren Kindern hin und verbinden Sie das Nützliche mit dem Angenehmen!«
Ich fragte mich, was für ihn das Nützliche und was das Angenehme war, aber ich tat wie geheißen.
Auf mein Klingeln an der Klosterpforte öffnete eine Nonne in schwarzer Tracht. Ich fühlte mich wie in einer anderen Welt. Dass es so was hier überhaupt noch gab!
Die etwa fünfzigjährige Nonne sah mich fragend an.
»Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?«
Ehrfürchtig trat ich einen Schritt zurück. »Bitte entschuldigen Sie die Störung. Wissen Sie, ich suche überall ein Kreuz, doch in ganz Thalheim und Umgebung ist keines zu finden. Herr Pfarrer Perniok von der Gemeinde zum guten Hirten meinte, ich könnte es hier mal versuchen.« Ich schluckte. Verlegen knetete ich meine Hände. Wenn mich Manfred so sehen könnte, würde er bestimmt in höhnisches Gelächter ausbrechen. Doch ich straffte die Schultern. Dies hier war meine Entscheidung. Der Eintritt in ein neues Leben, mein selbstbestimmtes Leben.
Als hätte die Nonne meine Gedanken erraten, glitt ein Lächeln über ihr blasses Gesicht. Sie öffnete die schwere Tür vollends. Suchend schaute sie zum Parkplatz hinüber, auf dem nur einsam mein Trabi parkte. »Sind Sie allein?«
»Ja, die Kinder spielen im Tiergehege. Ich habe ihnen Geld für Ziegenfutter gegeben. Ich schätze, die sind eine Weile beschäftigt.«
»Kommen Sie herein.« Sie ließ mich eintreten.
Ich betrat einen Vorraum zur Klosterkirche, der mit Marmor verkleidet war. Es roch nach Weihrauch und altem Gemäuer. An der einen Wand stand eine hölzerne Wartebank, an der anderen befand sich eine Bank vor einem kleinen Altar, auf der man knien konnte. Die Nonne griff zu einem an der Wand befestigten Telefon und sprach mit klarer Stimme hinein: »Herr Pater, hier ist eine Dame, die sucht ein Kreuz.«
Sie bekreuzigte sich vor dem kleinen Altar, nickte mir zum Abschied stumm zu und verschwand hinter einer eisernen Pforte.
Ich entschied mich für die Wartebank.
Nach einer Weile öffnete sich die eiserne Pforte wieder, und er stand vor mir:
Ein großer schlanker Mann mit kurz geschnittenem dunkelblondem Haar in einer bodenlangen schwarzen Soutane mit weißem Stehkragen. Leuchtend braune Augen musterten mich interessiert und zugewandt. Als ich erschrocken aufsprang, stahl sich ein warmes Lächeln auf sein ebenmäßiges Gesicht, und zwei tiefe Grübchen kamen zum Vorschein. Meine Beine wurden weich wie Pudding, und ich musste mich gleich wieder setzen.
Was für ein wunderschöner Pater! Ein Heiliger, direkt aus dem Himmel. Und das mir!
Ich starrte ihn mit offenem Mund an, und mein Herz setzte einen Schlag aus. Augenblicklich setzte ein Fluchtreflex ein, doch diese überirdische Erscheinung stand mit dem Rücken zur Tür.
»Wie kann ich Ihnen helfen?« Seine Stimme war ein wohlklingender Bariton.
Ich schluckte trocken.
»Ich … suche ein Kreuz.« War ich das, die da so krächzte?
»Dann kommen Sie mal mit. In der Sakristei dürfte es noch welche geben.«
Beschwingt eilte er vor mir durch den altehrwürdigen Säulengang.
Unsere Schritte hallten auf dem Marmorboden wider. Von den Wänden schauten heilige Märtyrer herab, und die leidende Mutter Gottes hielt den toten Jesus auf dem Schoß.
Mein Herz klopfte zum Zerspringen. Wo war die Nonne hin? In ihrer Anwesenheit wäre mir wohler gewesen!
Der schöne Geistliche öffnete eine Tür, und schon standen wir in einem Raum voller Kirchengewänder, Kerzen, Kelchen und Monstranzen. An den Wänden hingen wieder Bilder von Heiligen, aber auch mehrere Kruzifixe. Es roch nach Weihrauch und Myrrhe.
»Ich bin Pater Raphael von Ahrenberg.« Der freundliche Mann in der schwarzen Soutane streckte mir die Hand hin.
»Carina Kramer.« Mir schoss die Röte ins Gesicht. Ich fühlte seinen festen Händedruck und wollte ihn gar nicht mehr loslassen. Meine Knie zitterten wie die einer Sechzehnjährigen in der ersten Tanzstunde. Warum schaute der mich so an? Ein unfassbar herzliches Lächeln kam aus unfassbar traurigen Augen.
Es traf mich bis ins Mark. War der hier etwa eingesperrt?
»Kommen Sie, setzen wir uns doch.« Der Pater zeigte auf eine Sitzecke mit zwei samtbezogenen Stühlen. »Erzählen Sie mir ein bisschen von sich. Warum suchen Sie ein Kreuz?«
Stockend und unendlich verlegen erzählte ich ihm von meinem Sinneswandel und meiner Rückkehr zum Christentum. Meine Augen füllten sich mit Tränen, als ich ihm von der langen Leidenszeit meines Mannes berichtete. »Erst jetzt begreife ich, wie viel Kraft und Trost mir die Kirche zurückgegeben hat. Ich habe mich zwischenzeitlich so verzweifelt und alleingelassen gefühlt. Und jetzt möchte ich einfach für mich und die Kinder ein Zeichen setzen. Auch andere sollen ruhig sehen, dass wir bekennende Christen sind.«
Die Augen des Paters ruhten voller Anteilnahme auf mir.
»Ich freue mich so sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.« Mit seinen langfingrigen, schmalen Händen holte er ein großes Kruzifix von der Wand, an dem ein goldener Christus hing. »Dieses hier könnte ich Ihnen geben.«
»Das ist … Ich finde … Bitte nehmen Sie das nicht persönlich …« Es tat mir weh, diesen netten Menschen so enttäuschen zu müssen. »Da soll eigentlich kein toter Christus drauf sein. Das ist ein bisschen viel auf einmal … auch für die Kinder.«
Ein amüsiertes Lächeln umspielte seine viel zu sinnlichen Lippen, und wieder bekam er Grübchen auf den Wangen. Er hängte das Kreuz zurück und bot mir Gelegenheit, sein edles Profil mit der randlosen Brille zu begutachten.
Ich knetete verlegen die Hände. »Wir waren jahrelang auf dem sozialistischen Trip und wollen erst mal klein anfangen. Also vielleicht lieber ein einfaches, schlichtes. Mein Jüngster ist ja erst sechs, und ich will nicht, dass er schlechte Träume hat.«
»Tja.« Suchend sah sich Pater Raphael um. »Alle Kruzifixe, die wir haben, sind MIT Corpus Christi. Und die anderen sind noch viel größer. Tut mir leid.«
»Wofür steht eigentlich dieses INRI?« Ich trat einen Schritt zurück.
»Das I ist eigentlich ein J. Jesus von Nazareth, König der Juden. Das R steht für Rex. König.«
Verwirrt betrachtete ich die Buchstaben. Das überraschte mich. Ich kannte ziemlich viele Schäferhunde namens Rex, und erst jetzt wurde mir klar, dass die alle König hießen.
Andächtig betrachtete ich die vorhandenen Kreuze in der Sakristei. An der Längswand hing so ein INRI in seiner ganzen Pracht, bei dem man jede einzelne Rippe sehen konnte. In seinen Händen und Füßen steckten riesige Nägel, aus denen Blut quoll. Er hatte den Kopf gesenkt, auf dem eine adventskranzgroße Dornenkrone saß. Jeder einzelne Blutstropfen sah so echt aus, dass ich mich abwenden musste. Nein!, dachte ich. Nicht schön. Das müssen die Kinder wirklich nicht jeden Tag sehen.
Der Pater sah mich mit einer solchen Herzenswärme an, dass es mir schwerfiel, mich zu verabschieden.
»Dann … will ich Sie auch nicht weiter stören. Die Kinder werden schon nach mir suchen! Sie füttern nämlich die Ziegen, aber irgendwann wird das ja auch langweilig.« Verlegen strich ich mir den Rock glatt. »Aber Danke für Ihre Zeit und … Gottes Segen.«
Was sagte ich denn da? Gottes Segen? Das war doch bestimmt sein Text!
Der Pater geleitete mich durch dunkle Gänge zurück ans Tageslicht. Ein Blick auf den einsamen Parkplatz sagte mir, dass mich die Kinder noch nicht vermissten. Nur der Trabi harrte meiner Wenigkeit.
»Ah, Sie haben ein Auto!« Der Pater war freudig erstaunt. Seine Stimme war auch hier draußen noch genauso wohltönend wie drinnen in der Kirchenakustik. Sie schien mich zu umarmen. Ich hatte so etwas noch nie erlebt – so eine warme Stimme, die mich mit aufrichtigem Interesse umfing. Und er schien Zeit zu haben! Alle Zeit der Welt. Für mich kleine unbedeutende Sachbearbeiterin, die ihm das Herz ausgeschüttet hatte.
»Ja, ähm … ich fahre damit in ein paar Wochen zur Kur«, entfuhr es mir. »In den Harz.«
»Das freut mich sehr für Sie. Bitte erholen Sie sich gut.« Einer plötzlichen Eingebung folgend, griff er in seine Jackentasche und überreichte mir ein winziges Kofferradio. Es war so klein, dass es in meine Handtasche passte. Ich sah ihn perplex an.
»Wenn ich Ihnen schon kein passendes Kreuz geben kann, möchte ich Ihnen wenigstens mein Radio leihen. Für die Kur.« Seine Gesichtszüge wurden ganz weich, und seine Augen ruhten fürsorglich auf mir. »Sie werden endlich mal Zeit für sich haben. Genießen Sie es.«
»Aber … Ich kann das unmöglich annehmen!« Das Radio fühlte sich in meinen Händen an wie glühende Kohlen. »Es ist Ihr persönliches Radio, Sie werden es doch sicher vermissen.«
»Es tut gut, Zeit in völliger Stille zu verbringen.« Der Pater trat einen Schritt zurück. »Sie können es mir ja nach der Kur zurückbringen.« Spitzbübisch lächelnd stand der schöne Pater in der Kirchentür. »Ich werde solange für Sie beten.«
»Dann … werde ich Ihnen eine Ansichtskarte schreiben.« Ich machte ein paar Schritte rückwärts und wäre fast über einen Stein gestolpert. »Aus der … hoppla … Kur. Und sage ganz herzlich Danke schön.«
Wie von der Tarantel gestochen, riss ich die Tür meines Trabis auf und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Erst als ich die Landstraße erreicht hatte, merkte ich, dass ich die Kinder vergessen hatte.
4
Bad Berneburg, Oktober 1981
»Carina! Kommst du mit? Wir gehen Kastanien und Bucheckern sammeln!«
Martina, meine Zimmergenossin bei der Kur in Bad Berneburg, steckte fröhlich den Kopf zur Tür herein. Wir verstanden uns blendend und hörten ständig Musik aus dem kleinen Kofferradio. Sie war wie ich alleinerziehende Mutter und kam aus Bad Merseburg. »Was machst denn du schon wieder? Schreibst du an deinen Pater?«
Neugierig näherte sie sich und spähte wie ein Kiebitz auf die wenigen Zeilen, die ich, auf der Fensterbank sitzend, auf die Rückseite einer bunten Ansichtskarte gekritzelt hatte.
Hastig schob ich die Karte unter meine Strickjacke. Ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht schoss. »Geht ihr ruhig. Ich komme gleich nach.«
»Kann ich dir irgendwie helfen … Ich meine, bei der Formulierung?« Martina grinste mich eine Spur zu neugierig an. »Nicht dass der arme Mann denkt, du willst was von ihm!« Gespielt theatralisch schlug sie ein Kreuz, faltete anschließend die Hände und verdrehte die Augen zum Himmel. »Vergiss nicht, er ist ein Gottesmann.« Doch mir kam dieser leise Spott völlig fehl am Platz vor!
Natürlich hatte ich ihr längst von meiner wunderbaren Begegnung mit ihm erzählt, nicht zuletzt wegen des Radios, das wir Tag und Nacht nutzten. Wie Teenager auf Klassenfahrt hatten wir schon halbe Nächte im Schlafanzug in unserem Zimmer vertanzt. Zurzeit waren wir völlig süchtig nach den Songs von ABBA.
»Thank you for the music« zum Beispiel. Und »I have a dream«.
Wieso ich bei diesen Texten an den Pater denken musste, war mir ein Rätsel.
»Martina, bitte!« Ich wies mit dem Kinn auf die Tür. »Viel Spaß beim Bucheckern Sammeln!«
»Grüß Euer Merkwürden schön von mir!« Die Tür fiel ins Schloss, und Martina entfernte sich fröhlich pfeifend. »Dancing Queen …«
»Den Teufel werde ich tun«, entfuhr es mir eine Spur schärfer als beabsichtigt. Kopfschüttelnd vertiefte ich mich wieder in mein Geschreibsel. War das auch nicht zu plump oder anbiedernd? Würde ich ihm damit nicht zu nahe treten? Würde er mich belächeln?
Meine Finger umklammerten die Ansichtskarte, und zum hundertsten Mal las ich prüfend die wenigen Worte, die ich bereits an ihn geschrieben hatte.
»Lieber Pater Raphael,
noch einmal möchte ich mich für das Kofferradio bedanken, das hier fast Tag und Nacht zum Einsatz kommt. Es hat mir so gutgetan, mit Ihnen zu reden. Vergessen Sie mich nicht. Ich möchte wieder und wieder mit Ihnen sprechen dürfen. Auch wenn mein eigentliches Anliegen nicht erfüllt werden konnte, hat mich doch die Begegnung mit Ihnen erfüllt und mein Herz erwärmt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und grüße Sie herzlich aus Bad Berneburg, wo ich viel zu oft an Sie denke.
Ihre Carina Kramer«
Nein, den letzten Satz kritzelte ich durch. »Wo ich viel zu oft an Sie denke!« Carina, geht’s noch? Und führe uns nicht in Versuchung! Aus dem Gekritzel malte ich kunstvoll einen Tannenzapfen. Bescheuert.
Nachdenklich schaute ich aus dem geöffneten Panoramafenster unseres Kurheimes auf die bunte Hügelkette des Harzes, wo die Bäume bereits in hellem Gelb und sattem Rot leuchteten. Der Altweibersommer trotzte dem Oktober noch herrlich warme Tage ab, und die schräg stehende Nachmittagssonne tauchte die Lärchen in flüssiges Gold. In mir breitete sich eine merkwürdige Freude aus.
Hatte ich einen Freund gefunden? Ganz für mich allein? Er mochte mich, das hatte ich an seinem Blick gesehen. Ich trank einen großen Schluck Kräutertee, um mich zu beruhigen. Dann noch einen. Wieder dieses seltsame Ziehen und Sehnen, aber mit einem ganz klaren Gesicht vor Augen. Waren diese Zeilen neutral genug? Auf keinen Fall wollte ich Pater Raphael zu nahe treten! Ich respektierte seinen geistlichen Stand. Andererseits war es mir ein tiefes Bedürfnis, ihm diese Worte zu schreiben. Aber einem Freund durfte man doch solche Ansichtskarten schreiben, oder? Mit gemalten Tannenzapfen drauf! Ich unterdrückte ein Kichern. Er würde sie hoffentlich nicht gegens Licht halten und lesen, was ursprünglich da gestanden hatte? Und wie er sich über mein Auto gefreut hatte! Fast so, als hätte er Lust, einmal mit mir darin einen Ausflug zu machen.
In diesem Moment wusste ich einfach, dass alles wieder gut werden würde. Alles war einfach nur himmlisch! Eigentlich war der ganze Tag besser als Weihnachten und Ostern zusammen.
Endlich raffte ich mich auf, steckte die kostbare Postkarte in einen Umschlag und warf sie unten in der Halle in den Briefkasten. Danach gesellte ich mich zu den anderen, die fleißig Bucheckern, Kastanien und Eicheln sammelten. Ich selbst pflückte herrliche Gräser, die ich später in ein Stück Holz steckte. Unter Anleitung einer Gestalttherapeutin bastelten wir viele kleine Kunstwerke. Obwohl ich den Tischschmuck eigentlich für meine Familie gemacht hatte, ertappte ich mich dabei, ihn innerlich Pater Raphael zu schenken. Er sah wirklich wunderschön aus und war als Dankeschön fürs Radio bestimmt. Gott, ich war doch nicht etwa verliebt?
»Carina! Post für dich!« Martina winkte beim Mittagessen im Speisesaal mit einem edlen Briefumschlag. »Wenn das mal nicht von Euer Merkwürden persönlich ist!« Sie hielt den Brief hoch über den Kopf, sodass alle schon die Hälse danach reckten.
Ich sah auf, und das Essen blieb mir im Halse stecken. Etwa von ihm? So schnell? Ich fühlte mich wirklich wie in einem Mädchenpensionat. Ich spürte, wie es mich innerlich fast zerriss vor Freude! Mein Herz raste wie ein D-Zug. Der schöne Pater musste wirklich postwendend geantwortet haben! Ich entriss meiner Zimmergenossin den Brief und verzog mich damit in unser Zimmer, das ich von innen abschloss. Dieser kostbare Moment gehörte mir ganz allein. Carina!, ermahnte ich mich selbst. Sei nicht albern. Er ist ein Pater.
Na und? Aber er ist ein Mensch! Und was für ein netter!
Mit zitternden Fingern riss ich den gefütterten Briefumschlag vorsichtig auf, dessen Absender das Priesterseminar war: »Philosophisch Theologische Ausbildungsstätte der katholischen Kirche Gera.
Orden der Brüder Jesu: BJ Brüder Jesu« war in kunstvoll ineinander verschlungenen Buchstaben auf der Rückseite eingeprägt.
Auf feinem Büttenpapier, dessen Briefkopf denselben Absender aufwies, stand mit grüner Tinte in gleichmäßiger Schrift:
Liebe Frau Kramer,
haben Sie recht herzlichen Dank für Ihre schöne Postkarte aus dem Harz. Gottes Güte geht manchmal eigenartige Wege, die gerade deshalb immer wieder überraschend zu tiefer Freude führen. Vertrauen Sie Ihre Sorgen deshalb immer wieder Gott an und lassen Sie sich durch Ihren Glauben von Sonntag zu Sonntag tragen. Es ermutigt und stärkt uns sehr, Gott zu ehren und Ihm den Vorzug zu geben. Und noch etwas erscheint mir wichtig. Lassen Sie sich nie die Überzeugung nehmen, schenkend zu sein, in allem was Sie tun und tun müssen. Denken Sie: Das tue ich für Dich, für die Kinder, für die Menschen, die ich vor Augen habe, für Christus. Mit diesem Geheimnis des Herzens hält man sich stets über Wasser. Man weiß um die innere Fähigkeit, liebend zu sein. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen großen Reichtum an Zuversicht und Freude.
Seien Sie herzlich gegrüßt,
Ihr Pater Raphael von Ahrenberg
Wieder und wieder las ich diese Zeilen, drückte den kostbaren Brief an meine Brust und starrte gedankenverloren in die herbstliche Pracht hinaus. Was für ein Geschenk war diese Freundschaft! Dieser wunderbare Pater schien mich zu verstehen – nach nur einem Gespräch, das wir in der Sakristei geführt hatten. Es erfüllte mich mit Stolz, dass er mich so ernst nahm, dass ich ihm solche Zeilen wert war. Unwillkürlich musste ich lächeln. Ich schien ihn ja auch irgendwie beeindruckt zu haben!
Vielleicht hatte ich ihm auch gutgetan? Bestimmt war der Pater genauso einsam wie ich in seinem dunklen, kalten Gemäuer. Er dürfte etwa vierzig sein. Seit wann er wohl in diesem Orden war? Meine Wangen glühten, und auf einmal spürte ich, wie mir die Tränen in die Augen traten. Der brauchte doch bestimmt auch einen Vertrauten genau wie ich! Es könnte doch eine rein platonische Freundschaft werden. Einfach nur edel und rein!
Die ganze Kur über schwebte ich vor Glück. Mit Martina und den anderen lachte ich viel, wir tanzten ausgelassen zu der Musik aus dem kleinen Radio und wanderten täglich stundenlang durch die Natur. Als ich nach drei Wochen wieder nach Hause kam, war ich bestimmt zehn Jahre jünger und zehn Kilo leichter geworden.
»Gut siehst du aus!«, begrüßte mich Dorothea am ersten Sonntag nach meiner Rückkehr. »Diese Kur hat wie ein Jungbrunnen auf dich gewirkt! Hast du dich etwa verliebt?«
Mein Gesicht brannte. Stand mir das so deutlich auf der Stirn geschrieben? Aufpassen, Carina!
»Quatsch. Wir waren nur Frauen.« Ich erzählte unverfänglich von unseren Wanderungen und nächtlichen Pyjama-Partys. Doch dann konnte ich mich einfach nicht mehr bremsen. »Sag mal, kennst du einen Pater von Ahrenberg?«, fragte ich sie so beiläufig wie möglich.
»Nicht persönlich.« Dorothea verstaute ihr Gebetbuch in der Handtasche und legte die Stirn in Falten. »Ich weiß, dass ein gewisser Pater Raphael von Ahrenberg im Priesterseminar St. Eckhard als Dozent tätig ist. Unser Pfarrer Perniok zitiert in seinen Predigten manchmal aus seinen Schriften. Er sagt, das ist sehr zeitgemäßes Christentum, was dieser Pater von Ahrenberg da lehrt. Wieso fragst du?«