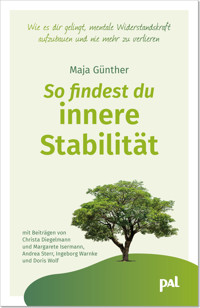14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur Balance eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Raus aus der Vergleichsfalle – hin zu einem selbstbestimmten Leben. Das Praxisbuch mit konkreten Hilfestellungen. Wir vergleichen uns ständig: Andere sehen besser aus, machen Dinge besser und geschickter als wir und haben einfach viel mehr vom Leben ... Die charismatische Psychologin (HP) Maja Günther kennt aus ihrer Beratungs-Praxis viele solcher Fälle, und durch die sozialen Medien werden es zunehmend mehr. Deshalb hat sie ein alltagsnahes Coaching zur Selbsthilfe entwickelt, das Menschen hilft, ihren Selbstwert wahrzunehmen und zu sich zu stehen: Schritt für Schritt aus der Unsicherheit des Vergleichens hin zur authentischen Selbstakzeptanz. Maja Günther erklärt die psychologischen Hintergründe, die dem ständigen Vergleichen zugrunde liegen und uns seit unserer Kindheit prägen. Sie sagt: "Vergleichen ist so, wie wenn wir durch ein Schlüsselloch schauen: Wir sehen nicht das ganze Bild, sondern nur einen kleinen Ausschnitt, der nichts über die Realität aussagt." In ihrem psychologischen Coaching-Ratgeber begleitet sie uns durch diesen wichtigen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung hin zu mehr Selbstwertgefühl. Alles beginnt mit Bewusstwerdung und führt letztlich dazu, sich aus der eigenen Komfortzone zu wagen und dadurch sich selbst und auch andere in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen. Ganz nach dem Motto: Sei du selbst – alle anderen gibt es schon!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Ähnliche
Maja Günther
mit Lisa Bitzer
Vergleiche dich nicht, sei du selbst
Eine Anleitung zur Selbstakzeptanz
Knaur e-books
Über dieses Buch
Raus aus der Vergleichsfalle – hin zu einem selbstbestimmten Leben. Das Praxisbuch mit konkreten Hilfestellungen.
Wir vergleichen uns ständig: Andere sehen besser aus, machen Dinge besser und geschickter als wir und haben einfach viel mehr vom Leben …
Die charismatische Psychologin (HP) Maja Günther kennt aus ihrer Beratungs-Praxis viele solcher Fälle, und durch die sozialen Medien werden es zunehmend mehr. Deshalb hat sie ein alltagsnahes Coaching zur Selbsthilfe entwickelt, das Menschen hilft, ihren Selbstwert wahrzunehmen und zu sich zu stehen: Schritt für Schritt aus der Unsicherheit des Vergleichens hin zur authentischen Selbstakzeptanz.
Maja Günther erklärt die psychologischen Hintergründe, die dem ständigen Vergleichen zugrunde liegen und uns seit unserer Kindheit prägen. Sie sagt: »Vergleichen ist so, wie wenn wir durch ein Schlüsselloch schauen: Wir sehen nicht das ganze Bild, sondern nur einen kleinen Ausschnitt, der nichts über die Realität aussagt.«
In ihrem psychologischen Coaching-Ratgeber begleitet sie uns durch diesen wichtigen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung hin zu mehr Selbstwertgefühl. Alles beginnt mit Bewusstwerdung und führt letztlich dazu, sich aus der eigenen Komfortzone zu wagen und dadurch sich selbst und auch andere in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen.
Ganz nach dem Motto: Sei du selbst – alle anderen gibt es schon!
Inhaltsübersicht
Für Carlo, meinen Mann, der immer an mich glaubt und mich in allem unterstützt, und für Anton, unseren wunderbaren Sohn. Danke, ihr seid toll!
Einleitung
Wir lieben Vergleiche, auch wenn sie hinken oder humpeln. – Dieser Satz geht auf den deutschen Satiriker und Journalisten Klaus Klages zurück. Er trifft den Nagel auf den Kopf: Menschen vergleichen sich, immerzu und überall.
Sie tun das aus den unterschiedlichsten Gründen, meist mehrfach am Tag und oft mit einem niederschmetternden Ergebnis für ihr Selbstwertgefühl. Denn zu viele Vergleiche können dafür sorgen, dass wir uns klein und minderwertig fühlen. Wir vergleichen uns in der Regel nicht mit schwächeren, hässlicheren, weniger erfolgreichen oder weniger gebildeten Menschen. Nein, wir nehmen uns diejenigen, die am meisten strahlen, die erfolgreich, schön, attraktiv sind und es bis ganz nach oben geschafft haben. In jedem Fall sehen wir uns einer Person gegenüber, die in unseren Augen höher steht als wir.
Das Problem dabei ist: Wer sich ständig mit anderen vergleicht, verletzt sich dauerhaft selbst und schadet seinem Selbstwert. Das führt in vielen Fällen zu einem unzufriedenen Leben und einer Weltanschauung, die zwischen »mir« und »den anderen« unterscheidet. Auch psychische Erkrankungen, das Gefühl, ausgegrenzt zu werden oder kein integrierter Teil einer Gesellschaft zu sein, können die Folge der nicht enden wollenden Vergleiche sein. Sie stören unser soziales Gleichgewicht und sorgen dafür, dass wir uns nicht nur von uns selbst, sondern vor allem von den anderen entfremden.
Ich möchte dich dazu einladen, dich für Situationen zu sensibilisieren, in denen du dich vergleichst und darunter leidest. Herauszufinden, wie häufig und intensiv du den Vergleich bereits in dein Leben gelassen hast und wie häufig er deine Handlungen, deine Gedanken, vor allem aber deine Gefühle beeinflusst, ist durchaus kompliziert. Deshalb halte ich es für wichtig, dass du erst einmal verstehst, wie der Vergleich auf psychischer und emotionaler Ebene funktioniert. Ich werde dir erklären, wo Vergleiche herkommen, wie sie wirken, was du aus ihnen lernst und wie du dir schließlich deiner Einzigartigkeit bewusst werden kannst. Mithilfe zahlreicher Übungen möchte ich dir zeigen, wie du aus der Vergleichsfalle herauskommst. Denn wenn du erst einmal erlebt hast, weshalb du einzigartig und deshalb unvergleichlich bist, wirst du ein zufriedenerer Mensch, der darüber hinaus auch die anderen in ihrer Anders- und Einzigartigkeit akzeptieren kann. Lern dich selbst kennen! Werde der beste Experte, den es für dich gibt.
Warum gerade ich? Ich bin Maja Günther und arbeite seit vielen Jahren als therapeutische Beraterin und Coach für große Unternehmen, aber auch für Privatpersonen und Paare. In meiner Praxis begegne ich immer wieder Klienten, die sich zu ihren Ungunsten mit anderen vergleichen. Die frustriert sind, traurig, wütend und mutlos, weil sie denken, dass sie weniger wert sind als andere Menschen.
Mein Ziel ist es, dir dabei zu helfen, dein vergleichendes Verhalten aufzuspüren, es dir bewusst zu machen und dich davon zu befreien. Mit einem gesunden Selbstwertgefühl und der Gewissheit, dass du – genau wie jeder andere Mensch – einzigartig und damit unvergleichlich bist, gelingt es dir nämlich viel leichter, das Vergleichen zukünftig sein zu lassen. Dich gibt es nur einmal, deswegen darfst du damit aufhören, dich mit anderen zu messen oder sie gar übertreffen zu wollen. Ich hoffe, dich auf dem Weg zu der Erkenntnis, dass du das Maß deiner Dinge bist, begleiten zu dürfen.
Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg!
1.Warum wir uns überhaupt vergleichen
Unsere moderne Welt wird bestimmt von Vergleichen. Auch in meiner Tätigkeit als Coach und Beraterin ist eines der Hauptthemen immer wieder der Vergleich mit anderen. Frauen vergleichen sich mit Männern, Männer mit Frauen, Töchter mit Müttern, Söhne mit Vätern, Kollegen mit Kollegen, Angestellte mit Vorgesetzten. In den meisten Fällen geht das Vergleichen für diejenigen, die es tun, nicht gut aus. Das heißt, dass sie sich schlechter fühlen, nachdem sie sich selbst, ihren Körper, ihre Leistung oder ihren Besitz in Relation zu einem anderen gesetzt haben. Sie tappen in die Vergleichsfalle, und die schnappt gnadenlos zu.
Wenn ich mir ansehe, wie frustrierend, ermüdend und deprimierend die meisten Vergleiche sind, frage ich mich zwangsläufig: Warum vergleichen wir uns überhaupt? Können wir es nicht einfach sein lassen und uns sagen: »Ich bin, wie ich bin, und du bist, wie du bist, und das ist auch gut so«? Es wäre schön, wenn wir alle fortan so denken könnten. Dann wäre das Buch, das du in den Händen hältst, nur zwölf Seiten lang, und die meisten Therapeuten könnten ihre Praxis dichtmachen.
Ist Vergleichen ausschließlich schlecht? Nein. Fakt ist: Sich mit anderen zu vergleichen, hat oft negative Auswirkungen, ist im Grunde jedoch ein recht nützlicher Mechanismus, den die Natur in unser Gehirn eingebaut hat.
Was hat sie, was ich nicht habe? – Theorie des sozialen Vergleichs
Der US-amerikanische Sozialpsychologe Leon Festinger gilt als Pionier auf dem Gebiet des sozialen Vergleichs. Er formulierte 1954 als Erster die These, dass Menschen durch den Vergleich mit anderen Informationen über das eigene Selbst gewinnen.[1] Festinger ging davon aus, dass dem Menschen als soziales Wesen das Bedürfnis innewohnt, seine Umgebung realistisch einzuschätzen – und damit Aussagen über die eigene Persönlichkeit zu treffen. Darüber hinaus beobachtete er, dass Menschen offenbar fortwährend motiviert sind, die individuellen Fähigkeiten und Lebensumstände zu verbessern. Über den sozialen Vergleich erlangen Menschen also die Möglichkeit, sich selbst im Verhältnis zu anderen einzuschätzen und die eigenen Bemühungen dementsprechend anzupassen. Die meisten von uns tendieren dazu, sich mit Personen ähnlichen Hintergrunds oder ähnlicher Fähigkeit zu vergleichen, vor allem dann, wenn objektive Maßstäbe fehlen.
Das klingt in der Theorie viel komplizierter, als es in Wahrheit ist. Denn dass wir schon im Kindesalter vergleichen, erkennen wir beispielsweise an den Schultüten, die zur Einschulung geschenkt werden. Natürlich freut sich jeder Abc-Schütze über die Tüte, die Mutter oder Vater am großen Tag überreichen – wirklich einschätzen, wie »wertvoll« der Inhalt der Tüte ist, kann das Schulkind jedoch erst, wenn auch die anderen ihre Gaben auf den Tisch legen. Im besten Fall stellt der Schulanfänger fest, dass seine Eltern es mit ihm gut gemeint haben – oder aber der Frust beginnt schon am ersten Schultag und noch bevor die erste Zensur vergeben wurde, weil die Geschenke in der Schultüte weniger teuer, vielzählig oder einfallsreich waren.
Einer der wichtigsten Gründe, warum wir uns vergleichen, lautet also: um uns selbst und das, was wir haben, fühlen oder vermögen, einschätzen zu können.
Das tun wir aus gutem Grund, denn eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Talente sichert das Überleben. Vielleicht nicht beim Beispiel mit der Schultüte, aber spätestens, wenn wir zum ersten Mal in ein Auto steigen und auf die Autobahn fahren, einen Skiabhang hinunterjagen oder auf das Zehnmeterbrett klettern, tun wir gut daran, ein grundsätzliches Gefühl für unsere Kenntnisse oder Befähigungen zu haben. Das Gehirn des Menschen ist so angelegt, dass es vorrangig zwei Ziele verfolgt: erstens das Überleben des Individuums sicherstellen, zweitens Energie sparen. Deswegen entstehen Ängste, deswegen entwickeln wir Routinen. »Schuld« daran ist das Organ in unserem Schädel, das alle Körperprozesse und maßgeblich auch unsere Gedanken steuert.
I feel good – Belohnungszentrum und Dopamin
Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum wir uns mit anderen vergleichen: Wir wollen uns gut fühlen. Hier kommen das Belohnungszentrum und der Treibstoff für gute Gefühle ins Spiel, das Dopamin. Würde es diesen Treibstoff nicht geben, der über das Belohnungszentrum in unserem Gehirn ausgeschüttet wird, wäre aus der Menschheit vermutlich nicht viel geworden. Wir hätten keine Stämme gebildet, kein Feuer gemacht und kein Rad erfunden, sondern würden wie ein Faultier den lieben langen Tag an einem Ast hängen und dösen – wenn wir es in der Evolution überhaupt so weit gebracht hätten.
Das Belohnungszentrum ist dafür verantwortlich, warum wir aufstehen, essen, Sport machen, Sex haben, Freunde treffen und so weiter, denn es schüttet besagtes Dopamin aus. Der Volksmund nennt Dopamin auch »Glückshormon«, was genau genommen nicht stimmt, denn es ist kein Hormon, sondern ein Neurotransmitter, der in einer komplizierten biochemischen Reaktion mit unseren Nervenzellen reagiert. Die genaue Beschreibung erspare ich dir an dieser Stelle.
Wichtig ist nur, dass du dir merkst: Immer dann, wenn sich etwas »gut« anfühlt, hat das Belohnungszentrum seine Arbeit verrichtet. Es macht uns glücklich, wenn wir ein leckeres Stück Kuchen gegessen, Zeit mit lieben Menschen verbracht oder einen Berggipfel bezwungen haben. Nur so ist zu erklären, warum wir uns überhaupt zu irgendetwas aufraffen. Die Aussicht, wieder in diesen zufriedenen Rausch der Gefühle zu kommen, treibt uns an – und kann uns gleichzeitig in die schlimmste Sucht oder das tiefste Unglück stürzen.
Dopamin wird im Grunde andauernd ausgeschüttet: nach dem Essen, beim Küssen oder Sport, während einer guten Unterhaltung, nach Erhalt einer freudigen Nachricht, aber auch, wenn wir unsere Lieblingsserie schauen oder ein Lied hören, mit dem wir schöne Erinnerungen verbinden.
Und: wenn wir uns mit jemand anderem verglichen haben und der Vergleich zu unseren Gunsten ausfiel.
Verantwortlich für die Menge an Dopamin, die ausgeschüttet wird, sind dabei die Belohnungswerte. Stell dir das wie bei »Let’s Dance« vor: Du erlebst eine Situation oder erhältst eine Information und gleichst diese augenblicklich und vollkommen unbewusst mit deinen bisherigen Erfahrungen beziehungsweise deiner aktuellen Gefühlslage ab. Das Ergebnis deines internen Vergleichs spiegelt sich in den Belohnungswerten wider, die wie die Punktzahlen der Jury vergeben werden. Bei hoher Punktzahl wird eine größere Menge Dopamin ausgeschüttet, bei niedriger Punktzahl eine kleinere – oder gar keine, was heißt: keine Belohnung. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass deine individuelle Bewertung dafür verantwortlich ist, ob das »Glückshormon« freigesetzt wird oder nicht – und wie viel.
Nimm zum Beispiel einen Apfel, den du von einer Marktfrau geschenkt bekommst. Zunächst einmal freust du dich, denn du hast mit keinem Geschenk gerechnet. Dein gutes Gefühl wird noch größer, als du siehst, dass niemand anderes von den Kunden vor dir einen Apfel bekommen hat. Dein Belohnungszentrum stellt dementsprechend Dopamin zur Verfügung, was du als kleinen Glücksrausch wahrnimmst. Nun kommt ein anderer Kunde an den Stand, und die Marktfrau schenkt ihm drei Äpfel. Dein eigener Apfel wirkt mit einem Mal recht kümmerlich – du bist vielleicht sogar enttäuscht; ein Gefühl, das ebenfalls von deinem Belohnungszentrum in Form von bestimmten Transmittern bereitgestellt wird.
Du verstehst, worauf ich hinauswill: Wie wir etwas bewerten, ob es gut oder schlecht, erfreulich oder unerfreulich ist, hat immer mit dem Referenzrahmen zu tun, innerhalb dessen wir das Ereignis abgleichen. Das ist ganz normal, das kann man auch nicht abstellen, denn für unseren Organismus ist diese Funktion überlebenswichtig.
Der Referenzrahmen, von dem ich gerade sprach, ist der Grund, warum manche Vergleiche mehr wehtun als andere. Der Vergleich mit einem Multimillionär zum Beispiel ist möglicherweise (es sei denn, du bist selbst einer) weniger frustrierend als mit der Kollegin, die in einer ähnlichen Position wie du arbeitet, aber 15 Prozent mehr Gehalt bekommt (sei es aufgrund ihrer längeren Beine oder wegen ihres besseren Verhandlungsgeschicks – das ist für den anschließenden Frust egal). Natürlich hat der Multimillionär im Vergleich zu dir noch viel mehr Geld als die Kollegin – doch euer beider Leben sind so unterschiedlich, dass du dir vermutlich nicht weiter darüber den Kopf zerbrechen wirst, warum er fünf Bentleys in der Garage stehen hat und du einen Golf.
Ein weiterer Grund, weshalb wir uns vergleichen, ist der intrinsische Wunsch des Menschen, sich zu verbessern. Auch hier kommen unsere Urahnen ins Spiel: Es war für unser Überleben zuträglich, wenn wir schneller, geschickter oder stärker waren als andere. Schneller rennen hieß, dem Säbelzahntiger zu entkommen. Cleverer kombinieren bedeutete, dem blöden Vieh beim nächsten Mal aus dem Weg zu gehen und sich das Wegrennen zu ersparen. Und fester draufhauen erklärt sich von selbst.
Das Vergleichen ist der Menschheit also in die Wiege gelegt, und zwar wortwörtlich. Denn auch wenn die Zeit, in der wir in Höhlen lebten und uns in Mammutfelle wickelten, aus unserer heutigen Perspektive eine Ewigkeit entfernt scheint: Verglichen mit dem Alter der Erde, ist unsere Gattung erst seit etwa einem Wimpernschlag auf dem Planeten. Kein Wunder, dass sich unsere Gehirne immer noch im Steinzeit-Programm befinden. Wir sind quasi erst vor fünf Minuten aus der Ursuppe gekrochen.
Höher, schneller, weiter – Vergleiche, um zu wachsen
Bis heute prägt die frühzeitliche Entwicklung des Gehirns unser Verhalten – deshalb kann uns der Vergleich mit anderen auch helfen, höhere Leistungen zu erzielen. Sportler sind in der Regel schneller oder stärker, wenn sie ein Rennen oder einen Wettkampf in Konkurrenz zu einem anderen Athleten absolvieren. 2014 haben Forscher der Universität von Saskatchewan in Kanada untersucht, welche Auswirkungen der direkte Leistungsvergleich auf die Trainingsintensität und -dauer hat. Sie teilten knapp siebzig Sportler in zwei Gruppen auf und stellten folgende Aufgabe: so lange wie möglich im Ganzkörperstütz auf Ellenbogen und Füßen ausharren. Der Versuch wurde zweimal hintereinander durchgeführt, zwischen den beiden Durchgängen lagen drei Minuten Pause.
In dieser Pause teilten die Forscher Gruppe A mit, dass 80 Prozent von Gruppe B länger durchgehalten hatten als Gruppe A. Der Vergleichsgruppe B wurde hingegen nichts gesagt. Und siehe da: Im zweiten Durchgang konnte Gruppe A ihre Leistung messbar steigern, und zwar um 5 Prozent. Ein bemerkenswertes Ergebnis – allein durch die neue Information konnten die Forscher die Gruppenteilnehmer A zu mehr Leistung motivieren. Gruppe B schnitt im zweiten Durchlauf hingegen deutlich schlechter ab. Ihre Leistung brach um fast 20 Prozent ein, da sie ja schon im ersten Durchgang bis an ihre Belastungsgrenze gegangen waren. Es kommt aber noch besser: Gruppe A zeigte sich, nachdem sie von den Ergebnissen des ersten Durchgangs in Gruppe B gehört hatten, deutlich vertrauensvoller, was ihre eigene Leistung angeht. Knapp 60 Prozent gaben vor dem zweiten Durchgang an, ihre Leistung noch einmal steigern zu können. Vor der Information, dass Gruppe B besser abgeschnitten hatte, waren es nur 45 Prozent.[2]
Unsere innere Einstellung ist also in der Lage, uns zu erstaunlichen Leistungen zu motivieren. Für unser Überleben zwischen Säbelzahntiger und Mammut war dies schon vor Hunderttausenden von Jahren zuträglich, und auch heute steuern uns dieselben Mechanismen. Wir joggen ausdauernder, wenn wir einen Trainingspartner haben, sind motivierter, wenn wir mit fähigen Kollegen zusammenarbeiten, und zeigen uns disziplinierter, wenn wir mit anderen gemeinsam Diät halten (nicht zuletzt ist dies einer der Gründe, warum beispielsweise die »Weight Watchers« seit Jahrzehnten so erfolgreich sind). Das alles tun wir, weil wir uns mit den anderen vergleichen und so über uns hinauswachsen. Der Vergleich kann uns also zu einer besseren Version unseres Selbst machen.
Auch Vorbilder haben die Funktion, uns aufzuzeigen, was potenziell möglich ist. In der griechischen Antike waren es die Heroen, seit dem 20. Jahrhundert sind es die Idole und Stars, die von uns bewundert werden. Oft, wenn auch nicht immer, verfügen diese »Besten ihrer Art« über eine bestimmte Eigenart oder Kraft, ein besonderes Talent oder Aussehen, dem wir nacheifern. Aber Vorbilder müssen nicht immer prominent sein, auch Verwandte, Bekannte oder Personen des eigenen Umfelds haben das Zeug, uns zu inspirieren. An ihnen legen wir unsere Messlatte an, sie ahmen wir nach, in unseren Leistungen, unserem Äußeren, unserem Denken oder unserem Handeln. Manchmal werden aus den Vergleichen, die wir in Zusammenhang mit Idolen und Vorbildern anstellen, sogar (abgekürzte) Slogans wie »W.W.J.D.« für »What would Jesus do?« (»Was würde Jesus tun?«): Das soll in vier Buchstaben beziehungsweise einfachen Wörtern an die Prinzipien gemahnen, nach denen die biblische Figur der Überlieferung nach in verschiedenen Situationen reagiert, gehandelt oder gedacht hat, und des Normalsterblichen Handeln positiv beeinflussen.
Vergleiche, egal ob mit echten oder fiktiven, lebenden oder verstorbenen, unbekannten oder prominenten Personen, helfen also, das eigene Selbst einzuschätzen und uns anzuspornen. Gibt es jemanden oder etwas, der oder das Orientierung verschafft, fällt es leichter, den Platz in der Welt zu finden. Damit können Vergleiche, vor allem in jungen Jahren, identitätsstiftend und der eigenen Persönlichkeitsentwicklung förderlich sein. Gerade Teenies neigen aus diesem Grund dazu, sich zu Fans einer Sache oder einer Person zu entwickeln – und sei es nur, um einen komplett anderen Weg als den ihrer Eltern oder Geschwister einzuschlagen.
Kinder, Kinder – Vergleiche im Nachahmungsprozess
Auch der Nachahmungsprozess, den wir als Babys und Kleinkinder durchlaufen, bedient sich des Vergleichs. Wir lernen das Vergleichen von Anfang an, ja, es ist sogar wichtig, weil es uns dazu ermutigt und befähigt, uns weiterzuentwickeln. Als Babys sind wir ja umgeben von Menschen, die alles können: laufen, reden, den Löffel halten, sich die Hose anziehen, Schuhe binden … Und wir können nichts. Oder zumindest nicht viel. Wenn du dich nur für einen kurzen Moment in das Leben eines Babys oder Kleinkindes hineinversetzt, wird dir klar, wie hilflos diese kleinen Wesen sind – und wie groß ihr Hunger darauf, all die Dinge zu können, welche die großen Leute mit Selbstverständlichkeit tun. Denn für ein Kind ist vollkommen klar: Wenn die Großen laufen können, kann ich das doch eigentlich auch.
Als Kinder schauen wir uns Verhaltensweisen ab und versuchen, dieses auf gleiche Weise wiederzugeben. Eine Mutter lacht ihr Baby an, und das Baby lacht zurück. Würde es seiner engsten Bezugsperson nicht nacheifern, würde es keine Mimik entwickeln und es später schwer haben, die Gesichtsausdrücke anderer zu deuten. Auch beim Erlernen von Gehen, Sprechen und Essen imitiert ein Kleinkind im Grunde die Menschen um sich herum. Es lernt, wie man den Löffel zum Mund führt und selbstständig isst, zieht sich an Möbeln hoch und macht die ersten wackligen Schritte oder versucht, die Laute nachzubilden, die das Umfeld andauernd von sich gibt. Es gibt zwar Unterschiede in der Entwicklung der Kinder (manche lernen erst laufen und dann sprechen, bei anderen ist es umgekehrt), grundsätzlich passiert der Lernvorgang bei allen Kindern jedoch zunächst durch Nachahmung. Die Eltern oder Bezugspersonen werden in diesem Moment zum Vorbild. Sie leben dem Kind jedes Verhalten und jede Handlung vor. Manchmal kopiert das Kind so gut die Bewegungen oder Handlungen seiner Eltern, dass es im Erwachsenenalter geht wie die Mutter oder redet wie der Vater. Häufig erkennt man familiäre Besonderheiten in der Mimik, die von den Kindern übernommen wurden. Kennst du das auch, dass du jemanden siehst, der sich wie eines seiner Elternteile bewegt, lacht oder spricht?
Wie du dir sicher denken kannst, birgt die Nachahmung Gefahren. Babys und Kinder suchen sich ihre Vorbilder nämlich nicht selbst aus – sie haben in keinem bewussten Vorgang beschlossen, dass das Verhalten der Eltern besonders nachahmenswert ist. In ihrer gesamten Existenz sind sie von ihrem Umfeld abhängig. Kinder übernehmen demnach gute wie schlechte Verhaltensweisen und stehen später im Leben vor der Herausforderung zu entscheiden, wer sie sein und wie sie leben wollen. Aus diesem Grund reflektieren sie das zunächst unreflektiert nachgeahmte Verhalten. Sie machen sich ihre eigenen Werte bewusst und vergleichen das gelernte Verhalten mit dem Verhalten anderer Menschen. Wie gehen andere Väter oder Mütter mit ihren Kindern um? Wie ist das in den Familien der Freunde, im Bekannten- oder Verwandtenkreis? Das Erwachsenwerden ist in großen Teilen so schmerzhaft und anstrengend, weil wir uns wieder von den Vorbildern, die uns bis zu diesem Zeitpunkt geprägt haben, abnabeln und anfangen, unser eigenes Leben zu leben. Je älter wir werden, desto besser lernen wir uns kennen und desto klarer wird unsere Idee davon, wie wir uns verhalten wollen. Das Tückische an diesem Prozess ist, dass er in der Regel unbewusst stattfindet. Erst viel später erkennen wir, dass uns so mancher Glaubenssatz, den wir jahrelang zu erfüllen versuchten, in die Irre führt.
Der Prozess der Loslösung kann unterschiedlich lange dauern und auch gestört werden. Deshalb fühlen sich viele Menschen bis in die Zwanziger, Dreißiger oder sogar Vierziger verunsichert und wissen nicht, was sie brauchen, um ihr Leben zur eigenen Zufriedenheit und nach ihren eigenen Werten und Normen zu gestalten. Eltern, die in ihrer Erziehung viel geschimpft oder ihre Kinder ständig kritisiert haben, die es nicht ertragen konnten, wenn mal was herunterfiel oder wenn das Kind sich dreckig machte, richten zuweilen schlimme Dinge in der Persönlichkeit ihrer Kinder an. Denn der unentwegte Tadel, die fehlende Toleranz und Ungeduld im Lernprozess können bei Kindern zu großen Verunsicherungen führen – oder sogar zur Unfähigkeit, den eigenen Weg zu finden.
Ein Beispiel: Ein Kind lernt, selbstständig zu essen. Es schaut den anderen zu, wie sie den Löffel zum Mund führen, vergleicht ihr Verhalten unbewusst mit seinem eigenen und will fortan nicht mehr gefüttert werden, sondern es selbst versuchen. Bei seinen ersten Übungen mit dem Löffel trifft das Kind natürlich nicht immer den Mund. Das Essen verteilt sich im Gesicht, auf dem Tisch, auf dem Boden und auf den Kleidern. Wenn mit diesem Kind immer geschimpft wird, dass es sich dreckig macht, und die Eltern bei jedem seiner Versuche mit einem gestressten oder ärgerlichen Gesicht wahrnimmt, wird es vermutlich daraus schließen, dass der Versuch, selbstständig zu essen, von den Eltern negativ gewertet wird. Das Kind kann nicht unterscheiden, ob die Eltern sauer sind, weil das Essen auf dem Boden liegt oder weil sich das Kind schlecht verhält. In diesem Moment bildet sich der erste, leider nicht förderliche Glaubenssatz im jungen Unterbewusstsein des Kindes: »Ich bin schlecht, so wie ich bin.« Oder: »Andere Kinder machen nicht so viel kaputt wie ich.« Kinder, die in einem strengen, wenig liebevollen Elternhaus aufgewachsen sind, brauchen oft Jahre, sich so weit selbst zu stabilisieren, dass sie sich ihres eigenen Wertes bewusst werden.
Dass Eltern von Zeit zu Zeit schimpfen, ist natürlich normal und muss auch manchmal sein. Solange sie ihrem Kind das Gefühl geben, grundsätzlich akzeptiert und geliebt zu werden, wird es keine hinderlichen Glaubenssätze oder sich zu einer unsicheren Person entwickeln. Dieses Grundgefühl der bedingungslosen Liebe kann in der Erziehung deshalb gar nicht genug Bedeutung haben.
Ich hatte mal einen etwa vierzigjährigen Mann in der Beratung, der mir schilderte, dass er sich immerzu schuldig fühlte, auch wenn er wisse, dass er nichts falsch gemacht habe. Er zuckte jedes Mal zusammen, wenn etwas herunterfiel und in die Brüche ging – beinah sofort kam ein Schuldgefühl in ihm auf. Auf die Frage, wie lange ihm das schon so gehe, erwiderte er, dass er sich nicht erinnern könne, jemals ohne Schuldgefühl existiert zu haben. Er schilderte mir, dass immer, wenn in seiner Kindheit zu Hause etwas kaputtgegangen war, sein Vater mit ihm geschimpft hatte. Das ging so weit, dass er anfing, sich zu verstecken oder es zu verheimlichen, wenn etwas passiert war. Keine gute Idee, denn so wurde er auch noch der Heimlichtuerei und Unaufrichtigkeit beschuldigt, wenn sein Vergehen zwangsläufig ans Licht kam. Der Mann berichtete, er habe es in diesen Momenten nicht einmal mehr geschafft, sich zu entschuldigen oder zu erklären, was passiert war.
Wenngleich es aus erwachsener Sicht nicht schlimm ist, wenn etwas zu Bruch geht, war die fatale Folge seiner Erfahrung, dass er sich das Verhalten als Mechanismus antrainierte und es ihn bis ins Erwachsenenalter hinein begleitete. Immer wenn er Fehler machte, verheimlichte er diese und fühlte sich gleichzeitig schuldig. Am Verheimlichen war er genau genommen auch »schuld«, aber für die Ursache konnte er nichts. Es dauerte eine Weile, bis er mit diesem Wissen über den Ursprung seines schlechten Gewissens anfangen konnte, über seine Fehler zu sprechen. Erstaunt stellte er fest, dass die erwartete Konsequenz, dass der andere wütend und abwertend reagieren würde, gar nicht eintraf.
Schreib auf, in welchen Situationen du dich vergleichst. Sind es eher berufliche oder private Situationen? Finden die Vergleiche in Bezug auf deinen Körper oder deinen Charakter statt? Vergleichst du dich eher mit Menschen, die du kennst, oder Menschen, die du aus den Medien kennst?
Hinweise auf Vergleiche sind oft die Momente, in denen du dich schlecht, blöd, ungebildet oder hässlich fühlst. Überleg dir also, womit du an dir unzufrieden bist, und liste die zugehörigen Situationen auf.
Er so, sie so – Verglichen werden
Wir lernen aber nicht nur, indem wir uns selbst mit anderen vergleichen, wir werden auch verglichen.