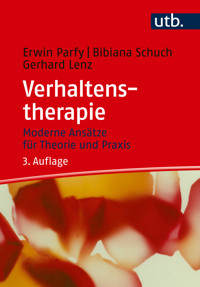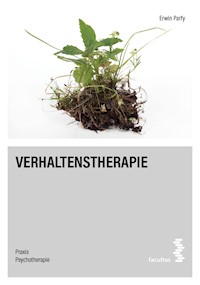
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Praxis Psychotherapie
- Sprache: Deutsch
Die Reihe „Praxis Psychotherapie“ beleuchtet die in Österreich anerkannten psychotherapeutischen Methoden und zeigt kompakt und verständlich fundiertes Basiswissen, neueste Entwicklungen und die Anwendung in der Praxis auf. Band 3 rückt die Verhaltenstherapie in den Fokus, welche in den letzten Jahrzehnten mit mehreren neuen Behandlungsansätzen aufhorchen ließ. Im Verständnis des Autors vermittelt das verhaltenstherapeutische Beziehungsangebot zwischen den individuellen Bedürfnissen der Hilfesuchenden und den möglichen Veränderungsperspektiven in einer höchst individuellen Weise. Der Therapieprozess wird hier als ein von Moment zu Moment stets aufs Neue gemeinsam zu erarbeitender Konsens gesehen, der psychische Flexibilität fördert und die Bereitschaft zu neuen Erfahrungen weckt. Nicht zuletzt ermöglicht die Reflexion persönlicher Werte eine Orientierung in Richtung einer von den emotionalen Verstrickungen der Vergangenheit befreiten und somit bewusster gestalteten eigenen Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Erwin ParfyVerhaltenstherapie
Mag. Dr. Erwin Parfystudierte in Wien Psychologie, absolvierte eine verhaltenstherapeutische Ausbildung und arbeitet als Psychotherapeut in freier Praxis. Als Lehrtherapeut ist er in der verhaltenstherapeutischen Fort- und Weiterbildung vielschichtig engagiert.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Angaben in diesem Buch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung des Autors oder des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage 2021
Copyright © 2021 Facultas Verlags- und Buchhandels AG
facultas Universitätsverlag, Stolberggasse 26, 1050 Wien, Österreich
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
Umschlagbild: © Robert Zahornicky, Bonsai-Wildnis 029, 2013, www.zahor.net
Lektorat: Mag. Katharina Schindl, Wien
Satz: Wandl Multimedia-Agentur, Groß Weikersdorf
Druck und Bindung: Druckerei Berger, Horn
Printed in Austria
ISBN 978-3-7089-2142-6
eISBN 978-3-99111-372-0
Vorwort
Zunächst möchte ich mich beim Facultas-Verlag für das Vertrauen bedanken, mich als Autor für die vorliegende Reihe „Praxis Psychotherapie“ angefragt zu haben. Wir haben schon mehrere gemeinsame Projekte hinter uns, bei denen ich den Leser*innen die Verhaltenstherapie nähergebracht habe, und gerne mache ich es mir wieder zur Aufgabe, dieses dynamische Feld meiner psychotherapeutischen Grundorientierung in eine sprachliche Ordnung zu bringen. Praxisnah soll es sein, für angehende Psychotherapeut*innen ebenso einen ersten Zugang ermöglichen wie für Hilfesuchende, die sich über die Verhaltenstherapie informieren wollen.
Da liegt freilich auch schon eine erste Hürde, denn von der Verhaltenstherapie zu sprechen, als ob sie unabhängig von den konkreten Personen der Therapeut*innen und der Hilfesuchenden und unabhängig von den sich in deren Zusammenarbeit bewährenden Theorien und Methoden existieren würde, verbleibt mir persönlich zu sehr im Abstrakten und lässt nur schwer begreifen, was sich in den Praxisräumen wirklich ereignet. Mir ist es daher ein Anliegen, den lebendigen Moment einer Begegnung von Mensch zu Mensch einzufangen, aus dem sich dann ein therapeutischer Prozess entwickelt und nährt – so erlebe ich zumindest selbst meine berufliche Tätigkeit. Die Bezugnahme auf die vielen Konzepte, Strategien und therapeutischen Techniken, die sich im Einflussbereich der Verhaltenstherapie unschwer auffinden lassen, würde ich gerne dem einzigartigen Verlauf von Passungen und Divergenzen in der therapeutischen Beziehung nachgeordnet sehen.
Die faktischen Ereignisse beim Beschreiten eines gemeinsamen therapeutischen Weges werden oft zur anregenden Quelle einer Kreativität, die ebenjene Konzepte, Strategien und Techniken in höchst individueller Weise an die augenblicklichen Anforderungen heranzuführen vermag. Und als im eigentlichen Wortsinn kreativ ist wohl auch die Art und Weise zu bezeichnen, in der die Hilfesuchenden dann darauf antworten, nämlich mit dem Entdecken neuer Möglichkeiten des Umgangs mit sich selbst und mit anderen. Persönliche Veränderung kann demgemäß als kreativer Akt verstanden werden, ähnlich wie ein Geburtsvorgang, bei dem sich neben dem Schmerz auch eine neue Lebendigkeit offenbart.
Mir ist durchaus bewusst, dass ich mich hier von einer eher unüblichen Seite an die Verhaltenstherapie annähere. Der in der Literatur meines Faches sonst häufig vorzufindenden sachlich-technischen Begrifflichkeit möchte ich mit einer weniger distanzierten und somit weniger limitierenden Sprache entgegengehen.
In meiner langjährigen Berufsausübung haben mich viele geschätzte Kolleg*innen eindrücklich daran teilhaben lassen, wie sie selbst eine sehr offene, von hohem Respekt für die situativen Erfordernisse getragene Umsetzung von verhaltenstherapeutischem Gedankengut realisiert haben. Diesen Aspekt zu betonen fühle ich mich verpflichtet, denn er kennzeichnet all das, was ich an der Verhaltenstherapie so schätze. Und er räumt auf mit dem leider noch immer herumgeisternden Zerrbild, dass hier vielleicht gar zu mechanistisch und direktiv gearbeitet werden könnte, was wohl der oft formalistisch anmutenden Darstellungsweise verhaltenstherapeutischer Konzepte geschuldet ist.
Ich hoffe also, dass ich mit allfälligen Vorurteilen aufräumen kann und dass das Empfinden geweckt wird, hier „gut landen“ zu können. Mit einer hohen Bereitschaft von Verhaltenstherapeut*innen, jede noch so unerwartete Schwierigkeit im Therapieverlauf mit gemeinsamer Anstrengung zu überwinden, ist jedenfalls zu rechnen.
Noch ein paar Worte zu dem nun folgenden Text: Ich wollte mit meinen Sätzen nahe an der Art meines sprachlichen Ausdruckes bleiben, weil mir dies für das Unterfangen, die verhaltenstherapeutische Praxis zu beschreiben, besonders naheliegend erscheint. Schließlich handelt es sich um eine Tätigkeit, die vorwiegend auf einem „Miteinander-Sprechen“ basiert. Die potenziellen Leser*innen standen mir beim Schreiben förmlich gegenüber, und so oder so ähnlich würde ich allen erzählen wollen, was ich über den von mir geschätzten Beruf als mitteilenswert erachte.
Freilich nimmt so eine Erzählung notwendigerweise immer die Form einer zeitlich linearen Abfolge von aneinandergereihten Abschnitten an, wiewohl sich im Kopfe der Therapeut*innen vieles parallel ereignet und fachliche Überlegungen als komplexes und gleichzeitiges Geschehen ablaufen, angeregt von den unmittelbaren Eindrücken aus dem persönlichen Kontakt mit den Hilfesuchenden. Doch ähnlich wie in der therapeutischen Sitzung ist auch im Schreiben eine Synthese daraus zu bilden, mündend in einen konkreten Satz, der versucht, den inneren Überlegungen wie auch den äußeren Anforderungen gerecht zu werden, so gut es gerade möglich ist.
Wer sich darüber hinaus selbst in der verhaltenstherapeutischen Fachliteratur umsehen und sich ein eigenes Bild von den im Hintergrund mitgedachten theoretischen Grundkonzepten machen will, findet im vorletzten Kapitel eine ausführliche Auswahl der aktuellen verhaltenstherapeutischen Ansätze, wo auch einführende Publikationen genannt werden.
Was die „gendergerechte“ Personenbezeichnung betrifft, so habe ich da eine eher geschlechtsneutrale Form vor Augen: Menschen sprechen in Therapien mit Menschen, wobei sich einerseits die berufliche Rolle von Psychotherapeut*innen als professionelle Helfer*innen ausmachen lässt und andererseits die Person der bzw. des Hilfesuchenden (eine von mir bevorzugte Bezeichnung, um dem Disput aus dem Weg zu gehen, ob es besser wäre von Klient*innen oder Patient*innen zu sprechen). Alle zusammen lassen sich in jeder nur erdenklichen Konstellation von geschlechtlichen Identitäten denken.
Beim Schreiben bin ich ohnedies immer häufiger zu einem „Wir“ gelangt, wo ich alle Leser*innen miteinbeziehen möchte in eine Sicht der Dinge, die meiner Meinung nach für uns alle gilt, da wir gemeinsam, als Menschen unter Menschen, in vielen psychischen Belangen sowieso „in ein und demselben Boot sitzen“.
Wien, im Mai 2021Erwin Parfy
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1Einführung
1.1Die Phase des Kennenlernens
1.2Die Diagnose und erste Weichenstellungen
1.3Das individuelle Fallkonzept
1.4Zwischen therapeutischer Planung und Spontanität
2Die Arbeit an der lebensgeschichtlichen Erfahrung
2.1Affektbrücken in die Vergangenheit
2.2Erkundung, Integration und Abgrenzung von Traumata
2.3Aufbau von Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz
2.4Wege zu einer gelungenen Kindheit
3Die Veränderung im Hier und Jetzt
3.1Wenn die Lösungsstrategie zum Problem wird
3.2Aufmerksamkeitsfixierung oder Flexibilität
3.3Die Entdeckung der Achtsamkeit
3.4Bereitschaft als entscheidender Moment für Veränderung
4Die Orientierung an der Lebensperspektive
4.1Vom Selbstmanagement zur Selbsteffizienzerfahrung
4.2Zu den Werten hinter den Zielen
4.3Aufbau von hilfreichen Fertigkeiten
4.4Gratwanderung zwischen Selbstoptimierung und Selbstbefreiung
5Was das verhaltenstherapeutische Beziehungsangebot zur Verfügung stellt
6Im Reigen der verhaltenstherapeutischen Ansätze
6.1Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie(Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT)
6.2Akzeptanz- und Commitment-Therapie(Acceptance and Commitment Therapy, ACT)
6.3Dialektisch-behaviorale Therapie(Dialectical Behavior Therapy, DBT)
6.4Kognitive Verhaltenstherapie(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)
6.5Metakognitive Therapie(Metacognitive Therapy, MCT)
6.6Mitgefühlsfokussierte Therapie(Compassion-Focused Therapy, CFT)
6.7Schematherapie(Schema Therapy, ST)
6.8Selbstmanagement-Therapie(Self-Management Therapy, SMT)
7Ausblick
Literaturverzeichnis
1Einführung
Wenn wir uns zuvorderst fragen, was in der verhaltenstherapeutischen Praxis von zentraler Bedeutung ist, dann sind für mich persönlich weniger die geschichtlich gewachsenen Behandlungskonzepte an erster Stelle zu nennen, sondern die therapeutische Grundhaltung einer konstant achtsamen Präsenz, die der praktischen Umsetzung ebenjener Konzepte vorauszusetzen ist. Diese therapeutische Grundhaltung besteht in der konzentrierten Anerkennung dessen, was unmittelbar vonseiten der Hilfesuchenden ausgedrückt wird, sowie in der präzisen Reaktion und unterstützenden Bezugnahme darauf. Und um hinreichend präzise reagieren und unterstützen zu können, ist wiederum das erwähnte weit gefächerte und in zahlreiche Behandlungskonzepte gegossene Erfahrungswissen nötig, welches im Hintergrund permanent mitwirkt und das konkrete verhaltenstherapeutische Handeln von Moment zu Moment beeinflusst.
Seit über hundert Jahren und in wiederholten Wellen der Erneuerung haben sich jene verhaltenstherapeutischen Behandlungskonzepte ausgebildet. Sie orientieren sich gerne an den Einsichten der Grundlagenforschung der verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen und haben sich in der Regel einer systematischen Auswertung ihrer Praxistauglichkeit gestellt. Um vorab eine erste Vorstellung von der Bandbreite dieser Ansätze zu vermitteln, vielleicht einige Beispiele dazu.
So kann entsprechend der jeweiligen Rahmenbedingungen die Umsetzung eines Behandlungskonzeptes mal mehr systematisiert oder mal mehr individualisiert erfolgen. In Krankenhäusern und Reha-Kliniken wird etwa gerne in Gruppen und mit themenspezifisch vorstrukturierten Schwerpunkten in eher kürzerem Zeitrahmen verhaltenstherapeutisch gearbeitet, in der Nachbetreuung und in der freien Praxis der niedergelassenen Psychotherapeut*innen hingegen vorwiegend im Einzelsetting, in einer freieren Annäherung an die vorgebrachten Schwierigkeiten und über deutlich längere Zeitspannen hinweg.
Neben diesen rein äußerlichen Unterschieden gibt es auch inhaltlich ganz verschiedene Kristallisationspunkte für Veränderungsprozesse. Mal scheint die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie einen besseren Zugang zu relevanten Gefühlen zu ermöglichen, mal verspricht die Einübung konkreter Fertigkeiten eine adäquatere Bewältigung emotional aufgeladener zwischenmenschlicher Situationen, mal wird der therapeutische Fokus auf die Neigung zu gedanklichen Schlussfolgerungen mit fataler Wirkung gelegt. Und das alles kann aufeinander folgen oder eng miteinander verwoben stattfinden, oder aber nichts von all dem wird als vordergründig hilfreich eingeschätzt. Dann beginnt eine gemeinsame Suche, bis einer der vielen anderen verhaltenstherapeutischen Ansatzpunkte für genau diesen Moment in genau dieser therapeutischen Konstellation passend erscheint.
Die Verhaltenstherapie zeigt sich also bei näherer Betrachtung rasch als äußerst vielgestaltig und als im Laufe ihrer Geschichte sehr dynamisch gewachsen, mit zahlreichen, teils nicht immer ganz aufeinander abgestimmten Parallelentwicklungen. Die vorzufindenden Ansätze weisen einerseits immer wiederkehrende Grundprinzipien auf und sind meist in einer auf die Behandlungszwecke konzentrierten sachlich-wissenschaftlichen Sprache beschrieben, andererseits ermöglichen sie eine Adaption mit hohen Freiheitsgraden und erlauben somit sehr individuelle Umsetzungen von ursprünglichen Behandlungsentwürfen.
Verhaltenstherapeut*innen in den unterschiedlichsten Ländern rund um den Erdball haben offensichtlich ihre persönlichen Praxiserfahrungen als Herausforderung gesehen und die von ihnen vorgefundenen Behandlungsvorstellungen aus- und umgebaut, ja oft auch gänzlich neue und unerwartete Sichtweisen eingebracht und empirisch erprobt. Der daraus resultierenden bunten Theorienlandschaft sieht man durchaus an, dass hier mit dem steten Nachschärfen der bisherigen Gepflogenheiten gerungen wurde (und wird), und man ahnt, dass es den Pionier*innen des Faches sehr ernst damit ist, dem Leben mit all seinen Fallstricken in immer neuen Annäherungen gerecht zu werden. Sie trachten offensichtlich danach, ihre Hilfestellung mit vorbehaltlos geklärtem Blick entsprechend ihren Einsichten weiter zu präzisieren.
Dieser Zugang verlangt freilich nach mutigen Therapeut*innen mit integrativen Fähigkeiten, welche die im Leben wie auch in Therapien unvermeidlich auftauchenden Ungewissheiten überbrücken können und dabei flexibel auf eine große Bandbreite von Sichtweisen und Strategien zurückgreifen. Und er verlangt nach Persönlichkeiten, die sich nicht zwanghaft an einem vermeintlich einzig richtigen Konzept anhalten wollen, sondern bereit sind, „maßgeschneiderte“ Antworten auf individuelle Anforderungen zu finden. Eine treffsichere Intuition und damit verbundene Entscheidungssicherheit bezüglich einer möglichst stimmigen Sichtweise der vorliegenden Problematik ist gefragt, gangbare therapeutische Wege lassen sich dann meist unmittelbar davon ableiten. Eine fundierte Vertrautheit mit den menschlichen Schwierigkeiten, gepaart mit Einfühlungsvermögen und Mitgefühl wird hier zum Schlüssel für eine gelingende Passung und die daraus resultierende Ermutigung zu einer neuen Lebensperspektive.
Wie nun einsteigen in eine detaillierte Darstellung dessen, was die Verhaltenstherapie ausmacht? Vielleicht bei der Schilderung des Anfanges einer jeden psychotherapeutischen Beziehung, also in der Situation des Erstgespräches und darüber hinaus.
1.1Die Phase des Kennenlernens
Wenn sich jemand auf die Suche nach psychotherapeutischer Hilfe macht, hat er meist schon viel durchlitten. Schmerzliche, verunsichernde Gefühle, zweifelnde, anklagende oder fordernde Gedanken, körperliche Beschwerden, Impulsdurchbrüche oder Verhaltensexzesse, Beziehungskrisen oder Zuspitzungen am Arbeitsplatz – eine leicht fortsetzbare Aufzählung menschlichen Erlebens, das mehr oder weniger qualvoll darauf drängt, persönliche Veränderung zu wünschen und sich dafür auch einzusetzen, was immer das dann auch konkret bedeuten könnte.
Hinweise und Empfehlungen von Freund*innen und Bekannten, es doch mal mit Psychotherapie zu probieren, können da folgen. Auch wertvolle Fingerzeige aus der Lektüre von Selbsthilfeliteratur sind vielleicht im Hinterkopf. Eine Suchmaschine im Internet ist rasch gefunden, erst bloß aus neugierigem Interesse, wer denn da so verfügbar wäre, und nach längerem Herumklicken lässt schließlich ein Bild eines*einer professionellen Helfers*in mit ansprechendem Begleittext innehalten.
Freilich ziemlich aufregend, sich auf so ein Angebot einzulassen. Aber wie heißt es so schön:„Nur wer wagt, gewinnt!“ Und es geht ja um nichts weniger als um das eigene Leben, das es wieder voll und ganz zurückzugewinnen gilt. Also vielleicht mal drüber schlafen, oder aber ganz dem Augenblick vertrauen und gleich anrufen, nein, besser ein Mail schicken, das ist fürs Erste neutraler. Wer weiß, ob überhaupt ein Therapieplatz frei ist, und auch das mit dem Geld und wie häufig solche Sitzungen stattfinden sollen, ist vorab zu klären. Und was ist dort eigentlich im Erstgespräch vorzubringen? Wie soll all das, was plagt, in Worte gefasst werden? Vielleicht gleich noch einige Notizen machen, damit nichts vergessen wird. Ungewiss bleibt freilich, ob das Gespräch gut in Fluss gerät und es sich gut anfühlt, endlich mal alles loswerden zu können. Hoffentlich Verständnis zu finden für die Not in der derzeitigen Situation, und ja, auch etwas möglichst Konkretes mitnehmen zu können, das den Umgang damit irgendwie erleichtert …
So oder so ähnlich werden sich die inneren Abläufe auf den Moment der ersten Begegnung hin bewegen. Therapeut*innen wissen, wie aufwühlend und letztlich folgenschwer jene Überlegungen und Entscheidungen sind, und haben dies auch vor Augen, wenn jemand erstmals im Therapieraum im Sessel gegenüber Platz nimmt. In einer solcherart begonnenen Verhaltenstherapie wird seitens der Therapeut*innen darauf geachtet, eine möglichst konfliktfreie, natürlich-ungezwungene und Sicherheit vermittelnde Atmosphäre zu schaffen. Das bedeutet, dass eine Gesprächsführung durch die Therapeut*innen zu erwarten ist, bei der behutsam und aktiv erkundet wird, welche persönlichen Motive nach Veränderung suchen lassen (Parfy, Schuch & Lenz, 2016).
Vielleicht tasten sich die ersten Fragen zunächst einmal an die neutraleren Rahmenbedingungen des Lebens heran (Alter, Herkunft, Familienstand, Beruf), um nicht sofort zu heiklen Themen vorzudringen, davon ausgehend, dass die damit verbundene Berührbarkeit möglicherweise noch ein wenig Zeit braucht. Emotionale Überforderung wird hier vermieden und die Entwicklung einer sich als tragfähig erweisenden therapeutischen Beziehung steht eingangs im Vordergrund. Mit zunehmender Vertrautheit in der ungewohnten Gesprächssituation, wo sich auch die Therapeut*innen schon in ihrer Art zu fragen oder Gedanken auszudrücken persönlich gezeigt haben und somit abschätzbarer erscheinen, nähert sich dann der geeignete Moment für die Schilderung der eigentlich belastenden Umstände des aktuellen Lebens.
Verhaltenstherapeut*innen möchten sich ein möglichst plastisches Bild von den individuellen Schwierigkeiten machen und werden von Beginn an Wert darauf legen, die Innenwelt des Gegenübers detailliert nachvollziehen zu können. Im Gespräch wechselt die Schilderung der vorgebrachten Kernprobleme mit darauf abgestimmten Fragen ab, die konkreter erfassen und verstehen wollen, was hier durchlebt wird. In welchen Situationen treten welche belastenden Phänomene auf? Was wird körperlich empfunden und welche Gefühle und Gedanken drängen sich auf? Wird etwas unternommen, um die Situation zu verändern, und, wenn ja, was genau geschieht dann und worin besteht der nachfolgende Effekt? Und seit wann und wie häufig treten diese Phänomene auf?
Viele solcher von natürlichem zwischenmenschlichem Interesse und emotionaler Anteilnahme getragene Fragen ermuntern zur Offenheit bezüglich den Themen, die jemanden in eine Therapie führen. Hier wird es im Erstgespräch meist recht „dicht“ an komplexer Information und emotionaler Berührtheit. Und es liegt auch in der Hand der Therapeut*innen, rasch herauszufiltern, welche Hauptstränge des Erzählten von unmittelbarerer Relevanz sind und wo es sich zwar auch um wichtige Hinweise, aber nicht um zentrale Anliegen handelt.
Es entsteht auf diesem Weg ein Bild von der gegenwärtigen Lebenssituation eines Menschen mitsamt seiner familiären Geschichte (Hand, 2008; Zarbock, 2008). Das Geflecht seiner derzeit wichtigen Beziehungen, seiner täglichen Anforderungen, seiner Probleme und Hoffnungen wird greifbar. Gegen Ende des Erstgespräches versuchen Verhaltenstherapeut*innen, zusammenzufassen und wiederzugeben, was sie vom Gegenüber erfahren haben. So kann auch eine Rückmeldung erfolgen, ob die Lebenssituation stimmig aufgefasst wurde und Übereinkunft in der Sichtweise von bestehenden Schwierigkeiten hergestellt werden konnte.
Ein diesbezüglicher Konsens erlaubt manchmal selbst in einer frühen Phase der Therapie eine erste Hypothesenbildung betreffend mögliche Ursachen und denkbare therapeutische Hilfestellungen auf der Suche nach Veränderung. Nicht selten entstehen bereits hier erste Ansatzpunkte und hoffnungsgebende neue Blickwinkel auf die nur allzu vertrauten Schwierigkeiten (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2012).
Freilich kann die Komplexität des ersten Eindruckes auch weitere erkundende Anstrengungen erfordern, um Genaueres über mögliche therapeutische Hilfestellungen sagen zu können. Dies freimütig einzuräumen und keine vorschnellen und daher unseriösen Schlüsse ziehen zu wollen, ist wohl selbstverständlich. Die Hilfesuchenden haben immer die Wahl, ihren Eindruck des Erstgespräches nachwirken zu lassen, und können sich zu Hause in aller Ruhe überlegen, ob sie weitere Stunden vereinbaren wollen. Das therapeutische Beziehungsangebot bleibt jedenfalls frei von jedem Drängen in diese Richtung.
Kommt es zu einer Fortführung der Therapie, treten Stunde für Stunde vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse die wiederkehrenden Muster im Leben der Betroffenen immer deutlicher hervor. Ergänzt um vielleicht bisher übersehene Aspekte, zunehmend detailliert und differenziert durch ausführlichere Schilderungen und diesbezügliche Nachfragen, entsteht so ein miteinander abgestimmtes Sprechen über die persönlichen Schwierigkeiten. Manche signifikanten Begriffe und therapeutischen Schlüsselgedanken werden an passenden Stellen im Gespräch wiederholt zu den vorgebrachten Umständen in Beziehung gesetzt und können so erprobt, korrigiert und nachjustiert werden (Vilatte, Vilatte & Hayes, 2016). Die unterschiedliche Gewichtung der verschiedenen Anliegen und Bedürfnisse ist expliziter Gegenstand wechselseitiger Klärung und bleibt über den ganzen Therapieprozess im Blickfeld der Therapeut*innen, die eine ausbalancierte Themenführung entlang von sich abzeichnenden „roten Fäden“ zu gewährleisten haben. Offenheit für die aktuellen Befindlichkeiten des Gegenübers einerseits und Verantwortungsübernahme für die Prozessgestaltung und die damit verbundene gezielte Anregung von psychischer Entwicklung andererseits machen die verhaltenstherapeutische Grundhaltung aus.
1.2Die Diagnose und erste Weichenstellungen