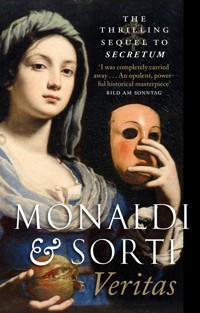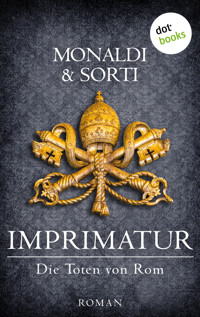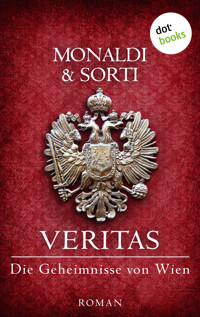
5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Abbé Melani ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein Rätsel im Dunkel der Geschichte: Der historische Kriminalroman »Veritas« von Monaldi & Sorti jetzt als eBook bei dotbooks. »Das Traumpaar des historischen Romans!« Brigitte –Anno domini 1711: Im geheimen Auftrag seines Herrn, des französischen Sonnenkönigs, ist Abbé Melani unterwegs nach Wien. In der Residenzstadt der Habsburger soll er einen Weg finden, um den seit über zehn Jahren andauernden Spanischen Erbfolgekrieges zu beenden. Doch der Abbé ist nicht der einzige Gesandte am Hof des Kaisers: In der Wiener Residenz trifft Melani auf einen düsteren Schwarm von Diplomaten, Geheimagenten und undurchsichtigen Gestalten aller Herren Länder – sie alle sind verstrickt in einen tödlichen Tanz aus Intrigen und Verrat. Als Melanis wenige Verbündete mysteriösen Mordanschlägen zum Opfer fallen, beginnt der Abbé selbst zu ermitteln – und stößt auf eine rätselhafte Spur, die ihn an allem zweifeln lässt, was er bisher zu wissen glaubte … »Monaldi & Sorti – das neue italienische Autorenduo von internationalem Rang!« FAZ »Monaldi & Sorti sind die Erben Umberto Ecos.« L’ Express Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Kriminalroman »Veritas«, das fesselnde Finale der Bestseller-Trilogie von Monaldi & Sorti – alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1346
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Das Traumpaar des historischen Romans!« Brigitte
Anno domini 1711: Im geheimen Auftrag seines Herrn, des französischen Sonnenkönigs, ist Abbé Melani unterwegs nach Wien. In der Residenzstadt der Habsburger soll er einen Weg finden, um den seit über zehn Jahren andauernden Spanischen Erbfolgekrieges zu beenden. Doch der Abbé ist nicht der einzige Gesandte am Hof des Kaisers: In der Wiener Residenz trifft Melani auf einen düsteren Schwarm von Diplomaten, Geheimagenten und undurchsichtigen Gestalten aller Herren Länder – sie alle sind verstrickt in einen tödlichen Tanz aus Intrigen und Verrat. Als Melanis wenige Verbündete mysteriösen Mordanschlägen zum Opfer fallen, beginnt der Abbé selbst zu ermitteln – und stößt auf eine rätselhafte Spur, die ihn an allem zweifeln lässt, was er bisher zu wissen glaubte …
»Monaldi & Sorti – das neue italienische Autorenduo von internationalem Rang!« FAZ
»Monaldi & Sorti sind die Erben Umberto Ecos.« L’ Express
Über die Autoren:
Das international erfolgreiche Autorenduo Rita Monaldi und Francesco Sorti machte mit seinem brillant recherchierten Romanzyklus IMPRIMATUR, SECRETUM und VERITAS weltweit auf sich aufmerksam. Als das Journalistenpaar außerdem im Zuge seiner Recherchen ein Geheimnis um Papst Innozenz XI. lüftete, machte der Vatikan seinen ganzen Einfluss geltend, weshalb die Werke jahrelang in Italien nicht vertrieben werden durften. In Folge des Skandals leben die Autoren heute in Wien.
Bei dotbooks erscheint die Trilogie über Abbé Melani, den Geheimagenten des Sonnenkönigs: »Imprimatur – Die Toten von Rom«, »Secretum – Die Schatten des Vatikans« und »Veritas – Die Geheimnisse von Wien«.
Weiterhin veröffentlichten sie bei dotbooks den historischen Roman »Die Entdeckung des Salaì«.
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe Juli 2020
Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Veritas« bei Rowohlt
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Dmitrijs Mihejevs / digieye
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (cg)
ISBN 978-3-96655-324-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Veritas« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Monaldi & Sorti
Veritas – Die Geheimnisse von Wien
Roman
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
dotbooks.
ANMERKUNG DER AUTOREN
Jede Bezugnahme auf Orte, Personen und Ereignisse ist – wie befremdlich sie auch erscheinen mögen – kein Produkt unserer Phantasie, sondern stammt aus zeitgenössischen Quellen. Immer wenn der geneigte Leser an der Wahrhaftigkeit des Gelesenen zweifelt, möge er die Anmerkungen und die Bibliographie am Ende des Buches zu Rate ziehen. Dort wird er alle urkundlichen Beweise finden. Es ist unser größtes Vergnügen, in Archiven jene Absonderlichkeiten der Geschichte auszugraben, die als unwahrscheinlich gelten würden, wären sie nicht wahr.
»Denn nicht kämpfen Troer nur und Achaierjetzt die furchtbare Schlacht,mit den Unsterblichen gar schlagen die Danaersich schon.«
»Vater Zeus schuf ein drittes Geschlechtsprechender Menschen, ein bronzenes,in nichts dem silbernen vergleichbar: ein grausames,fürchterliches Geschlecht aus Eschen. Diesen war anWerken des Mars gelegen, Trauer brachten sie undjede Art von Gewalt; auch Getreide pflanztensie nicht, sondern hatten ein diamantenes,hartes Herz, die Unzugänglichen.«
(Homer, Illias, und Hesiod, Werke und Tage, zitiert nach: G. A. Borgese, Rubé)
Eine Verabredung
Der große Saal erglänzt im bronzenen Schimmer der Einrichtung und Voluten, hell strahlen die Kerzen.
Abbé Melani lässt auf sich warten. Zum ersten Mal seit über dreißig Jahren.
Immer fand ich ihn am vereinbarten Treffpunkt vor, wo er seit geraumer Zeit auf mich wartete, nervös mit dem Fuß wippend und voller Ungeduld. Jetzt hingegen bin ich derjenige, der den Blick fortwährend auf das erhabene, monumentale Eingangsportal richtet, dessen Schwelle ich vor über einer halben Stunde durchschritten habe. Dem eiskalten, schneeigen Wind trotzend, der durch die offenen Torflügel dringt und sie zum Knirschen bringt, suche ich vergeblich nach Anzeichen für den bevorstehenden Einzug des Abbés: das Hufegeklapper des Vierspänners, die im Fackelschein auftauchenden, federbuschgeschmückten Köpfe der Pferde, welche die schwarze Galakutsche bis vor die große Freitreppe ziehen werden. Dort erwarten vier alte Lakaien, in winterliche, von Schnee bedeckte Paletots gehüllt, ihren noch älteren Herrn, um ihm den Kutschenschlag zu öffnen und ihm einmal noch beim Aussteigen behilflich zu sein.
Um die Wartezeit zu überbrücken, lasse ich meinen Blick schweifen. Rings um mich herum prangen die kostbarsten Dekorationen. Draperien, bestickt mit verschiedenen goldenen Inschriften, hängen von den Arkaden, Brokatdecken verkleiden die Wände, und Schleier mit silbernen Tropfen formen eine Ehrengalerie. Säulen, Bögen und Pfeiler aus künstlichem Marmor führen zu dem Baldachin in der Mitte des Saales, einer Art Pyramide ohne Spitze, die auf einem sechs oder sieben Stufen über dem Fußboden sich erhebenden Podest ruht und von einer dreifachen Reihe Kandelaber umgeben ist.
An ihrem oberen Ende warten zwei geflügelte Wesen aus Silber, jedes auf einem Bein kniend, mit weit ausgestreckten Armen, die Hände zum Himmel gerichtet.
Myrten- und Efeuranken zieren die vier Seiten des Baldachins, und auf jeder thront, aus frischen Blumen geformt, die wohl direkt aus Versailler Gewächshäusern stammen, das Wappen des venezianischen Adels mit dem Schweinchen auf grünem Grund. An den Ecken flackern mächtige Fackeln auf hohen, silbernen Dreifüßen, auch diese mit dem Wappen geschmückt.
Trotz der Prächtigkeit des Castrums und der pompösen Ausschmückung sind nur wenige Menschen im Raum: Abgesehen von den Musikanten (die bereits Platz genommen und ihre Instrumente ausgepackt haben) und den Pagen in schwarzen, roten und vergoldeten Livreen (die frisch barbiert und stocksteif wie Statuen die Fackeln halten) entdecke ich nur heruntergekommene, neidisch dreinschauende Adelige in Geldnot und eine Schar Arbeiter, Diener und Weiber aus dem Volk, die sich trotz der späten Abendstunde und des eisigen Frostes verzückt umsehen, während sie auf den Geleitzug warten.
Nun beginnen auch die Erinnerungen umherzuschweifen. Sie verlassen den bleigrauen Pariser Winter über der menschenleeren Place des Victoires, wo ein zorniger Nordwind um die Reiterstatue des alten Königs herumwirbelt. Dann kehren sie zurück, weit zurück, gleiten über die sanften Hänge der Ewigen Stadt und wandern bis auf den höchsten Punkt des Gianicolo, bis zu dem Tag zurück, als ich in der blendenden Hitze eines langvergangenen römischen Sommers, umgeben von Angehörigen eines anderen Adels und von weit anmutigeren Bauten aus Pappmaché, wo ein anderes Orchester für die musikalische Untermalung eines anderen Ereignisses probte und die Pagen sich anschickten, Fackeln zu tragen, die eine andere Geschichte erhellen würden, verstohlen die Ankunft einer Kutsche auf dem Eingangsweg der Villa Spada beobachtete.
Wunderliche Launen des Schicksals: Damals ahnte ich nicht, dass jene Kutsche mir den Abbé Melani, nachdem ich achtzehn Jahre nichts von ihm gehört hatte, zurückbringen würde; heute indessen weiß ich mit Gewissheit, dass Atto binnen Kürze hier eintreffen wird. Doch die Kutsche, die ihn zu mir führen soll, will noch nicht am Horizont auftauchen.
Der polternde Lärm eines Orchestermusikers, der von der Bühne gesprungen ist, hat meine Gedanken kurz unterbrochen. Ich hebe den Blick:
Obsequio erga Regem
ist mit goldenen Buchstaben auf das schwarzsamtige Drapeau mit silbernen Fransen gestickt, das die hohe, schlichte Säule aus ephemerem Porphyr schmückt. Es gibt eine weitere, mit dieser vollkommen identische Säule auf der anderen Seite, deren Inschrift jedoch zu weit entfernt ist, dass ich sie lesen könnte.
In meinem ganzen Leben habe ich nur ein einziges Mal an einem Ereignis dieser Art teilgenommen. Auch damals war es kalt, es war Nacht, und es schneite, oder nein, ich glaube, es regnete. Auf jeden Fall herrschten in meiner Seele Eiseskälte, Regen und Düsternis.
Damals lag ein anderer Körper im Sarg. Man hatte ihn vergiftet, ausbluten lassen, zerfleischt. Das Blut war ihm aus den Augen, das Hirn aus der Nase getropft. Nichts blieb von ihm als ein erbärmliches Bündel verfaultes Fleisch. Betrug, Verrat und Frevel hatten seinen Sarg gezimmert.
Ungerührt lachten die Mörder in der Dunkelheit.
***
Auch damals war ich Attos Begleiter. Wir befanden uns mitten in einem wimmelnden Ameisenhaufen: Von allen Seiten strömten die Menschenmassen herbei. So überfüllt war jeder Winkel des Raumes, dass Abbé Melani und ich in einer Viertelstunde eben zwei Schritte machen konnten; man kam weder vor noch zurück, man sah gerade mal die Verzierungen an der Decke und die Inschriften an den Arkaden oder an der Spitze der Kapitelle.
Ob Hispaniam assertam Ob Galliam triumphatam
Ob Italiam liberatam Ob Belgium restitutum
Vier dorische Säulen mit Motti gab es dort, das Sinnbild der Helden. Und sie waren sehr hoch, etwa fünfzig Fuß, den großen historischen Vorbildern in Rom, der Antoniussäule und der Trajanssäule, nachempfunden. Zwischen ihnen hing über dem Castrum ein künstlicher Nachthimmel aus Schleiern, welche, mit vergoldeten Flammen besetzt und in der Mitte eine Krone formend, durch goldene Kordeln und Schärpen gerafft und emporgezogen wurden. Vier gewaltige Schnallen in Gestalt majestätischer Adler, welche jedoch den Kopf auf die Brust senkten, hielten die Kordeln zusammen.
Neben ihnen hielt die Allegorie des Ruhmes mit strahlenbekränztem Haupt (sie war der Claritas auf den Münzen des Kaisers Konstantin nachgebildet) einen Lorbeerkranz in der Linken und eine Sternenkrone in der Rechten.
Hinter uns warteten dicht vor der breiten Eingangsschwelle vierundzwanzig Kammerdiener auf ihren Herren. Plötzlich erstarb das Gemurmel in der Menge. Alles verstummte, und ein heller Schein bezwang die nächtliche Stunde: Es war das Licht der weißen Fackeln, die von Edelknaben gehalten wurden.
Er war eingetroffen.
***
Das Hufeklappern der Pferde, das draußen auf dem Pflaster verklingt, reißt mich aus meinen Erinnerungen. Endlich setzen sich die vier Lakaien, deren schneebedeckte Paletots in der Winternacht leuchten, in Bewegung. Atto ist angekommen.
Die Flämmchen der Kerzen zittern und verschwimmen vor meinen Augen, weit öffnen sich derweil die Türflügel der Kirche, wo ich ihn erwarte: Notre Dame des Victoires, die Basilika der Barfüßigen Augustiner. Auf der schwarzen Kutsche schimmert der rote Samt der Bahre im Licht der Fackeln: Atto Melani, Abbé von Beaubec, Gentilhomme des Königs, gebürtiger Bürger der Serenissima und mehrmaliger Konklavist, ist im Begriff, feierlich Einzug zu halten.
Die alten Diener tragen den Sarg auf dem Rücken, in welchen Attos Wappen, das Schweinchen auf grünem Grund, geschnitzt ist. Unter der Ehrengalerie aus den schwarzen Schleiern mit silbernen Tropfen bahnen sie sich einen Weg zwischen den Anwesenden zu beiden Seiten, den wenigen, denen der olim berühmte Name Atto Melanis, des letzten Zeugen einer vom Krieg hinweggefegten Zeit, vielleicht noch 'etwas sagt. Die vier Lakaien schreiten bis zur Mitte des Castrum doloris, wo der Katafalk aufragt, steigen die Stufen der stumpfen Pyramide hinauf und übergeben den Leichnam ihres alten Herren den offenen Armen der beiden silbernen Engel, deren zum Himmel weisende Hände endlich empfangen, worauf sie gewartet.
Vom Katafalk hängt ein Trauertuch aus schwarzem Samt mit silbernen Fransen, bestickt mit goldenen Buchstaben:
Hic iacet Abbas Atto Melani Pistoriensis in Etruria, Pietate erga Deum Obsequio erga Regem Illustris Ω . Die 4. Ianuarii 1714. Ætatis suæ octuagesimo octavo Patruo Dilectissimo Dominicus Melani nepos mestissimus posuit
Die gleichen Worte werden in den Stein des Grabmals gemeißelt werden, das Attos Neffe bereits beim Florentiner Bildhauer Rastrelli in Auftrag gegeben hat. Die Augustinermönche haben eingewilligt, dass er in einer nahe beim Hochaltar gelegenen Seitenkapelle, direkt gegenüber der Tür zur Sakristei, aufgestellt werde. Hier also wird Atto, seinem Wunsche entsprechend, bestattet werden, in der Kirche, in der auch die sterblichen Überreste eines anderen toskanischen Musikers ruhen: des großen Giambattista Lulli.
»Pietate erga Deum / Obsequio erga Regem / Illustris«: Die Inschrift wiederholt sich auf den beiden seitlichen Säulen, von denen ich kurz zuvor nur die näher stehende lesen konnte. »Ruhmwürdig durch Ergebenheit vor Gott und durch Gehorsam gegenüber dem König«. In Wirklichkeit steht die erste Tugend im Gegensatz zur zweiten, niemand weiß das besser als ich.
Das Orchester beginnt, die Totenmesse zu spielen. Man hört die Stimme eines Kastraten:
Crucifixus et sepultus est
»Gekreuzigt und begraben«, singt er mit zarter Stimme. Ich kann nichts mehr wahrnehmen, um mich herum ist alles verschwommen, die Tränen lösen Gesichter, Farben und Lichter auf, wie bei einem Gemälde, das ins Wasser gefallen ist.
Atto Melani ist tot. Er starb hier in Paris, in der Rue Plastrière, die zur Pfarrgemeinde von Saint Eustache gehört, vorgestern, am 4. Januar 1714, um zwei Uhr in der Früh. Ich war bei ihm.
***
»Bleib bei mir«, hat er gesagt und ist verschieden.
Ja, ich werde bei Euch bleiben, Signor Atto: Wir haben ein Bündnis geschlossen, ich habe Euch ein Versprechen gegeben und werde Euch die Treue halten.
Es ist nun nicht mehr von Bedeutung, wie viele Male Ihr Euch nicht an unsere Vereinbarungen gehalten habt, wie viele Male Ihr den zwanzigjährigen Hausburschen und späteren Familienvater belogen habt. Dieses Mal werde ich keine Überraschung mehr erleben: Ihr habt Eure Pflicht mir gegenüber bereits erfüllt.
Jetzt, wo ich nahezu so viele Jahre zähle, wie Ihr einst, als wir uns kennenlernten, jetzt, wo Eure Erinnerungen die meinen sind, wo Eure alten Leidenschaften in meinem Herzen aufflammen, jetzt ist Euer Leben zu meinem geworden.
Dank einer Reise fand ich Euch vor drei Jahren wieder, und eine andere Reise, die des Todes, führt Euch nun an andere Gestade.
Gute Reise, Signor Atto. Ihr werdet bekommen, um was Ihr mich gebeten habt.
RomJanuar 1711
»Wien? Was um alles in der Welt haben wir in Wien zu suchen?« In Erwartung einer Antwort starrte meine Frau Cloridia mich mit weit aufgerissenen Augen an.
»Meine Liebe, du bist in Holland aufgewachsen, hast eine türkische Mutter gehabt, bist als nicht mal Zwanzigjährige ganz allein bis hier nach Rom gekommen, und jetzt hast du Angst vor einer kleinen Reise ins Kaiserreich? Was soll ich denn da sagen, wo ich doch nie weiter als bis nach Perugia gekommen bin?«
»Du sprichst ja nicht von einer kleinen Reise; du erzählst mir, dass wir nach Wien fahren, um dort zu leben! Kannst du vielleicht Deutsch?«
»Nun ja, nein ... noch nicht.«
»Gib das mal her«, sagte sie und riss mir gereizt das Papier aus der Hand.
Sie las es erneut, zum wer weiß wievielten Mal.
»Und was zum Teufel soll das sein, diese Schenkung? Ein Grundstück? Ein Ladengeschäft? Eine Anstellung als Diener bei Hofe? Das hier erklärt überhaupt nichts!«
»Du hast doch selbst gehört, was der Notar gesagt hat: Wir werden es bei unserer Ankunft erfahren, aber es handelt sich bestimmt um eine Schenkung von großem Wert.«
»O ja, gewiss. Wir klettern über die Alpen, nur um die nächste der unzähligen Betrügereien deines Abbés zu erleben, dieses Gauners, der dich für irgendeine neue wahnsinnige Unternehmung ausnutzen und am Ende wie einen alten Lappen wegwerfen wird!«
»Cloridia, denk bitte einmal nach: Atto ist jetzt fünfundachtzig Jahre alt. Zu welchen wahnsinnigen Unternehmungen hätte er deiner Meinung nach noch die Kraft? Lange Zeit habe ich sogar geglaubt, er sei tot. Es ist schon viel, dass er einen Notar beauftragen konnte, um seine Schulden bei mir zu begleichen. Sicher hat er gespürt, dass das Ende naht, und wollte mit sich ins Reine kommen. Wir sollten dem Herrgott lieber dankbar sein, dass er uns in einem so schwierigen Moment eine solche Gelegenheit gewährt hat.«
Meine Gattin schlug die Augen nieder.
***
Seit zwei Jahren machten wir schlimme Zeiten durch. Der Winter des Jahres 1709 war äußerst streng gewesen, er hatte im Übermaß Schnee und Eis gebracht. Eine entsetzliche Hungersnot war daraufhin ausgebrochen, und zusammen mit dem verlustreichen Krieg um den spanischen Thron, welcher sich nun schon seit sieben Jahren hinzog, hatte sie das römische Volk ins Elend gestürzt. Meine Familie, in der Zwischenzeit um ein nunmehr sechs Jahre altes Söhnchen gewachsen, hatte diesem unglücklichen Schicksal nicht entrinnen können: Ein Jahr mit Unwettern und starkem Frost, wie man es nie zuvor in Rom gesehen, hatte unser bescheidenes Landgut unfruchtbar werden lassen und mein Gewerbe als Bauer zunichtegemacht. Der Niedergang der Familie Spada und der daraus folgende Verfall der Villa an der Porta San Pancrazio, wo ich viele Jahre lang oftmals einträgliche Dienste versehen hatte, hatte unsere Lage über alle Maßen verschlechtert. Ach, und ungenügend waren die Bemühungen meiner Frau Cloridia, dem wirtschaftlichen Ruin vermöge ihrer Gevatterinnenkünste Einhalt zu gebieten, die sie seit Jahrzehnten mit achtbarem Erfolg und tatkräftiger Hilfe zweier Jungfräulein, unserer Töchter von dreiundzwanzig und neunzehn Jahren, ausübte. Durch die Hungersnot war nämlich auch die Anzahl der Wöchnerinnen ohne jeden Heller gestiegen, und diesen stand meine Gemahlin mit derselben aufopfernden Hingabe wie den Edeldamen bei.
So wuchsen unsere Schulden, und schließlich hatten wir, um des bloßen Überlebens willen, den schmerzhaftesten Schritt nicht vermeiden können: Da wir die Geldverleiher bezahlen mussten, hatten wir unser Häuschen und das Landgut verkauft, das wir vor sechsundzwanzig Jahren mit den Spargroschen meines seligen Schwiegervaters erworben hatten. Wir fanden Zuflucht in der Stadt, eine Wohnstatt in einem Kellergeschoss, das wir zwar mit einer Familie aus Istrien teilen mussten, doch hatte es wenigstens den Vorteil, nicht allzu feucht zu sein und im Winter eine konstante Temperatur zu bewahren, die sogar dem strengsten Frost trotzte, da die Räume in Tuffstein gehauen waren.
Wir aßen dunkles Brot und des Abends Suppe mit Brennnesseln und Kräutern. Und am Tag behalfen wir uns mit Eicheln und anderen Hülsenfrüchten, die wir überall auflasen und zu Mehl mahlten, um daraus eine Art Grütze zu kochen, der wir kleine Rübchen beigaben. Schuhe waren alsbald zum Luxus geworden und mussten auch im Winter Holzpantinen und Pantoffeln weichen, die wir daheim aus alten Lumpen und Schnüren aus Hanf zusammennähten.
Arbeit hatte ich keine mehr gefunden, zumindest nichts, was diesen Namen verdiente. Meine geringe Körpergröße verwehrte mir viele Gelegenheiten, zum Beispiel mich als Auslader oder Lastenträger zu verdingen. So war ich schließlich so tief gesunken, das niedrigste und schmutzigste aller Gewerbe auszuüben, zu dem kein Römer sich je herabgelassen hätte, jedoch auch das einzige, bei dem ich im Vergleich zu Familienvätern von größerer Statur im Vorteil war: Schornsteinfeger.
Damit bildete ich eine Ausnahme: Schornsteinfeger und Dachdecker kamen gewöhnlich aus den Alpentälern, vom Comer und vom Langensee, aus dem Camonica-Tal, dem Brembana-Tal und ebenso aus dem Piemont – überaus arme Gegenden, wo der Hunger die Familien sogar zwang, ihre sechs- und siebenjährigen Kinder zu bestimmten Jahreszeiten den Schornsteinfegern zu überlassen, welche sie unter Lebensgefahr die engsten Rauchabzüge reinigen ließen.
Mit kindlichen Körpermaßen, doch mit der Kraft eines Erwachsenen ausgestattet, konnte ich wie niemand sonst meine Arbeit nach allen Regeln der Kunst ausüben: Ich schraubte mich geschickter durch die engen Schächte und kletterte gewandter die rußigen Rauchabzüge empor, ebenso kratzte ich fachmännischer, als ein Kind dies vermocht hätte, die schwarzen Wände der Abzugshaube und des Rauchfangs frei. Zudem bewahrte mein geringes Körpergewicht die Ziegel vor Schäden, wenn ich auf das Dach kletterte, um den Schornstein zu säubern oder instand zu setzen, gleichzeitig aber drohte mir weniger Gefahr zu fallen und am Boden zu zerschellen, wie es den blutjungen Kaminkehrern leider nur allzu oft widerfuhr.
Zu guter Letzt war ich als ortsansässiger Schornsteinfeger das ganze Jahr über verfügbar, während meine Kollegen aus den Alpen erst Anfang November nach Rom herunterkamen.
Um die Wahrheit zu sagen, war auch ich genötigt, mein lebhaftes Söhnchen mitzunehmen, niemals aber hätte ich ihn einen Schornstein hinaufklettern lassen; ich begnügte mich damit, ihn als Lehrjungen und Gehilfen zu beschäftigen, da dies ein Gewerbe ist, wo man mindestens zu zweit sein muss.
Um die Kunden meiner Geschicklichkeit zu versichern, brüstete ich mich damit, eine lange Lehrzeit in den Bergen der Abruzzen absolviert zu haben (denn auch dort gab es, wie in den Alpen, eine große Tradition der Kaminkehrerkunst). Rechte Erfahrung besaß ich in Wahrheit jedoch nicht. Ich hatte die Anfangsgründe dieser Kunst einzig in der Villa Spada gelernt, bei jenen Gelegenheiten, wo man mich gerufen hatte, damit ich in Rauchabzüge hinaufstieg, um einen unvorhergesehenen Schaden zu beheben oder das Dach zu reparieren.
Und so lud ich Nacht für Nacht meine Werkzeuge auf den Karren – Schultereisen, Spatel, Kehrstangenhaspel, Leinsterne, Kugelschlag, ein Seil, eine Leiter und Zuggewichte – und machte mich auf den Weg, freilich nicht, ohne mir zuvor die traurige Umarmung meiner Gemahlin und des noch schlaftrunkenen Kleinen anzusehen. Cloridia hasste mein gefahrvolles Gewerbe, sie verbrachte schlaflose Nächte mit Bittgebeten, mir möge ja nichts zustoßen.
Fest in mein kurzes, schwarzes Mäntelchen gewickelt, war ich, wenn das erste Licht des Morgens graute, schon bis in die hintersten Stadtviertel oder umliegenden Dörfer gelangt. Hier bot ich mit dem Ruf »Schornsteinfeeeeger, Schornsteinfeeeeger!« meine Dienste an.
Nicht selten erhielt ich als Antwort böses Gebrummel und hässliche Gesten, die das Unheil abwenden sollten: Der Schornsteinfeger kommt im Winter, mit ihm bricht das schlechte Wetter an, also gilt er als Unglücksbringer. Öffnete man uns jedoch die Tür, bekam der Kleine, wenn wir Glück hatten, von einer mitleidigen Hausfrau eine Tasse heiße Brühe und Brot.
Das schwarze Wams, dessen Knöpfe links unter dem Arm saßen, damit sie sich nicht im Kamin verfingen, bis zum Hals zugeknöpft und auch die Ärmel am Handgelenk mit Bändern zugezogen, damit kein Ruß eindrang, die Kniehosen aus glattem, einfachem Barchent, der keinen Schmutz aufnahm, Flicken zur Verstärkung auf Knien, Ellenbogen und Gesäß, jenen Stellen, die sich am stärksten abnutzten, wenn ich durch die engen Schächte kletterte – das war mein Dienstkleid, welches mich, da es so eng saß und gänzlich schwarz war, fast so klein und mager wie mein Knäblein aussehen ließ, sodass viele mich für seinen um wenige Jahre älteren Bruder hielten.
Wenn ich mich durch den Rauchfang nach oben schlängelte, steckte ich den Kopf in einen am Hals dicht verschlossenen Leinensack, um mich wenigstens teilweise vor dem Einatmen des Rußes zu schützen. In solcher Vermummung gemahnte ich an einen zum Tod durch den Strang Verurteilten. Ich war vollkommen blind, doch im Schornstein musste man ohnehin nicht sehen können: Man arbeitete, indem man sich mit den Händen vorantastete und mit dem Schultereisen kratzte.
Der Kleine blieb unten, und jedes Mal zitterte er vor Angst, mit könne etwas zustoßen und ich würde ihn ganz allein lassen, weit weg von seiner lieben Mama und den Schwestern.
Allerdings blieb ich barfüßig, wenn ich durch den Kamin und aufs Dach stieg, um mich besser abstützen und hochstemmen zu können. Das Problem war nur, dass ich meine Füße auf diese Weise zu unförmigen, mit Blutergüssen und Wunden übersäten Gebilden machte und mich den ganzen Winter lang, also in der Zeit, wo es am meisten Arbeit gab, nur unsicher und humpelnd fortbewegen konnte.
Auf den Dächern zu arbeiten, konnte sehr gefährlich werden, und trotzdem war es eine Kleinigkeit für jemanden, der wie ich einmal die Kuppel von St. Peter bestiegen hatte.
***
Doch das leidvollste Kapitel unserer Armut war nicht einmal mein erbärmliches Gewerbe, sondern das Schicksal unserer beiden Mädchen. Meine Töchter waren leider immer noch unverheiratete Jungfern, und alles ließ befürchten, dass sie es noch lange bleiben würden. Der Herrgott, ihm sei gedankt, hatte sie mit einer eisernen Gesundheit ausgestattet: Trotz der Entbehrungen waren sie schön, rosig und frisch geblieben (»Einzig das Verdienst der dreijährigen Ernährung mit Muttermilch!«, erklärte Cloridia immer wieder stolz). So prächtig und glänzend war ihr Haarschopf, dass sie jeden Samstagmorgen auf dem Markt ein paar Heller für die Haare bekamen, die bei der morgendlichen Toilette im Kamm geblieben waren. Ihre Gesundheit war wahrhaftig ein Wunder, denn um uns herum hatten Frost und Hungersnot eine große Anzahl Opfer gefordert.
Meine beiden Jungfräulein hatten, liebenswürdig, gesund, schön und tugendhaft, wie sie waren, nur einen einzigen Makel: Sie verfügten über keinen Heller Mitgift. Mehrmals schon waren die Nonnen des Klosters von Santa Caterina Sopra Minerva zu um gekommen, das die Familien armer Mädchen, welche die Gelübde ablegen sollten, jedes Jahr mit ansehnlichen Summen bedachte. Sie wollten mich überreden, meine Töchter gegen ein Häufchen Geld dem Kloster zu überlassen. Die robuste körperliche Verfassung und gute Gesundheit der beiden Mägdlein weckte Begehrlichkeiten bei den Schwestern, brauchten sie doch kräftige Mitschwestern von niedriger Herkunft für jene Arbeiten im Kloster, die den Ordensfrauen aus adeligen, Familien nicht zuzumuten waren. Doch auch in den bittersten Momenten hatte ich ihr Anerbieten stets höflich zurückgewiesen (weniger freundlich war Cloridia, die die Klosterfrauen unter wütendem Schütteln ihrer Brüste anschrie: »Habe ich sie etwa drei Jahre lang gestillt, damit sie so enden?«), und im Übrigen zeigten auch meine Mädchen selbst nicht die geringste Neigung, den Schleier zu nehmen.
Stattdessen lechzten die beiden, die dank ihrer Erfahrung als Hilfshebammen bereits tiefe Einblicke in die Freuden der Mutterschaft gewonnen hatten, danach, so bald wie möglich einen Ehemann zu finden.
Irgendwann hatte die Kälte geendet und die Hungersnot mit ihr. Doch das Elend wollte nicht weichen. Zwei Jahre später warteten meine Töchterchen noch immer.
Mich packte die Wut, wenn ich sah, wie das feine Gesicht der Älteren, ohne dass sie sprach, plötzlich einen abwesenden und traurigen Ausdruck annahm (sie zählte schon fünfundzwanzig Jahre!). Aber mein Zorn war nicht gegen ein blindes und grausames Schicksal gerichtet. Ich wusste ja nur allzu gut, wer die Schuld an unserem Unglück trug: Es war weder die Kälte noch die Hungersnot, die ganz Europa getroffen hatten. O nein. Es war Abbé Melani.
Käyserliche Haupt- und Residenz-Stadt WiennFebruar 1711
Gewaltig wirbelten die Trommeln über die verschneite, kahle Fläche des großen Platzes vor den Stadtmauern. Ihr mächtiger Donner verband sich mit den silberhellen, verschlungenen Melodien der Paradetrompeten, der Militärpfeifen und der Blaskapellenhörner. Der martialische Lärm wurde noch gesteigert durch das Echo, das von den zyklopischen Mauern zwischen Tenaillen, Kronwerk, Außenwerk und Erdwällen widerhallte, sodass nicht eine, sondern drei oder vier, vielleicht gar zehn Gruppen von Musikanten am Werke schienen.
Während ein Regiment des Heeres vor den Mauern der Stadt exerzierte, ragten aus dem Inneren der Bollwerke achtunggebietend die Spitzen von Kirchen und großen Häusern hervor, Kirchtürme, von Kreuzen überragt, zinnengekrönte Wachttürme, friedliche Kuppeln und weitläufige Terrassen, heilige und profane Gipfel, die den Reisenden ermahnten: Es ist keine gestaltlose Anhäufung von Menschen und Dingen, wohin du gelangst, sondern eine gefällige Wiege guter Seelen, eine starke Festung, eine von Gott gesegnete Schutzburg für Handel und Gewerbe.
Unsere Kutsche war schon kurz vor dem Kärntnertor, durch welches die von Süden kommenden Reisenden nach Wien hineinfahren, da erblickte ich jene stolzen und noblen Erhebungen, die sich eine nach der anderen vor dem bleigrauen Himmel abzeichneten.
Die höchste von allen, erklärte uns der Kutscher, sei die schlank aufragende, erhabene Fiale auf dem Turm des Stephansdoms, kühn durchbrochen von kostbaren Verzierungen, die jetzt zudem der weiß schimmernde Mantel des Schnees verschönte. Dann ganz in der Nähe der mächtige, achteckige Turm der Dominikanerkirche. Dann der edle Glockenturm der Peterskirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit und jener der Michaelerkirche der Barnabitenpatres, der Turm von St. Hieronymus der Franziskaner-Zönobiten, die Fiale des Klosters der Chorfrauen an der Himmelpforte und viele andere, alle überragt von Zwiebelhelmen, wie sie für diese Gegend bezeichnend sind, die oben in vergoldeten Kugeln auslaufen und vom Heiligen Kreuz gekrönt werden.
Schließlich erblickte ich das Sinnbild der allerhöchsten kaiserlichen Macht, den Wehrturm der Kaiserlichen Residenz, in welcher Joseph I. aus dem Hause der österreichischen Habsburger, glanzvoller Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, seit sechs Jahren mit glücklicher Hand regierte.
Während die Musik des Regiments uns zur Disziplin aufrief, die grandiosen, befestigten Stadtmauern zur Bescheidenheit und die zahllosen Kirchtürme der Stadt zur Gottesfurcht mahnten, begann ich, mir im Geiste die vielfachen Windungen der Donau vorzustellen, welche, wie ich aus den vor der Abreise studierten Büchern wusste, auf der anderen Seite Wiens floss. Vornehmlich aber rief ich mir stillschweigend den Namen jener üppigen, dunklen Masse ins Gedächtnis, die sich nun zwischen zwei Wolken am Horizont abzuzeichnen begann. Lieblich war sie anzusehen, mit ihren sanft gerundeten Hügeln, und gleichwohl mächtig, wie sie sich steil abfallend über die Wasser des Flusses beugte und still nach Osten blickte, ein stummer, heroischer Wächter der Stadt. Es war der Kahlenberg, ruhmreiche Anhöhe, Retterin des Abendlandes; jenes dicht bewaldete Vorgebirge, von dem aus die christlichen Heere die Stadt vor achtundzwanzig Jahren von der türkischen Belagerung befreit und ganz Europa vor der Bedrohung durch Mohammed gerettet hatten.
Es war kein Zufall, dass ich jene Ereignisse so gut im Gedächtnis bewahrt hatte. Damals, vor vielen Jahren, im September 1683, als die Menschen in Rom und überall in Europa zitternd auf den Ausgang der Schlacht um Wien warteten, befand ich mich als junger Hausbursche in einer Locanda, wo ich Mittags- und Abendmahlzeiten servierte. Dort hatte ich unter den zahlreichen Gästen der Herberge einen gewissen Abbé Melani kennengelernt ...
Während sich die Räder der Kutsche ächzend aus einem der vielen Gräben zogen, schärfte ich meine Augen und sah, wie ein Sonnenstrahl das kleine Gebäude auf dem Gipfel des Kahlenbergs traf, eine Kirche vielleicht, ja, eine Kapelle, just jene, wo im Morgengrauen des 12. September 1683 ein Kapuzinerpater (so sagte mir meine Erinnerung, die jetzt schon Geschichte geworden war) vor dem entscheidenden Angriff die Messe gelesen und eine Ansprache an die christlichen Heerführer gehalten hatte, um sie zum blutigen, aber gesegneten Sieg über die Ungläubigen zu führen. Jetzt würde auch ich jenes glänzende Andenken an die Vergangenheit betreten, ich selbst würde die nahe gelegenen, sanften Hügel von Nußdorf hinaufsteigen, wo die Infanteristen der christlichen Armeen den widerwärtigen Abschaum Mohammeds von Haus zu Haus, von Heuschober zu Heuschober, von Weinberg zu Weinberg immer weiter zurückgedrängt hatten.
Ergriffen wandte ich mich zu Cloridia um. Meine Gemahlin, unseren schlafenden Knaben im Schoß, sprach kein Wort. Aber ich wusste, dass auch sie an meinen Gedanken teilhatte. Und es waren keine fröhlichen Gedanken.
Wir hatten eine beschwerliche, fast einmonatige Reise hinter uns. Ende Januar waren wir in Rom aufgebrochen, nicht ohne uns zuvor bänglich vor dem verehrungswürdigen Leichnam des Heiligen Filippo Neri verbeugt zu haben, des Schutzpatrons unserer Stadt. Abbé Melani hatte Sorge getragen, dass wir stets Platz im Fond der Kutsche erhielten und nicht neben den Schlägen sitzen mussten, wo man weniger komfortabel reist. Nachdem wir die Pferde in Civita Castellana gewechselt und in Otricoli übernachtet hatten, waren wir durch das umbrische Narni, dann durch Terni gekommen und schließlich, um Mitternacht, ins alte Foligno gelangt. Von da an hatte ich, der ich nie weiter als bis nach Perugia gekommen war, Tag für Tag in einem anderen Ort übernachtet: von Tolentino, Loreto und Sinigaglia, welches in einer lieblichen Ebene vor dem Adriatischen Meere liegt, fuhren wir bis nach Rimini und Cesena in der Romagna, dann nach Bologna und Ferrara und weiter hinauf bis nach Chioggia am Delta des Flusses Po, nach Mestre vor den Toren Venedigs und Sacile und Udine, der Hauptstadt der Republik Venedig. Ich hatte die Nächte von Gorizia und Adelsberg gesehen, um glücklich bis nach Laibach zu gelangen, wo der Schnee, der uns von unserer Abfahrt bis zur Ankunft unentwegt begleitet hatte, immer noch fiel. Auch hatte ich in Cilla, in Marburg an der Drau, in Graz, der Hauptstadt der Steiermark, in Pruch und schließlich in Stuppach geschlafen. Andere Städte, die wir passierten, waren Fano, Pesaro und Cattolica, ein kleines Örtchen in der Romagna, und von dort Forli und Faenza. Wir hatten den Po überquert, waren durch Corsola und Cavanella an der Etsch gereist, hatten auf der Fahrt über den Brenta das reizende Mira gesehen und waren nach Fusina gelangt, wo man in die Gewässer der großen Lagune von Venedig einfährt. Und schließlich hatten wir den Fluss Lintz befahren, auf einem jener kleinen Boote, die dortselbst zu Recht »hölzerne Häuser« genannt werden, da sie alle Bequemlichkeiten eines Wohnhauses besitzen. Zwölf Männer saßen am Ruder, und sie trieben das Boot schnell voran, sodass das Panorama vor unseren Augen innerhalb weniger Stunden von Felsen in Wälder, von Weinbergen in Kornfelder, von großen Städten in Schlossruinen überging.
Kälte und Schnee schienen nicht nachlassen zu wollen. Jetzt standen wir endlich vor den Toren Wiens, ängstlich angesichts dessen, was uns erwartete. Die Stadt, die uns in ihren Schoß aufnehmen würde und von der wir so oft geträumt hatten, galt zu Recht als das »Zweite Rom«: Sie war die Hauptstadt des unermesslichen Heiligen Römischen Reiches. Unter ihre Herrschaft fielen zuvörderst Ober- und Niederösterreich, Kärnten, Tirol, die Steiermark, der Vorarlberg und das Burgenland, die Erbländer der Habsburger, wie das sogenannte Erz-Herzogtum Österreich ob und unter der Enns, über das sie schon lange Zeit, bevor sie zu Kaisern gekrönt wurden, als Erzherzöge regierten. Doch das Heilige Römische Reich umfasste auch unzählige andere Länder und Regionen mit Küsten oder Gebirgen. Dazu gehörten zum Beispiel die Kraina, Istrien, Dalmatien, das Banat, die Bukowina, Croatien, Bosnien, die Herzegowina, Slavonien, Hungarn, Böheim und Mähren, Galizien und Lodomerien, Schlesien und Siebenbürgen. Außerdem besaß es noch einige Hoheitsrechte über die Deutschen Kurfürstentümer einschließlich Sachsens und daher auch Polens. Und seit dem Mittelalter hatten dem Reich auch die Schweiz, Schwaben, das Elsass, Burgund, Flandern, Artois, Franche-Comté, Spanien, die Niederlande, Sardinien, die Lombardei, die Toskana, das Großherzogtum Spoleto, Venedig und Neapel angehört – oder würden ihm in naher Zukunft angehören.
Millionen und Abermillionen Untertanen zählte die Alma Urbe Caesarea, sowie Dutzende und Aberdutzende unterschiedlicher Kulturen und Sprachen. Deutsche, Italiener, Magyaren, Slawen, Polen, Ruthenier, schwäbische Handwerker und böhmische Köchinnen, Adjutanten und Kammerdiener aus dem Balkan, arme Flüchtlinge, die den Türken entkommen waren, vor allem aber Heerscharen von Bedientenpack aus Mähren, das wie wimmelnde Bienenschwärme in Wien einfiel.
Für all diese Völker war die Stadt vor unseren Augen ihre Hauptstadt. Würden wir hier finden, was Atto Melani uns versprochen hatte?
Dank seines Darlehens hatten wir unsere mageren Ersparnisse den beiden Mädchen anvertrauen können, die wir lieber in Rom, unter der strengen Aufsicht unserer freundlichen istrianischen Nachbarn, gelassen hatten, damit sie dort weiterhin ihrem Gewerbe als Gevatterinnen nachgehen konnten. Unter Tränen und mit dem Versprechen, so bald wie möglich mit der langersehnten Mitgift zurückzukehren, auf dass sie endlich heiraten konnten, hatten wir tiefbetrübt von ihnen Abschied genommen.
Freilich hätten wir, wenn uns in Wien das Glück nicht hold war, keinen Heller gehabt und die Stadt weder verlassen noch dort überleben können. Wir hätten nur Almosen erbetteln und im eisigen Winter auf unseren Tod warten können. So viel vermag die grausame Armut: Erst treibt sie die Sterblichen dazu, in höchster Eile durch die halbe Welt zu reisen, dann zwingt sie sie in der hoffnungslosen Umklammerung ihrer Fänge zur Unbeweglichkeit. Kurzum, wir hatten wahrlich einen Sprung ins Dunkle getan.
Cloridia hatte der Reise schließlich zugestimmt: »Alles, wenn ich dich nur nie wieder mit diesem rußbefleckten Gesicht sehen muss«, hatte sie gesagt. Allein die Vorstellung, dass ich jenes Gewerbe endlich aufgeben würde, welches sie so oft in Angst und Sorge versetzte, hatte sie bewogen, das Angebot Abbé Melanis anzunehmen.
Unwillkürlich betrachtete ich meine Hände: Auch nach Tagen ohne Arbeit waren sie noch schwarz zwischen den Fingern, in den Poren und unter den Fingernägeln – das Erkennungsmerkmal der armseligen Schornsteinfeger.
Cloridia und das Kind husteten stark, wie schon seit Tagen. Auch ich wurde von den Anzeichen einer geschwürigen Lungensucht gequält. Die Fieberanfälle, die auf der Hälfte der Reisestrecke begonnen hatten, hatten uns nach und nach sehr geschwächt.
Die Kutsche fuhr über eine kleine Brücke, die einen der Verteidigungsgräben überspannte, und rollte endlich durch das Kärntnertor. In der Ferne sah ich die Tannenwälder des Kahlenbergs grün aufleuchten. Das Tagesgestirn zog seine goldenen Fingerkuppen von dem Hügel zurück und legte sie mitleidig auf meine arme Person: Unerwartet traf mich ein heiterer Sonnenstrahl mitten ins Gesicht. Ich lächelte Cloridia zu. Die Luft war kalt, klar und rein. Wir waren in Wien angekommen.
***
Unwillkürlich fasste ich an die Tasche meiner schweren, funkelnagelneuen Pelerine, eines Erwerbs aus der Spende des Abbés, in der ich alle für die Reise erforderlichen Aufzeichnungen bewahrte. Aus den Papieren, die der römische Notar uns überreicht hatte, ging hervor, dass wir Unterkunft bei einer bestimmten Adresse finden würden, wo wir uns nach unserer Ankunft einfinden sollten. Der Name der Straße verhieß Gutes: Himmelpfortgasse.
Umgeben von der unwirklichen Stille, die der Schnee mit sich bringt, fuhr die Kutsche jetzt langsam durch die Kärntnerstraße, welche vom Stadttor gleichen Namens in die Stadtmitte führt. Cloridia blickte sich mit vor Erstaunen geöffnetem Mund um: Zwischen den prächtigen, in ein aristokratisches, weißes Mantelkleid gehüllten Wohnhäusern und den Kutschen, die aus den Seitenstraßen hervorkamen, schlenderten Scharen warm eingehüllter Dienstmädchen unbekümmert durch die Straßen, als wäre dies ein Sonntag und nicht ein Tag mitten in der Arbeitswoche.
Gerne hätte sie den Kutscher um eine Erklärung gebeten, doch sie verzichtete, der sprachlichen Schwierigkeiten halber.
Ich hingegen hatte nur Augen für den Turm des Stephansdoms, den ich aus den Dächern zur Rechten, je näher wir kamen, umso mächtiger aufragen sah. Dies war, so überlegte ich, die heilige Spitze, welche die Osmanen im Sommer 1683 Tag für Tag mit ihren Kanonen unter Beschuss genommen hatten, während die Belagerten diesseits der Mauern der Stadt, die sich mittlerweile im Handel zu hoher Blüte entwickelt hatte, tapfer Widerstand leisteten, obgleich sie nicht nur mit den feindlichen Geschossen, sondern auch mit Hunger, Krankheit und Mangel an Munition zu kämpfen hatten.
Der Kutscher, dem ich das Papier mit der für uns bestimmten Adresse gezeigt hatte, ließ uns in einer schmucken Querstraße der Kärntnerstraße absteigen. Wir waren am Ziel.
Als er uns auf den Strang einer Glocke hinwies, damit wir unsere Ankunft avisierten, war ich ein wenig überrascht: Wir befanden uns vor dem Eingangstor eines Klosters.
***
»Eine Moment, eine Moment«, sprach in unbeholfenem Italienisch ein Schatten, der hinter dem engmaschigen, schwarzen Gitter neben der Eingangsglocke aufgetaucht war.
Als er unsere Namen hörte, nickte er zustimmend. Wir wurden erwartet. Zwei Tage zuvor hatte der Kutscher während eines Halts auf der Reise einen Boten geschickt, damit er unsere baldige Ankunft melde.
Der Kutscher war mir beim Ausladen des Gepäcks behilflich, und so vernahm ich von ihm, dass wir uns anschickten, eines der größten Frauenklöster der Stadt, fast gewiss aber das wichtigste, zu betreten.
Wir wurden in einer großen, düsteren Eingangshalle empfangen, aus der wir wenige Minuten später wieder ins helle Tageslicht traten, in den Kreuzgang des Innenhofes, einen langen Säulengang aus weißen Steinen, geschmückt mit den Bildnissen jener Ordensfrauen, die im höchsten Grade ihre Tugendhaftigkeit unter Beweis gestellt hatten. Im Gefolge einer alten Nonne, die stumm zu sein schien, vielleicht aber nur unseres Idioms unkundig war, gingen wir raschen Schritts unter den Arkaden voran und gelangten ins Gästehaus. Uns wurden zwei nebeneinander liegende Zimmerchen zugewiesen. Während Cloridia und der Knabe sich erschöpft auf das Bett warfen, mühte ich mich damit ab, das Gepäck in unsere Unterkunft zu tragen, wobei mich ein junger Idiot unterstützte, den die Schwestern vorübergehend für Aufräum- und Reinigungsarbeiten in den Kellergeschossen in Dienst genommen hatten. Der Idiot, ein gebückter und tollpatschiger Mensch, gleichzeitig jedoch muskulös und von großem Wuchs, war überaus geschwätzig, und am Tonfall seines Geplappers meinte ich zu erkennen, dass er mir Fragen nach der Reise oder Ähnlichem stellte. Schade, dass ich kein einziges Wort verstand.
Nachdem ich den Idioten mit einem breiten Lächeln entlassen und die Tür hinter mir geschlossen hatte, blickte ich mich um. Das Zimmer war spärlich eingerichtet, doch es fehlte nicht an den zum Leben nötigsten Dingen. Auf jeden Fall erschien es weit besser als der Keller aus Tuffstein, jene römische Behausung, mit der wir in den letzten zwei Jahren hatten vorliebnehmen müssen und wo wir schweren Herzens unsere Jungfräulein zurückgelassen hatten. Ich wandte den Blick zu Cloridia.
Natürlich erwartete ich Klagen, Vorwürfe und Zweifel an den Versprechen des Abbé Melani: Bei Nonnen unterzukommen war das Schlimmste, was ihr widerfahren konnte, das wusste ich bereits. Die Bräute Christi waren nämlich die einzigen Frauen, mit denen mein Ehegespons sich durchaus nicht vertrug.
Aber kein Wort kam über ihre Lippen. Auf dem Bett liegend, das Kind, das im Schlaf hustete, noch fest an sich gepresst, schaute Cloridia sich verwirrt um, und sie hatte den leeren Blick des Menschen, der kurz davor ist, dem dunklen Halbschlaf größter Erschöpfung zu erliegen.
Das Kind ließ mich aufschrecken. Es wurde von einem stärkeren Hustenanfall denn je geschüttelt. Sein Zustand schien sich zu verschlechtern. Nach einer Weile klopfte es.
»Ziegenfett und Dinkelmehl mit einem Tropfen Wermutöl, auf der Brust zu verreiben. Und das Köpfchen muss auf diesem Kissen aus Dinkelspelz ruhen.«
Mit diesen Worten in makellosem Italienisch betrat, unter höflichem, aber entschlossen eiligem Gebaren, eine junge Nonne unsere Unterkunft.
»Ich bin Camilla, die Chormeisterin des Augustinerinnenklosters«, stellte sie sich vor, während sie, ohne Cloridia um Erlaubnis zu bitten, das Kissen schon unter den Kopf des Kleinen schob und ihm, nachdem sie sein Leibhemdchen gelüftet, die Salbe auf der Brust verrieb.
»Chor... meisterin?«, stotterte ich, indes ich niederkniete, um ihr Gewand zu küssen und ihr für die erwiesene Gastfreundschaft zu danken.
»Ja, die Leiterin des Chores«, bestätigte sie freundlich.
»Es ist eine Überraschung, hier in Wien ein so vollkommenes Italienisch hören zu dürfen, ehrwürdige Mutter.«
»Ich bin Römerin, wie Ihr; aus Trastevere, um genau zu sein. Mit bürgerlichem Namen Camilla de' Rossi. Aber nennt mich bitte nicht Mutter: Ich bin nur eine Laienschwester.«
Cloridia hatte sich nicht vom Bett gerührt. Ich sah, dass sie unseren Gast scheel von der Seite beäugte.
»Und er soll zwei Wochen lang nichts anderes als eine dünne Suppe zu sich nehmen«, schloss die Chormeisterin, dieweil sie sich vor das Kind stellte und es aufmerksam betrachtete.
»Ich hab's ja gewusst. Großzügig wie immer ...«
Die plötzliche, scharfe Bemerkung Cloridias ließ mich vor Scham erröten; schon fürchtete ich, wir würden recht bald aus dem Haus gejagt werden, doch das Opfer reagierte mit einem Lachen:
»Ich sehe, dass Ihr uns gut kennt«, antwortete sie, ohne im Geringsten beleidigt zu sein, »doch ich versichere Euch, dass die sprichwörtliche Knauserigkeit meiner Mitschwestern nichts damit zu tun hat. Dinkelsuppe mit gemahlenen Pflaumenkernen heilt jede Lungensucht.«
»Auch Ihr kuriert mit Dinkel«, bemerkte Cloridia nach einem Augenblick des Schweigens mit tonloser Stimme, »wie meine Mutter.«
»Wie es uns seit den fernen Zeiten unserer heiligen Schwester Hildegard, der Äbtissin von Bingen, überliefert ward«, stellte Camilla mit einem reizenden Lächeln richtig. »Aber es freut mich aufrichtig, dass auch Eure Mutter den Dinkel zu schätzen wusste; vielleicht erzählt Ihr mir eines Tages von ihr, so es Euch beliebt?«
Cloridia fiel in ein feindseliges Schweigen.
Diese Camilla de' Rossi war wirklich liebenswert, dachte ich, trotz des Misstrauens meiner Frau. Sie war in ein weißes Gewand gekleidet, die Ärmel mit einem feinen, schneeweißen Indischleinen überzogen, die Haube aus demselben Stoff, dahinter ein Schleier aus schwarzem Crepon.
Das Gesicht, das Haube und Schleier frei ließen, hätte man wahrlich keiner der beiden Physiognomien zuordnen können, welche jungen Ordensschwestern (oder Laienschwestern, da war kaum ein Unterschied) eigentümlich sind: Camilla hatte weder den wässrigen, blöden Blick, der von feisten und wie Schinkenspeck glänzenden Wangen umrahmt wird, noch die zwei harten, zornigen, in ein fahlgelbes, hageres Gesichtsfleisch gebohrten Äuglein. Sie war eine gesunde, anmutige junge Frau, deren große, dunkle Augen mit dem stolzen und samtweichen Blick und deren flinker Mund mich an die Züge gemahnten, die meine Gemahlin noch vor wenigen Jahren gehabt.
Wieder klopfte es.
»Euer Mittagessen kommt«, kündigte die Chormeisterin an, während sie zwei Dienstmädchen mit Tabletts öffnete.
Seltsamerweise war die gesamte Mahlzeit auf der Grundlage von Dinkel zubereitet: Brotfladen aus Dinkel und Kastanien, Kompott aus Äpfeln und Dinkel, Auflauf aus Dinkelkörnern und Fenchel.
»Jetzt müsst Ihr euch sputen«, mahnte Camilla, nachdem wir uns gestärkt hatten, »Ihr werdet in einer halben Stunde beim Notar erwartet.«
»Ihr wisst also ...«, wunderte ich mich.
»Ich weiß alles«, beschied sie mich knapp. »Ich habe bereits dafür gesorgt, dass der Notar von Eurer Ankunft benachrichtigt wird. Los, eilt Euch, ich kümmere mich um den Kleinen.«
»Ihr erwartet doch nicht im Ernst, dass ich meinen Sohn in Euren Händen lasse?«, protestierte Cloridia.
»Wir sind alle in Gottes Hand, meine Tochter«, versetzte die Chormeisterin, welche dem Alter nach unsere Tochter hätte sein können, in mütterlichem Tonfall.
Kaum hatte sie das gesagt, schob sie uns mit sanfter Entschlossenheit zur Tür.
Ich flehte Cloridia mit Blicken an, sich nicht zu wehren und auch keine weitere unhöfliche Bemerkung gegen die Gattung der Bräute Christi fallenzulassen.
»Alles, damit ich nur ja keinen Ruß mehr sehen muss«, sagte sie.
Ich dankte Gott, dass meine Gattin wegen ihres Hasses auf das Gewerbe der Schornsteinfeger endlich nachgab. Vielleicht hatte diese junge Ordensfrau, der die Gesundheit unseres Kleinen so am Herzen zu liegen schien, sogar schon begonnen, eine Bresche in die Mauer aus Misstrauen zu schlagen, mit der Cloridia sich umgab.
Am Ausgang fanden wir den Idioten des Klosters vor, der an die Wand gelehnt auf uns wartete. Die Chormeisterin warf ihm einen raschen Blick des Einverständnisses zu.
»Das ist Simonis. Er wird Euch zum Notar bringen.«
»Ich bitte um Verzeihung, ehrwürdige Mutter«, versuchte ich einzuwenden, »ich kann noch nicht besonders gut Deutsch, und was dieser Mensch zu mir sagt, verstehe ich nicht. Auch vorhin, bei unserer Ankunft ...«
»Es ist kein Deutsch, was Ihr gehört habt: Simonis ist Grieche. Und wenn er will, kann er sich durchaus verständlich machen«, erklärte sie lächelnd und verriegelte, ohne ein weiteres Wort, das Tor hinter unserem Rücken.
***
»Sehr großzügig, diese Schenkung des Abbé Milani, o ja, nicht wahr?«
Der in pfleglichem Italienisch und nur beim Namen Melanis fehlerhafte Satz, mit dem uns der Notar, hinter kleinen Augengläsern blinzelnd, in seiner Kanzlei willkommen hieß, ließ leider nicht erkennen, ob er als Feststellung oder als Frage gemeint war.
Wir waren angekommen, nachdem wir einen kurzen Weg zu Fuß durch den Schnee zurückgelegt hatten, bei dem uns allerdings die Glieder über die Maßen steif wurden. Der schreckliche Winter des Jahres 1709, der meine Familie und ganz Rom in die Knie gezwungen hatte, war nichts im Vergleich zu dieser Kälte, und ich erkannte jetzt, dass die schweren Pelerinen, die wir vor der Abreise erstanden hatten, uns hier nicht besser schützten als eine Zwiebelschale. Cloridia wurde von Hustenfällen gepeinigt.
»O ja, nicht wahr«, wiederholte der Notar mehrmals, der uns, nachdem wir die Pelerinen abgelegt, auch zum Ausziehen der Schuhe genötigt und sodann aufgefordert hatte, ihm gegenüber Platz zu nehmen. Simonis war im Vorzimmer geblieben, um dort auf uns zu warten.
Während wir die Wärme des großen, prächtigen Ofens aus majolikaverziertem Gusseisen genossen, wie ich dergleichen noch nie gesehen, schickte er sich an, eine Akte zu durchblättern, die eine Aufschrift in Fraktur trug.
Gespannt beobachteten Cloridia und ich, wie seine Finger sich eilig zwischen dem Papier bewegten. Meine arme Frau legte sich eine Hand an die Schläfe: Ich begriff, dass bei ihr nun wieder jenes entsetzliche Hauptweh ausbrach, das sie quälte, seit wir im Elend lebten. Welche Nachricht mochten diese Blätter bergen? Stand dort das Ende unserer Nöte oder wieder nur ein böser Streich geschrieben? Ich spürte, wie mein Magen vor ängstlicher Sorge in Wallung geriet.
»Die Dokumente sind vollständig: Geburths-Brief, Kauff-Contract und vor allem die Hofbefreyung«, sagte der Notar endlich halb auf Italienisch, halb auf Deutsch. »Wenn die Herrschaften bittschön kontrollieren wollen, ob die Daten korrekt sind«, fügte er hinzu, während er mir die Dokumente vorlegte, deren Bedeutung ich freilich noch nicht erfasst hatte. »Der Signor Abbé Milani, Euer Wohltäter ...«
»Melani«, verbesserte ich ihn, wohl wissend, dass Attos Unterschrift gelegentlich Anlass zu solcherart Missverständnissen gab.
»Aha, richtig«, sagte er, nachdem er ein Blatt aufmerksam studiert hatte. »Wie ich schon sagte: Der Signor Abbé Melani und seine Bevollmächtigten haben sich größter Sorgfalt und Genauigkeit befleißigt. Aber der Hof ist äußerst streng: Es muss alles seine Ordnung haben.«
»Der Hof?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Wenn der Hof Euch ablehnt, kann die Schenkung nicht wirksam werden«, setzte der Notar hinzu, »doch lest nun diesen Geburths-Brief und sagt mir, ob alle Angaben stimmen.«
Mit diesen Worten legte er mir das erste der vier Dokumente vor, das sich zu meiner nicht geringen Überraschung als eine Geburtsurkunde auf meinen Namen entpuppte, die Tag, Monat, Jahr und Ort, ja sogar Vater und Mutter verzeichnete. Das war nun wirklich eigenartig, da ich, ein Waisenkind, selber nicht wusste, wann, wo und von wem ich geboren worden war.
»Dies hier ist der Gesellenbrief«, drängte unser Gesprächspartner, der, nachdem er aus dem Fenster geschaut hatte, plötzlich große Eile zu haben schien. »Der Hof ist überaus streng, ich sage es noch einmal. Besonders was Eure Qualifikationen betrifft; widrigenfalls könnte die Innung Euch Schwierigkeiten machen.«
»Die Innung?«, fragte ich und hatte nicht die geringste Ahnung, wovon er sprach.
»Jetzt wollen wir fortfahren, denn die Zeit drängt. Fragen mögt Ihr mir hernach stellen.«
Ich hätte ihm gerne gesagt, dass ich noch nicht verstanden hatte, welchem Zwecke all diese, zumal gefälschten, Dokumente dienten. Vor allem aber erklärte die Rede des Notars nicht, worin Atto Melanis Schenkung eigentlich bestand. Doch ich gehorchte und enthielt mich weiterer Einwürfe. Auch Cloridia schwieg, den Blick von Kopfweh und Lungensucht verhangen.
»Die Hofbefreyung hingegen ist weniger pressant: Ich persönlich kann für ihre Gültigkeit garantieren. Da die Zeit knapp wird, könnt Ihr sie in der Kutsche in Augenschein nehmen.«
»In der Kutsche?«, wunderte sich Cloridia. »Wohin fahren wir?«
»Die Richtigkeit dessen zu überprüfen, was der Kauff-Contract enthält, ei, wohin denn sonst?«, antwortete jener, als wäre dies selbstverständlich, derweil er sich erhob und uns aufforderte, ihm zu folgen.
So geschah es, dass wir, nachdem wir die Kanzlei des Notars mit tausend Hoffnungen im Herzen betreten hatten, sie nun mit ebenso vielen Fragen im Kopfe wieder verließen.
***
Wir waren nicht wenig erstaunt, als die Kutsche mit Cloridia, Simonis, dem Notar und mir das Zentrum Wiens zu verlassen begann. Alsbald gelangte sie zu den Umfriedungsmauern und fuhr durch eines der Tore auf eine froststarrende Ebene vor der Stadt hinaus.
Während der Fahrt kauerte meine Frau sich wegen der Kälte in einer Ecke zusammen, und Simons sah mit ausdruckslosem Blick aus dem Fenster. Grübelnd betrachtete ich den Notar. Er schien es eilig zu haben; was er vorhatte, war freilich nicht zu ergründen. Ganz offensichtlich waren die zwei Dokumente, die er mir bis jetzt vorgelegt hatte, Fälschungen nach allen Regeln der Kunst und stammten vom Abbé Melani. Atto – ich erinnerte mich gut – war geübt im Fälschen von Papieren, auch solchen von weit größerer Bedeutung als diesen ... Zugegeben, hier waren seine Absichten weniger verdammenswert: Er wollte nur die Schenkung wirksam machen.
Der Notar erwiderte meinen Blick: »Oh, ich weiß, was Ihr Euch fragt, und bitte um Vergebung, dass ich nicht früher daran gedacht habe. Es ist nun an der Zeit, dass ich Euch erkläre, wohin wir fahren.«
»Na endlich«, dachte ich, und Cloridia, die schlagartig wieder zu sich gekommen war, verwandte ihre verbliebenen Kräfte darauf, sich auf dem Sitz aufzurichten, um zu vernehmen, was der Notar uns sogleich sagen würde.
»Vornehmlich dürfte es konvenieren, wenn ich Eure Gemahlin ein wenig von den Beschwernissen der Fahrt erlöse, indem ich ihr ein Bild von der äußeren Erscheinung und vom Wesen der Hauptstadt des Reiches gebe«, hub der Notar pompös an, der offensichtlich sehr stolz auf seine Heimat war. »Vor dem Mauerring, und diesen zur Gänze umgebend, befindet sich eine große freie Fläche aus geebnetem Boden ohne jeden Bewuchs, welche im Falle eines feindlichen Angriffs gestattet, die Belagerungstruppen zu beschießen. Östlich der Stadt verläuft der Donaufluss, welcher in seinen Windungen von Norden nach Süden und von Westen und Osten strömt, wobei er zahlreiche Inselchen, Moraste und Sümpfe bildet. Noch weiter östlich beginnt hinter jenem feuchten, lagunenartigen Gebiete die weite Ebene, welche ohn Unterbrechung bis zum Königreich Polen und zum Reich des Zaren von Russland sich erstreckt. Item dehnt sich im Süden ein flacher Landstrich aus, selbiger führt bis nach Kärnten, jener Region, so an Italien grenzt, dahero auch Ihr selbst gekommen. Im Westen und im Norden hingegen wird die Stadt von bewaldeten Höhen umgeben, deren höchste der Kahlenberg ist, der fernste Ausläufer der Alpen, steil gegenüber der Donau aufragend, das Bollwerk des Abendlandes, das auf die weite östliche Ebene Pannoniens blickt.«
Liebenswürdig war die Rede des Notars, allein Cloridias Gesicht verfinsterte sich zunehmend, und auch ich mutmaßte mit immer mehr Bangen über die Größe und Art der Schenkung. Wenn dieser wunderliche Notar sich doch nur endlich entschlösse, uns zu verraten, worin sie bestand!
»Ich weiß, woran Ihr denkt«, sagte er in diesem Moment, die orographische Lektion über Wien unterbrechend, und richtete das Wort an mich: »Ihr fragt Euch, welcher Natur die Schenkung Eures Wohltäters genauerhin sein mag und von welchem Werte sie sei. Nun gut: Wie Ihr selbst in der Hofbefreyung lesen könnt«, erläuterte er, indem er mir mit äußerster Behutsamkeit eines der Dokumente vorlegte, »hat der Abbé Melani Euch mit Sitz in der Josephina, der Vorstadt bei der Michaelerkirchen, dahin wir uns justament begeben, ein Amt als Hofbefreyter Meister verschafft.«
»Was bedeutet das?«, fragten Cloridia und ich gleichzeitig.
»Das ist doch sonnenklar: hofbefreit. Mit Erlaubnis des Hofes oder, wenn man so will, durch Kaiserliches Dekret, seid Ihr frei, Meister zu werden.«
Wir sahen ihn fragend an.
»Solches ist vonnöten, weil Ihr kein Bürger Wiens seid«, erläuterte der Notar weiter. »Da der Kaiser Eurer Dienste dringlich, ja in äußerstem Maße dringlich bedarf, hat Euer Wohltäter großzügigerweise bei Hof ein Gewerbsprivilegium für Euch erbeten und erhalten«, schloss er, ohne zu gewahren, dass er die wichtigste Frage noch nicht beantwortet hatte.
»Ja, und?«, drängte Cloridia mit skeptischer Hoffnung angesichts der unerwarteten Worte des Notars.
»Das Recht, jenes Gewerbe auszuüben, selbstredend! Und mithin auch in die Innung aufgenommen zu werden«, explizierte der Notar ungeduldig und betrachtete uns, als wären wir zwei Wilde, die seiner Hilfsbereitschaft überdies keinen Dank erwiesen.
Wie ich mit der Zeit nur allzu gut lernen sollte, verwechseln die Wiener bei Fremden ungenügende Kenntnisse ihrer Sprache mit einem Mangel an Gesittung und Scharfsinn.
Die harsche Reaktion des Notars ließ meine geschwächte Frau verstummen. Ohnehin war sie eingeschüchtert durch die Furcht, ihn zu verärgern und damit Schwierigkeiten heraufzubeschwören, die uns den Zugang zu der ersehnten, rätselhaften und nunmehr in unmittelbarer Reichweite befindlichen Schenkung Attos verwehren würden.
Welche Art Meister war ich geworden? Worin bestand das Gewerbe, dessen Ausübung der Kaiser mir gnädig gewährt hatte, obwohl ich kein Wiener Bürger war? Vor allem aber, welche Dienste benötigte der gütige Herrscher von mir mit so großer Dringlichkeit?
»Ihr müsst ein tugendhaftes Leben ohne jeden Makel führen, um Euren Pflichten aufs beste nachzukommen und den Gesellen zum Vorbild und Exemplum zu gereichen«, hub er wieder geheimnisvoll an. »Und dies ist noch nicht alles: Wie Ihr im Kauff-Contract lesen könnt, den Herr Abbé Melani hochherzig in Eurem Namen abgeschlossen hat, sind hier Haus, Hof und Weingarten aufgeführt! Welch unvergleichliche Generosität! Doch halt, wir sind endlich angekommen. Gerade noch rechtzeitig vor der Dämmerung.«
Tatsächlich schwand das Licht rasch. Zwar war es noch früher Nachmittag, doch in den nördlichen Gefilden fällt die Dunkelheit sehr früh und nahezu ohne Vorwarnung ein, insbesondere im Winter. Dies also war der Grund für die Eile, die der Notar in seiner Kanzlei an den Tag gelegt hatte.
Ich wollte gerade fragen, worin die drei Dinge bestanden, welche im Kaufvertrag aufgelistet waren, als die Kutsche zum Halten kam. Wir stiegen aus. Vor uns stand ein eingeschossiges, scheinbar unbewohntes Häuschen. Am Eingang hing ein blitzblankes, neues Schild mit einer Aufschrift in Fraktur.
»Gewerbe IV«, las der Notar für uns. »Ach ja, ich vergaß, die Sache genauer zu spezifizieren: Euch gehört das Gewerbe Numero vier der siebenundzwanzig derzeit in der Kaiserlichen Hauptstadt und Umgebung konzessionierten Gewerbe, und es ist eines der fünf, welche kürzlich auf Wunsch Ihro Kaiserlicher Majestät Joseph I. mit Privilegium vom 19. April 1707 in den ehrwürdigen Rang städtischer Gewerbe erhoben wurden. Eure Hauptaufgabe bleibt natürlich, in Eurer Eigenschaft als Hofadjunkt die pressanten Bedürfnisse des Kaisers zu befriedigen: Euch wird die Pflege und Verantwortung für ein altes kaiserliches Gebäude anvertraut, welches unser gütiger Herrscher in seinem ursprünglichen Glanze wiederherzustellen gedenkt.«
Auf diese letzte Eröffnung des Notars hin kehrte Cloridia, die sich mit finsterer Miene hinter uns herschleppte, beobachtet nur von Simonis' leerem Blick, schlagartig zu ihrer stolzen Haltung zurück und schritt schneller voran. Auch ich begann, wieder Hoffnung zu schöpfen: Wenn das Gewerbe, das Atto für uns gekauft hatte und dessen Meister ich werden sollte, von niemand Geringerem als dem Kaiser höchstpersönlich eingerichtet worden war und es in der ganzen Stadt eine sogar per Dekret festgesetzte Anzahl davon gab, mir überdies – mit höchster Dringlichkeit! – die Pflege von nichts Geringerem als einem kaiserlichen Gebäude anvertraut wurde, konnte es sich gewiss nicht um eine Bagatelle handeln.
»Nun, Herr Notar«, fragte meine Gattin mit honigsüßer Stimme und zeigte ihr erstes Lächeln an diesem Tag, »mögt Ihr uns endlich sagen, worum es sich handelt? Worin besteht die Tätigkeit, welche mein Mann, dank der Großzügigkeit des Abbé Melani und der Güte Eures Kaisers, die Ehre haben wird, in dieser herrlichen Stadt Wien auszuüben?«
»Oh, pardon, meine Dame, ich dachte, das wäre Euch bereits klar: Rauchfangkehrermeister.«
»Wie bitte?«
»Wie sagt man auf Italienisch? Rauchfegemeister ... nein ... Rohrfeger ... Ach ja: Schornsteinfeger.«
Wir hörten einen dumpfen Aufprall. Cloridia war ohnmächtig zu Boden gesunken.
Käyserliche Haupt- und Residenz-Stadt WiennDonnerstag den 9. April 1711
ERSTER TAG
11. Stunde, wenn Handwerker, Sekretäre, Sprachlehrer, Priester, Handelsdiener, Lakaien und Kutscher zu Mittag speisen
Gierig schlürfte ich einen heißen Kräuteraufguss, betrachtete von Zeit zu Zeit den spielenden Knaben und blätterte derweil im Neuen Crackauer Schreib-Calender auf das Jahr 1711, der mir zufällig in die Hände gefallen war. Bald würde es Mittag schlagen, und soeben hatte ich in der Gastwirtschaft zum bescheidenen Preis von acht Kreuzern das gewohnte üppige Mahl aus sieben, reichlich mit Fleisch bestückten Gängen zu mir genommen, welches für zehn Männer (und zwanzig von meiner Statur) ausgereicht hätte, hier in Wien jedoch grundsätzlich an jedem Tag der Woche und jedem beliebigen Handwerker serviert wurde, während es in Rom nur für einen Kirchenfürsten erschwinglich gewesen wäre.
Bis vor ein paar Monaten hätte ich mir nicht vorzustellen vermocht, dass mein Bauch sich derart füllen ließ.
So aber half ich mir, wie jeden Tag, mit der wohltätigen Wirkung von Cloridias verdauungsfördernden Absuden, derweil ich schläfrig in meinen brandneuen Sessel aus hellgrüner Brokatelle sank.
O ja, in diesem 1711. Jahr nach der Geburt Christi, unseres Erlösers, oder auch – wie der Crackauer Schreib-Calender ins Gedächtnis rief – 5660 Jahre nach der Erschaffung der Welt, 3707 Jahre nach dem ersten Osterfest, 2727 Jahre nach dem Bau des Tempels durch Salomon, 2302 Jahre nach der Babylonischen Gefangenschaft, 2463 Jahre nach der Gründung Roms durch Romulus, 1757 nach dem Beginn des Römischen Reiches unter Julius Cäsar, 1678 nach der Auferstehung Jesu Christi, 1641 nach der Zerstörung Jerusalems unter Titus Vespasianus, 1582 nach der Einführung der Fastenzeit von 40 Tagen und der Anordnung der Heiligen Kirchenväter, dass alle Christen müssten getauft sein, 1122 Jahre nach der Entstehung des Osmanischen Reiches, 919 Jahre nach der Krönung Karls des Großen, 612 nach der Eroberung Jerusalems durch Gottfried von Bouillon, 468 Jahre nachdem die teutsche Sprache statt der lateinischen in offiziellen Kanzleischriften gebraucht wurde, 340 Jahre nach der Erfindung der Büchse, 258 nach der Eroberung Konstantinopels durch die Ungläubigen, 278 nach der Erfindung des Buchdrucks dank des Ingeniums eines Johannes Gutenberg aus Mainz und 241 Jahre nach jener des Papiermachens durch Anton und Michael Gallician, 220 Jahre nachdem Christophorus Columbus aus Genua die Neue Welt entdeckte, 182 Jahre nach der ersten türkischen Belagerung Wiens und 28 nach der zweiten und letzten, 129 Jahre nach der Korrektur des Gregorianischen Kalenders, 54 nach der Erfindung der Perpendicular-Uhren, 61 nach der Geburt Clemens XI., unseres Papstes, 33 Jahre nach der Geburt Ihro Kaiserlicher Majestät Joseph I. und 6 nach seiner Besteigung des Kaiserthrons, nun, in ebendiesem glanzvollen Anno Domini, welches wir schrieben, besaßen Cloridia und ich endlich einen Sessel, ja sogar deren zwei.
Sie waren uns nicht von einer mitleidigen Seele geschenkt worden, wir hatten sie mit den Erträgen unseres kleinen Familienbetriebs selbst gekauft und genossen ihrer in unserer Unterkunft im Augustinerinnenkloster, wo wir weiterhin wohnten, bis die Aufstockungsarbeiten unseres Hauses in der Josephina beendet sein würden.
An diesem Tag, dem ersten Donnerstag nach Ostern, waren seit unserer Ankunft in der Kaiserlichen Hauptstadt fast zwei Monate vergangen, und in unserem Leben gab es nunmehr keine Spur der Hungersnot mehr, die uns in Rom so heftig zugesetzt hatte.