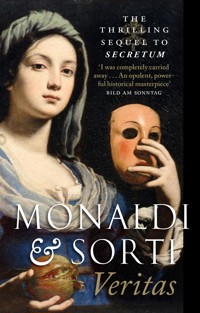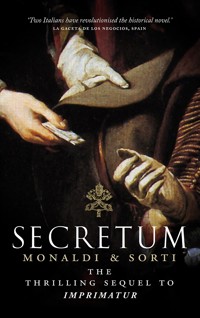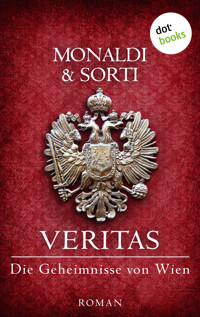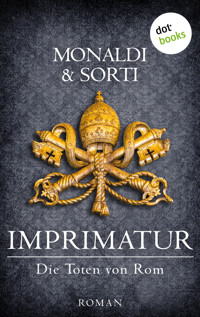Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Abbé Melani ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein Kontinent taumelt in den Abgrund: Der historische Kriminalroman »Secretum« von Monaldi & Sorti jetzt als eBook bei dotbooks. »Monaldi & Sorti – das neue italienische Autorenduo von internationalem Rang!« FAZ – Rom anno domini 1700. Ganz Europa blickt gebannt auf die Ewige Stadt: Der Papst liegt im Sterben – und noch vor seinem Ableben beginnt das tödliche Spiel aus Intrigen und Verschwörungen um einen Nachfolger. Auch Abbé Melani, der beste Agent des französischen Sonnenkönigs, weilt unter ihnen: vorgeblich als Gast auf einer politisch bedeutsamen Hochzeit, in Wahrheit aber mit einem Geheimauftrag seines Herrn. Sollte Melani dabei enttarnt werden, ist das Schicksal der französischen Krone besiegelt! Um seine Mission zu lösen, braucht er nichts dringender als die Hilfe eines alten Freundes – aber wem kann Melani in diesen chaotischen Zeiten noch trauen? »Monaldi & Sorti sind die Erben Umberto Ecos.« L' Express »Das Traumpaar des historischen Romans!« Brigitte Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Kriminalroman »Secretum«, der mitreißende zweite Teil der Bestseller-Trilogie von Monaldi & Sorti, der auch unabhängig gelesen werden kann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1444
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Monaldi & Sorti – das neue italienische Autorenduo von internationalem Rang!« FAZ
Rom anno domini 1700. Ganz Europa blickt gebannt auf die Ewige Stadt: Der Papst liegt im Sterben – und noch vor seinem Ableben beginnt das tödliche Spiel aus Intrigen und Verschwörungen um einen Nachfolger. Auch Abbé Melani, der beste Agent des französischen Sonnenkönigs, weilt unter ihnen: vorgeblich als Gast auf einer politisch bedeutsamen Hochzeit, in Wahrheit aber mit einem Geheimauftrag seines Herrn. Sollte Melani dabei enttarnt werden, ist das Schicksal der französischen Krone besiegelt! Um seine Mission zu lösen, braucht er nichts dringender als die Hilfe eines alten Freundes – aber wem kann Melani in diesen chaotischen Zeiten noch trauen?
»Monaldi & Sorti sind die Erben Umberto Ecos.« L’ Express
»Das Traumpaar des historischen Romans!« Brigitte
Über die Autoren:
Das international erfolgreiche Autorenduo Rita Monaldi und Francesco Sorti machte mit seinem brillant recherchierten Romanzyklus IMPRIMATUR, SECRETUM und VERITAS weltweit auf sich aufmerksam. Als das Journalistenpaar außerdem im Zuge seiner Recherchen ein Geheimnis um Papst Innozenz XI. lüftete, machte der Vatikan seinen ganzen Einfluss geltend, weshalb die Werke jahrelang in Italien nicht vertrieben werden durften. In Folge des Skandals leben die Autoren heute in Wien.
Bei dotbooks erscheint die Trilogie über Abbé Melani, den Geheimagenten des Sonnenkönigs: »Imprimatur – Die Toten von Rom«, »Secretum – Die Schatten des Vatikans« und »Veritas – Die Geheimnisse von Wien«.
Weiterhin veröffentlichten sie bei dotbooks den historischen Roman »Die Entdeckung des Salaì«.
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe Juli 2020
Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Secretum« bei Ullstein
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / wjarek / digieye
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (cg)
ISBN 978-3-96655-323-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Secretum« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Monaldi & Sorti
Secretum – Die Schatten des Vatikans
Roman
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
dotbooks.
Alles auf dieser Erde ist eine Maskerade, aber Gott hat bestimmt, daß das Schauspiel auf diese Weise aufgeführt werden muß.
(ERASMUS von ROTTERDAM, Lob der Torheit)
Konstanza, 14. Februar 2041
An Seine Exzellenz Msgr.Alessio TanariSekretär der Kongregation für die HeiligsprechungVatikanstadt
Mein lieber Alessio,
ein Jahr ist nunmehr vergangen, seit ich Ihnen zuletzt schrieb. Sie haben mir nie geantwortet.
Vor einigen Monaten wurde ich überraschend (doch vielleicht wissen Sie es bereits) nach Rumänien versetzt. Ich gehöre nun zu den wenigen Priestern, die in Konstanza, einer Kleinstadt am Schwarzen Meer, Aufnahme gefunden haben.
Hier erhält das Wort »Armut« jene erbarmungslose und endgültige Bedeutung wieder, die es einst auch bei uns besaß. Baufällige Häuser in fahlen Farben, ärmlich gekleidete Kinder, die auf schmutzigen Straßen spielen, wo jede Beschilderung fehlt, Frauen, die mit müden Gesichtern misstrauisch aus den Fenstern hässlicher Mietskasernen blicken, diesen kahlen, übel zugerichteten Hinterlassenschaften des realen Sozialismus. Trostlosigkeit und Elend überall.
Dies ist die Stadt, die Umgebung, die mir vor einigen Monaten zugewiesen wurde. An diesen Ort wurde ich berufen, meine seelsorgerische Mission zu erfüllen, und ich werde mich meinen Pflichten nicht entziehen. Weder die Not dieses Landes noch die Tristesse, die hier jeden Winkel durchdringt, werden mich davon abhalten.
Wie Sie wissen, war das Fleckchen Erde, das ich verlassen habe, vollkommen anders. Bis vor wenigen Monaten war ich Bischof von Como, dem lieblichen Seestädtchen, das Manzoni zu seiner unsterblichen Prosa inspirierte: die ehemalige Perle der opulenten Lombardei, reich an Zeugnissen einer vornehmen Geschichte, in deren Zentrum mit seinen charakteristischen historischen Gebäuden sich heute Geschäftsleute, Modeschöpfer, Fußballer und wohlhabende Seidenfabrikanten niedergelassen haben.
Meine geistliche Mission bleibt von diesem jähen, unerwarteten Wechsel gleichwohl unberührt. Man hat mir mitgeteilt, dass ich hier in Konstanza gebraucht werde, dass ich durch meine besondere Berufung den spirituellen Bedürfnissen dieses Landes besser gerecht werden könne als jeder andere, und dass die Versetzung aus Italien (die mir nur zwei Wochen vor dem festgelegten Datum angekündigt wurde) keine Degradierung und noch weniger eine Strafe sei.
Als mir die Veränderung in Aussicht gestellt wurde, habe ich sofort beträchtliche Zweifel (und, wie ich hinzufügen muss, ebenso große Verwunderung) geäußert, denn niemals zuvor bin ich meiner seelsorgerischen Tätigkeit außerhalb Italiens nachgegangen, wenn man von einigen Monaten der Ausbildung in Frankreich während meiner nunmehr weit zurückliegenden Jugendjahre absieht.
Obwohl ich die Bischofswürde als die größte nur mögliche Krönung meiner Laufbahn betrachte, und ungeachtet meines fortgeschrittenen Alters, hätte ich einen neuen Bestimmungsort durchaus bereitwillig akzeptiert: zum Beispiel in Frankreich, in Spanien (Länder, deren Sprache mir nicht unbekannt ist) oder sogar in Lateinamerika.
Gewiss, es hätte sich in jedem Fall um ein ungewöhnliches Vorgehen gehandelt, denn dass ein Bischof von heute auf morgen in weit entfernte Länder versetzt wird, erlebt man nur äußerst selten, wenn seine Laufbahn keine schwerwiegenden Makel aufweist. Dies ist in meinem Fall, wie Sie sicher wissen, nicht gegeben, und dennoch hat sich – gerade wegen des abrupten und außergewöhnlichen Charakters dieser Versetzung – manch ein Gemeindemitglied in Como nicht zu Unrecht ermächtigt gefühlt, einen derartigen Verdacht zu hegen.
Ich hätte eine solche Entscheidung fraglos angenommen wie man Gottes Willen annimmt, nämlich ohne Vorbehalte und Bedauern. Doch man hat beschlossen, mich ausgerechnet hierher zu schicken, nach Rumänien, in ein Land, wo mir alles unbekannt ist, von der Sprache bis zu den Gebräuchen, von der Geschichte bis zu den Erfordernissen des täglichen Lebens. Und so finde ich mich wieder, wie ich meine müden Glieder bei dem Versuch strapaziere, mit den Jungen des Ortes auf dem Gelände der Pfarrei Fußball zu spielen und ihre schnelle Redeweise aufzufassen, was ein ganz und gar zweckloses Unterfangen ist.
Meine Seele wird, bitte verzeihen Sie mir dieses Bekenntnis, von einem unaufhörlichen subtilen Schmerz gepeinigt. Er rührt jedoch nicht von meinem Schicksal her (das Gott so gewollt hat und das darum mit Dankbarkeit und heiterer Gelassenheit angenommen werden muss), sondern von den geheimnisvollen Umständen, die es gelenkt haben. Umständen, die Ihnen sogleich zu erläutern mir ein Bedürfnis ist.
Zuletzt schrieb ich Ihnen vor einem Jahr, um Sie auf einen außerordentlich heiklen Fall aufmerksam zu machen. Damals war der Prozess der Heiligsprechung des Seligen Innozenz XI. Odescalchi, Papst ruhmreichen Angedenkens von 1676 bis 1689, Betreiber und Unterstützer der Schlacht der christlichen Heere 1683 in Wien gegen die Türken, welcher die Anhänger Mohammeds für immer aus Europa vertrieb, noch in vollem Gange. Da dieser Papst aus Como stammte, war mir die ehrenvolle Aufgabe zugefallen, das Verfahren einzuleiten, welches dem Heiligen Vater sehr am Herzen lag. Denn die vernichtende, historisch bedeutende Niederlage des Islam hatte sich im Morgengrauen des 12. Septembers 1683 ereignet, als man in New York, die Zeitverschiebung eingerechnet, noch den 11. September schrieb ... Nun ist unserem innig geliebten Papst vierzig Jahre nach dem tragischen Angriff des Islam auf die Türme des World Trade Centers in New York die Übereinstimmung zwischen den beiden Daten nicht entgangen. Er hat daher Innozenz XI. – den Papst, der den Islam bekämpfte – gerade im Zusammenhang mit der Wiederkehr dieser beiden historischen Daten heilig sprechen wollen. Mit dieser Geste wollte er die christlichen Werte und den Abgrund, der Europa und den gesamten Westen von den Idealen des Korans trennt, erneut bekräftigen.
Als das Untersuchungsverfahren damals abgeschlossen war, schickte ich Ihnen jene unveröffentlichte Schrift. Sie erinnern sich? Es war das Manuskript meiner beiden alten Freunde Rita und Francesco, deren Spur ich schon Jahre zuvor verloren hatte. Das Manuskript enthüllte eine beträchtliche Reihe ehrenrühriger Umstände zu Lasten des Seligen Innozenz. Dieser hatte sich nämlich während seines gesamten Pontifikats in seinen Handlungen von niedrigen persönlichen Interessen leiten lassen. Und auch wenn er zweifellos zum Werkzeug Gottes geworden war, als er die christlichen Herrscher antrieb, gegen die Türken zu kämpfen, hatte ihn doch bei anderen Gelegenheiten seine Geldgier dazu verleitet, die christliche Moral auf das Schwerste zu beleidigen und der katholischen Religion in Europa irreparable Schäden zuzufügen.
Wie Sie sich erinnern werden, bat ich Sie daraufhin, die Angelegenheit Seiner Heiligkeit zu unterbreiten, damit er entscheiden möge, ob man Schweigen bewahren müsse oder er – wie ich hoffte – das Imprimatur erteilen, also die Veröffentlichung des Manuskripts anordnen und die Wahrheit allen zugänglich machen wolle.
Ich erwartete, ehrlich gesagt, zumindest die Andeutung einer Empfangsbestätigung. Ich glaubte, dass es Ihnen, abgesehen von den gravierenden Sachverhalten, die mich zu meinem Schreiben veranlasst hatten, Freude machen würde, von dem Menschen zu hören, der schließlich einmal Ihr Lehrer im Priesterseminar gewesen war. Wohl wusste ich, dass die Antwort auf mein Ersuchen in Anbetracht der Tragweite der Entdeckungen, die ich Seiner Heiligkeit zur Kenntnis gab, lange, vielleicht sehr lange auf sich warten lassen würde. Doch ich war mir gewiss, dass Sie unterdessen, wie in solchen Fällen üblich, zumindest mit einem Antwortkärtchen von sich hören lassen würden.
Aber nichts geschah. Monatelang erhielt ich weder schriftlich noch telefonisch Mitteilung, obwohl der Ausgang des Prozesses der Heiligsprechung von der Antwort abhing, auf die ich wartete. Ich führte mir das Bedürfnis des Heiligen Vaters vor Augen, gründlich zu überlegen, zu bewerten und abzuwägen. Vielleicht auch einige Experten mit einem streng vertraulichen Gutachten zu beauftragen. Ich fügte mich geduldig in das Warten, zumal ich aufgrund meiner Pflicht zur Geheimhaltung und Wahrung des Ansehens des Seligen niemandem außer Ihnen und dem Heiligen Vater offenbaren durfte, was ich entdeckt hatte.
Bis ich es eines Tages in einer Mailänder Buchhandlung inmitten tausend anderer Bücher erblickte: das Buch, das den Namen meiner beiden Freunde trug.
Als ich es endlich aufschlug, hatte ich die Bestätigung: Es war wirklich das Buch. Wie war das möglich? Wer um alles in der Welt hatte es in Druck gegeben? Schon bald sagte ich mir: Niemand anderes als unser Pontifex persönlich konnte die Veröffentlichung angeordnet haben. Vielleicht war jenes Imprimatur, das ich vom Papst erwartet hatte, schließlich in definitiver und mächtiger Weise ergangen, was wiederum bedeutete, dass er das Manuskript von Rita und Francesco unmittelbar in Druck hatte geben lassen.
Es stand außer Frage, dass der Prozess der Kanonisierung Papst Innozenz XI. damit für immer eingestellt war. Aber warum hatte man mich nicht davon in Kenntnis gesetzt? Warum hatte ich keinen einzigen Hinweis erhalten, nicht einmal nach der Veröffentlichung und sogar von Ihnen nicht, Alessio?
Ich war kurz davor, Ihnen erneut zu schreiben, als ich eines Tages in aller Frühe eine Nachricht erhielt. Und ich erinnere mich ungewöhnlich deutlich an diesen Moment. Ich wollte gerade in mein Arbeitszimmer gehen, als mein Sekretär mit einem Umschlag auf mich zukam. Er reichte ihn mir. Beim Öffnen konnte ich im Halbdunkel des Flurs gerade noch die auf den Umschlag geprägten päpstlichen Schlüssel erkennen, da hielt ich den Inhalt, das Blatt Kartonpapier, schon in den Händen.
Ich war zu einer Unterredung eingeladen. Besonders auffällig war der äußerst kurzfristige Termin, den das Billett angab: in zwei Tagen, überdies an einem Sonntag. Aber das war noch nichts im Vergleich zur Uhrzeit (6 Uhr morgens) und der Identität dessen, der mich zu einem persönlichen Gespräch aufforderte: Monsignore Jaime Rubellas, Staatssekretär des Vatikans.
Die Begegnung mit Kardinal Rubellas verlief ausnehmend freundlich. Er erkundigte sich zunächst nach meiner Gesundheit, den Erfordernissen in meiner Diözese, der Anzahl der Priesteramtskandidaten. Dann fragte er diskret nach dem Fortgang des Prozesses der Heiligsprechung Innozenz XI. Verwundert fragte ich zurück, ob er denn nicht von der Veröffentlichung des Buches unterrichtet sei. Er antwortete nicht, sondern schaute mich an, als hätte ich ihm einen Fehdehandschuh hingeworfen.
In genau diesem Moment teilte er mir mit, wie dringend ich in Konstanza gebraucht werde, wie die neuen Grenzen der Kirche von nun an verliefen, und wie mangelhaft die pastorale Betreuung der Seelen in Rumänien sei.
Die Liebenswürdigkeit, mit der mir der Monsignore Staatssekretär die Gründe für meine Versetzung schilderte, ließ mich während der Unterredung fast vergessen, dass es durchaus nicht einsichtig war, warum ausgerechnet er persönlich mir diese Ankündigung machte, und warum ich in dieser ungewöhnlichen Form vorgeladen worden war, als wollte man all dies geschützt vor indiskreten Blicken verhandeln. Außerdem vergaß ich zu fragen, wie lange meine Abwesenheit aus Italien währen sollte.
Zuletzt bat Monsignore Rubellas mich gänzlich überraschend, das vollständigste Stillschweigen über unser Gespräch und seinen Inhalt zu wahren.
Die Fragen, die ich mir an jenem Morgen in Rom nicht stellte, lieber Alessio, beschäftigen mich nun hier in Konstanza immer häufiger, vor allem abends, wenn ich in meinem Kämmerlein geduldig Rumänisch übe, eine sonderbare Sprache, bei der die Artikel hinter den Substantiven stehen.
Gleich nach meiner Ankunft erfuhr ich, dass Konstanza während des Römischen Reiches, zu dessen Herrschaftsbereich es lange Zeit gehörte, Tomis hieß. Als ich später eine Landkarte der Umgebung von Konstanza sah, entdeckte ich, dass es in unserer Nähe eine Ortschaft mit dem merkwürdigen Namen Ovidiu gibt.
In diesem Moment läutete in meinem Geist eine Alarmglocke. Rasch prüfte ich im Handbuch der lateinischen Literatur nach – mein Gedächtnis trog mich nicht. Als Konstanza noch Tomis hieß, verbannte Kaiser Augustus den berühmten Dichter Ovid an diesen Ort. Der offizielle Grund lautete, er habe obszöne Verse verfasst, doch in Wirklichkeit argwöhnte Augustus, Ovid habe von allzu vielen Geheimnissen des kaiserlichen Hofes gewusst. Zwei volle Lustren lang lehnte Augustus seine Gnadengesuche ab, bis Ovid schließlich starb. Ohne Rom je wieder gesehen zu haben.
Jetzt weiß ich, lieber Alessio, wie das Vertrauen erwidert worden ist, das ich vor einem Jahr in Sie setzte. Meine Verbannung hier nach Tomis, in das Exil für »literarische Vergehen«, hat mir die Augen geöffnet. Nicht nur war die Veröffentlichung des Manuskripts meiner beiden Freunde keineswegs durch den Heiligen Stuhl veranlasst, sie ist auch über euch alle wie ein Blitz aus heiterem Himmel gekommen. Und ihr habt geglaubt, ich steckte dahinter, ich hätte es in Druck gegeben. Darum habt ihr mich hierher verbannt.
Aber ihr irrt euch. Ebenso wie ihr habe auch ich keine Ahnung, wie dieses Buch zur Veröffentlichung gelangen konnte. Unser Herrgott, quem nullum latet secretum, »der alle Geheimnisse kennt« – wie man hierorts in den orthodoxen Kirchen betet –, bedient sich für Seine Zwecke auch desjenigen, der gegen Ihn handelt.
Wenn Sie einen Blick auf das Konvolut geworfen haben, das meinem Schreiben beiliegt, werden Sie bereits erkannt haben, worum es sich handelt: ein weiteres Manuskript von Rita und Francesco. Auch dieses vielleicht ein historisches Dokument, vielleicht ein Roman, wer weiß. Sie können sich nun damit vergnügen, es selbst herauszufinden, indem Sie die Urkundenbeweise überprüfen, die ich mit dem Schriftstück erhalten habe und die ich Ihnen ebenfalls übersende.
Natürlich werden Sie sich fragen, wann ich den maschinegeschriebenen Text erhalten habe, wo er abgesendet wurde, und schließlich, ob ich meine beiden alten Freunde wiedergefunden habe. Sämtlich Fragen, die ich Ihnen diesmal nicht beantworten kann. Ich bin sicher, dass Sie das verstehen werden.
Ich kann mir denken, dass Sie sich außerdem wundern, warum ich Ihnen das Ganze schicke. Schon jetzt stelle ich mir Ihr Erstaunen vor, und den Zweifel, ob ich naiv oder verrückt bin oder einer Logik gehorche, die sich Ihrem Verständnis entzieht. Eine dieser drei Vermutungen ist die Antwort, die Sie suchen.
Möge Gott Sie bei der Ihnen bevorstehenden Lektüre erneut erleuchten. Und möge Er Sie ein weiteres Mal zum Werkzeug Seines Willens machen.
Lorenzo Dell'Agio, pulvis et cinis
WAHRHAFFTIGER UNDFASZLICHER
BERICHT
Der ruhmreichen Thaten
WELCHE SICH EREIGNET IM JAHRE 1700 A. D. IN ROMUNTER DEM PONTIFIKAT
INNOZENZ XII.
Gewidmet meinem Vortrefflichstenund Hochverehrten HerrenAbbé Atto Melani
Mit amtlichem Privilegio
Gedruckt zu Rom, in Verlegung durchMichel'Ercole
MDCCII
***
Hochwürdigster und durchlauchtigster Herr,
Mit jeder Stunde dünkt mich gewisser, dass Euer Hochwohlgeboren eine kurzgefaßte Darlegung jener außergewöhnlichen Begebnisse, welche im Monat Juli des Jahres 1700 A. D. in Rom sich zugetragen, höchlichst willkommen sein möchte. Edler, löblicher und hochgeschätzter Held nämlicher Begebenheiten ist ein gehorsamster Unterthan Ihrer Majestät des Allerchristlichsten Königs Ludwig von Frankreich gewesen, an dessen glorreichen Thaten, so hier in einer Fülle von Descriptiones und mannigfachen Beschreibungen nacherzählet, man sich ergötzen möge.
Dies ist die Frucht der Mühen eines einfachen Bauernmenschen, wiewohl ich die feste Hoffnung hege, das glänzende Ingenium Euer sehr verehrten Hochwohlgeboren werde sich vor den Schöpfungen meiner rohen Muse nicht entsetzen. Ist die Gabe auch gering, so ist der gute Wille doch groß.
Werdet Ihr mir vergeben, wenn ich Euch auf den folgenden Seiten nicht genugsam gerühmet? Die Sonne, wenn sie gleich von andren nie gerühmet wird, bleibt doch immer die Sonne. Als Entgelt erwarte ich nicht mehr, als Ihr mir vordem bereits versprochen, und ich wiederhole es nicht, dieweil ich weiß, dass eine so großherzige Seele wie die Eure ihrer eigenen Natur nicht untreu werden kann.
Ich wünsche Euer Exzellenz ein sehr langes Leben, im Falle ich selbst mir lange Hoffnung wünschen darf, und bleibe unterthänigst mit der tiefsten Ehrerbietung ...
Den 7. Juli im Jahr des Herrn 1700, erster Tag
Brennend heiß stand die Sonne hoch am Himmel über Rom um die Mittagszeit jenes siebten Tages im Juli des Jahres 1700, an dem Unser Herrgott mir die Gnade erwies, hart (doch gegen gerechten Lohn) im Garten der Villa Spada arbeiten zu dürfen.
Als ich die Augen vom Boden hob und meinen Blick über die weit entfernten, zur Feier des Tages gänzlich geöffneten Gittertore hinweg zum Horizont schweifen ließ, erspähte ich hinter den Pagen, die das Haupttor bewachten, vielleicht als Erster die Wolke weißen Straßenstaubes, welche die Vorhut der langen Reihe einander folgender Kutschen ankündigte.
Bei diesem Anblick, den ich schon bald mit den anderen Hausdienern der Villa teilte, die wie üblich neugierig herbeigeeilt waren, wurde die fröhliche Betriebsamkeit der Festvorbereitungen noch fieberhafter: Rasch hinter das Casino der Villa zurückgekehrt, wo viel Arbeit wartete, brüllten die Hausmeister, die das Gesinde seit Tagen schon mit Befehlen antrieben, noch ungeduldiger; die wimmelnden Scharen von Kammerdienern stießen gegeneinander, während sie die letzten Speisevorräte im Keller aufhäuften, derweil die Bauern, welche Kisten mit Obst und Gemüse entluden, sich beeilten, wieder auf ihre am Lieferanteneingang abgestellten Karren zu steigen, und nach ihren Frauen riefen, die sich verspäteten, da sie unter den Hausmädchen immer noch nach einer geeigneten Person suchten, der sie die prachtvollen Blumengirlanden anvertrauen konnten, die so samtig und rot waren wie ihre frischen Wangen.
Blasse Stickerinnen lieferten unterdessen Damaststoffe an, Vorhänge und elfenbeinweiße, durchbrochen bestickte Tischtücher, deren bloßer Anblick unter der glühenden Sonne blendete; die Tischler nagelten und feilten noch hastig an Gerüsten, Stühlen und Bühnen, was einen seltsamen Kontrapunkt zum wirren Probespiel der Musiker bildete, die gekommen waren, die Akustik der Freilufttheater zu prüfen; auf Knien maßen die Architekten, die Perücke übel zerdrückt in der Hand und ob der Hitze schnaufend, mit halbgeschlossenen Augen die Flucht eines Gartenwegs, um die Gesamtwirkung ihrer Bühnenausstattungen zu kontrollieren.
All diese Aufregung hatte ihren guten Grund. In zwei Tagen würde Kardinal Fabrizio Spada die Hochzeit seines einundzwanzigjährigen Neffen Clemente und Erben seines ungeheuren Vermögens mit Maria Pulcheria Rocci feiern, die ebenfalls eng mit einem hochwürdigsten Mitglied des Heiligen Kardinalskollegiums verwandt war.
Um das Ereignis angemessen zu begehen, wollte Kardinal Spada eine große Schar ,Kirchenfürsten, Edelleute und Cavalieri mehrere Tage lang mit Divertissements unterhalten, und all dies sollte in der Villa seiner Familie stattfinden, die, umgeben von herrlichen Gärten, auf dem Gianicolo-Hügel in der Nähe der Quelle der Acqua Paola lag, wo man den schönsten und weitesten Blick über die Dächer der Stadt genießt.
Die Sommerhitze hatte es nämlich ratsam erscheinen lassen, die Villa dem ebenso prunkvollen und berühmten Palast der Familie unten in der Stadt, an der Piazza Capo di Ferro, vorzuziehen, wo die Eingeladenen zudem nicht die Freuden des Landlebens hätten genießen können.
Der festliche Empfang sollte freilich schon an diesem Tag offiziell beginnen, und wie vorgesehen, zeichneten sich eben um die Mittagszeit die Kutschen der eilfertigsten Gäste am Horizont ab. Man erwartete eine große Menge adeliger Herrschaften und geistlicher Würdenträger von überall her: die diplomatischen Vertreter der Großmächte, die Mitglieder des Kardinalskollegiums, die Sprösslinge sowie betagtere Angehörige der großen, vornehmen Familien. Die offiziellen Lustbarkeiten würden mit der eigentlichen Trauung anheben. Für diesen Tag war alles sorgfältig vorbereitet, um das Publikum mit natürlichen und künstlichen Bühneneffekten zu überraschen. Man hatte die einheimische Pflanzenwelt um exotische Blumen bereichert und um Pappmachégebilde, die jeden dazu herausfordern würden, sie in ihren tausendfältigen Gestalten zu erkennen, allesamt prächtiger als das Gold Salomons und flüchtiger als das Quecksilber von Idria.
Die Staubwolke um die Kutschen kam, unter dem Lärm der Vorbereitungen geräuschlos, immer näher, und schon als sie auf der Höhe der großen Wegbiegung vor den Toren der Villa Spada anlangte, konnte man die glanzvollen Verzierungen an den Wagen aufblitzen sehen.
Vor allen anderen, so hatte man uns mitgeteilt, würden die Gäste eintreffen, die von außerhalb kamen, damit sie nach den Mühen der Reise der verdienten Ruhe pflegen und einige Abende lang den sanften Frieden der ländlichen Umgebung genießen konnten. So würden sie frisch, erquickt und bereits ein wenig eingestimmt zur Festlichkeit erscheinen. Was der allgemeinen guten Stimmung und dem glücklichen Gelingen des Ereignisses gewiss zuträglich war.
Die römischen Gäste hingegen konnten wählen, ob sie ebenfalls in der Villa Spada logieren wollten, oder es vorzogen, falls zu sehr von Amtspflichten und Geschäften beansprucht, jeden Tag um die Mittagszeit mit ihrer Kutsche einzutreffen und abends in die eigene Residenz zurückzukehren.
Denn nach der Vermählung waren weitere Tage und Abende mit den ergötzlichsten, mannigfaltigsten Pläsieren vorgesehen: neben den Mahlzeiten im Grünen, die ich schon erwähnte, eine Jagd, Musik, Theater, verschiedene Gesellschaftsspiele und sogar eine Akademie. Zum Abschluss sollte es ein Feuerwerk geben. Das Ganze würde, vom Tag der Hochzeit an gerechnet, eine volle Woche der Festivitäten bedeuten, bis zum 15. Juli, dem Tag, an dem man den Gästen vor dem Abschied die besondere Gunst erweisen wollte, sie in die Stadt zu fahren, damit sie den prächtigen, noblen Palazzo Spada an der Piazza Capo di Ferro besichtigen konnten, wo die Großonkel von Kardinal Fabrizio, der selige Kardinal Bernardino und sein Bruder Virgilio, vor einem halben Jahrhundert eine überaus reiche Sammlung an Bildern, Büchern, Antiquitäten und Kostbarkeiten zusammengetragen hatten, ganz zu schweigen von den Fresken, den Malereien mit Trompe-l'œil-Effekten und den vielfältigsten ingeniösen; architektonischen Finessen, die auch ich noch nicht gesehen hatte, von denen ich aber wusste, dass alle Welt sie staunend bewunderte.
Mittlerweile wurde der Anblick der Kutschen am Horizont vom fernen Rattern der Räder auf dem Kopfsteinpflaster begleitet, doch bei genauerem Hinsehen bemerkte ich, dass vorerst nur eine einzige Kutsche eintraf. Natürlich, sagte ich mir, die Herrschaften sind ja stets darauf bedacht, zwischen den jeweiligen Geleitzügen Abstand zu wahren, damit einem jeden der ihm gebührende Empfang zuteil und das Risiko unabsichtlicher Insolenzen vermieden wird, da diese leider nicht selten in Zwietracht, jahrelange Feindschaften und, Gott behüte, sogar in blutige Duelle ausarteten.
Bei dem heutigen Anlass oblag es allerdings der Umsicht des Zeremonienmeisters sowie des Haushofmeisters, des untadeligen Don Paschatio Melchiorri, diese Gefahr zu bannen: Jene beiden würden sich dem Empfang der Gäste widmen, da Kardinal Spada, worüber man bereits in Kenntnis gesetzt, durch seine amtlichen Verpflichtungen als Staatssekretär verhindert war.
Während ich das Wappen des heranrollenden Wagens zu erraten versuchte und in der Ferne schon die Staubwolke der folgenden Kutschen erblickte, pries ich im Stillen noch einmal die weise Entscheidung für die Villa Spada als Schauplatz des Ereignisses: In den Gärten auf dem Gianicolo war nach dem Untergang der Sonne erfrischende Kühle gewiss. Ich wusste das recht wohl, denn ich ging nicht erst seit kurzer Zeit in der Villa Spada ein und aus. Mein bescheidener Hof lag in nächster Nähe, vor dem Stadttor San Pancrazio. Meine Gemahlin Cloridia und ich hatten das Glück, den Bediensteten der Villa Spada frische Kräuter und schöne Früchte unseres kleinen Feldes verkaufen zu dürfen. Und von Zeit zu Zeit bestellte man mich zu einer außergewöhnlichen Arbeit, in Sonderheit dann, wenn es darum ging, unzugängliche Stellen wie Dächer oder Dachluken zu erklettern, Unternehmungen, bei denen mich meine geringe Körpergröße durchaus begünstigte. Doch wurde ich auch angefordert, wenn es an Dienstpersonal mangelte, wie aus Anlass des Festes, daher man sogar sämtliche Bedienstete des Palazzo Spada zum Arbeiten in die Villa versetzt hatte. Im Übrigen hatte der Kardinal die Gelegenheit genutzt, um im Palazzo verschiedene Verschönerungsarbeiten ausführen zu lassen, darunter die Bemalung eines den Brautleuten zugedachten Alkovens mit Fresken.
Seit ein paar Monaten stand ich also unter dem Befehl des Blumenmeisters und beschäftigte mich eifrig mit Umgraben, Pflanzen, Beschneiden und Pflegen. Es gab nicht wenig zu tun. Die Villa Spada sollte ihren Besitzern alle Ehre machen. Auf dem freien Platz vor dem Eingangsportal der Villa hatte man Laubengänge aufgestellt, alle mit Grünpflanzen geschmückt, die sich, zu üppigen Spiralen gezüchtet, wie eine weiche, duftende Schlange um Säulen und kleine Pfeiler wanden und sich mählich verjüngten, bis sie mit den kleinen Verzierungen der Arkaden verschmolzen. Den Eingangsweg, der gewöhnlich zwischen schlichten Reihen von Weinstöcken verlief, säumten nun zwei Flügel aus herrlichen, blühenden Zierbeeten. Überall waren die Mauern mit grüner Farbe angestrichen worden, auf die man künstliche Fenster gemalt hatte; die nach den Anweisungen des Blumenmeisters perfekt gestutzten Wiesen kamen einer Liebkosung gleich und verlangten danach, mit bloßem Fuße erkundet zu werden.
Sodann vor dem Casino der Villa, dem eigentlichen Wohngebäude, angelangt, wurde man von dem wohltuenden Schatten und betäubenden Wohlgeruch einer großen, von Glyzinien umrankten Pergola empfangen, die ein ephemerer Bau aus festlich mit Blattgrün verkleideten Bögen stützte.
Neben dem Casino lag der italienische Garten, der aufs Schönste neu hergerichtet worden war. Es war ein Giardino segreto, das heißt ein von Mauern umgebener Garten. Auf den Wänden, die ihn verbargen, konnte man Landschaftsmalereien und mythologische Szenen sehen: Überall lugten Gottheiten, Putten und Satyrn hervor. Im Inneren des Gartens mit seinem kühlenden Schatten konnte, wer sich geschützt vor neugierigen Blicken in die Ruhe und Kontemplation zurückziehen wollte, ungestört Ulmen und Pappeln aus Capocotta, Sauerkirsch- und Pflaumenbäume, Zibebe-Trauben, üppige Weinreben, Bäume aus Bologna und Neapel, Kastanien, wild wachsende Stämme, Quittenbäume, Platanen, Granatapfel- und Maulbeerbäume, außerdem kleine Brunnen, Wasserspiele, perspektivische Täuschungen, Terrassierungen und tausenderlei andere Attraktionen bewundern.
Es folgte der Hortus sanitatis, der Apothekergarten, ebenfalls von oben bis unten zur Gänze neu bepflanzt, wo frische Heilkräuter für Arzneitränke, Breiwickel, Pflaster und jegliche Nutzung in der ärztlichen Kunst gezüchtet wurden. Die Medizinpflanzen wurden von Salbei- und Rosmarinhecken umschlossen, die man zu akkuraten geometrischen Figuren gestutzt hatte, und ihr Odeur erfüllte den Äther und verwirrte die Sinne des Besuchers. Auf der Rückseite des Gebäudes führte ein breiter Weg an einem schattigen Wäldchen vorbei zur Privatkappelle der Familie Spada, wo die Hochzeit gefeiert werden sollte. Von hier aus zweigten, dem Gefälle des Hügels hinunter zur Stadt folgend, wie ein Dreizack drei kleine Wege ab, von denen einer zu einer Freilichtbühne führte (die eigens für das Fest gebaut und fast fertig gestellt war), der zweite zu einem Landhaus (als Schlafstätte für die Wächter, Schauspieler, Brunnenmeister und wen sonst immer gedacht), und der dritte führte zum Hinterausgang.
Zurück im vorderen Teil der Villa kam man hingegen über eine lange, von der ländlichen Anmutung des Weinbergs umgebene Allee (die parallel zum Eingangsweg, doch weiter im Inneren verlief) zum Brunnenrund des Nymphäums und gelangte schließlich zu einer gepflegten kleinen Wiese, auf der für die Mahlzeiten im Freien Bänke und Tische aufgestellt worden waren. Die überreich mit Schnitzereien und Intarsien geschmückten Möbel empfingen Schatten von prächtigen Zeltkonstruktionen aus gestreiftem Leinen.
Der ahnungslose Besucher blieb staunend davor stehen, bis er erkannte, dass dieses Gepränge nichts anderes war als der Rahmen, der den Auftakt zum stupendesten Anblick des ganzen Weinbergs bildete: In die verwundert geweiteten Pupillen prägte sich ihm nun eine fulminante Reihe römischer Bollwerke und zinnengekrönter Mauern, die sich, unversehens aus der Tiefe ihrer jahrtausendealten, unsichtbar schlummernden Fundamente auftauchend, zu seiner Rechten bis an den Horizont erstreckten. Die Lider flatterten ihm bei diesem unerwarteten, grandiosen Anblick, und das Herz klopfte ungestüm. Inmitten all dieser mit Wohlgerüchen und Zauber so freigiebigen Herrlichkeiten schien alles zur Lust geschaffen und alles war Poesie.
So stieg die Villa Spada zum großen Schauplatz dieser Feierlichkeiten auf und schien nicht mehr das kleine, wiewohl entzückende sommerliche Landhaus zu sein, das angesichts des Reichtums und der Erhabenheit des weitaus prächtigeren Palazzo Spada an der Piazza Capo di Ferro nahezu verblasste.
Die Villa durfte sich nun ohne Scham mit den berühmten Lusthäusern des sechzehnten Jahrhunderts messen, als Giuliano da Sangallo und Baldassare Peruzzi Rom mit ihren Künsten veredelten. Während Sangallo für die Villa Chigi angestellt worden war, hatte Kardinal Alidosi sich Peruzzi für sein Landhaus an der Magliana gewünscht. Zur gleichen Zeit begann Giulio Romano mit der Villa von Datario Turini auf dem Gianicolo, derweil Bramante und Raffael den vatikanischen Belvedere und die Villa Madama mit ihren genialen Werken schmückten.
Doch schon seit unvordenklichen Zeiten war es in der Ewigen Stadt bei den edlen Herren Brauch, sich herrliche Residenzen im Grünen bauen zu lassen, wo man dank des ländlichen Friedens der alltäglichen Sorgen und Plagen vergessen konnte, auch wenn man sich nur wenige Male im Jahr dorthin begab. Ohne bis zu den großartigen Landhäusern zurückzugehen, die schon die Römer errichten ließen (und die viele vortreffliche Dichter, von Horaz bis Catull, besungen hatten), wusste ich durch Lektüren oder Gespräche mit manch einem gelehrten Buchhändler (aber mehr noch mit alten Bauern, welche die Weinberge und Gärten der Stadt besser kannten als irgendjemand sonst), dass es bei den großen römischen Fürsten vor allem in den vergangenen zweihundert Jahren Mode geworden war, sich ein Lustschlösschen vor der Stadt bauen zu lassen. Und so hatten innerhalb der Aurelianischen Mauern und in ihrer unmittelbaren Nähe der Weinberg und das dazugehörige Landhaus, das heißt der Garten und seine Villa, allmählich die Oberhand über kahle Ebenen und feuchte kleine Felder gewonnen.
Und während die ersten Villen noch Zinnen und Türmchen besaßen (wie sie noch heute am Eingang der im Übrigen friedfertigen Vigna Capponi zu sehen sind), eine imposante Hinterlassenschaft der Wirren des Mittelalters, als die Wohnsitze der Adeligen Festungen glichen, ward der Stil im Laufe weniger Jahrzehnte heiterer und anmutiger, und nun wünschte jeder große Herr eine Residenz sein Eigen zu nennen, die auf Weinberge, Gärten, Obstbäume, Wälder oder Pinienhaine blickte und ihm den süßen Trug vorspielte, alles zu besitzen und zu beherrschen, was der Blick umfing, ohne sich aus dem Sessel erheben zu müssen.
***
In schönstem Einklang mit den sich lebhaft entfaltenden Festvorbereitungen innerhalb der grünen Umfriedung der Villa stand die fröhliche Atmosphäre, die in der Heiligen Stadt herrschte. Das Jahr des Herrn 1700, in dem wir uns befanden, war nämlich ein Heiliges Jahr. Aus allen Teilen der Welt strömten endlose Pilgerscharen herbei, um die Vergebung der Sünden und die Gnade des Ablasses zu erflehen. Sobald sie von der Via Romea aus den Kamm der umliegenden Hügel erreichten und die Kuppel von St. Peter erblickten, stimmten die Gläubigen (die eben darum »Romei«, Rompilger, genannt werden) einen Lobgesang auf die erhabenste aller Städte an, die rot ist vom purpurnen Blut der Märtyrer und weiß von den Lilien der Jungfrauen Christi. Herbergen, Hospize, Pensionen und sogar Privatwohnungen, die der Bewirtungspflicht unterlagen, waren überfüllt mit Pilgern; durch Gässchen und über Plätze strömte Tag und Nacht das Gewimmel der frommen Scharen, die den Himmel mit ihren Litaneien erfüllten. Taghell ward die Nacht von den Fackelzügen der frommen Bruderschaften gelichtet, die unaufhörlich die Straßen der inneren Stadtviertel belebten. Inmitten so inbrünstiger Gläubigkeit konnte nicht einmal mehr das grausame Schauspiel der Flagellanten entsetzen: Das Schnalzen der Peitschen, mit denen die Asketen gegen ihren verschwitzten, zerfetzten Rücken wüteten, bildete einen Kontrapunkt zu den keuschen Gesängen, die die Novizinnen in den kühlen Kreuzgängen der Klöster anstimmten. Kaum in der Stadt des Stellvertreters Christi angekommen, begaben sich die Pilger, obschon von der langen Reise zu Tode erschöpft, sofort nach St. Peter, und erst wenn sie lange am Grab des Apostels gebetet hatten, gönnten sie sich ein paar Stunden der Ruhe. Bevor sie am nächsten Tag aus ihren Unterkünften kamen, beugten sie die Knie zur Erde, erhoben ihre Herzen zum Himmel, bekreuzigten sich, sannen über das Mysterium des Lebens Jesu und der Allerheiligsten Jungfrau Maria nach, beteten den Rosenkranz und begannen dann mit dem Rundgang der vier Pilgerbasiliken des Heiligen Jahres, auf die das Vierzig-Stunden-Gebet folgt oder das Besteigen der Heiligen Treppe, wodurch sie die vollkommene Vergebung ihrer Sünden erlangen würden.
Alles schien also in vollkommener, würdiger Übereinstimmung mit dem feierlichen Anlass zu verlaufen, der im Abstand von fünfundzwanzig Jahren seit den Zeiten Bonifaz VIII. Tausende von Pilgern nach Rom führte. Doch nicht alles, um die Wahrheit zu sagen. Eine ängstliche Sorge lastete still auf den Massen der Gläubigen und Römer: Seine Heiligkeit war schwer erkrankt.
Schon zwei Jahre zuvor war Papst Innozenz XII., mit bürgerlichem Namen Antonio Pignatelli, von einer schweren Form der Gicht heimgesucht worden, die sich langsam verschlimmert hatte, bis es ihm unmöglich geworden war, seinen Aufgaben wie gewohnt nachzukommen. Im Januar des Heiligen Jahres war eine leichte Besserung eingetreten, und im Februar hatte er dem Konsistorium vorsitzen können. Aufgrund seines Alters und seiner Gebrechen war er jedoch nicht in der Lage gewesen, die Heilige Tür zu öffnen.
Je weiter das Heilige Jahr voranschritt, desto größer wurde die Zahl der Gläubigen, die in Rom eintrafen. Und es bekümmerte den Papst, dass er seine frommen Verpflichtungen nicht erfüllen konnte, bei denen ihn nun Bischöfe und Kardinäle ersetzen mussten. Den Gläubigen, die sich täglich zu Tausenden in St. Peter einstellten, nahm der Kardinal Pönitentiar die Beichte ab.
In der letzten Februarwoche ging es dem Oberhirten wieder schlechter. Im April hatte er dann die Kraft gefunden, die Masse der Gläubigen vom Balkon des Papstpalastes auf dem Monte Cavallo aus zu segnen. Im Mai hatte er sich sogar persönlich in die vier Patriarchalbasiliken begeben, und gegen Ende des Monats hatte er den Großherzog der Toskana empfangen. Mitte Juni schien er fast wiederhergestellt: Er hatte zahlreiche Kirchen besucht, außerdem den Brunnen San Pietro in Montorio in unmittelbarer Nähe der Villa Spada.
Doch jeder wusste, dass die Gesundheit Seiner Heiligkeit gefährdeter war als eine Schneeflocke bei Anbruch des Frühlings; und die Hitze der Sommermonate versprach nichts Gutes. Wer direkten Umgang mit dem Papst hatte, berichtete flüsternd von häufigen Erschöpfungsanfällen, von durchlittenen Nächten, von jähen, furchtbaren Koliken. Immerhin, versicherten die Kardinäle einander in ihren kummervollen Gesprächen, war der Heilige Vater fünfundachtzig Jahre alt.
Das von unserem Oberhirten Innozenz XII. so glücklich eröffnete Heilige Jahr 1700 würde also vielleicht von einem anderen Papst beendet werden: seinem Nachfolger. Eine noch nie da gewesene Situation, so überlegte man in Rom, aber deswegen nicht unmöglich. Einige sahen bereits ein Konklave im November voraus, andere sogar schon im August. Die Sommerhitze, prophezeiten die größten Pessimisten, werde die letzten Widerstandskräfte des Papstes brechen.
Die Seelenlage in der Kurie (und die jedes Römers) war darob gespalten zwischen der heiteren Atmosphäre des Heiligen Jahres und den schlechten Nachrichten über die Gesundheit des Papstes. Selbst ich hatte ein persönliches Interesse an der Sache: Solange der Heilige Vater lebte, würde ich die Ehre haben, wenngleich nur gelegentlich, demjenigen zu dienen, der wie kein anderer in Rom gefürchtet und verehrt wurde: dem hochwürdigsten Kardinal Fabrizio Spada, den Seine Heiligkeit zu seinem Staatssekretär erwählt hatte.
Ich durfte gewiss nicht behaupten, dass ich den verehrtesten, gütigsten Kardinal Spada gut kannte. Doch ich hatte oft sagen hören, er sei außerordentlich rechtschaffen und wahrhaftig, sowie höchst umsichtig und von schärfstem Verstande. Nicht zufällig hatte ihn Seine Heiligkeit Innozenz XII. an seiner Seite haben wollen. Darum ahnte ich, dass das bevorstehende Fest kein schlichtes gemeinschaftliches Mahl edler Geister sein würde, sondern eine erlauchte Zusammenkunft von Kardinälen, Botschaftern, Bischöfen, Fürsten und anderen hoch stehenden Personen. Und alle würden die Brauen vor Erstaunen heben angesichts der Vorführungen von Musikern und Komödianten, der poetischen Darbietungen, der gelehrten Ansprachen und üppigen Gelage inmitten grüner Kulissen und Bühnen aus Pappmaché in den Gärten der Villa Spada, wie man sie in Rom seit der Zeit der Barberini nicht mehr gesehen.
***
Unterdessen hatte ich das Wappen der ersten Kutsche erkennen können: Es war dasjenige der Familie Rospigliosi. Darunter hing jedoch eine auffällige Quaste in den Farben der Familie, was bedeutete, dass die Kutsche einen geschätzten Gast und Schützling dieses vornehmen Geschlechts transportierte, kein Familienmitglied.
Der Wagen lenkte direkt auf die Ehrenpforte zu. Doch meine Neugierde reizte das Vorfahren der Kutschen, das Öffnen der Wagenschläge und das darauf folgende höfliche Empfangsritual zwischen den hohen Herrschaften nicht mehr. In der ersten Zeit, ja, da hatte ich mich hinter eine Ecke des Casinos gestellt, um die Scharen von Dienern zu beobachten, die mit Schemeln beim Aussteigen aus den Kutschen behilflich waren, die Dienstmädchen mit ihren Fruchtkörben, der ersten Hommage des Hausherren, die Reden des Zeremonienmeisters, die aufgrund der Müdigkeit der Neuankömmlinge stets auf halber Strecke abbrachen, und dergleichen mehr.
Ich entfernte mich, um die Ankunft jener hohen Herrschaften nicht durch meine bescheidene Gegenwart zu stören und machte mich wieder an die Arbeit.
Während ich damit beschäftigt war, Wiesen umzugraben, Büsche zu stutzen, Hecken in Form zu schneiden und Unkraut zu zupfen, hob ich von Zeit zu Zeit die Augen und erfreute mich an dem Anblick der Stadt auf den sieben Hügeln. Unterdessen machte die sanfte Sommerbrise mir die lieblichen Klänge der Orchesterprobe zum Geschenk. Mit der Hand an der Stirn zum Schutz vor dem grellen Sonnenlicht, erblickte ich am äußersten linken Rand meines Gesichtsfeldes die großartige Kuppel des Petersdomes, rechts die bescheidenere, doch nicht weniger schöne Kuppel von Sant'Andrea della Valle, in der Mitte den kühn emporragenden Bau von Sant'Ivo alla Sapienza, gleich daneben, unterwürfig geduckt, die heidnische Kuppel des Pantheon und im Hintergrund schließlich, mächtig und erhaben, den Quirinale, den apostolischen Palast auf dem Monte Cavallo.
Gerade als ich eine dieser kurzen Pausen beendet hatte und mich wieder mit der Rundsichel an einigen Bäumchen zu schaffen machen wollte, sah ich einen Schatten neben den meinen fallen.
Ich beobachtete ihn lange: Er bewegte sich nicht. Meine Hand dagegen, die die Sichel hielt, bewegte sich von allein. Die Spitze der Klinge zeichnete auf den Sand des Gartenweges einen Umriss um den Schatten neben mir. Die Soutane, die Perücke und der Hut eines Abbé ... wie um der Untersuchung durch meine Hand zu willfahren, drehte sich in diesem Moment der Schatten langsam zur Sonne um und zeigte ihr sein Profil: So konnte ich eine Hakennase, ein fliehendes Kinn, einen anmaßenden Mund in den Boden ritzen ... Die Hand, die diese Linien jetzt eher zu liebkosen schien als sie nachzuzeichnen, zitterte. Ich zweifelte nicht mehr.
***
Atto Melani. Ich vermochte die Augen nicht von der Silhouette loszureißen, die ich in den Sand gemalt hatte, denn ein wirres Gedankenknäuel trübte mir Sicht und Gehör. Abbé Melani ..., für mich Signor Atto. Atto, wirklich Atto ...
Der Schatten wartete gutmütig.
Wie viele Jahre waren seither vergangen? Sechzehn. Nein, siebzehn rechnete ich und suchte all meinen Mut zusammenzunehmen, damit ich mich umdrehen konnte. Tausend Gedanken und Erinnerungen zogen, unter Missachtung aller Gesetze der Zeit, in diesen wenigen Sekunden ihre Bahn. Fast siebzehn Jahre ohne irgendein Lebenszeichen vom Abbé Melani. Und nun tauchte er wieder auf, hier war sein Schatten, hinter mir, und er überragte meinen, so ging es mir immer wieder mechanisch durch den Kopf, während ich mich schließlich vom Boden erhob und mich sehr langsam umwandte.
Und nach einer Weile behaupteten sich meine Pupillen endlich gegen die Sonne.
Er stand auf einen Stock gestützt, ein wenig kleiner und gebeugter, als ich ihn zuletzt gesehen hatte. Wie ein Geist vergangener Zeiten war er mit der Soutane aus grauviolettem Leinen und dem Hut eines Abbé bekleidet, genau wie bei unserer allerersten Begegnung, und offenbar unbekümmert darüber, dass dieses Habit inzwischen unmodern geworden war. Vor meinem glasigen, bestürzten Blick hub er mit lakonischer, entwaffnender Unbefangenheit an zu sprechen:
»Ich gehe mich ausruhen: Ich bin gerade angekommen. Wir sehen uns später. Ich werde dich rufen lassen.«
Damit verschwand er wie ein Gespenst im Gleißen der Hitze Richtung Casino.
Ich blieb wie versteinert stehen. Wie lange ich so dastand, reglos, mitten im Garten, weiß ich nicht zu sagen. Gleich dem weißen, kalten Marmor der Galatea vermochte der lebendige Hauch meine Brust erst nach und nach zu erwärmen. Dann aber überwältigte mich der unerwartete Aufruhr, den der reißende Strom liebevoller und schmerzlicher Empfindungen, die mich seit Jahren bei dem Gedanken an Abbé Melani ergriffen, in meinem Herzen anrichtete.
***
Die Briefe, die ich ihm nach Paris geschickt hatte: Ein Abgrund schwarzen Schweigens hatte sie verschlungen. Jahr um Jahr hatte ich in Erwartung einer Antwort die Poststelle Frankreichs vergeblich bestürmt. Allein um meine Furcht zu bändigen, hätte ich mich zuletzt mit einer düsteren, endgültigen Mitteilung abgefunden, die ich mir tausendmal vorgestellt hatte:
Es ist meine traurige Pflicht, Euch vom Tod des Herren Abbé Melani zu unterrichten ...
Stattdessen nichts. Bis zu diesem Moment, da sein unerwartetes Erscheinen mir den Atem in der Kehle stocken ließ. Ich konnte es kaum glauben: Soeben eingetroffen, war er, der vornehme Gast der Rospigliosi, der mit allen Ehren in die Villa Spada Geladene, zuallererst zu mir gekommen, einem über seinen Spaten gebückten Bauern. Freundschaft und Treue des Abbé Melani hatten über die Entfernung und die langen Jahre gesiegt.
Ich verrichtete in größter Hast einen Teil meiner Arbeit und eilte dann auf dem Rücken meines Maultiers nach Hause. Ich konnte es nicht erwarten, Cloridia die Nachricht zu überbringen!
Auf dem Weg sagte ich mir immer wieder gerührt: »Worüber wunderst du dich?« Sah es ihm doch ganz ähnlich, dieses brüske, überraschende Auftauchen. Aber welch ein Tumult der Gefühle und welch ein Stich ins Herz!, während ich nun, wie in einem Traum, noch einmal den Wirbel aus gelehrten Lektionen und geistigen Leidenschaften erlebte, den Abbé Melani mir damals enthüllt hatte und in den ich hineingezogen worden war, als ich ihm auf seinen gefährlichen Wegen folgte ...
Nach einer Weile gesellte sich jedoch eine Frage zu meiner Freude und Dankbarkeit. Wie hatte Atto mich in der Villa Spada aufspüren können? Folgerichtig wäre es gewesen, wenn er mich in der Via dell'Orso gesucht hätte, in dem Haus, das einst die Locanda del Donzello beherbergt hatte, wo ich als Hausbursche gedient und wir uns kennen gelernt hatten. Stattdessen war Atto, offensichtlich von Kardinal Spada zur bevorstehenden Hochzeit seines Neffen eingeladen, direkt nach seiner Ankunft zu mir geeilt, als wisse er genau, wo er mich finden würde.
Von wem hatte er es erfahren? Mit Sicherheit nicht von jemandem aus der Villa Spada: Niemand wusste von unserer alten Bekanntschaft, ganz abgesehen davon, dass meine Person keine besondere Beachtung fand. Überdies hatten wir keine gemeinsamen Bekannten – nur jenes weit zurückliegende Abenteuer im Donzello vor siebzehn Jahren. Über diese außergewöhnlichen Begebenheiten hatte ich zunächst ein knappes Tagebuch geführt, um mit dessen Hilfe später ausführliche Memoiren zu verfassen, auf die ich, nebenbei gesagt, sehr stolz war. In meinem letzten Schreiben, das ich ihm vor einigen Monaten geschickt hatte, meinem letzten, verzweifelten Versuch, Nachrichten von ihm zu erhalten, hatte ich Atto sogar davon berichtet.
Während ich im leichten Trab über die Felder ritt, ließ ich meinen Erinnerungen freien Lauf, und einige Augenblicke lang erlebte ich jene längst vergangenen, erstaunlichen Ereignisse noch einmal: die Pest, die Giftmorde, die Verfolgungsjagden im römischen Untergrund, die Schlacht um Wien, die Verschwörungen der europäischen Herrscher ...
Wahrlich brillant hatte ich das alles in meinen Memoiren erzählt, dachte ich, tatsächlich hatte es mir anfangs sogar selber Freude gemacht, in schlaflosen Nächten erneut darin zu lesen. Und es störte mich nicht mehr, dass ich dabei auch alle Schandtaten Attos wieder vor Augen hatte, seine Vergehen, seine Gemeinheiten und gotteslästerlichen Taten. Ich brauchte nur ans Ende meiner Schrift gelangen, um mich ermutigt, ja sogar glücklich zu fühlen: die Liebe meiner Cloridia, die mich Deo gratias immer noch begleitete; die ehrbare Feldarbeit und zu guter Letzt der Hinweis darauf, dass ich jüngst meinen Einstand in der Villa. Spada gehalten hatte, ein namenloser, verkannter Bauer, von dessen erstaunlichen Erfahrungen niemand etwas ahnen konnte. Ach ja, Villa Spada ...
Wie von tausend Skorpionen gestochen, trieb ich mein Maultier an und eilte nach Hause.
Leider hatte ich es bereits begriffen.
Cloridia war nicht im Haus. Atemlos stürzte ich mich auf die Truhen, in denen ich all meine Bücher aufbewahrte. Ich leerte sie hitzig, wühlte bis auf den Grund: Die Memoiren waren verschwunden.
***
»Dieb, Räuber, Betrüger«, knurrte ich leise. »Und ich bin ein Dummkopf, ein vollkommener Idiot, ein Esel.«
Was für ein Fehler, Atto von meinen Memoiren zu schreiben! Diese Seiten bargen zu viele Geheimnisse, zu viele Beweise der Treulosigkeiten und Tücken, derer Abbé Melani fähig war. Kaum hatte er von ihrer Existenz erfahren – ach, jetzt erst begriff ich das –, hatte er einen seiner ruchlosen Kumpane in Rom aufgehetzt und sie entwenden lassen. In mein unbewachtes Häuschen einzudringen und alles zu durchstöbern, musste ein Kinderspiel gewesen sein.
Ich verfluchte Atto, mich selber und wen auch immer er geschickt hatte, meine schönen Memoiren zu stehlen. Aber was konnte ich schon anderes vom Abbé Melani erwarten? Es genügte, sich ins Gedächtnis zu rufen, was ich über seine früheren, trüben Machenschaften wusste.
Kastrierter Sänger und Spion der Franzosen: Das sagte doch alles über ihn. Seine Karriere als Singvögelchen war nun schon seit langem beendet. Als junger Mann war er freilich ein berühmter Sopran gewesen, und unter dem Deckmantel seiner Konzerte hatte er sich jahrelang an den Höfen halb Europas als Spion betätigt.
Listen, Lügen und Betrug waren sein täglich Brot; Hinterhalte, Komplotte und Morde seine Weggefährten. Er war imstande, eine Pfeife in seiner Hand als Pistole durchgehen zu lassen; dir die Wahrheit zu verschweigen, ohne lügen zu müssen; aus purer Berechnung in Rührung zu geraten (und dich zu rühren); er kannte und praktizierte die Kunst des Beschattens und des Diebstahls.
Sein Verstand jedoch war überragend schnell und scharf. Seine Kenntnisse von Staatsangelegenheiten reichten, soweit ich mich entsann, bis in die bestgehüteten Geheimnisse der Königreiche und königlichen Familien. Überdies durchdrang sein wacher, geschliffener Geist die menschliche Seele wie das Messer den nachgiebigen Speck. Seine blitzenden Augen erwarben ihm Sympathien und mit seiner Redegewandtheit eroberte er sich mühelos die Anerkennung seines Gegenübers.
Doch all seine hervorragenden Eigenschaften standen im Dienst der schändlichsten Zwecke. Wenn er dich durch eine Enthüllung in seine Pläne einweihte, geschah es nur, um dir Zustimmung zu entlocken. Wenn er behauptete, er sei auf einer Mission, vergaß er darüber gewiss nicht seine schmutzigen persönlichen Interessen. Wenn er dir schließlich seine Freundschaft versprach, so erinnerte ich mich grollend, wollte er dir damit nur die Gefälligkeiten abpressen, die ihm besonders nützlich waren.
Der Beweis dafür? Seine Gleichgültigkeit gegenüber alten Freunden. Er hatte mich siebzehn Jahre lang ohne Nachricht gelassen. Und jetzt rief er mich, als wäre nichts gewesen, dringend in seine Dienste ...
»Nein, Signor Atto, ich bin nicht mehr der Junge von vor siebzehn Jahren«, hätte ich ihm sagen und ihm dabei direkt in die Augen blicken mögen. Ich hätte ihm schon gezeigt, dass ich mittlerweile ein lebenserfahrener Mann war, nicht mehr tödlich verlegen vor hohen Herrschaften, sondern lediglich ehrerbietig, dass ich fähig war, für jeden Fall Vorsorge zu treffen und meinen eigenen Vorteil zu erkennen. Und selbst wenn mich alle wegen meiner geringen Körpergröße immer noch einen Jungen nannten, war ich doch ein anderer Mensch als der Hausbursche, den Atto vor vielen Jahren kennen gelernt hatte und fühlte mich auch so.
Nein, ich konnte das Benehmen des Abbé Melani nicht akzeptieren. Und maxime konnte ich den Diebstahl meiner Memoiren nicht dulden.
Ich warf mich aufs Bett, um mich auszuruhen und mich von der Gesellschaft dieser und anderer trauriger Überlegungen zu befreien, zerwühlte stattdessen aber unentwegt die Laken. Erst jetzt fiel mir ein, dass Cloridia mir angekündigt hatte, sie werde nicht nach Hause kommen: Wie jede gute Hebamme oder Wehemutter oder Obstetrix oder Geburtshelferin, wie immer man sie nennen will (eine solche war sie nach langen Jahren praktischer Erfahrung geworden), verbrachte sie die letzten Tage vor dem Partus, also der Entbindung, im Hause der Wöchnerin. Bei ihr waren meine innig geliebten Küken, unsere beiden kleinen Mädchen, die inzwischen gar nicht mehr so klein waren: Die eine zehn, die andere sechs Jahre alt, waren meine nun schon recht großen Töchter ernsthaft in die Fußstapfen der (angebeteten) Mutter getreten, und das nicht nur als ihre Schülerinnen, damit sie in dieses überaus wichtige Gewerbe recht wohl eingewiesen würden, sondern auch, auf dass sie ihr bei jeder Gelegenheit mit allem, was Not tat, zur Hand gehen könnten, zum Beispiel, indem sie warme Fette und Öle, Trockentücher, Schere und Faden für die Nabelschnur reichten oder auch beim gewandten Herausziehen der Plazenta, also des Mutterkuchens, und bei ähnlichen Geschäften behilflich waren.
Meine Gedanken kreisten ein wenig um sie: Die beiden kleinen Küken zeigten vor anderen Menschen eine Verständigkeit, welche nur ihrer Lebhaftigkeit im Elternhause gleichkam, und folgten der Mama wie ein Schatten. Ihre Abwesenheit ließ mir das Haus noch leerer und trauriger erscheinen und erinnerte mich an meine freudlose Kindheit als Findelkind.
Auf den Flügeln der Einsamkeit hatten die düsteren Gedanken erneut die Oberhand gewonnen. Schlaflosigkeit umschlang mich mit kalter Umarmung, und ich erfuhr, wie bitter das eheliche Lager ohne den Trost der Liebe ist.
Keine Stunde später, das Mittagessen hatte ich ausgelassen, weil mir der Appetit fehlte, entschloss ich mich, in die Villa Spada zurückzukehren, um wieder meinen Verpflichtungen nachzugehen. Wiewohl von kurzer Dauer, hatte die Ruhepause doch die gewünschte Wirkung gehabt: Der bohrende Gedanke an Abbé Melani und seine plötzliche Rückkehr, von der ich selbst nicht mehr wusste, ob sie mir willkommen oder lästig war, hatte mir endlich eine Schonfrist gewährt. Abbé Melani, so überlegte ich, war gekommen, um den friedlichen Kontrapunkt meines Daseins wie ein unangenehmer Tritonus zu stören. Es war richtig, dass ich jetzt versuchte, nicht mehr an ihn zu denken.
Er würde mich rufen lassen, hatte er angekündigt: Bis dahin konnte ich mich also anderen Dingen widmen. Ich hatte viel zu tun und begab mich an eine der Arbeiten, die mich am besten ablenkten: das Säubern der Volieren. Der Diener, der gewöhnlich damit betraut war, musste immer häufiger das Bett hüten, der Grund war eine böse Verletzung am Fuß, die nicht mehr heilen wollte. Es war also nicht das erste Mal, dass ich ihn bei dieser Aufgabe vertrat. Ich ging das Vogelfutter holen und machte mich auf den Weg.
Der Leser möge sich nicht wundern, dass die Villa Spada eine so exotische Attraktion besaß wie die Voliere. Waren Gelegenheiten zur Zerstreuung in den römischen Villen doch seit jeher äußerst begehrt. Kardinal de' Medici hielt in seiner Villa auf dem Pincio Bären, Löwen und Straußenvögel; in den Villen der Borghese und Pamphili liefen Hirsche und Damwild frei herum. Zu der Zeit von Papst Leo X. wanderte sogar ein Elefant mit Namen Annone durch die vatikanischen Gärten. Aber nicht nur Tiere sollten die Gäste verblüffen und divertieren, es fehlte auch nicht an köstlichen Vergnügungen wie dem Pall Mall (welches man in der Villa Pamphili zu spielen pflegte) oder dem Boccia, gelegentlich auch Billard genannt, das in der Villa der Cavalieri von Malta oder in der Villa Costaguti gespielt wurde, und zwar auf einem mit Seife polierten Grund oder auf einem mit Tuch bespannten Tisch. Und es gab das Billard im Freien, wie in der Villa Mattei, das gegen die schwermütige Stimmung der Sommerabende half.
Die Voliere befand sich in einer abgelegenen Ecke der Villa zwischen der Kapelle und dem Garten, dem Blick durch eine Baumreihe und eine dichte, hohe Hecke verborgen. Sie war so angelegt worden, dass sie im Winter Sonne und im Sommer Schatten empfing, damit die Vögel nicht den lästigen Unbilden des Wetters ausgesetzt waren. Sie hatte das Aussehen einer kleinen Burg mit quadratischem Grundriss, über den vier Ecktürmen und dem Hauptteil wölbten sich Kuppeln aus Metallgeflecht, die ihrerseits von schönen Fialen mit eisernen Fähnchen gekrönt wurden. Das Innere zierten Fresken mit weiten Himmels- und Landschaftsansichten, damit die Vögel den Eindruck eines größeren Raumes hatten. Steineichen und Lorbeerbäume waren hineingestellt worden, Töpfe mit Gestrüpp, um daraus Nester zu bauen, und vier große Tränken. Die Bewohner (von denen einige Grüppchen in getrennten Käfigen hausten) waren recht zahlreich und dem Auge wie dem Ohr außerordentlich wohlgefällig: Nachtigallen, Pfauentauben, Rebhühner, Steinhühner, Frankoline, Fasanen, Gartenammern, Grünfinken, Amseln, Pieper, Buchfinken, Turteltauben, Kernbeißer und andere mehr.
Unsicher betrat ich die Voliere und verursachte sofort ein großes Durcheinander aus aufgeregtem Flügelschlagen. Vögel, so war mir gesagt worden, müssen immer von demselben Menschen ernährt und versorgt werden, zu dem sie dann im Laufe der Zeit Zutrauen fassen. Meine Anwesenheit anstelle des gewohnten Mannes rief einige Unruhe hervor. Ich ging vorsichtig hinein, während Pfauentauben mich nervös beobachteten und ein Schwarm kleiner Vögel mich mit drohender Gebärde umschwirrte. Ein Schreckensschauer durchfuhr mich, als eine Amsel sich kühn auf meiner Schulter niederließ, um mir den Nacken mit kräftigen Flügelschlägen zu umfächeln, und wie durch ein Wunder stieß ich nicht mit einem Frankolin zusammen, der keck auf mich zugeflattert kam.
»Wenn ihr nicht sofort aufhört, gehe ich, und es gibt kein Mittagessen!«, drohte ich.
Doch als Antwort erhielt ich ein nur noch lauteres Krächzen, Pfeifen und Schnattern sowie neue, gefährliche Luftangriffe kaum eine Handbreit vor meinem Kopf.
Eingeschüchtert flüchtete ich mich in eine Ecke, bis der Aufruhr sich legte. Für die Betreuung von Vögeln und Volieren tauge ich nicht, dachte ich.
Als endlich auch die frechsten Flieger wieder zur Ruhe gekommen waren, begann ich, die Tränken und Futternäpfe zu säubern, um sie dann mit frischem Wasser, Zichorie, Mangold, Vogelmiere, Kopfsalat, Wegerichsamen, Getreidekörnern, Beize, Hirse und Hanfsamen zu füllen. Sodann versorgte ich die Voliere wieder mit Spargelgras, das sich gut zum Nestbau eignet. Während ich ein paar Stücke trockenen Brotes auf dem Boden verteilte, sprang ein junger, hungriger Frankolin auf meinen Arm und versuchte, seinen Gefährten das Beutegut aus schmackhaften Krumen wegzuschnappen.
Nachdem ich noch die Sitzstangen gereinigt und den Kot am Boden aufgefegt hatte, durfte ich endlich wieder durch den Ausgang schlüpfen, froh, den Gestank und das Durcheinander in der Voliere hinter mir lassen zu können. Ich wollte gerade die Türe schließen, da rutschte mir das Herz vor Schreck schier in die Hose.
Ein Pistolenschuss. Eine Kugel, die in nächster Nähe vorbeipfiff. Jemand schoss auf mich.
Instinktiv duckte ich mich, die Arme schützend über den Kopf gelegt. Dann vernahm ich eine harte, laute Stimme, die eindeutig mich meinte:
»Haltet ihn! Er ist ein Dieb!«
Unwillkürlich hob ich die Hände, als wollte ich mich ergeben. Ich drehte mich um, sah aber niemanden. Da schlug ich mir an die Stirn und lächelte, verärgert über mein schlechtes Gedächtnis, hob langsam die Augen und dort erblickte ich ihn, am gewohnten Platz.
»Sehr witzig«, antwortete ich, während ich die Tür der Voliere schloss und versuchte, meinen Schreck zu verbergen.
»Haltet ihn, habe ich gesagt, er ist ein Dieb. Buuum!«
Und mit diesem zweiten Pistolenschuss, der noch echter wirkte als der erste, hatte sich das absonderlichste Wesen der ganzen Villa Spada endgültig angekündigt: Cesare Augusto, Papagei.
An dieser Stelle ist es angezeigt, dass ich vom Naturell und Verhalten dieses seltsamen Federviehs berichte, welches in den Ereignissen, von denen ich erzählen will, eine nicht geringe Rolle spielen wird.
Ich wusste, dass der Papagei wegen seiner Talente von einigen Autoren als »Genie unter den Vögeln«, »Herrscher über Ostindien« oder so ähnlich bezeichnet wird, weil die ersten Exemplare Alexander dem Großen von der Insel Taprobana mitgebracht wurden, und später hat man viele andere Arten in Westindien entdeckt, maxime in Kuba und Manacapan. Außerdem weiß jeder, dass der Papagei (von dem es nach Meinung einiger Fachleute über hundert verschiedene Spezies gibt) das einzigartige Vermögen hat, die menschliche Stimme nachzuahmen, und nicht nur diese, sondern auch Geräusche und Klänge und vieles mehr. Über ein solches Können verfügten vor Jahren der Papagei Seiner Exzellenz Kardinal Madruzzo und der des Cavalier Cassiano Dal Pozzo, wobei Letzterer die menschliche Stimme zwar weniger gut, die Laute von Hunden und Katzen aber vortrefflich nachzubilden vermochte. Es gab sodann einige, die den Ruf anderer Vögel, sogar den verschiedener Arten, sehr gut nachmachen konnten. Außerhalb des Kirchenstaates erinnert man sich noch an den Papagei Seiner Durchlaucht von Savoyen, der sich nach Aussage vieler Zeugen mit der Gabe einer raschen, sehr gewandten Rede hervortat. Es heißt, dass der Papagei von Kardinal Colonna sogar das ganze Credo auswendig hersagen konnte. Und auf dem Sitz der Barberini, neben der Villa Spada, war vor kurzem ein weißgelber Papagei von derselben Art wie Cesare Augusto angekommen, der offenbar ebenfalls ein guter Redner war.
Cesare Augusto aber überragte seine Artgenossen bei weitem. Er imitierte die menschliche Stimme perfekt, auch die von Menschen, die er erst seit kurzem kannte und deren Ausdrucksweise er kaum je gehört hatte, wobei er Tonfall, Rhythmus, Akzent und sogar leichte Aussprachefehler akkurat nachahmte. Er wiederholte natürliche Geräusche wie Donner, das Glucksen von Quellen, Blätterrauschen, Windesheulen und sogar das Klatschen der Meereswellen. Nicht weniger geschickt war er bei den Lauten von Hunden, Katzen, Kühen, Eseln, Pferden, natürlich sämtlichen Vogelarten und vermutlich auch anderen Tierlauten, die ich ihn nur noch nicht hatte versuchen hören. Mit größter Echtheit erzeugte er das Knirschen von Türangeln, sich nähernde Schritte, Pistolen- und Arkebusenschüsse, Geklingel, Pferdehufe im Trab, eine Tür, die laut zuschlägt, die Schreie von Straßenverkäufern, das Weinen eines Kindchens, das Klirren sich im Duell kreuzender Klingen, die gesamte Bandbreite des Lachens und Klagens, klapperndes Besteck, das Scheppern von Tellern, klingende Gläser und des Weiteren mehr.
Es war, als sei die ganze Welt für Cesare Augusto ein einziger, unermesslicher Übungsplatz, wo er sein außergewöhnliches, unbeschreibliches, unübertreffliches Nachahmungstalent .Tag für Tag vervollkommnen konnte. Dank seines hervorragenden Gedächtnisses war er imstande, Stimmen und Geflüster noch Wochen, nachdem er sie gehört hatte, hervorzubringen, womit er alles übertraf, was Menschen vermögen.
Niemand wusste, wie alt er war: Manche sagten fünfzig Jahre, andere sogar siebzig. In Wahrheit war alles möglich, bedenkt man die allenthalben bekannte Langlebigkeit von Papageien, welche nicht selten älter werden als das Jahrhundert und ihre Besitzer überleben.
Seine überwältigende Begabung, die Cesare Augusto zum berühmtesten Papageien aller Zeiten hätte machen können, hatte leider eine Grenze. Denn der Papagei der Villa Spada weigerte sich seit geraumer Zeit, seine Fähigkeiten zu zeigen. Kurzum, er tat, als wäre er stumm.
Alle Bitten, Schmeicheleien und Befehle waren vergeblich gewesen, ja, sogar ein grausames Fasten, dem er auf persönlichen Befehl von Kardinal Spada unterworfen worden war, um ihn zur Vorführung zu zwingen. Doch nichts half: Cesare Augusto hüllte sich seit vielen, vielen Jahren (keiner wusste mehr, wie lange schon) in das hartnäckigste Schweigen.
Natürlich kannte niemand den Grund. Einige erinnerten sich indessen noch daran, dass Cesare Augusto ursprünglich Pater Virgilio Spada, dem vor gut vierzig Jahren verstorbenen Onkel von Kardinal Fabrizio, gehört hatte. Virgilio, ein begeisterter Antikensammler und Liebhaber der klassischen Welt, war es gewesen, der dem Papagei den Namen des berühmtesten römischen Kaisers gegeben hatte. Es muss sich um eine Art Liebesbeweis gehandelt haben: Man sagt nämlich, dass Virgilio seinem Vogel sehr zugetan gewesen sei, und unter den Dienstboten wurde gemunkelt, der Tod seines Herren habe Cesare Augusto in die schwärzeste Verzweiflung gestürzt. Hatte der Kummer dem Papageien den Schnabel verschlossen? Tatsächlich schien es, als hätte er in der traurigen, sinnlosen Erwartung, sein alter Besitzer würde ins Leben zurückkehren, ein Schweigegelübde abgelegt.
Doch ich wusste, dass dem nicht so war. Cesare Augusto sprach, und wie er sprach, und dafür war ich Zeuge: der einzige, um genau zu sein. Denn nur in meiner Gegenwart öffnete der Papagei den Schnabel. Warum, vermochte ich selber nicht zu sagen: Ich vermutete, dass er eine besondere Zuneigung für mich hegte, war ich doch der Einzige, der ihn höflich behandelte; ich hütete mich davor, ihn zu necken und mit Zweigen oder Steinchen zu belästigen, um ihn zum Sprechen zu bringen, wie es die Dienerschaft der Villa tat.