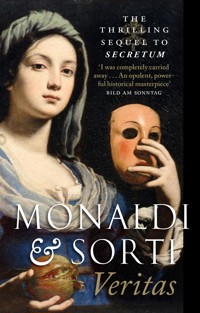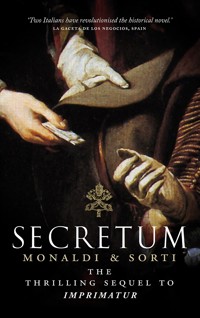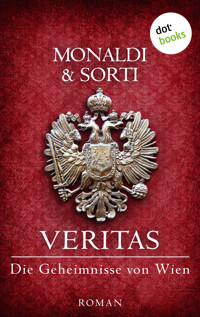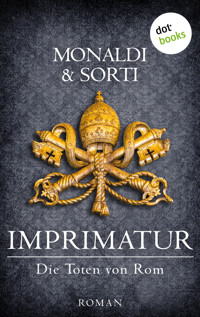
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Abbé Melani ermittelt
- Sprache: Deutsch
In den Gassen der ewigen Stadt wartet der Tod: Der historische Kriminalroman »Imprimatur« von Monaldi & Sorti jetzt als eBook bei dotbooks. »Monaldi & Sorti sind die Erben Umberto Ecos!« L' Express – Rom anno domini 1683. Er ist der beste Agent des französischen Sonnenkönigs, betraut mit einem Auftrag, bei dem das Schicksal Europas auf dem Spiel steht – doch nun sitzt Abbé Melani in der Herberge Locanda del Donzello fest: Einer der Gäste ist angeblich an der Pest gestorben, und das hat die römischen Behörden zu einer sofortigen Quarantäne veranlasst. Doch Abbé Melani erkennt bald, dass der Mann ermordet wurde – und der Mörder immer noch unter ihnen lauert … Um einen Weg aus der streng bewachten Herberge zu finden und seine Mission doch noch zu Ende bringen zu können, muss sich der Abbé mithilfe eines ungewöhnlich scharfsinnigen Küchenjungen auf die Suche nach dem Giftmörder machen – aber der schreckt vor nichts zurück, um sein Geheimnis zu bewahren … »Monaldi & Sorti – das neue italienische Autorenduo von internationalem Rang!« FAZ »Das Traumpaar des historischen Romans!« Brigitte Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Kriminalroman »Imprimatur«, der fesselnde Auftakt zur Bestseller-Trilogie von Monaldi & Sorti. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1125
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Monaldi & Sorti sind die Erben Umberto Ecos!« L’ Express
Rom anno domini 1683. Er ist der beste Agent des französischen Sonnenkönigs, betraut mit einem Auftrag, bei dem das Schicksal Europas auf dem Spiel steht – doch nun sitzt Abbé Melani in der Herberge Locanda del Donzello fest: Einer der Gäste ist angeblich an der Pest gestorben, und das hat die römischen Behörden zu einer sofortigen Quarantäne veranlasst. Doch Abbé Melani erkennt bald, dass der Mann ermordet wurde – und der Mörder immer noch unter ihnen lauert … Um einen Weg aus der streng bewachten Herberge zu finden und seine Mission doch noch zu Ende bringen zu können, muss sich der Abbé mithilfe eines ungewöhnlich scharfsinnigen Küchenjungen auf die Suche nach dem Giftmörder machen – aber der schreckt vor nichts zurück, um sein Geheimnis zu bewahren …
»Monaldi & Sorti – das neue italienische Autorenduo von internationalem Rang!« FAZ
»Das Traumpaar des historischen Romans!« Brigitte
Über die Autoren:
Das international erfolgreiche Autorenduo Rita Monaldi und Francesco Sorti machte mit seinem brillant recherchierten Romanzyklus IMPRIMATUR, SECRETUM und VERITAS weltweit auf sich aufmerksam. Als das Journalistenpaar außerdem im Zuge seiner Recherchen ein Geheimnis um Papst Innozenz XI. lüftete, machte der Vatikan seinen ganzen Einfluss geltend, weshalb die Werke jahrelang in Italien nicht vertrieben werden durften. In Folge des Skandals leben die Autoren heute in Wien.
Bei dotbooks erscheint die Trilogie über Abbé Melani, den Geheimagenten des Sonnenkönigs: »Imprimatur – Die Toten von Rom«, »Secretum – Die Schatten des Vatikans« und »Veritas – Die Geheimnisse von Wien«.
Weiterhin veröffentlichten sie bei dotbooks den historischen Roman »Die Entdeckung des Salaì«.
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe Juli 2020
Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Imprimatur« bei Claasen
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 2003 Ullstein Heyne List GmbH, München
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / GoneWithTheWind / digieye
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (cg)
ISBN 978-3-96655-322-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Imprimatur« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Monaldi & Sorti
IMPRIMATUR – Die Toten von Rom
Roman
Aus dem Italienischen von Maja Pflug und Friederike Hausmann
dotbooks.
An die Kongregation für die Heiligsprechung
Como, 14. Februar 2040
An Seine Exzellenz Msgr.
Alessio Tanari
Sekretär der Kongregation für die Heiligsprechung
Rom – Vatikanstadt
In nomine Domini
Ego, Lorenzo Dell’Agio, Episcopus Comi, in processu canonizationis beati Innocentii Papae XI, iuro me fideliter diligenterque impleturum munus mihi commissum, atque secretum servaturum in iis ex quorum revelatione preiudicium causae vel infamiam beato afferre posset. Sic me Deus adiuvet.
Sehr lieber Alessio,
bitte verzeihen Sie, wenn ich meinem Schreiben an Sie die Formel des üblichen Eides voranstelle: Schweigen zu bewahren über gewisse Dinge, die ich erfahren habe und die dem Ruf einer selig gesprochenen Seele zum Schaden gereichen könnten.
Ich weiß, dass Sie Ihrem alten Seminarlehrer die Wahl eines Briefstils vergeben werden, der weniger orthodox ist, als Sie es gewöhnt sind.
Vor nunmehr drei Jahren schrieben Sie mir im Auftrag des Heiligen Vaters und baten mich, eine angebliche Wunderheilung aufzuklären, die sich vor über vierzig Jahren in meiner Diözese zugetragen hat, bewirkt durch den Seligen Papst Innozenz XI.: jenen Benedetto Odescalchi aus Como, von dem Sie als Kind vielleicht zum ersten Mal eben aus meinem Munde erzählen hörten.
Bei dem Fall von mira sanatio ging es, wie Sie sich gewiss noch erinnern, um einen kleinen Jungen: ein Waisenkind aus dem Umland von Como, dem ein Hund einen Finger abgebissen hatte. Die Großmutter des Buben, die Papst Innozenz verehrte, hob den blutigen Stummel sofort auf, wickelte ihn in ein Heiligenbildchen des Pontifex und übergab ihn so den Ärzten in der Notaufnahme. Nach der Operation, bei der der Finger wieder angenäht wurde, hatte der Kleine sogleich die völlige Bewegungsfreiheit und Empfindungsfähigkeit des Fingers wiedererlangt: eine Tatsache, die sowohl bei dem Chirurgen als auch bei dessen Assistenten Staunen auslöste.
Ihren Anweisungen und dem Wunsch Seiner Heiligkeit entsprechend, habe ich den Prozess super mira sanatione eingeleitet, den zu eröffnen mein damaliger Vorgänger nicht für nötig befunden hatte. Ich will mich hier nicht weiter über den Prozess auslassen, den ich soeben abgeschlossen habe, obwohl unterdessen fast alle Zeugen des Vorgangs verstorben sind, die klinischen Berichte nach zehn Jahren vernichtet wurden und das Kind von damals mittlerweile ein fünfzigjähriger Mann ist, der schon lange in den Vereinigten Staaten lebt. Die Akten werden Ihnen gesondert zugeschickt. Wie es das Verfahren vorsieht, werden Sie sie der Kongregation zur Beurteilung vorlegen und dann einen Bericht für den Heiligen Vater abfassen. Mir ist durchaus bewusst, wie sehnlich sich unser geliebter Pontifex wünscht, bald ein Jahrhundert nach der Seligsprechung den Kanonisierungsprozess von Papst Innozenz XI. wieder aufzurollen, um ihn endlich heilig zu sprechen. Und gerade weil das Vorhaben Seiner Heiligkeit auch mir am Herzen liegt, komme ich nun zur Sache.
Gewiss ist Ihnen der beträchtliche Umfang des meinem Schreiben beiliegenden Konvoluts aufgefallen: Es ist das Manuskript eines nie veröffentlichten Buches.
Ihnen in allen Einzelheiten seine Entstehungsgeschichte zu schildern wird schwierig sein, denn nachdem die beiden Autoren mir ein Exemplar davon zukommen ließen, sind sie spurlos verschwunden. Ich bin sicher, dass Unser Herrgott dem Heiligen Vater und Ihnen nach der Lektüre des Werkes eingeben wird, was die gerechteste Lösung in diesem Dilemma ist: secretum servare aut non? Schweigen bewahren oder die Schrift veröffentlichen? Was immer entschieden wird, es wird mir heilig sein.
Ich entschuldige mich schon im Voraus, wenn meine Feder – da mein Geist erst jetzt von drei Jahren mühevoller Nachforschungen befreit ist – zuweilen allzu frei dahineilt.
Ich lernte die beiden Autoren des Manuskripts, ein junges Paar, vor nunmehr dreiundvierzig Jahren kennen. Ich war soeben zum Pfarrer in Rom ernannt worden und dort aus meiner Heimatstadt Como eingetroffen, in die ich dann später dank der Gnade unseres Herrn als Bischof zurückkehren durfte. Die miteinander verlobten jungen Leute, Rita und Francesco, waren beide Journalisten. Sie wohnten unweit meiner Pfarrei und wandten sich daher an mich, um bei mir den Vorbereitungskurs für das Sakrament der Ehe zu absolvieren.
Das Gespräch mit dem jungen Paar sprengte bald den Rahmen eines rein seelsorgerischen Verhältnisses und wurde mit der Zeit enger und vertraulicher. Der Zufall wollte, dass der Priester, der die Trauung vornehmen sollte, vierzehn Tage vor der Hochzeit von einer schweren Krankheit heimgesucht wurde. Es war daher für Rita und Francesco nur natürlich, mich zu bitten, den Ritus zu zelebrieren.
Ich traute sie Mitte Juni an einem sonnigen Nachmittag, im reinen, erhabenen Licht der Kirche San Giorgio in Velabro, unweit der glorreichen Ruinen des Forum Romanum und des Kapitols. Es war eine innige Feierstunde voller Rührung. Ich betete inbrünstig zum Allerhöchsten, er möge dem jungen Paar ein langes, heiteres Leben gewähren.
Nach der Hochzeit pflegten wir den Kontakt noch einige Jahre weiter. So erfuhr ich, dass Rita und Francesco trotz der wenigen Freizeit, die ihnen die Arbeit ließ, das Studium nie ganz aufgegeben hatten. Zwar hatten sich beide nach ihrem Staatsexamen in Literaturwissenschaft der schnelllebigeren und zynischeren Welt der Presse zugewandt, jedoch darüber die alten Interessen nicht vergessen. Sie widmeten sich vielmehr in freien Momenten weiterhin guter Lektüre, unternahmen Museumsbesuche und gelegentliche Streifzüge durch die Bibliothek.
Einmal im Monat luden sie mich zum Abendessen oder zu einem nachmittäglichen Kaffee ein. Häufig mussten sie, damit ich mich setzen konnte, im letzten Augenblick einen unter Stößen von Fotokopien, Mikrofilmen, Reproduktionen alter Stiche und Büchern begrabenen Stuhl frei machen: Und bei jedem Besuch sah ich, dass diese Papierberge noch gewachsen waren. Neugierig geworden, fragte ich, womit sie sich denn mit solch glühendem Eifer beschäftigten.
Daraufhin erzählten sie mir, sie seien vor einiger Zeit in der Privatsammlung eines bibliophilen römischen Aristokraten auf eine Reihe von acht handgeschriebenen Bänden gestoßen, die aus den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts stammten. Dank einiger gemeinsamer Freunde hatte der Besitzer, Marchese *** ***, den beiden die Erlaubnis erteilt, die alten Bände zu studieren.
Für Geschichtsliebhaber handelte es sich um ein wahres Juwel. Die acht Bände enthielten das Epistolarium des Abbé Atto Melani, der einer alten adeligen toskanischen Familie von Musikern und Diplomaten angehörte.
Doch die wahre Entdeckung sollte noch kommen: In einen der acht Bände mit eingebunden war ein umfangreiches Memoiren-Manuskript zum Vorschein gekommen. Es war auf 1699 datiert und in winziger Schrift abgefasst, von deutlich anderer Hand als der Rest des Bandes.
Der anonyme Autor der Memoiren behauptete, er sei Hausbursche in einer römischen Locanda gewesen, und schilderte in der ersten Person überraschende Begebenheiten, die sich im Jahre 1683 in Paris, Rom und Wien abgespielt hatten. Den Memoiren war ein kurzer Brief vorangestellt, ohne Datum, Absender oder Adressat und von recht dunklem Inhalt.
Mehr konnte ich zu jenem Zeitpunkt nicht erfahren. Die beiden Jungvermählten wahrten hinsichtlich ihrer Entdeckung größte Zurückhaltung. Ich ahnte nur, dass all ihre regen Nachforschungen von dem Fund jener Memoiren in Gang gesetzt worden waren.
Allerdings hatten die jungen Leute, da sie beide für immer aus der akademischen Welt ausgeschieden waren und ihren Studien keinen wissenschaftlichen Anstrich mehr geben konnten, begonnen, das Projekt eines Romans ins Auge zu fassen.
Anfangs erzählten sie mir davon wie zum Scherz: Sie würden die Memoiren des Hausburschen in die Form und Prosa eines Romans bringen. Darüber war ich zuerst etwas enttäuscht, da ich die Idee – als leidenschaftlicher Gelehrter, der zu sein ich mir einbildete – überheblich und oberflächlich fand.
Dann, im Laufe meiner Besuche, begriff ich, dass die Sache allmählich ernst wurde. Kaum ein Jahr nach der Hochzeit widmeten sie dem Projekt schon ihre gesamte Freizeit. Später gestanden sie mir, dass sie auch ihre Hochzeitsreise beinahe ausschließlich in den Archiven und Bibliotheken von Wien verbracht hatten. Ich stellte nie Fragen, sondern beschränkte mich darauf, als schweigsamer und diskreter Mitwisser ihrer Anstrengungen aufzutreten.
Leider schenkte ich damals dem Bericht, den mir die beiden jungen Leute über das Fortschreiten ihrer Arbeit lieferten, nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Sie wiederum, angespornt durch die Geburt einer hübschen kleinen Tochter und müde, auf den Treibsand unseres armen Landes zu bauen, hatten plötzlich beschlossen, nach Wien zu ziehen, eine Stadt, die sie vielleicht auch wegen der süßen Erinnerungen an ihre Flitterwochen lieb gewonnen hatten.
Kurz bevor sie Rom endgültig den Rücken kehrten, luden sie mich zu einem kurzen Abschiedstreffen ein. Sie versprachen, mir zu schreiben und mich zu besuchen, wenn sie wieder einmal nach Italien kämen.
Doch sie taten nichts von alledem, und ich hörte nichts mehr von ihnen. Bis ich eines Tages, nach Monaten, ein Päckchen aus Wien bekam. Es enthielt das Manuskript, das ich Ihnen sende: den sehnlich erwarteten Roman.
Ich freute mich zu erfahren, dass es ihnen wenigstens gelungen war, ihn zu Ende zu bringen, und wollte antworten, um ihnen zu danken. Doch ich musste erstaunt feststellen, dass sie mir weder ihre Adresse mitgeteilt noch ein paar begleitende Zeilen beigelegt hatten. Auf dem Frontispiz stand eine knappe Widmung: »Den Besiegten«. Und auf der Rückseite des Päckchens, mit Filzstift geschrieben, nur: »Rita & Francesco«.
Ich las also den Roman. Oder sollte ich eher von Memoiren sprechen? Handelt es sich wirklich um barocke, für den heutigen Leser aufbereitete Memoiren? Oder doch eher um einen modernen, im 17. Jahrhundert angesiedelten Roman? Oder beides? Diese Fragen bedrängen mich noch immer. In einigen Teilen hat man nämlich den Eindruck, als läse man aus dem 17. Jahrhundert unberührt auf uns gekommene Seiten: Die Personen disputieren unverändert in der Sprache der damaligen Traktate.
Doch wenn die gelehrten Gespräche dann der Handlung weichen, wandelt sich das linguistische Register abrupt, die gleichen Personen drücken sich in moderner Prosa aus und scheinen sich in ihrem Handeln sogar auffällig an den Topos des Kriminalromans – à la Sherlock Holmes und Watson, damit wir uns recht verstehen – anzulehnen. Geradeso, als hätten die Autoren in diesen Passagen einen Hinweis auf ihren Eingriff hinterlassen wollen.
Und wenn sie mich belogen hätten?, fragte ich mich zu meinem eigenen Erstaunen. Wenn die Geschichte von der Handschrift des Hausburschen, die sie wiedergefunden hätten, reine Erfindung wäre? Glich sie nicht doch zu sehr dem Kunstgriff, mit dem Manzoni und Dumas ihre Meisterwerke, Die Brautleute und Die drei Musketiere, einleiten? Auch das sind ja, welch ein Zufall, historische Romane, die im 17. Jahrhundert spielen …
Leider war es mir nicht möglich, der Sache auf den Grund zu gehen, vermutlich ist es ihr bestimmt, ein Geheimnis zu bleiben. Ich konnte nämlich die acht Briefbände des Abbé Melani, von denen die ganze Sache ihren Ausgang genommen hat, nicht auffinden. Die Bibliothek des Marchese *** *** wurde vor etwa zehn Jahren von den Erben aufgelöst und anschließend veräußert. Das Auktionshaus, das den Verkauf abgewickelt hatte, teilte mir, nachdem ich einige Bekannte bemüht hatte, auf informellem Weg die Namen der Käufer mit.
Ich glaubte mich der Lösung nahe und der Gnade des Herrn teilhaftig, bis ich dann die Namen der neuen Besitzer las: Die Bände waren von Rita und Francesco erworben worden. Von denen es natürlich keine Adresse gab.
In den letzten drei Jahren habe ich also mit den wenigen mir zur Verfügung stehenden Mitteln in mühseliger Kleinarbeit den Inhalt des Manuskripts überprüft. Das Ergebnis meiner Recherchen finden Sie auf den Seiten, die ich am Schluss beilege, und ich bitte Sie, alles mit größter Aufmerksamkeit zu lesen. Sie werden dabei entdecken, wie lange ich das Werk meiner Freunde ins Vergessen verbannte und wie viel Leid mir daraus erwuchs. Außerdem werden Sie eine detaillierte Überprüfung der im Manuskript geschilderten historischen Begebenheiten und einen Bericht über die anstrengenden Nachforschungen finden, die ich in den Archiven und Bibliotheken halb Europas angestellt habe, um herauszufinden, ob diese Ereignisse der Wahrheit entsprechen könnten.
Die geschilderten Fakten waren nämlich, wie Sie selbst feststellen können, von solcher Tragweite, dass sie den Lauf der Geschichte gewaltig und für immer verändern würden.
Doch nun, da ich am Ende meiner Nachforschungen angelangt bin, kann ich mit Gewissheit behaupten, dass die Begebenheiten und Personen in der Geschichte, die Sie gleich lesen werden, authentisch sind. Und auch dort, wo es nicht möglich war, Beweise für das Gelesene zu finden, konnte ich zumindest konstatieren, dass es sich um äußerst wahrscheinliche Ereignisse handelt.
Die von meinen beiden ehemaligen Pfarrkindern erzählte Geschichte dreht sich zwar nicht einzig um Papst Innozenz XI. (der sich im übrigen quasi gar nicht unter den handelnden Personen des Romans befindet), rückt jedoch Umstände ins Licht, die neue, finstere Schatten auf die Seelenreinheit des Pontifex und auf die Lauterkeit seiner Absichten werfen. Ich sage neue, da ja schon das Verfahren zur Seligsprechung des Papstes aus der Familie Odescalchi, das am 3. September 1714 von Clemens XI. eröffnet wurde, beinahe sofort ins Stocken geriet wegen der Einwände super virtutibus, die in der congregatio antepraeparatoria vom Glaubenspromotor erhoben wurden. Dreißig Jahre mussten vergehen, bis Benedikt XIV. aus der Familie Lambertini die Zweifel der Promotoren und Konsultoren an der Erhabenheit der Tugenden von Innozenz XI. per Dekret zum Schweigen brachte. Doch kurz darauf kam der Prozess erneut zum Stillstand, diesmal für beinahe zweihundert Jahre: Erst 1943 nämlich wurde unter Papst Pius XII. ein neuer Berichterstatter ernannt. Die Seligsprechung ließ noch weitere dreizehn Jahre auf sich warten, und zwar bis zum 7. Oktober 1956. Danach wurde es still um Papst Odescalchi. Nie mehr war, bis heute, die Rede davon, ihn heilig zu sprechen.
Dank der von Papst Johannes Paul II. vor über fünfzig Jahren gebilligten Gesetzgebung hätte ich auf meine Initiative hin eine Zusatzuntersuchung einleiten können. Doch hätte ich es in diesem Fall nicht vermocht, secretum servare in iis ex quorum revelatione preiudicium causae vel infamiam beato afferre posset. Denn ich hätte dann den Inhalt des Manuskripts von Rita und Francesco jemandem enthüllen müssen, und sei es auch einzig dem promotor fidei und dem postulator (den »Vertretern der Anklage und der Verteidigung der Heiligen«, wie sie heute plump in den Zeitungen genannt werden).
Auf diese Weise allerdings hätte ich schwerwiegende und nicht mehr zu beseitigende Zweifel an den Tugenden des Seligen aufkommen lassen: Und eine solche Entscheidung könnte nur der Pontifex Maximus treffen, ich ganz gewiss nicht.
Wäre das Buch allerdings in der Zwischenzeit erschienen, so wäre ich von meiner Geheimhaltungspflicht befreit gewesen. Daher hoffte ich, dass das Werk meiner beiden Pfarrkinder schon einen Verleger gefunden hätte. Ich betraute zwei meiner jüngsten und ahnungslosesten Mitarbeiter mit den entsprechenden Nachforschungen. Doch im Katalog der lieferbaren Bücher fand sich weder eine entsprechende Publikation noch der Name meiner Freunde.
Ich versuchte die beiden jungen Leute zu finden (die nun gewiss nicht mehr jung waren), und beim Einwohnermeldeamt waren sie tatsächlich als nach Wien verzogen registriert: Auerspergstraße 7. Ich schrieb an diese Adresse, doch die Antwort kam vom Leiter eines Studentenheims, der mir keinerlei weitere Auskunft geben konnte. Ich fragte bei der Stadt Wien an, aber es kam nichts Brauchbares dabei heraus. Ich wandte mich an Botschaften, Konsulate, Auslandsdiözesen – ohne das geringste Resultat.
Ich fürchtete das Schlimmste. Sogar an den Pfarrer der Minoritenkirche, der Kirche der italienischen Gemeinde in Wien, schrieb ich. Rita und Francesco aber waren überall unbekannt, glücklicherweise auch bei der Friedhofsverwaltung.
Zuletzt beschloss ich, selbst nach Wien zu reisen, in der Hoffnung, wenigstens ihre Tochter aufzuspüren, obwohl ich mich, nach vierzig Jahren, nicht mehr an ihren Taufnamen erinnerte. Wie vorauszusehen, führte auch dieser letzte Versuch zu nichts.
Von meinen beiden ehemaligen Freunden bleibt mir, außer den Schriften, nur ein altes Foto, das sie mir geschenkt hatten. Ich überlasse es Ihnen, wie auch alles Übrige.
Seit drei Jahren suche ich sie überall. Manchmal überrasche ich mich dabei, wie ich Mädchen anstarre, die rothaarig sind wie Rita, und dabei völlig vergesse, dass ihre Haare nun genauso weiß wären wie meine. Sie wäre jetzt vierundsiebzig Jahre alt und Francesco sechsundsiebzig.
Ich verabschiede mich fürs Erste von Ihnen und von Seiner Heiligkeit. Möge Gott Sie leiten bei der Lektüre, die Ihnen bevorsteht.
Msgr. Lorenzo Dell’Agio
Bischof der Diözese Como
Den Besiegten
Signore,
indem ich Euch diese Memoiren übersende,
die ich schließlich wiederfand, wage ich zu hoffen,
dass Eure Exzellenz in meinen Bemühungen,
Eure Wünsche zu erfüllen, das Übermaß an Leidenschaft
und Liebe erkennen wird, welche stets mein Glück
ausmachten, wenn ich sie Eurer Exzellenz
unter Beweis stellen konnte.
Memoiren
darinnen mannigfache wundersame Begebnisse,
so sich zugetragen in der Locanda des Donzello all’Orso
vom 11. bis zum 25. September im Jahr des Herrn 1683;
und worinnen referieret wird auf andere Geschehnisse
vor und nach jenen Tagen.
Zu Rom, A. D. 1699
Erster Tag – 11. September 1683
Die Schergen des Bargello kamen am späten Nachmittag, als ich soeben die Fackel entzünden wollte, welche unser Schild beleuchtete. In der Hand trugen sie Bretter und Hämmer, Siegel und Ketten und lange Nägel. Während sie die Via dell’Orso entlangmarschierten, schrien und gestikulierten sie herrisch, um den Passanten und den in Gruppen herumstehenden Leuten zu bedeuten, die Straße freizugeben. Sie waren wahrhaftig sehr verärgert. Als sie neben mir standen, begannen sie mit den Armen zu fuchteln: »Los, los, hinein mit euch, wir müssen schließen«, schrie derjenige von ihnen, welcher die Befehle gab.
Ich konnte gerade noch von dem Hocker klettern, auf dem ich stand, und schon stießen mich kräftige Hände unsanft in den Eingang hinein, während sich einige der Schergen daranmachten, die Tür in Furcht einflößender Weise zu verbarrikadieren. Ich war wie betäubt. Das Gedränge, das wie der Blitz aus heiterem Himmel bei dem Geschrei der Offiziere im Flur entstand, brachte mich abrupt wieder zu mir. Es waren die Gäste unserer Herberge, die als Locanda del Donzello bekannt war.
Sie waren insgesamt nur neun und allesamt präsent: In der Erwartung, dass das Abendessen serviert würde, lungerten sie wie jeden Tag zwischen den Ottomanen der Eingangshalle und den Tischen der beiden angrenzenden Speisesäle herum und gaben vor, mit dieser oder jener Tätigkeit beschäftigt zu sein; in Wirklichkeit aber zog sie der junge französische Gast an, der Musiker Roberto Devizé, der mit großer Bravour auf seiner Gitarre übte.
»Lasst mich raus! Wie könnt ihr es wagen? Hände weg! Ich kann nicht hier bleiben! Ich bin kerngesund, verstanden? Kerngesund! Lasst mich durch, sage ich euch!«
Wer so zeterte (ich erkannte ihn kaum hinter dem Lanzengewirr, mit dem die Bewaffneten ihn in Schach hielten), war Pater Robleda, der spanische Jesuit, welcher bei uns logierte und, vor Panik nach Luft ringend, mit rot angeschwollenem Hals herumbrüllte. So laut, dass es mich an das heftige Quieken erinnerte, das Schweine ausstoßen, wenn sie, kopfunter aufgehängt, abgestochen werden.
Der Lärm hallte in der Gasse wider und war offenbar bis auf den kleinen Platz zu vernehmen, der sich im Nu ganz von selbst geleert hatte. Auf der anderen Straßenseite erkannte ich den Fischhändler und zwei Diener aus der nahen Locanda dell’Orso, die alles beobachteten.
»Sie sperren uns ein«, rief ich ihnen zu und versuchte mich bemerkbar zu machen, doch die drei zuckten nicht mit der Wimper.
Ein Essigverkäufer, ein Schneelieferant und ein Grüppchen kleiner Jungen, deren Geschrei gerade noch die Straße erfüllt hatte, huschten verängstigt um die Ecke, um sich zu verstecken.
Derweil hatte mein Herr, Signor Pellegrino de Grandis, einen Schemel auf die Schwelle der Locanda gestellt. Ein Offizier des Bargello legte das Register der Gäste unserer Locanda darauf, das er sich soeben hatte aushändigen lassen, und begann mit dem Appell.
»Pater Juan de Robleda aus Granada.«
Da ich noch nie eine Schließung wegen Quarantäne erlebt und mir auch noch nie jemand davon erzählt hatte, glaubte ich zuerst, man wolle uns einkerkern.
»Böse Geschichte, böse Geschichte«, hörte ich Brenozzi, den Venezianer, zischen.
»Pater Robleda soll vortreten!«, wiederholte der Offizier ungeduldig.
Der Jesuit, welcher im vergeblichen Kampf mit den Bewaffneten zu Boden gestürzt war, erhob sich wieder, und nachdem er festgestellt hatte, dass jeder Fluchtweg von den Lanzen abgeschnitten war, antwortete er auf den Appell mit einem Wink seiner stark behaarten Hand. Sogleich wurde er auf meine Seite gestoßen. Pater Robleda war erst vor wenigen Tagen aus Spanien gekommen und hatte seit dem Vormittag aufgrund der Ereignisse nichts anderes getan, als unsere Ohren mit seinem Angstgeheul auf eine harte Probe zu stellen.
»Abbé Melani aus Pistoia!«, rief der Offizier, der den Appell nach dem Herbergsregister durchführte.
Im Halbdunkel leuchtete die Spitzenmanschette auf, die nach französischer Manier das Handgelenk unseres neuesten, erst im Morgengrauen eingetroffenen Gastes zierte. Eifrig hob er bei seinem Namen die Hand, und seine kleinen, dreieckigen Augen funkelten wie Dolche, die aus dem Schatten hervorblitzen. Der Jesuit rührte keinen Muskel, um beiseite zu treten, als Melani sich ruhigen Schrittes und schweigend zu uns gesellte. Es waren nämlich die Rufe des Abbé an jenem Morgen gewesen, die den Alarm ausgelöst hatten.
Alle hatten wir sie gehört, sie kamen aus dem ersten Stock. Pellegrino, der Wirt und mein Brotherr, hatte als Erster seine langen Beine ausgeschüttelt und war hingeeilt. Doch kaum hatte er das große Zimmer im ersten Stock erreicht, das auf die Via dell’Orso hinausgeht, war er stehen geblieben. Dort wohnten zwei Gäste: Signor de Mourai, ein alter französischer Edelmann, und sein Begleiter, Pompeo Dulcibeni aus den Marken. Mourai, welcher gerade sein gewohntes Fußbad im Zuber nahm, lehnte mit hängenden Armen schräg im Sessel, während Abbé Melani ihn am Oberkörper stützte und versuchte, ihn wiederzubeleben, indem er ihn am Kragen schüttelte. Mourai, der den Blick starr über Melanis Schulter gerichtet hielt und Pellegrino mit großen, verwunderten Augen zu mustern schien, gab ein undeutliches Röcheln von sich. Da bemerkte Pellegrino, dass der Abbé in Wirklichkeit nicht um Hilfe rief, sondern den Alten laut und erregt befragte. Er sprach Französisch mit ihm, und mein Herr verstand nichts, vermutete aber, er wolle sich erkundigen, was Mourai zugestoßen sei. Dennoch war es Pellegrino (wie er selbst uns allen später berichtete) so vorgekommen, als schüttelte Abbé Melani Signor de Mourai allzu heftig in der Bemühung, diesen wieder zu Bewusstsein zu bringen, daher stürzte er hin, um den armen Alten aus dem gewaltsamen Griff zu befreien. Genau in diesem Augenblick stieß der arme Signor de Mourai unter ungeheurer Anstrengung seine letzten Worte hervor: »Ahi, dunqu’è pur vero«, stammelte er auf Italienisch – »O weh, also ist es doch wahr.« Dann hörte er zu röcheln auf. Er starrte weiterhin den Wirt an, und grünlicher Geifer tropfte ihm aus dem Mund auf die Brust. So war er gestorben.
***
»Der Alte, es el viejo«, flüsterte Pater Robleda keuchend und mit entsetzter Miene halb auf Italienisch, halb in seiner Sprache, sobald wir die zwei Bewaffneten mit gedämpfter Stimme untereinander die Worte »Pest« und »schließen« wiederholen hörten.
»Cristofano, Medikus und Wundarzt aus Siena!«, rief der Offizier.
Langsam und gemessen trat unser toskanischer Gast vor, in der Hand seine Ledertasche, die all seine Instrumente enthielt und von der er sich niemals trennte.
»Das bin ich«, antwortete er mit leiser Stimme, nachdem er die Tasche geöffnet, in einem Haufen Papiere gewühlt und sich mit eisiger Beherrschung geräuspert hatte. Cristofano war ein rundlicher Herr von nicht sehr großer Statur, höchst gepflegtem Äußeren und schalkhaftem Blick, der gute Laune verhieß. An jenem Abend jedoch wurde seine vorgetäuschte Gelassenheit Lügen gestraft von seinem blassen, schweißüberströmten Gesicht, das zu trocknen er sich nicht die Mühe machte, und auch seine auf etwas Unsichtbares vor ihm konzentrierten Pupillen sowie die hastige Bewegung, mit der er sich den Spitzbart glättete, bevor er zu sprechen anhub, enthüllten, dass er sich in einem Zustand äußerster Anspannung befand.
»Ich möchte gern klarstellen, dass ich nach einer ersten, aber eingehenden Examination des Leichnams von Signor de Mourai keineswegs gewiss bin, dass es sich um die Seuche handelt«, begann Cristofano, »während der ärztliche Gutachter des Gesundheitsmagistrats, der dies mit so großer Gewissheit asseriert, sich in Wirklichkeit nur sehr kurz bei dem Toten aufgehalten hat. Ich habe hier«, damit zeigte er seine Papiere, »meine Beobachtungen schriftlich festgehalten. Ich glaube, sie könnten dazu dienen, noch ein wenig nachzudenken und diese Eure übereilte Entscheidung aufzuschieben.«
Die Männer des Bargello hatten jedoch weder die Macht noch die Lust, auf dergleichen Feinheiten einzugehen.
»Der Magistrat hat die sofortige Schließung dieser Locanda angeordnet«, erwiderte derjenige, welcher offenbar der Anführer war, schroff und fügte hinzu, im Augenblick sei noch keine wirkliche Quarantäne verhängt worden: Die Klausur betrage nur zwanzig Tage, und die Straße werde nicht geräumt; unter der Voraussetzung natürlich, dass keine weiteren verdächtigen Todesfälle oder Krankheiten aufträten.
»Darf ich wenigstens, da ich mit eingeschlossen werde und um mir die Diagnose zu erleichtern«, beharrte Signor Cristofano ein wenig alteriert, »etwas mehr über die letzten Mahlzeiten des verstorbenen Signor de Mourai erfahren, der ja stets allein in seinem Zimmer aß? Es könnte sich nämlich auch um eine einfache Kongestion handeln.«
Der Einwand wirkte und ließ die Schergen zögern, welche mit Blicken nach dem Wirt suchten. Doch dieser hatte die Forderung des Arztes gar nicht gehört: Auf einem Stuhl zusammengesunken, stöhnte er voller Verzweiflung und fluchte wie gewöhnlich auf die unendlichen Qualen, die das Leben ihm auferlegte. Zum letzten Mal vor kaum einer Woche, als in einer der Mauern der Locanda ein kleiner Riss entstanden war, was in den alten Häusern Roms nicht selten geschieht. Der Spalt bedeute keinerlei Gefahr, war uns gesagt worden; doch das hatte schon genügt, um meinen Herrn zu bedrücken und rasend zu machen.
Der Appell ging unterdessen weiter. Die Abendschatten nahten, und der Trupp hatte beschlossen, die Schließung nicht länger hinauszuzögern.
»Domenico Stilone Priàso aus Neapel! Angiolo Brenozzi aus Venedig!«
Die beiden jungen Männer, Dichter der eine und Glasbläser der andere, traten vor und sahen einander dabei an, als wären sie erleichtert, dass sie gemeinsam aufgerufen wurden, als hätte jeder auf diese Weise nur die Hälfte der Furcht zu tragen. Brenozzi, der Glasbläser – mit verängstigtem Blick, glänzenden braunen Löckchen und einer Stupsnase, die zwischen den geröteten Wangen hervorlugte –, erinnerte an ein Jesulein aus Porzellan. Schade, dass er wie gewöhnlich seine Anspannung entlud, indem er mit zwei Fingern obszön an dem Selleriestängel zwischen seinen Schenkeln zupfte, fast als spielte er ein Instrument mit nur einer Saite. Mir sprang dieses sein Laster mehr ins Auge als jedem anderen.
»Der Allerhöchste stehe uns bei«, jammerte indessen Pater Robleda – ich begriff nicht, ob wegen der anstößigen Geste des Glasbläsers oder wegen der Situation – und ließ sich hochrot auf einen Schemel fallen.
»Und alle Heiligen«, fügte der Dichter hinzu, »bin ich doch aus Neapel gekommen, um mir die Seuche zu holen.«
»Daran habt Ihr nicht gut getan«, erwiderte der Jesuit, indem er sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn wischte. »Wärt Ihr nur in Eurer Stadt geblieben, dort fehlt es ja nicht an Gelegenheiten.«
»Mag sein. Aber nachdem es nun einen guten Papst gibt, glaubte man, hier der Gnade des Himmels teilhaftig zu werden. Zuerst muss man freilich abwarten, was die, wie sagt man, die hinter der Pforte darüber denken«, zischte Stilone Priàso.
Verkniffene Lippen und eine scharfe Zunge – der neapolitanische Dichter hatte die Stelle getroffen, an der niemand auch nur berührt werden wollte.
Seit Wochen belagerte das türkische Heer der Hohen Pforte nun schon blutrünstig die Tore Wiens. Alle militärischen Kräfte der Ungläubigen strömten unaufhaltsam (so zumindest hieß es in den mageren Berichten, die bis zu uns drangen) vor der Kapitale des Heiligen Römischen Reiches zusammen und drohten, deren Bastionen bald zu stürmen.
Die Soldaten des christlichen Lagers, der Kapitulation nahe, hielten nur noch kraft ihres Glaubens stand. Ohne ausreichende Waffen und Verpflegung, von Hunger und Durchfall geschwächt, wurden sie darüber hinaus von den ersten Anzeichen eines Pestherds erschreckt.
Alle wussten: Würde Wien fallen, wäre für die Armeen des türkischen Befehlshabers Kara Mustafa der Weg nach Westen frei. Und sie würden mit blindwütiger, entsetzlicher Lust überallhin vordringen.
Um die Bedrohung abzuwenden, hatten sich viele edle Fürsten, Königshäuser und Feldherrn in Bewegung gesetzt: der König von Polen, Herzog Karl von Lothringen, Kurfürst Maximilian von Bayern, Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden und andere. Alle jedoch waren vom einzig wahren Bollwerk der Christenheit überzeugt worden, den Belagerten zu Hilfe zu eilen: von Papst Innozenz XI.
Seit langer Zeit nämlich kämpfte der Pontifex zäh darum, die christlichen Heere zu einen, zu versammeln und zu stärken. Und nicht nur mit den Mitteln der Politik, sondern auch mit wertvoller finanzieller Unterstützung. Ständig wurden von Rom großzügige Subsidien entsandt: über zwei Millionen Scudi an den Kaiser, fünfhunderttausend Gulden nach Polen, dazu weitere hunderttausend vom Neffen des Pontifex gestiftete Scudi, Donationen einzelner Kardinäle und schließlich eine großzügige, außerordentliche Entnahme aus dem Kirchenzehnten von Spanien.
Die Heilige Mission, die der Pontifex verzweifelt zu einem Abschluss zu bringen suchte, kam noch zu den zahllosen frommen Werken hinzu, die er in den sieben Jahren seines Pontifikats vollbracht hatte.
Der inzwischen zweiundsiebzigjährige Nachfolger Petri, geboren unter dem Namen Benedetto Odescalchi, war vornehmlich mit gutem Beispiel vorangegangen. Groß, hager, mit hoher Stirn, Adlernase, strengem Blick, vorstehendem, aber edlem, von Spitzbart und Oberlippenbart gerahmtem Kinn, hatte er sich den Ruf eines Asketen erworben.
Da er ein scheues, zurückhaltendes Temperament besaß, sah man ihn sehr selten in der Kutsche durch die Stadt fahren, und er mied sorgsam den Beifall des Volkes. Es war bekannt, dass er die allerkleinsten, ungastlichsten und schlichtesten Gemächer, die je ein Papst bewohnt, für sich gewählt hatte und dass er fast nie in die Gärten des Quirinals und des Vatikans hinunterging. Er war so genügsam und sparsam, dass er nur Gewänder und Paramente seiner Vorgänger benutzte. Seit seiner Wahl trug er stets dieselbe weiße Soutane, obwohl sie schon über die Maßen abgewetzt war, und er wechselte sie erst, als man ihn darauf hinwies, dass eine zu nachlässige Kleidung dem Stellvertreter Christi auf Erden nicht geziemt.
Doch auch bei der Verwaltung des Kirchenvermögens hatte er sich höchste Verdienste erworben. Er hatte die Kassen der Apostolischen Kammer saniert, die seit den schmählichen Zeiten von Urban VIII. und Innozenz X. Diebereien aller Art ausgesetzt waren. Er hatte den Nepotismus abgeschafft: Kaum gewählt, hatte er seinen Neffen Livio zu sich bestellt, um ihn – so hieß es – wissen zu lassen, dass er ihn nicht zum Kardinal machen und ihn vielmehr von allen Staatsgeschäften fern halten werde.
Darüber hinaus hatte er seine Untertanen endlich zu strengerem und sittsamerem Lebenswandel aufgerufen. Die Theater, Orte ungezügelter Belustigung, waren geschlossen worden. Der Karneval, der noch zehn Jahre zuvor Bewunderer aus ganz Europa anzog, war so gut wie gestorben. Feste und musikalische Darbietungen waren auf ein Minimum beschränkt. Den Frauen waren zu offenherzige Kleider und Ausschnitte nach französischer Manier verboten worden. Der Pontifex hatte sogar Sbirren ausgesandt, um die an den Fenstern aufgehängte Wäsche zu begutachten und zu gewagte Mieder und Blusen zu konfiszieren.
Dank dieser ebensowohl finanziellen wie auch moralischen Strenge hatte Innozenz XI. nach zähem Ringen das Geld aufbringen können, um die Türken zu bekämpfen, und groß war die Hilfe, die er der Sache der christlichen Heere angedeihen ließ.
Doch nun war der Krieg in die entscheidende Phase eingetreten. Und die gesamte Christenheit wusste, was sie sich zu erwarten hatte: die Rettung oder den Untergang.
In äußerster Seelenpein befand sich daher das Volk, welches bei jedem Morgengrauen den Blick angstvoll gen Osten wandte und sich fragte, ob der neue Tag Horden von blutrünstigen Janitscharen samt dürstenden Schlachtrössern bringen würde, die nur darauf warteten, sich an den Brunnen auf dem Petersplatz zu laben.
Schon im Juli hatte der Pontifex seine Absicht verkündet, das große Heilige Jahr auszurufen, um die göttliche Hilfe zu erflehen, vor allem aber, um noch mehr Gelder für den Krieg zu sammeln. Alle, Laien und Geistliche, waren feierlich zur Mildtätigkeit aufgefordert worden, und man hatte eine großartige Prozession unter Teilnahme aller Kardinäle und Beamten der Kurie abgehalten. Mitte August hatte der Papst angeordnet, dass die Kirchen Roms jeden Abend eine Achtelstunde lang die Glocken läuten sollten, um Gottes Beistand zu erwirken.
Anfang September schließlich war im Petersdom mit großem Gepränge die Monstranz mit dem Allerheiligsten ausgestellt worden, begleitet von Musik und Gebeten, und dann hatten die Kanoniker, auf Geheiß Seiner Heiligkeit, vor der riesigen Volksmenge die Feierliche Messe contra paganos gesungen.
***
Daher hatte der Wortwechsel zwischen dem Jesuiten und dem Dichter einen Schrecken wachgerufen, der wie ein unterirdischer Fluss die ganze Stadt durchzog.
Stilone Priàsos Bemerkung hatte in der schon leidgeprüften Seele Pater Robledas Furcht auf Furcht gehäuft. Finster und bebend war das runde Gesicht des Jesuiten vor aufgestautem Zorn, von einem Fettwulst umrahmt, der unter seinem Kinn zitterte.
»Hält hier jemand zu den Türken?«, keuchte er maliziös.
Die Anwesenden wandten sich unwillkürlich zu dem Dichter um, den ein misstrauisches Auge in der Tat leicht mit einem Abgesandten der Pforte hätte verwechseln können: Mit seiner dunklen, pockennarbigen Haut und den kohlschwarzen Äuglein sah er so drohend drein wie ein Uhu. Seine düstere Gestalt erinnerte an jene Räuber mit struppigem, kurzem Haar, die man, leider allzu häufig, auf der Straße ins Königreich Neapel antrifft. Stilone Priàso blieb keine Zeit zu antworten.
»Wollt ihr endlich still sein!«, ging einer der Gendarmen dazwischen, der mit dem Appell fortfuhr.
»Signor de Mourai, Franzose, mit Signor Pompeo Dulcibeni aus Fermo und Roberto Devizé, Musiker aus Frankreich.«
Der Erste war, wie mein Herr sich zu erklären beeilte, der alte Franzose, welcher Ende Juli in der Locanda del Donzello eingetroffen war und der nun der Seuche erlegen zu sein schien. Er war gewisslich ein großer Edelmann, fügte Pellegrino hinzu, von höchst angegriffener Gesundheit, und er befand sich bei seiner Ankunft in Gesellschaft von Devizé und Dulcibeni. Signor de Mourai war nämlich beinahe blind und benötigte Begleitung. Vom alten Mourai wusste man fast nichts: Seit seiner Ankunft hatte er immer wieder gesagt, er sei sehr müde, hatte sich die Mahlzeiten jeden Tag aufs Zimmer bringen lassen und war auch nur selten zu einem kurzen Spaziergang in der Nähe der Locanda ausgegangen. Die Schergen notierten rasch die Erklärungen meines Padrone.
»Es ist einfach nicht möglich, meine Herrn, dass er an der Pest gestorben ist! Er hatte allerbeste Manieren und war gut gekleidet; es wird das Alter gewesen sein, das ist alles.«
Pellegrinos Zunge hatte sich plötzlich gelöst, und er begann, sich in jenem weichen Tonfall an die Miliz zu wenden, den er zwar nur selten benutzte, der ihn aber zuweilen sehr effektvoll überkam. Trotz der adeligen Züge und der hohen, schmalen Gestalt, der zarten Hände und der vornehmen, leicht gebeugten Haltung seiner fünfzig Jahre, trotz seines Gesichts, das von fließendem weißem, mit einem Band zusammengehaltenen Haar umrahmt war, und seiner schmachtenden braunen Augen war mein Herr leider Opfer eines recht galligen, zornigen Temperaments, weshalb er seine Reden meist mit einer großen Auswahl Flüchen schmückte. Nur die drohende Gefahr hinderte ihn bei dieser Gelegenheit daran, seiner Natur freien Lauf zu lassen.
Doch schon hörte ihm niemand mehr zu. Erneut wurden der junge Devizé und Pompeo Dulcibeni aufgerufen, die sogleich vortraten. Die Augen unserer Herbergsgäste leuchteten beim Anblick des französischen Musikers, dessen Gitarrenspiel sie noch kurz zuvor bezaubert hatte.
Die Männer des Bargello hatten es unterdessen eilig, sie wollten gehen und stießen Dulcibeni und Devizé, noch bevor diese die Wand erreichten, beiseite, während der Offizier rief: »Signor Eduardus Bedfordi, Engländer, und Donna … und Cloridia.«
Die plötzliche Korrektur und das vieldeutige Lächeln, mit dem der letzte Name ausgesprochen wurde, ließen unzweifelhaft darauf schließen, welch uraltes Gewerbe der einzige weibliche Gast des Donzello ausübte. In Wirklichkeit wusste ich nicht viel über diese Frau, da mein Herr sie nicht zusammen mit den anderen Herbergsgästen, sondern im Türmchen untergebracht hatte, wo sie über einen separaten Eingang verfügte. In dem knappen Monat ihres Aufenthalts hatte ich ihr nur Speisen und Wein bringen und gelegentlich (ehrlich gestanden, mit bemerkenswerter Häufigkeit) Briefchen im verschlossenen Umschlag übergeben müssen, auf denen fast nie der Name des Absenders stand. Cloridia war sehr jung, schätzungsweise etwa so alt wie ich. Manchmal hatte ich sie in die Räume im Erdgeschoss herunterkommen und dort – sehr liebenswürdig, muss ich sagen – mit einigen unserer Herbergsgäste plaudern sehen. Nach den mit Signor Pellegrino geführten Gesprächen schien sie gesonnen, unsere Locanda zu ihrem festen Wohnsitz zu erwählen.
Signor di Bedfordi konnte nicht unbemerkt bleiben: Er hatte feuerrotes Haar, dichte goldene Sommersprossen auf Nase und Wangen, so himmelblaue, schielende Augen, wie ich sie noch nie gesehen, und er stammte von den fernen britannischen Inseln. Nach allem, was ich gehört hatte, logierte er nicht zum ersten Mal im Donzello: Ebenso wie der Glasbläser Brenozzi und Stilone Priàso, der Dichter, war er schon zu Zeiten der vorigen Besitzerin hier gewesen, einer verstorbenen Cousine meines Herrn.
Mein Name wurde als letzter aufgerufen.
»Er ist zwanzig Jahre alt und arbeitet seit kurzem bei mir«, erklärte Pellegrino. »Im Augenblick ist er mein einziger Hausbursche, da wir derzeit wenig Gäste haben. Ich weiß nichts über ihn, ich habe ihn eingestellt, weil er niemanden hatte«, sagte mein Herr hastig, wobei er den Eindruck vermittelte, als wolle er jede Verantwortung für die Seuche von sich abwälzen.
»Lass ihn uns bloß sehen, wir müssen schließen«, unterbrachen ihn die Schergen ungeduldig, da sie mich nicht entdecken konnten.
Pellegrino packte mich am Arm und hob mich beinahe in die Höhe.
»Junge, du bist ja wirklich ein Knirps!«, höhnte der Gendarm, während seine Kumpane lachten.
Aus den umliegenden Fenstern beugten sich unterdessen schüchtern einige Köpfe heraus. Die Bewohner des Viertels hatten gehört, was vorging, doch nur die Neugierigsten versuchten, sich zu nähern. Der größte Teil der Leute hielt indessen Abstand, da sie bereits die Auswirkungen der Seuche fürchteten.
Die Gendarmen hatten ihre Aufgabe fast beendet. Die Locanda besaß vier Eingänge. Zwei gingen zur Via dell’Orso hinaus: der Haupteingang und die breite Tür daneben, die in den ersten der beiden kleinen Speisesäle führte und an Sommerabenden stets offen stand.
Dann gab es noch den seitlichen Dienstboteneingang, durch den man von der Gasse direkt in die Küche gelangte, und schließlich das Törchen, das vom Hausflur zum Hof führte. Mit Nägeln, die eine halbe Spanne maßen, wurden sie nun alle akkurat mit starken Buchenbrettern vernagelt und versiegelt. Nicht anders erging es der Tür, die sich von Cloridias Türmchen aufs Dach öffnete. Die Fenster im Erdgeschoss und im ersten Stock sowie die Schlitze, die sich auf der oberen Kellerebene zur gepflasterten Gasse hin öffneten, waren schon vergittert, und eine Flucht aus dem zweiten Stock oder vom Dachboden hätte die Gefahr mit sich gebracht, abzustürzen oder entdeckt und verhaftet zu werden.
Der Befehlshaber der Männer des Bargello, ein feistes Individuum mit halb abgeschlagenem Ohr, gab uns seine Anweisungen. Den Leichnam des verstorbenen Signor de Mourai sollten wir nach Sonnenaufgang aus einem der Fenster seines Zimmers herunterlassen, wenn der Karren der Societas Orationis et Mortis vorbeikäme, der Bruderschaft, die für das Begräbnis sorgen werde. Von sechs Uhr morgens bis zehn Uhr abends würden wir von einer Tageswache beaufsichtigt, die restlichen Stunden von einer Nachtwache. Wir dürften das Haus nicht verlassen, bis gesichert sei, dass keine Gesundheitsgefährdung mehr von der Locanda ausgehe, auf keinen Fall jedoch vor Ablauf von zwanzig Tagen. Während dieser Zeit müssten wir regelmäßig zum Appell an einem der Fenster antreten, die auf die Via dell’Orso hinausgingen. Man werde uns einige große Schläuche mit Wasser, gepressten Schnee, mehrere Brotlaibe, Käse, Speck, ein paar Kräuter und einen Korb gelber Äpfel dalassen. Später würden wir eine kleine Summe erhalten, damit wir den Nachschub an Lebensmitteln, Wasser und Schnee bezahlen konnten. Die Pferde der Locanda würden bleiben, wo sie waren, nämlich im Stall des Kutschers, der direkt nebenan wohnte.
Wer das Haus verlassen oder die Flucht auch nur versuchen sollte, würde vierzig Strangzüge erhalten und vor den Magistrat gebracht, um abgeurteilt zu werden. Sodann nagelten die Gendarmen das schändliche Schild mit der Aufschrift SANITÄRE MASSNAHME an die Eingangstür. Sie ermahnten uns, alle Befehle zu respektieren, die uns noch gegeben würden, einschließlich der Anordnungen, die in Zeiten von Kontagium oder Pest getroffen werden, denn diejenigen, welche nicht gehorchten, würden schwer bestraft. Stumm lauschten wir im Innern der Locanda der Mitteilung, die uns zur Abgeschiedenheit verdammte.
»Wir sind tot, samt und sonders so gut wie tot«, sagte einer der Herbergsgäste mit tonloser Stimme.
Wir waren alle im langen schmalen Flur der Locanda versammelt, der trostlos und dunkel wirkte, seit die Tür verbarrikadiert war. Verwirrt sahen wir uns um. Niemand entschloss sich, in die angrenzenden Speiseräume hinüberzugehen, wo das längst erkaltete Essen aufgetragen war. Mein Herr, auf dem Ladentisch im Eingang zusammengesunken, hielt den Kopf zwischen den Händen und schimpfte. Er warf mit Schmähungen und Verwünschungen um sich, die man nicht wiedergeben kann, und drohte, er werde jedem gefährlich werden, der in seine Nähe käme. Plötzlich begann er zuzuschlagen, mit bloßen Händen hieb er so entsetzlich auf den armen Ladentisch ein, dass das Gästebuch in die Luft flog. Danach hob er den Tisch hoch, um ihn gegen die Wand zu schleudern. Wir mussten eingreifen und ihn an Armen und Oberkörper festhalten, um ihn zu bremsen. Pellegrino versuchte sich loszureißen, verlor aber das Gleichgewicht und warf dabei noch ein paar Gäste zu Boden, die mit großem Geschrei übereinander fielen. Ich selbst konnte gerade noch ausweichen, bevor das Menschenknäuel mich unter sich begrub. Mein Herr war flinker als seine Bewacher, sprang sogleich wieder auf und hämmerte erneut wie wild mit den Fäusten auf den Ladentisch.
Ich beschloss, jenen engen und nun gefährlich gewordenen Raum zu verlassen, und schlüpfte die Treppe hinauf. Hier jedoch fand ich mich, am ersten Absatz angekommen, Abbé Melani gegenüber. Vorsichtigen Schrittes kam er ohne Eile herunter.
»Nun haben sie uns eingesperrt, Junge«, sagte er mit Betonung auf seinem seltsamen französischen »r«.
»Was machen wir jetzt?«, fragte ich.
»Nichts.«
»Aber wir werden an der Pest sterben.«
»Mal sehen«, erwiderte er mit einem undefinierbaren Unterton in der Stimme, den ich bald deuten lernen sollte.
Sodann wechselte er die Richtung und lockte mich in den ersten Stock. Wir gingen bis zum Ende des Flurs und betraten das große Zimmer, das der verstorbene Mourai zusammen mit seinem alten Begleiter, Pompeo Dulcibeni aus den Marken, gemietet hatte. Ein Vorhang unterteilte das Zimmer. Wir schoben ihn beiseite und sahen den Arzt Cristofano, welcher, auf dem Boden hockend, in seinem Köfferchen kramte.
Vor ihm, im Sessel, lag Signor de Mourai, noch halb entkleidet, so wie Cristofano und der ärztliche Gutachter ihn am Morgen verlassen hatten. Der Tote stank schon leicht aufgrund der Septemberhitze und wegen des Fußbades, in dem das Fleisch nun schon faulte, da der Bargello angeordnet hatte, bis zum Ende des Appells nichts zu verändern.
»Junge, schon heute früh hatte ich dich darum gebeten: Wisch bitte dieses übel riechende Wasser auf dem Fußboden auf«, befahl mir Cristofano mit einem Hauch Ungeduld in der Stimme.
Ich wollte gerade antworten, dass ich es längst getan hatte, sobald er es mir befohlen; doch als ich auf den Boden blickte, sah ich rund um den Zuber tatsächlich noch einige Pfützen. Widerspruchslos beseitigte ich sie mit Lumpen und Besenstiel und verwünschte mich dafür, dass ich am Morgen nicht sorgfältig genug gewesen war. Ich hatte nämlich bis dahin noch nie in meinem Leben eine Leiche gesehen, und die Aufregung musste mich verstört haben.
Mourai wirkte noch magerer und blutleerer als bei seiner Ankunft in der Locanda del Donzello. Aus seinen leicht geöffneten Lippen tropfte ein wenig grünlicher Schaum, den Cristofano mit einem Lappen abzutupfen begann, da er den Mund des Toten noch weiter öffnen wollte. Allerdings achtete der Arzt darauf, ihn erst anzufassen, nachdem er seine Hand mit einem weiteren Stofffetzen umwickelt hatte. Wie schon am Morgen sah er dem Verstorbenen aufmerksam in den Hals und roch an dem Schaum. Dann ließ er sich von Abbé Melani dabei helfen, die Leiche aufs Bett zu legen. Die Füße, aus dem Zuber gehoben, waren grau und fahl und verbreiteten einen entsetzlichen Todesgeruch, der uns den Atem nahm.
Cristofano streifte ein Paar braune Stoffhandschuhe über, die er einer Schachtel entnommen hatte. Noch einmal untersuchte er die Mundhöhle, danach betrachtete er den Oberkörper und die schon freigelegte Leistengegend. Zuerst jedoch tastete er mit Zartgefühl hinter den Ohren; dann ging er zu den Achseln über, wobei er den Rock verschob, um das schlaffe, schütter behaarte Fleisch in Augenschein nehmen zu können. Zuletzt stieß er mehrmals mit den Fingerspitzen an das weiche Stück Fleisch, das sich auf halber Strecke zwischen Scham und Schenkelansatz befindet. Darauf zog er die Handschuhe vorsichtig wieder aus und legte sie in eine Art kleinen Käfig, der von einem waagrechten Gitter in zwei Fächer unterteilt war. Im unteren Fach befand sich ein Schälchen, in das er eine bräunliche Flüssigkeit goss, sodann schloss er das Türchen des Fachs, in welches er die Handschuhe gelegt hatte.
»Das ist Essig«, erklärte er. »Der reinigt von Pestsäften. Man weiß nie. Gleichwohl bleibe ich bei meiner Meinung: Ich glaube wirklich nicht, dass es sich hier um die Seuche handelt. Vorerst können wir beruhigt sein.«
»Den Männern vom Bargello habt Ihr gesagt, es könnte sich um eine Kongestion handeln«, erinnerte ich ihn.
»Das habe ich nur als Exempel genannt, auch um Zeit zu gewinnen. Ich wusste schon von Pellegrino, dass Mourai nur Suppen zu sich nahm.«
»Das ist wahr«, pflichtete ich bei. »Auch heute früh im Morgengrauen hatte er eine verlangt.«
»Ach ja? Erzähl weiter«, fragte der Arzt interessiert nach.
»Da gibt es nicht viel zu sagen: Er hatte bei meinem Herrn um eine Milchbrühe gebeten, als dieser hinaufgegangen war, um Signor de Mourai und den vornehmen Mann aus den Marken, mit dem er das Zimmer teilte, wie jeden Morgen zu wecken. Signor Pellegrino hatte aber zu tun und beauftragte deshalb mich mit der Zubereitung. Ich bin in die Küche hinuntergelaufen, habe die Suppe gekocht und sie ihm gebracht.«
»Warst du allein?«
»Ja.«
»Ist jemand in die Küche gekommen?«
»Nein.«
»Hast du die Brühe je unbewacht gelassen?«
»Keinen Augenblick.«
»Sicher?«
»Falls Ihr denkt, dass etwas in dieser Brühe Signor de Mourai geschadet haben könnte, so wisst, dass ich sie ihm persönlich verabreicht habe, da Signor Dulcibeni schon ausgegangen war, und ich habe auch selbst einen Becher davon getrunken.«
Der Arzt stellte keine weiteren Fragen. Mit einem Blick auf die Leiche fügte er hinzu: »Ich kann hier und jetzt keine Autopsie durchführen, und ich glaube, angesichts des Pestverdachts wird das niemand tun. Doch ich wiederhole, mich dünkt, es handelt sich nicht um die Seuche.«
»Aber«, warf ich ein, »warum haben sie uns dann in Quarantäne eingeschlossen?«
»Aus Übereifer. Du bist noch jung, ich glaube jedoch, dass die Leute in dieser Gegend sich durchaus noch an die letzte Epidemie erinnern. Wenn alles gut geht, werden sie bald gewahren, dass keine Gefahr besteht. Dieser alte Herr, der sich ohnehin nicht allerbester Gesundheit zu erfreuen schien, ist nicht pestverseucht. Und daher würde ich sagen, dass weder ihr noch ich es sind. Dennoch haben wir keine Wahl: Wir werden den Leichnam und die Kleider des verstorbenen Signor de Mourai auf die Gasse hinunterlassen müssen, wie uns die vom Bargello befohlen haben. Außerdem werden wir jeder in einem anderen Zimmer schlafen müssen. Es sind ja genug Räume vorhanden in der Locanda, wenn ich mich nicht täusche«, sagte er und sah mich fragend an.
Ich nickte. Auf jedem Stockwerk gab es in den zwei Teilen des Flurs vier Zimmer: ein recht geräumiges gleich neben der Treppe, gefolgt von einem sehr winzigen und einem L-förmigen, während sich am Ende des Flurs jeweils das größte Zimmer befand, das einzige auch, das nicht nur auf die Gasse, sondern auch auf die Via dell’Orso hinausging. Es würden also, dachte ich, alle Zimmer im ersten und zweiten Stock belegt sein, aber ich wusste, dass mein Herr nicht sonderlich darüber klagen würde, da ja im Augenblick gewiss keine neuen Gäste eintreffen konnten.
»Dulcibeni wird in meinem Zimmer schlafen«, fügte Cristofano hinzu, »er kann natürlich nicht hier bei der Leiche bleiben. Wie auch immer«, schloss er, »wenn keine weiteren Fälle hinzukommen, ob echte oder falsche, werden sie uns in ein paar Tagen herauslassen.«
»Wann genau?«, fragte Atto Melani.
»Wer kann das vorhersagen? Falls in der Nachbarschaft jemand erkrankt, und sei es auch nur, weil er schlechten Wein getrunken oder faulen Fisch gegessen hat, wird man sogleich uns verdächtigen.«
»Also besteht die Gefahr, dass wir für immer hier drinbleiben«, wagte ich einzuwerfen und fühlte mich schon jetzt erdrückt von den dicken Mauern der Locanda.
»Für immer nicht. Doch beruhige dich: Bist du nicht in den letzten Wochen Tag und Nacht hier drin gewesen? Ich habe dich kaum ausgehen sehen; du bist also schon daran gewöhnt.«
Das stimmte. Der Padrone hatte mich aus Barmherzigkeit in seinen Dienst genommen, weil er wusste, dass ich allein auf der Welt war. Und ich arbeitete von früh bis spät.
Es war zu Anfang des vergangenen Frühlings geschehen, als Pellegrino aus Bologna, wo er als Koch arbeitete, nach Rom gekommen war, um die Locanda del Donzello zu übernehmen, nachdem seiner Cousine, der Wirtin Signora Luigia de Grandis Bonetti, ein Unglück zugestoßen war. Die Ärmste hatte ihre Seele dem Herrgott überantwortet, als sie den körperlichen Folgen eines Überfalls erlag, den zwei Zigeunerschurken auf der Straße auf sie verübt hatten, weil sie ihr die Geldbörse rauben wollten. Die Locanda, die Luigia dreißig Jahre lang, zuerst zusammen mit ihrem Mann Lorenzo und ihrem Sohn Francesco und später dann, als sie Witwe geworden und auch den Sohn verloren hatte, allein geführt hatte, war einst sehr berühmt und beherbergte Gäste aus allen Teilen der Welt. Ihre Verehrung für Herzog Orsini, den Besitzer des kleinen Palazzo, in dem sich die Locanda befand, hatte Luigia bewogen, ihn zu ihrem Universalerben zu ernennen. Der Herzog wiederum hatte nichts einzuwenden gehabt, als Pellegrino (der eine Frau, eine Tochter in heiratsfähigem Alter und noch eine Kleine zu versorgen hatte) aus Bologna angereist war, um den Herzog inständig zu bitten, er möchte ihn doch das blühende Geschäft seiner Cousine Luigia weiterführen lassen.
Diese Gelegenheit war für meinen Herrn Gold wert, da er eine andere soeben verpfuscht hatte: Am Ende einer mühevollen Karriere in den Küchen eines reichen Kardinals, wo er den begehrten Posten eines Hilfsküchenmeisters ergattert hatte, war er zuletzt wegen seines aufbrausenden Charakters und seiner Unmäßigkeit in zu vielen Dingen aus dem Haus gejagt worden.
Kaum hatte Pellegrino sich in der Nähe des Donzello niedergelassen in der Erwartung, dass einige vorübergehende Mieter des kleinen Palazzo wieder auszögen, wurde ich ihm vom Pfarrer der nahen Kirche Santa Maria in Posterula anempfohlen. Als der glühend heiße römische Sommer begann, war seine Gattin, durchaus nicht begeistert von der Idee, als Wirtin aufzutreten, mit den Töchtern ins Gebirge aufgebrochen, in den Apennin, wo noch Verwandte von ihr lebten. Zum Monatsende wurden sie zurückerwartet, und bis dahin war ich die einzige Hilfe.
Gewiss, man konnte von mir nicht verlangen, dass ich den besten aller Burschen abgab; doch ich tat alles, um Pellegrino zufrieden zu stellen. Hatte ich die täglichen Verrichtungen erledigt, nahm ich eifrig jede Gelegenheit wahr, um mich weiter nützlich zu machen. Und da ich ungern allein ausging und mich den Gefahren der Straße aussetzte (vor allem den grausamen Späßen meiner Altersgenossen), war ich fast immer in der Locanda del Donzello am Werk, wie Cristofano richtig beobachtet hatte. Gleichwohl schien mir die Vorstellung, die ganze Zeit der Quarantäne in jenen – wenn auch noch so vertrauten und behaglichen – Räumen eingeschlossen zu sein, plötzlich ein unerträgliches Opfer zu bedeuten.
***
Unterdessen hatte sich der Aufruhr in der Eingangshalle gelegt, und mein Herr war samt allen anderen, die sich mit ihm an der langen und nutzlosen Kräfteverschwendung beteiligt hatten, zu uns gestoßen. Cristofano legte ihnen kurz seine Einschätzung dar, was nicht wenig Erleichterung hervorrief, außer bei meinem Herrn.
»Ich bringe sie um, ich bringe sie alle um«, sagte er, erneut die Fassung verlierend.
Er fügte hinzu, dass dieses Geschehnis ihn ruiniert habe, da nun niemand mehr im Donzello einkehren und es natürlich auch unmöglich sein werde, den Betrieb zu verkaufen, die Locanda sei ja ohnehin schon durch diesen verfluchten Mauerriss entwertet, und er werde alle seine Kreditbriefe einlösen müssen, um eine andere zu bekommen, und in Kürze werde er für immer arm und zugrunde gerichtet dastehen, aber vorher wolle er die ganze Sache dem Kollegium der Locandieri unterbreiten, o ja, auch wenn jeder wusste, dass es nichts nützte, sagte er und widersprach sich dann noch viele Male, woran ich erkannte, dass er leider wieder dem Greco-Wein zugesprochen hatte.
Der Arzt fuhr fort: »Wir werden die Decken und Kleider des Alten zusammenpacken und sie auf die Straße herunterlassen müssen, wenn der Sammelkarren kommt.«
Dann wandte er sich an Pompeo Dulcibeni: »Habt Ihr auf der Reise von Neapel hierher infizierte Personen getroffen oder von solchen gehört?«
»Absolut nicht.«
Nur mühsam konnte der Grandseigneur aus den Marken seine große Erregung über den Verlust seines Freundes verbergen, dessen Tod zudem noch in seiner Abwesenheit eingetreten war. Ein Schweißfilm bedeckte seine Stirn und seine Wangenknochen. Der Arzt befragte ihn zu einer Menge Einzelheiten: ob der Alte regelmäßig gegessen habe, ob er guten Stuhlgang gehabt habe, ob er schwermütig gewesen sei, kurz, ob er Anzeichen von Unwohlsein gezeigt habe, die über die gewöhnlich vom fortgeschrittenen Alter verursachten Beschwerden hinausgingen. Doch Dulcibeni hatte nicht diesen Eindruck gehabt. Er selbst war von recht korpulenter Statur und stets in einen schwarzen Gehrock gekleidet; was ihn aber in Sonderheit behäbig und plump machte, war eine uralte Halskrause flämischer Machart (welche, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren einmal Mode gewesen sein muss), von seinem vorstehenden Bauch ganz abgesehen. Diese Leibesfülle und auch seine kräftige Gesichtsfarbe ließen vermuten, dass seine Vorliebe für das Essen nicht geringer war als die meines Herrn für den Wein. Die dichten, bereits schlohweißen Haare, das verhaltene Temperament, die leicht schleppende Stimme und das ernste, nachdenkliche Aussehen verliehen ihm den Anschein eines rechtschaffenen und gesitteten Mannes. Erst im Laufe der Zeit und nach aufmerksamerer Beobachtung sah ich später in seinen strengen, blaugrünen Augen und seinen schütteren, stets gerunzelten Brauen den Widerschein einer geheimen, unausrottbaren Verbissenheit.
Dulcibeni sagte, er habe den verstorbenen Signor de Mourai zufällig auf einer Reise kennen gelernt und wisse nicht viel über ihn. Er habe ihn zusammen mit Signor Devizé von Neapel hierher begleitet, weil der Alte, da er fast blind war, Betreuung brauchte. Signor Devizé, der Musikus und Gitarrenspieler, war hingegen nach Italien gekommen, bemerkte Dulcibeni weiter, während Devizé bestätigend nickte, um bei einem neapolitanischen Lautenbauer ein neues Instrument zu kaufen. Danach habe er den Wunsch geäußert, in Rom zu verweilen, um dort die neuesten musikalischen Stile kennen zu lernen, bevor er nach Paris zurückkehrte.
»Was passiert, wenn wir das Haus verlassen, bevor die Quarantäne zu Ende ist?«, fragte ich dazwischen.
»Die Flucht zu wagen ist die unvernünftigste Lösung«, erwiderte Cristofano, »da die Ausgänge alle vernagelt wurden, sogar die Tür, die von dem Türmchen, das Jungfer Cloridia bewohnt, aufs Dach führt. Die Fenster wiederum sind zu hoch oder vergittert, und unten steht ein Wachsoldat. Besser so: Bei der Flucht aus einer Quarantäne überrascht zu werden würde eine überaus harte Strafe nach sich ziehen und eine weit ärgere Absonderung über Jahre und Jahre. Die Leute aus dem Viertel würden dabei helfen, dem Flüchtigen auf die Spur zu kommen.«
Inzwischen war es dunkel geworden, und ich verteilte die Öllampen.
»Versuchen wir, guten Mutes zu bleiben«, fügte der toskanische Arzt hinzu und sah meinen Herrn bedeutungsvoll an. »Wir müssen den Eindruck vermitteln, dass zwischen uns bestes Einvernehmen herrscht. Wenn sich die Dinge nicht ändern, werde ich euch nicht untersuchen, außer ihr verlangt es von mir; sollten indes weitere Fälle von Schwachheit auftreten, werde ich es zum Wohle aller tun müssen. Gebt mir sofort Nachricht, wenn ihr euch gesundheitlich angegriffen fühlt, auch wenn ihr meint, es sei nur eine Lappalie. Im Augenblick ist es jedenfalls nicht angebracht, sich zu ängstigen, denn dieser Mann« – er wies auf den reglosen Leib von Signor de Mourai – »ist nicht an der Pest gestorben.«
»Woran dann?«, fragte Abbé Melani.
»Nicht an der Pest, wiederhole ich.«
»Und woher weißt du das, Medikus?«, bohrte der Abbé misstrauisch nach.
»Es ist noch Sommer und recht heiß. Wenn es die Pest ist, kann es sich nur um den Sommertypus handeln, welcher der Verderbung der natürlichen Wärme entspringt und Fieber und Hauptwehe causiert, Leichen, die sogleich schwarz und sehr heiß werden, sowie schwarze, faulige Beulen. Doch von Beulen oder Bubonen oder Geschwüren oder Apostemen, wie immer man es nennen will, findet sich bei ihm keine Spur; weder unter den Achseln noch hinter den Ohren noch in der Leiste. Es hat bei ihm weder Anstieg der Leibwärme noch Ausdörrung gegeben. Und nach den Auskünften seiner Reisegefährten schien es ihm bis wenige Stunden vor seinem Tod noch recht gut zu gehen. Das genügt, dünkt mir, um die Seuche auszuschließen.«
»Dann ist es ein anderes Übel«, erwiderte Melani.
»Ich sage es noch einmal: Um das herauszufinden, müsste man die Anatomie bemühen. Also den Leichnam öffnen und von innen untersuchen, wie es die Ärzte in den Niederlanden machen. Nach einer äußerlichen Examination könnte ich auf einen jähen Anfall von fauligem Fieber schließen, den man nicht erkennt, bis es zu spät ist. Ich entdecke an dem Leichnam jedoch weder Fäulnis noch übel riechende Ausdünstungen, die nicht vom Tod oder vom Alter herrühren. Ich könnte vielleicht vermuten, es handele sich um Morbus Mazucco oder Modoro, wie die Spanier sagen: Causa ist eine Art Apostem, ein Abszess im Hirn, also unsichtbar, wenn aber allbereit ein Apostem erfolgt ist, so ist kein Rat, sondern es muss der Mensch sterben und das Leben lassen. Wird die Krankheit hingegen bei den allerersten Anzeichen erkannt, ist sie leicht zu heilen. Kurz und gut, wenn ich von der Sache nur ein paar Tage früher erfahren hätte, so hätte ich ihn vielleicht retten können. Es hätte genügt, aus einer der beiden Adern unter der Zunge Blut zu lassen, beim Trinken eine Spur Vitriolöl beizumischen und Magen und Haupt mit geweihtem Öl zu salben. Doch wie es scheint, hat der alte Mourai keinerlei Zeichen gegeben, dass es ihm schlecht geht. Darüber hinaus …«
»Darüber hinaus?«, ermunterte Melani ihn.
»… lässt der Morbus Mazucco gewiss nicht die Zunge anschwellen«, schloss der Arzt mit einem bedeutsamen Lächeln. »Vielleicht ist es … etwas Ähnliches wie Gift.«