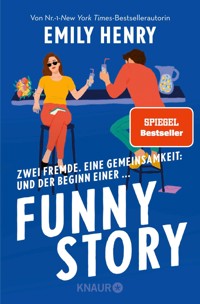9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Sprache: Deutsch
Die Romance-Autorin und der Literat: charmante Romcom über Bücher, das Leben und natürlich die Liebe Wie schreibt man einen Liebesroman, wenn die eigene Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist?: In einem idyllisch gelegenen Strandhaus hofft die New Yorker Romance-Autorin January, ihre Schreibblockade zu überwinden, denn der Abgabetermin für ihren neuesten Liebesroman rückt unerbittlich näher. Gleich am ersten Abend beobachtet January eine wilde Party bei ihrem Nachbarn – der sich ausgerechnet als der arrogante Gus herausstellt, mit dem sie vor Jahren einen Schreibkurs besucht hat. Als January erfährt, dass Gus ebenfalls in einer veritablen Schreibkrise steckt, seit er sich vorgenommen hat, den nächsten großen amerikanischen Roman zu verfassen, hat sie eine ebenso verzweifelte wie geniale Idee: Sie schreiben einfach das Buch des jeweils anderen weiter! Ein Experiment mit erstaunlichen Folgen … Eine bezaubernde romantische Komödie für alle, deren große Liebe das Lesen ist »Verliebt in deine schönsten Seiten« ist eine moderne, locker-leicht erzählte romantische Komödie über zwei Autoren mit erheblichen Vorurteilen gegen das Genre des jeweils anderen, über die Liebe zu Büchern und zum Lesen und natürlich über das Suchen (und Finden) der ganz großen Liebe, die sich gerne da versteckt, wo man sie am wenigsten erwartet. Entdecke auch die anderen fröhlich-originellen RomComs der Bestseller-Autorin, die sich perfekt als Urlaubslektüre eigenen: - Happy Place - Kein Sommer ohne dich - Book Lovers - Funny Story
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Emily Henry
Verliebt in deine schönsten Seiten
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Naumann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wie schreibt man einen Liebesroman, wenn die eigene Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist?
In einem idyllisch gelegenen Strandhaus hofft die New Yorker Romance-Autorin January, ihre Schreibblockade zu überwinden, denn der Abgabetermin für ihren neuesten Liebesroman rückt unerbittlich näher. Gleich am ersten Abend beobachtet January eine wilde Party bei ihrem Nachbarn – der sich ausgerechnet als der arrogante Gus herausstellt, mit dem sie vor Jahren einen Schreibkurs besucht hat. Als January erfährt, dass Gus ebenfalls in einer veritablen Schreibkrise steckt, seit er sich vorgenommen hat, den nächsten großen amerikanischen Roman zu verfassen, hat sie eine ebenso verzweifelte wie geniale Idee: Sie schreiben einfach das Buch des jeweils anderen weiter! Ein Experiment mit erstaunlichen Folgen …
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Dank
Für Joey:
Du bist so dermaßen mein Lieblingsmensch
Kapitel eins
Das Haus
Ich habe einen schlimmen Charakterfehler.
Ich glaube, wir alle haben einen. Zumindest macht mir diese Annahme das Schreiben leichter – so kann ich meine Heldinnen und Helden um diesen einen, selbstzerstörerischen Charakterzug herum bauen und alles, was ihnen in meinem Roman passiert, daran aufhängen: an den Strategien, die sie früher einmal gelernt haben, um sich zu schützen, die sie deshalb jetzt nicht mehr ablegen können, obwohl sie ihnen längst nicht mehr nützen.
Vielleicht hatte man als Kind zum Beispiel nicht so viel Kontrolle über sein Leben. Um Enttäuschungen zu vermeiden, fragte man sich daher nie, was man wirklich wollte. Das funktionierte dann auch für eine lange Zeit. Und dann irgendwann begreift man, dass man nie bekommen hat, was man wollte, weil man nicht wusste, was man wollte, und rast in einem Midlife-Crisis-Auto mit Karacho die Autobahn entlang, mit einer Tasche voller Geld auf dem Beifahrersitz und einem Mann namens Stan im Kofferraum.
Vielleicht ist dein schlimmer Fehler, dass du nie den Blinker setzt.
Oder vielleicht bist du wie ich hoffnungslos romantisch. Du kannst einfach nicht aufhören, dir immer dieselbe Geschichte zu erzählen. Die Geschichte deines eigenen Lebens, mit melodramatischem Soundtrack und goldenem Licht, das durchs Autofenster fällt.
Es fing an, als ich zwölf Jahre alt war. Meine Eltern setzten sich mit mir an den Küchentisch, um mir die Neuigkeiten zu erzählen. Mom hatte gerade ihre erste Diagnose bekommen – verdächtige Zellen in ihrer linken Brust – und schärfte mir so sehr ein, mir keine Sorgen zu machen, dass ich schon glaubte, Hausarrest zu bekommen, wenn sie mich dabei erwischte. Meine Mom war immer jemand, der die Dinge anpackte, der viel lachte, eine Optimistin, niemand, der sich viel Sorgen machte, aber ich spürte, dass sie Angst hatte, also hatte ich ebenfalls Angst. Ich saß wie erstarrt da und wusste nicht, was ich sagen sollte, um nicht alles noch schlimmer zu machen.
Aber dann tat mein lebensferner, häuslicher Vater etwas Unerwartetes. Er stand auf und nahm unsere Hände – eine von Mom, eine von mir – und sagte: Wisst ihr, was wir machen müssen, um diese Angst zu verlieren? Wir müssen tanzen!
In unserem Vorort gab es keine Clubs, nur ein mittelmäßiges Steakhaus, in dem freitags eine Band spielte, aber Mom freute sich, als hätte er gerade vorgeschlagen, mit einem Privatjet an die Copacabana zu fahren.
Sie trug ihr vanillegelbes Kleid und gehämmerte Metallohrringe, die glitzerten, wenn sie sich bewegte. Dad bestellte zwanzig Jahre alten Scotch für sich und Mom und einen Shirley Temple für mich, und wir drei wirbelten und hopsten auf der Tanzfläche herum, bis uns ganz schwindlig war, wir lachten und stolperten übereinander. Wir lachten, bis wir kaum noch stehen konnten, und mein für seine Zurückhaltung bekannter Vater sang bei »Brown Eyed Girl« mit lauter Stimme mit, als würden uns nicht alle im Saal anstarren.
Und dann fielen wir erschöpft ins Auto und fuhren durch die Stille nach Hause. Mom und Dad hielten zwischen den Sitzen Händchen, und ich lehnte den Kopf gegen das Autofenster, beobachtete, wie die Straßenlaternen vorbeizogen, und dachte: Es wird alles gut. Uns wird es immer gut gehen.
Und in diesem Moment begriff ich: Wenn die Welt sich dunkel und beängstigend anfühlte, ging die Liebe mit einem tanzen; Lachen konnte den Schmerz mildern; Schönheit konnte Löcher in die Angst treiben. Ich beschloss, dass mein Leben voller Liebe, Lachen und Schönheit sein sollte. Nicht nur um meinetwillen, sondern auch wegen Mom und für alle anderen um mich herum.
Es würde Ziele geben. Es würde Schönheit geben. Es würde Kerzenlicht geben, und Fleetwood Mac würde leise im Hintergrund spielen.
Was ich damit sagen will, ist, dass ich begann, mir mein Leben als wunderschöne Geschichte zu erzählen, in der es um Schicksal ging und darum, wie alles gut wird, und als ich achtundzwanzig war, war meine Geschichte perfekt.
Mit perfekten (krebsfreien) Eltern, die mehrmals die Woche anriefen, ein bisschen betrunken vom Wein und davon, zusammen zu sein. Mit einem perfekten (spontanen, mehrsprachigen, eins neunzig großen) Freund, der in der Notaufnahme arbeitete und wusste, wie man Coq au vin zubereitete. Mit einer Wohnung in Queens, perfekt eingerichtet im Shabby-chic-Stil. Mit einem perfekten Job als Autorin von Liebesromanen – inspiriert von den perfekten Eltern und dem perfekten Freund – für Sandy Lowe Books.
Ein perfektes Leben.
Aber das war nur eine Geschichte, und als sich plötzlich ein riesiges Loch in der Handlung auftat, brach alles zusammen. Denn so ist das bei Geschichten.
Jetzt, mit neunundzwanzig, ging es mir schlecht. Ich war pleite, fast wohnungslos, sehr alleinstehend und fuhr gerade die Auffahrt zu einem wunderschönen Haus am See hinauf, dessen schiere Existenz mir Übelkeit bereitete. Mein Leben zu romantisieren half mir nicht mehr, aber mein schlimmer Charakterfehler saß immer noch auf dem Beifahrersitz in meinem ramponierten Kia und erzählte:
January Andrews schaute aus dem Autofenster auf den windgepeitschten See, dessen Wellen gegen das düstere Ufer schlugen. Sie versuchte sich einzureden, dass es kein Fehler gewesen war herzukommen.
Es war eindeutig ein Fehler, aber ich hatte keine Wahl. Man lehnt eine freie Unterkunft nun mal nicht ab, wenn man pleite ist.
Ich parkte auf der Straße und schaute zur riesigen Fassade des Hauses empor, zu seinen glänzenden Fenstern und der märchenhaften Veranda. Der struppige Strandhafer bewegte sich in der warmen Brise.
Ich verglich die Adresse auf meinem GPS noch einmal mit der handgeschriebenen auf dem Hausschlüssel. Ja, das hier war das Haus.
Eine Minute lang blieb ich sitzen in der Hoffnung, dass vielleicht ein zerstörerischer Asteroid die Welt vernichten würde, bevor ich dazu gezwungen wäre, ins Haus zu gehen. Dann atmete ich tief durch und stieg aus, wobei ich meinen vollgestopften Koffer vom Rücksitz zerrte, zusammen mit dem Pappkarton voller Ginflaschen.
Ich schob mir das dunkle Haar aus den Augen, um mir die schneeweiß abgesetzten kornblumenblauen Schindeln anzuschauen. Tu einfach so, als wäre das hier ein Airbnb.
Sofort stellte ich mir vor, wie dieses Haus bei Airbnb angepriesen worden wäre: Cottage mit drei Zimmern und drei Badezimmern direkt am See. Voller Charme, außerdem der Beweis, dass dein Vater ein Arschloch und dein Leben eine Lüge war.
Ich begann, den grasbewachsenen Weg hinaufzugehen. Das Blut rauschte in meinen Ohren, meine Knie waren wie Gummi. Ich erwartete unwillkürlich, dass sich sogleich die Hölle auftun und die Welt verschlucken würde.
Aber das ist ja längst passiert. Letztes Jahr. Und es hat dich nicht umgebracht, also wird dich das hier auch nicht umbringen.
Als ich auf der Veranda stand, waren alle meine Sinne zum Zerreißen gespannt. Das Kribbeln in meinem Gesicht, der Stein in meinem Magen, der Schweiß in meinem Nacken. Ich balancierte den Ginkarton auf der Hüfte und ließ den Schlüssel ins Schloss gleiten. Ein Teil von mir hoffte heimlich, dass es klemmte. Dass all das nur ein komplizierter Streich war, den mein Dad für uns geplant hatte, bevor er gestorben war.
Oder noch besser: dass er gar nicht tot war. Dass er hinter den Büschen hervorspringen und schreien würde: »Reingefallen! Habt ihr ernsthaft geglaubt, ich führte ein Doppelleben? Ihr konntet doch nicht wirklich annehmen, ich besäße ein zweites Haus mit irgendeiner Frau, die nicht deine Mutter ist?«
Der Schlüssel drehte sich glatt im Schloss. Die Tür öffnete sich.
Im Haus war es still.
Ich spürte einen Schmerz. Denselben, den ich mindestens einmal am Tag gespürt hatte, seit Mom mich angerufen hatte, um mir vom Schlaganfall zu erzählen. »Er ist tot, Janie«, hatte sie geschluchzt.
Kein Dad. Nicht hier, nirgends. Und dann der zweite Schmerz, wie ein Messer, das sich in einer Wunde drehte: Den Vater, den du zu kennen geglaubt hast, gab es ohnehin nie.
Ich hatte ihn nie wirklich. Ebenso, wie ich niemals wirklich meinen Ex Jacques hatte – oder seinen Coq au vin.
Das war alles nur eine Geschichte gewesen, die ich mir selbst erzählt hatte. Von jetzt an wollte ich der hässlichen Wahrheit ins Gesicht sehen. Ich wappnete mich und trat ein.
Mein erster Gedanke war, dass die hässliche Wahrheit eigentlich gar nicht so furchtbar hässlich war. Das Liebesnest meines Vaters war unten offen gebaut und bestand aus einem Wohnzimmer, das in eine schicke, blau gekachelte Küche mit gemütlicher Essecke überging. Die Wand dahinter war verglast und ging auf eine dunkel gebeizte Holzterrasse hinaus.
Wenn Mom dieses Haus gehört hätte, wäre es ganz in cremigen, beruhigenden Pastelltönen gehalten gewesen. Das unkonventionelle Zimmer, in das ich hier getreten war, hätte mehr in Jacques’ und meine alte Wohnung gepasst als ins Haus meiner Eltern. Mir war ein bisschen flau bei der Vorstellung, dass Dad hier gewohnt hatte, inmitten all der Möbel und Dinge, die Mom niemals ausgewählt hätte: des rustikalen handbemalten Esstisches, der dunklen Bücherregale, des durchgesessenen Sofas mit den bunten Kissen.
Hier gab es keinerlei Hinweis auf die Version von ihm, die ich gekannt hatte.
Mein Telefon klingelte in meiner Tasche, und ich stellte die Kiste auf der Arbeitsfläche aus Granit ab, um ranzugehen.
»Hallo?« Meine Stimme klang schwach und rau.
»Wie ist es denn?«, fragte die Stimme am anderen Ende der Leitung ohne Umschweife. »Gibt es eine Sexhöhle?«
»Shadi?«, riet ich.
»Ich mache mir ernsthaft Sorgen darüber, dass ich offenbar der einzige Mensch bin, die dich extra anruft, um dich das zu fragen«, antwortete sie.
»Du bist der einzige Mensch, der überhaupt von dem Liebesnest weiß«, versetzte ich.
»Ich bin nicht die Einzige, die davon weiß«, widersprach Shadi.
Das stimmte, rein technisch gesehen. Ich hatte vor einem Jahr herausgefunden, dass mein Vater ein geheimes Haus am See besaß, aber Mom hatte schon viel länger davon gewusst. »Gut«, sagte ich. »Du bist der einzige Mensch, dem ich davon erzählt habe. Aber gib mir noch eine Sekunde. Ich bin gerade erst hier angekommen.«
»Buchstäblich?« Shadi atmete schwer, was darauf schließen ließ, dass sie gerade zur Arbeit im Restaurant ging. Da wir so unterschiedliche Tagesabläufe hatten, unterhielten wir uns meistens zu dieser Zeit.
»Nein, metaphorisch«, konterte ich. »Buchstäblich bin ich schon seit Stunden hier, aber erst jetzt habe ich das Gefühl, angekommen zu sein.«
»So weise«, bemerkte Shadi. »So tiefsinnig.«
»Pst«, machte ich. »Ich nehme das alles in mich auf.«
»Und such nach der Sexhöhle!«, beeilte sich Shadi zu sagen, als wollte ich schon auflegen.
Aber das wollte ich nicht. Ich presste nur das Handy ans Ohr, hielt den Atem an, versuchte, das heftig pochende Herz in meiner Brust zu beruhigen und schaute mich im zweiten Leben meines Vaters um.
Und dann, gerade als ich mir schon erfolgreich eingeredet hatte, dass Dad auf keinen Fall Zeit hier verbracht haben konnte, entdeckte ich etwas Gerahmtes an der Wand. Den Ausschnitt einer New York Times-Bestsellerliste von vor drei Jahren, derselben, die auch über dem Kamin zu Hause hing. Da stand ich, auf Nummer fünfzehn, ganz unten. Und dort, drei Plätze über mir, stand – üble Ironie des Schicksals – mein College-Rivale Gus (der sich inzwischen Augustus nannte – als ernst zu nehmender Mann) und sein anspruchsvoller Debütroman Die Offenbarenden. Sein Roman war fünf Wochen auf der Liste geblieben – nicht, dass ich mitgezählt hätte (ich hatte absolut nicht mitgezählt).
»Und?«, fragte Shadi. »Wie ist es?«
Ich drehte mich um meine eigene Achse, und mein Blick fiel auf den Wandteppich mit Mandela-Motiv über der Couch.
»Langsam frage ich mich, ob Dad wohl Gras geraucht hat.« Ich drehte mich zu den Fenstern an der Seite des Hauses um, die beinahe genau in die Fenster der Nachbarn schauten, ein Konstruktionsfehler, den Mom niemals übersehen haben würde, wenn sie das Haus gekauft hätte.
Aber dieses Haus gehörte ihr nicht, und ich konnte direkt auf die deckenhohen Regale im Arbeitszimmer des Nachbarn schauen.
»Oh Gott – ist es ein Gewächshaus?« Shadi klang begeistert. »Du hättest den Brief lesen sollen, January. Das war alles nur ein Missverständnis. Dein Dad hinterlässt dir das Familienunternehmen. Diese Frau war seine Geschäftspartnerin, nicht seine Geliebte.«
Jedenfalls hatte ich wirklich vorgehabt, den Brief zu lesen. Ich hatte nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und gehofft, dass der erste Zorn bis dahin verflogen und Dads letzte Worte tröstlich sein würden. Stattdessen war ein volles Jahr vergangen, und die Angst, die ich vor dem Öffnen des Umschlages hatte, wuchs mit jedem Tag. Es war so unfair, dass er das letzte Wort hatte und ich ihm nichts erwidern konnte. Und sobald ich den Brief geöffnet hätte, könnte ich nicht mehr zurück. Das wäre es dann. Der letzte Abschied.
Und so fristete der Brief bis auf Weiteres sein glückliches, wenn auch ein wenig einsames Dasein am Boden der Ginkiste, die ich aus Queens mitgebracht hatte.
»Es ist kein Gewächshaus«, sagte ich, schob die Glastür auf und trat auf die Terrasse hinaus. »Es sei denn, das Gras ist im Keller.«
»Auf keinen Fall«, versetzte Shadi. »Da ist ja schon die Sexhöhle.«
»Können wir vielleicht aufhören, über mein deprimierendes Leben zu sprechen?«
»Du meinst den Geisterhut«, sagte Shadi. Wenn sie nur weniger als vier Mitbewohner in ihrer schuhkartonkleinen Wohnung in Chicago hätte, dann würde ich jetzt bei ihr wohnen. Nicht, dass ich in der Lage wäre, irgendetwas geregelt zu kriegen, wenn Shadi und ich zusammen waren. Und meine finanzielle Situation war zu trostlos, als dass ich mir das hätte leisten können. Ich musste mein nächstes Buch in dieser mietfreien Hölle fertigbekommen. Dann würde ich mir vielleicht meine eigene Jacques-freie Wohnung leisten können.
»Wenn du unbedingt über den Geisterhut sprechen willst«, sagte ich, »dann mal los. Erzähl mir alles.«
»Hat immer noch nicht mit mir geredet«, seufzte Shadi wehmütig, »aber ich kann sozusagen spüren, wie er mich ansieht, wenn wir zusammen in der Küche sind. Weil wir eine Verbindung haben.«
»Machst du dir gar keine Sorgen, dass du diese Verbindung vielleicht gar nicht mit dem Typen hast, der diesen antiken Pork-Pie-Hut trägt, sondern vielleicht mit dem Geist des ursprünglichen Hutbesitzers? Was tust du, wenn du merkst, dass du dich in einen Geist verliebt hast?«
»Ähmmm.« Shadi dachte einen Moment lang nach. »Ich glaube, ich muss meine Tinder-Bio aktualisieren.«
Eine warme Brise kräuselte die glitzernden Wellen am Fuß des Hügels, zauste mein Haar und wehte mir die braunen Locken über die Schultern. Die untergehende Sonne lag über allem, so hell und heiß, dass ich blinzeln musste, wenn ich auf den in orangefarben und rot getöntes Licht getauchten Strand hinausschaute. Wenn das hier einfach nur ein Haus wäre, das ich gemietet hatte, wäre es der perfekte Ort, um die hinreißende Liebesgeschichte zu schreiben, die ich Sandy Lowe Books schon seit Monaten versprochen hatte.
Shadi, das bemerkte ich erst jetzt, hatte weitergesprochen. Noch mehr über den Geisterhut. Geisterhut hieß Ricky, aber wir nannten ihn nie so. Über Shadis Liebesleben sprachen wir immer verschlüsselt. Da war dieser ältere Mann, der das großartige Seafood-Restaurant (The Fish Lord) leitete, dann war da ein Typ, den wir Mark nannten, weil er aussah wie ein anderer, berühmter Mark, und jetzt war da ihr neuer Mitarbeiter, ein Bartender, der jeden Tag einen Hut trug, den Shadi scheußlich fand und dem sie dennoch nicht widerstehen konnte.
Ich hörte Shadi wieder zu, als sie gerade sagte: »Am Wochenende des vierten Juli? Kann ich dich dann besuchen?«
»Das ist noch mehr als einen Monat hin.« Ich wollte einwenden, dass ich bis dahin gar nicht mehr hier sein würde, aber ich wusste, dass das nicht stimmte. Ich würde mindestens den Sommer brauchen, um ein Buch zu schreiben, das Haus auszuräumen und beides zu verkaufen, damit ich (hoffentlich) bald wieder relativ bequem leben konnte. Nicht in New York, sondern an einem weniger teuren Ort. Ich nahm an, dass Duluth erschwinglich sein würde. Mom würde mich dort nie besuchen, aber wir hatten uns im vergangenen Jahr ohnehin nicht sehr oft gesehen, abgesehen von meinem dreitägigen Besuch zu Weihnachten. Sie hatte mich zu vier Yogastunden gezerrt, in drei überfüllte Saftbars und in eine Aufführung des Nussknackers, in dem irgendein Kind mitspielte, das ich nicht kannte, damit wir nur nicht auch nur eine Sekunde lang allein waren. Vermutlich fürchtete sie, dass das Gespräch auf Dad kommen und wir in Flammen aufgehen würden.
Mein ganzes Leben lang waren meine Freunde neidisch auf meine Beziehung zu ihr gewesen. So oft und offen (jedenfalls glaubte ich das damals), wie wir miteinander sprachen, wie viel Spaß wir zusammen hatten. Jetzt bestand unsere Beziehung darin, dass wir versuchten, einander möglichst nicht anzurufen.
Ich hatte zwei liebende Eltern und einen Freund gehabt, mit dem ich zusammengelebt hatte, und jetzt hatte ich im Prinzip nur noch Shadi, meine viel zu weit weg wohnende beste Freundin. Das einzig Gute daran, dass ich von New York nach North Bear Shores, Michigan, gezogen war, war, dass ich es jetzt nicht mehr so weit nach Chicago hatte, wo sie wohnte.
»Der vierte Juli ist viel zu lang hin«, beschwerte ich mich. »Du wohnst doch nur drei Stunden entfernt.«
»Ja, und ich kann nicht Auto fahren.«
»Dann solltest du den Führerschein vielleicht zurückgeben«, bemerkte ich.
»Glaub mir, ich warte nur noch darauf, dass er ungültig wird. Ich werde mich so frei fühlen, wenn meine Referenzen endlich zu meinen Fähigkeiten passen. Ich hasse es, dass die Leute glauben, ich könnte Auto fahren, nur weil ich das vor dem Gesetz darf.«
Shadi war eine schreckliche Autofahrerin. Sie schrie jedes Mal, wenn sie nach links abbiegen musste.
»Außerdem weißt du, wie schwierig es ist, in dem Business freizubekommen. Ich habe noch Glück, dass mein Chef mir den vierten Juli genehmigt hat. Vermutlich erwartet er jetzt, dass ich ihm dafür einen blase.«
»Auf keinen Fall. Blowjobs gibt es nur für den Jahresurlaub. Was du ihm dafür bieten kannst, ist ein guter alter Footjob, quid pro quo.«
Ich nahm einen Schluck Gin, wandte mich von der Aussicht ab und kreischte beinahe auf. Auf der benachbarten Terrasse entdeckte ich über der Rückenlehne eines Liegestuhls einen braunen Lockenkopf. Einen seligen Moment lang redete ich mir ein, dass der Nachbar im Liegestuhl eingeschlafen war, dass ich nicht den ganzen Sommer neben jemandem verbringen musste, der mitgehört hatte, wie ich guter alter Footjob geschrien hatte.
Als hätte er meine Gedanken gelesen, beugte er sich vor und nahm die Bierflasche von seinem Tischchen, um einen Schluck zu nehmen und sich wieder zurückzulehnen.
»Du hast ja so was von recht. Ich müsste nicht mal meine Crocs ausziehen«, sagte Shadi am anderen Ende. »Jedenfalls bin ich jetzt gerade bei der Arbeit angekommen. Aber sag mir Bescheid, wenn du Drogen oder Ledergeschirr im Keller findest.«
Ich wandte mich von der Nachbarterrasse ab, fasste mich wieder und sagte: »Ich schaue nicht nach, bis du mich besuchst.«
»Frech«, bemerkte Shadi.
»Druckmittel«, sagte ich. »Hab dich lieb.«
»Hab dich lieber«, entgegnete sie und legte auf.
Ich drehte mich wieder zum Lockenkopf um und wartete, dass er mich bemerkte, damit ich mich vorstellen konnte.
In New York hatte ich keinen meiner Nachbarn gekannt, aber hier waren wir in Michigan, und nach allem, was mir mein Dad aus seiner Kindheit in North Bear Shores erzählt hatte, war ich vollkommen darauf vorbereitet, diesem Mann irgendwann einmal Zucker leihen zu müssen (Erinnerung: Muss Zucker kaufen). Ich räusperte mich und versuchte, ein nachbarliches Lächeln aufzusetzen. Wieder beugte er sich vor, um noch einen Schluck Bier zu nehmen, und ich rief: »Entschuldigen Sie die Störung!«
Er winkte lässig mit der Hand und blätterte die Seite im Buch auf seinem Schoß um. »Was soll mich wohl an Footjobs als Währungseinheit stören?«, fragte er gedehnt mit rauchiger, gelangweilter Stimme.
Ich verzog das Gesicht und suchte nach einer Entgegnung – irgendeiner Entgegnung. Der alten January wäre sofort etwas eingefallen, aber mein Hirn war so leer wie jedes Mal in letzter Zeit, wenn ich Microsoft Word öffnete.
Na gut, vielleicht war ich im vergangenen Jahr ein bisschen eigenbrötlerisch geworden. Vielleicht war ich mir nicht einmal mehr ganz sicher, womit ich das Jahr überhaupt verbracht hatte, jedenfalls nicht damit, Mom zu besuchen, und auch nicht, ein Buch zu schreiben, und ganz sicher nicht, meine Nachbarn nach Strich und Faden um den Finger zu wickeln.
»Na egal«, presste ich schließlich hervor. »Ich wohne hier jetzt nämlich.«
Als hätte er meine Gedanken gelesen, winkte er desinteressiert ab und grummelte: »Dann lassen Sie es mich wissen, falls Sie mal Zucker brauchen.« Es klang wie Sprechen Sie bloß nicht wieder mit mir, es sei denn, Sie bemerken, dass mein Haus in Flammen steht, und selbst dann: Warten Sie erst ab, ob sich die Sirenen schon nähern.
So viel zur Gastfreundschaft im Mittleren Westen. In New York hatten uns unsere Nachbarn immerhin Kekse gebracht, als wir einzogen (sie waren glutenfrei und mit LSD gewesen, aber der Gedanke zählte).
»Oder wenn Sie die Wegbeschreibung zum nächsten Sexfetisch-Laden brauchen«, fügte der Griesgram hinzu.
Hitze stieg mir in die Wangen, ich war peinlich berührt und ärgerlich. Bevor ich nachdenken konnte, zickte ich zurück: »Ich warte dann einfach darauf, dass Sie losfahren, und folge Ihnen unauffällig.« Er lachte, es klang überrascht und rau, aber drehte sich immer noch nicht zu mir um.
»War wunderbar, Sie kennengelernt zu haben«, fügte ich sarkastisch hinzu. Dann drehte ich mich um, um durch die gläserne Schiebetür zurück ins Haus zu gehen, in dem ich mich vermutlich den ganzen Sommer über verschanzen musste.
»Lügnerin«, hörte ich ihn brummen, bevor ich die Tür schloss.
Kapitel zwei
Die Beerdigung
Ich war noch nicht bereit, mir den Rest des Hauses genauer anzusehen, also setzte ich mich an den Tisch, um zu schreiben. Wie immer starrte mich die leere Computerseite vorwurfsvoll an und wollte sich einfach nicht mit Wörtern oder Figuren füllen, egal wie lange ich zurückstarrte. Mit dem Schreiben von Liebesromanen ist es nämlich so: Es hilft, wenn man daran glaubt.
Und mit mir ist es so: Ich hatte bis zum Tag der Beerdigung meines Vaters tatsächlich daran geglaubt.
Meine Eltern, meine Familie hatten schon so viel hinter sich, und doch kamen wir jedes Mal gestärkt daraus hervor, mit noch mehr Liebe und Lachen als vorher. Da war diese kurze Trennung, als ich noch ein Kind war und Mom das Gefühl hatte, nicht mehr zu wissen, wer sie war, als sie anfing, aus dem Fenster zu starren, als würde sie sich selbst dort sehen, wie sie lebte, und genau wissen, was sie als Nächstes tun musste. Es gab Tänzchen in der Küche, Händchenhalten und Stirnküsse, als Dad wieder einzog. Dann war da Moms erste Krebsdiagnose und das irre teure Festmahl, als sie ihn überwand. Wir aßen wie Millionäre und lachten über den überteuerten Wein, und mein Mineralwasser drang mir durch die Nase, als könnten wir uns leisten, es zu verschwenden, als gäbe es keine Arztrechnungen. Und dann der zweite Krebsausbruch und das neue Leben nach der Mastektomie: die Töpferkurse, die Tanz-, Yoga- und marokkanischen Kochkurse, mit denen meine Eltern ihre Freizeit füllten, als wären sie entschlossen, so viel Leben in so wenig Zeit wie möglich zu stopfen. Lange Wochenendausflüge, um Jacques und mich in New York zu besuchen, Fahrten mit der Subway, während denen Mom mich anflehte, aufzuhören, sie mit Geschichten von unseren Kiffernachbarn Sharyn und Karyn zu traktieren (nicht verwandt miteinander; sie schoben uns ständig Infoblätter der Flat Earth Society unter der Tür hindurch, die die Überzeugung vertritt, dass die Erde eine Scheibe ist), weil sie fürchtete, sich in die Hosen zu machen. Dad widerlegte unterdessen im Flüsterton die Theorie der Flat Earth Society für Jacques.
Schicksalsschlag. Happy End. Schwere Zeiten. Happy End. Chemo. Happy End.
Und dann, mitten im glücklichsten Happy End von allen, war er einfach tot.
Ich stand da, in der Eingangshalle von seiner und Moms Kirche, in einem Meer schwarz gekleideter Menschen, die überflüssige Worte flüsterten, und hatte das Gefühl, hierher geschlafwandelt zu sein. Ich konnte mich kaum an den Flug, die Fahrt zum Flughafen, das Packen erinnern. Aber ich erinnerte mich zum millionsten Mal in den letzten drei Tagen, dass er tot war.
Mom war kurz auf die Toilette gegangen, und ich war allein. Da sah ich sie: die einzige Frau, die ich nicht kannte. Sie trug ein graues Maxikleid, Ledersandalen und einen schwarzen gehäkelten Schal, den sie sich nachlässig um die Schultern geschlungen hatte. Sie hatte kurzes weißes Haar, ein wenig vom Wind zerzaust, und sie starrte mich an.
Nach kurzem Zögern ging sie auf mich zu, und aus irgendeinem Grund hatte ich da bereits das Gefühl, dass mir der Magen nach unten sackte. Als wüsste mein Körper, dass sich alles ändern würde. Dass die Anwesenheit dieser Fremden auf Dads Beerdigung mein Leben ebenso aus der Bahn bringen würde wie sein Tod.
Sie lächelte zögerlich, als sie vor mir stand. Sie roch nach Vanille und Zitrus. »Hallo, January.« Ihre Stimme war rauchig, ihre Finger zupften nervös an den Fransen ihres Schals. »Ich habe ja so viel von dir gehört.«
Hinter ihr öffnete sich die Tür zur Toilette, und Mom kam heraus. Sie blieb stehen, erstarrt wie ein Eisblock, und ihr Gesichtsausdruck war mir ganz fremd. War es ein Wiedererkennen? Ein Erschrecken?
Sie wollte nicht, dass wir miteinander sprachen. Was bedeutete das?
»Ich bin eine alte Freundin deines Vaters«, sagte die Frau. »Er bedeutet… er bedeutete mir sehr viel. Ich kannte ihn so ziemlich mein ganzes Leben lang. Für eine lange Zeit waren wir praktisch unzertrennlich, und – er hat ununterbrochen von dir geredet.« Ihr Lachen sollte leichthin klingen, war aber Lichtjahre davon entfernt.
»Tut mir leid«, sagte sie heiser. »Ich habe versprochen, nicht zu weinen, aber …«
Ich fühlte mich, als hätte man mich von einem hohen Gebäude geschubst. Der Fall schien unendlich zu sein.
Alte Freundin. Das hatte sie gesagt. Nicht Geliebte oder Mätresse. Aber ich wusste es, sah es an der Art, wie sie bei der Beerdigung weinte – eine verzerrte Version von Moms Tränen. Ich erkannte ihren Blick als denselben wieder, den ich heute Morgen im Spiegel gesehen hatte, als ich Abdeckstift unter die Augen auftrug: Dads Tod hatte sie gebrochen, und sie würde nie wieder heil werden.
Sie holte etwas aus ihrer Tasche und hielt es mir hin. Einen Umschlag, auf den mein Name gekritzelt stand. Darauf lag ein Schlüssel, an dem ein Adressschild hing, in derselben Schrift wie auf dem Umschlag. »Er wollte, dass du das hier bekommst«, sagte sie. »Es gehört dir.«
Sie drückte mir beides in die Hand und ließ ihre kurz auf meiner liegen. »Es ist ein wunderschönes Haus, direkt am Lake Michigan«, brachte sie hervor. »Du wirst es lieben. Ganz bestimmt. Er sagte immer, dass du es lieben würdest. Und der Brief ist für deinen Geburtstag. Du kannst ihn dann öffnen oder … wann du willst.«
Mein Geburtstag. Ich würde erst in sieben Monaten Geburtstag haben. Mein Dad würde dann nicht da sein. Mein Dad war tot.
In Mom, die hinter ihr stand, kam wieder Leben. Sie trat mit einem mordlustigen Gesichtsausdruck auf uns zu. »Sonya«, zischte sie der Frau zu.
Und dann wusste ich alles.
Ich war die ganze Zeit ahnungslos gewesen, Mom aber nicht.
Ich schloss das Word-Dokument, als würde ein Klick auf das kleine x in der Ecke auch die Erinnerungen schließen. Ich suchte nach einer Ablenkung, scrollte durch meine E-Mails und fand die neueste von meiner Agentin Anya.
Sie war vor zwei Tagen eingegangen, bevor ich aus New York losgefahren war, und ich hatte immer lächerliche Gründe dafür gefunden, sie nicht zu öffnen.
Immerhin hatte ich packen müssen. Meine Habseligkeiten einlagern. Fahren. Versuchen, beim Pinkeln so viel Wasser wie möglich zu trinken. »Schreiben« mit Betonung auf den Anführungszeichen. Betrunken. Hungrig. Atmen.
Anya hatte den Ruf, besonders taff zu sein, eine echte Bulldogge den Verlegern gegenüber. Aber zu ihren Autoren war sie praktisch Miss Honey, die liebe Lehrerin aus Matilda, gekreuzt mit einer sexy Hexe. Man wollte ihr immer verzweifelt gefallen, nicht nur, weil man das Gefühl hatte, dass einen niemand je so rückhaltlos lieben und bewundern würde, sondern auch, weil man heimlich befürchtete, sie könnte einem ein Gelege Pythons auf den Hals hetzen, wenn sie es wollte.
Ich leerte meinen dritten Gin Tonic des Abends, öffnete die Mail und las:
Hallooo, Du meine wunderschöne und zauberhafte Qualle, engelsgleiche Künstlerin, Gelddruckmaschine,
ich weiß ja, dass alles in letzter Zeit SO irre war bei Dir, aber Sandy schreibt schon wieder – sie will jetzt echt wissen, wie es mit dem Manuskript läuft, Schrägstrich: ob es immer noch Ende des Sommers zu erwarten ist. Ich bin natürlich wie immer sofort bereit, ans Telefon zu springen (oder übers Internet zu chatten oder auf den Rücken eines Pegasus zu hüpfen und herbeizufliegen, wenn es sein muss), um dir beim Brainstormen zu helfen/Handlungsdetails auszubaldowern/zu tun, WAS AUCH IMMER du brauchst, damit mehr von deinen wunderbaren Wörtern in unvergleichlicher Verzückung das Licht der Welt erblicken.
Fünf Bücher in fünf Jahren war vielleicht ein bisschen viel (selbst für jemanden mit deinem spektakulären Talent), aber ich glaube wirklich, dass wir bei SLB gerade eine Sollbruchstelle erreicht haben, und es ist an der Zeit, die Zähne zusammenzubeißen und es herauszupressen, wenn es irgendwie geht.
XOX,
Anya
»Es herauszupressen.« Ich argwöhnte, dass es mir leichter fallen würde, am Ende des Sommers ein ausgereiftes, vollkommen gesundes Baby aus meinem Uterus zu pressen, als ein neues Buch zu schreiben und zu verkaufen. Wenn ich jetzt ins Bett ging, konnte ich morgen früh um sechs aus dem Bett hüpfen und ein paar tausend Wörter raushauen. Ich zögerte vor dem Schlafzimmer im Erdgeschoss. Ich würde niemals erfahren, in welchen Betten Dad und Diese Frau gelegen hatten.
Ich war praktisch in ein Gruselkabinett des Ehebruchs geraten. Eines Ehebruchs unter Greisen. Das hätte witzig sein können, wenn ich nicht im letzten Jahr die Fähigkeit verloren hätte, etwas lustig zu finden. Seitdem schrieb ich romantische Liebesgeschichten, in denen der Fahrer einschlief und mit all meinen Protagonisten eine Klippe herunterstürzte.
Ich stellte mir immer vor, wie Anya Das ist echt SUPERinteressant sagen würde, wenn ich eins dieser Exposés tatsächlich abschicken würde. Ich meine, ich würde ja sogar über deine EINKAUFSliste lachen und weinen. Aber das hier ist nun wirklich kein Sandy-Lowe-Buch. Fürs Erste also mehr Schmalz und weniger Untergang, Schatzilein.
Ohne Hilfe würde ich hier nicht schlafen können. Also schenkte ich mir noch einen Gin Tonic ein und schloss meinen Computer. Im Haus war es ganz heiß und stickig, also zog ich mich bis auf die Unterwäsche aus und öffnete überall im Erdgeschoss die Fenster. Dann trank ich mein Glas aus und ließ mich aufs Sofa fallen.
Das Sofa, stellte ich fest, war sogar noch gemütlicher, als es aussah. Verdammt sollte diese Frau sein mit ihrem wunderbaren Geschmack. Es war aber außerdem zu niedrig, als dass ein Mann mit Rückenschmerzen davon problemlos hätte aufstehen können, was bedeutete, dass sie darauf vermutlich keinen S.E.X gehabt hatten.
Dad hatte nicht immer Rückenschmerzen gehabt. Als ich noch ein Kind war, fuhr er an den Wochenenden, an denen er zu Hause war, auf dem Boot mit mir hinaus, und ich gewann den Eindruck, dass Bootfahren zu neunzig Prozent daraus bestand, sich zu bücken und Knoten zu knüpfen und wieder zu verknoten, während man die restlichen zehn Prozent damit verbrachte, die Arme auszubreiten, in die Sonne zu schauen und den Wind mit der raschelnden Jacke spielen zu lassen und …
Der Schmerz breitete sich mit Macht in meiner Brust aus.
Diese frühen Morgen draußen auf dem Wasser, auf dem See eine halbe Stunde von unserem Haus entfernt, hatten immer nur uns beiden gehört. Und wir fuhren immer am Morgen nach seiner Rückkehr von einer Reise hinaus. Manchmal wusste ich noch nicht einmal, dass er wieder zu Hause war. Ich wachte dann im dunklen Zimmer auf, weil er vor meinem Bett hockte, meine Nase kitzelte und leise die Dean-Martin-Songs sang, nach denen er meinen Namen ausgesucht hatte: It’s June in January, because I’m in love … I can feel the scent of roses in the air, it’s June in January. Dann war ich sofort hellwach, und mein Herz sang vor Aufregung, weil ich wusste, was das bedeutete: ein Ausflug mit dem Boot, nur wir beide.
Jetzt fragte ich mich, ob all diese kostbaren, eiskalten Ausflüge im Grunde nur aus seinen Schuldgefühlen entstanden waren, seine Zeit waren, in der er sich nach einem Wochenende mit Dieser Frau wieder an das Leben mit seiner Familie, mit Mom, gewöhnen konnte.
Aber ich wusste, dass ich mir die Geschichten lieber für mein Manuskript aufsparen sollte. Ich schob sie beiseite, legte mir ein Kissen aufs Gesicht, und der Schlaf verschluckte mich sofort.
Als ich aus dem Schlaf hochschreckte, war es dunkel im Zimmer, und sehr laute Musik dröhnte durch die Fenster.
Ich stand auf und tapste benommen vom Gin zum Messerblock in der Küche. Ich hatte noch nie von einem Serienkiller gehört, der seine Morde damit begann, dass er sein schlafendes Opfer mit R.E.Ms »Everybody Hurts« in voller Lautstärke weckte, aber immerhin lag das absolut im Bereich des Möglichen. Aber als ich in der Küche stand, wurde die Musik leiser.
Sie kam durch die offenen Fenster. Aus dem Haus des Blödmanns von nebenan.
Ich schaute auf die sanft glimmenden Ziffern am Herd. Halb eins morgens, und mein Nachbar riss die Lautstärke bei einem Song hoch, den man oft in alten Filmen hörte, besonders in Szenen, in denen der Protagonist allein und gebeugt durch den Regen nach Hause ging.
Ich stürmte zum offenen Fenster in der Essecke und lehnte mich hinaus. Die Fenster des Blödmanns standen ebenfalls offen, und ich sah einen Haufen Leute im Licht der Küche, die Gläser und Becher und Flaschen in den Händen hielten, träge ihre Köpfe an die Schultern ihres Nachbarn gelegt und Arme umeinander geschlungen hatten, wobei sie mit Inbrunst mitsangen.
Es war eine rauschende Party. Offenbar war der Blödmann nicht zu allen Menschen so unfreundlich, nur zu mir. Ich formte die Hände zu einem Trichter und schrie durchs Fenster: »VERZEIHUNG!«
Dasselbe versuchte ich noch zweimal ohne jede Antwort, dann knallte ich das Fenster zu und ging durch den ganzen ersten Stock, um alle Fenster zu schließen. Als ich fertig war, hörte es sich immer noch so an, als spielte R.E.M. ein Konzert auf meinem Sofatisch.
Und dann, einen wunderbaren Moment lang, hörte die Musik auf, und die Geräusche der Party, das Lachen und Plaudern und das Klirren der Gläser, wurden zu einem ruhigen Hintergrundrauschen.
Und dann fing es wieder an.
Dasselbe Lied. Sogar noch lauter. Oh Gott. Ich zog mir die Jogginghosen an und überlegte, welche Vor- und Nachteile wohl ein Anruf bei der Polizei wegen Ruhestörung hätte. Einerseits könnte ich vor meinem Nachbarn immer noch überzeugend alles abstreiten. (Oh, ich habe den Wachtmeister doch keinesfalls gerufen! Ich bin doch ein junges Fräulein von neunundzwanzig Lenzen, keine schrullige alte Jungfer, die nichts mehr verabscheut als Gelächter, Spaß, Gesang und Tanz!). Auf der anderen Seite fiel es mir seit dem Tod meines Vaters immer schwerer, kleine Frechheiten zu verzeihen.
Ich warf mir mein Pizza-Sweatshirt über und marschierte zu den Stufen zur Tür meines Nachbarn. Bevor ich es mir anders überlegen konnte, streckte ich die Hand nach dem Klingelknopf aus.
Es klang wie das Schlagen einer uralten Standuhr und übertönte die Musik, aber das Singen hörte nicht auf. Ich zählte bis zehn und klingelte dann erneut. Wenn die Partygäste die Klingel gehört hatten, schienen sie beschlossen zu haben, sie nicht zu beachten.
Ich hämmerte noch ein paar Sekunden lang gegen die Tür, wandte mich dann resigniert zum Gehen. Ein Uhr, beschloss ich. Dann würde ich die Polizei rufen.
Die Musik war jetzt sogar noch lauter. In den wenigen Minuten, die die Fenster geschlossen waren, war die Temperatur ins Unerträgliche gestiegen. Weil ich nichts Besseres zu tun hatte, holte ich ein Taschenbuch aus meiner Tasche und ging auf die Terrasse, wo ich nach den Lichtschaltern neben der Schiebetür tastete.
Meine Finger fanden sie, aber nichts passierte. Die Lichter draußen waren kaputt. Also musste ich eben beim Licht meines Handys um ein Uhr morgens auf der Terrasse des Zweithauses meines Vaters lesen. Ich trat hinaus, meine Haut kribbelte in der erfrischend kühlen Brise, die vom Wasser heraufwehte.
Die Terrasse des Blödmanns war ebenfalls dunkel. Ein einziges, von dicken Motten umschwirrtes Licht brannte, weshalb ich beinahe aufschrie, als sich in den Schatten etwas bewegte.
Und mit »beinahe aufschrie« meine ich natürlich, dass ich selbstverständlich schrie, was meine Lungen hergaben.
»Herrgott noch mal!«, keuchte das schattige Dings auf und erhob sich aus dem Sessel, in dem es gesessen hatte. Und mit »schattiges Dings« meine ich natürlich einen Mann, der in der Dunkelheit gesessen hatte, bis ich ihn zu Tode erschreckte. »Was, was ist los?«, wollte er wissen, als erwartete er, dass ich ihm sagen würde, dass er voller Skorpione sei.
Wenn das so gewesen wäre, wäre es immerhin weniger peinlich gewesen.
»Nichts!«, sagte ich, immer noch ganz außer Atem von dem Schreck. »Ich habe Sie gar nicht gesehen!«
»Sie haben mich nicht gesehen?«, wiederholte er. Er lachte ungläubig und rau. »Wirklich? Sie haben mich hier gar nicht gesehen, auf meiner eigenen Terrasse?«
Tatsächlich sah ich ihn immer noch nicht. Das Licht auf seiner Terrasse war ein paar Meter von ihm entfernt und verwandelte ihn in einen hochgewachsenen, menschenförmigen Umriss mit einem Lichtschein hinter seinem dunklen, zerzausten Haar. Aber inzwischen hielt ich es sowieso für besser, ihn den ganzen Sommer nicht sehen zu müssen.
»Schreien Sie auch so, wenn Autos an Ihnen vorbeifahren oder Sie Leute durch Restaurantfenster sehen? Vielleicht sollten Sie Ihre Fenster verdunkeln, damit Sie mich nicht zufällig mit einem Messer oder einem Rasiermesser in der Hand sehen?«
Ich verschränkte wütend die Arme vor der Brust. Zumindest versuchte ich das. Der ganze Gin machte mich ein bisschen ungeschickt.
Was ich eigentlich sagen wollte – und was die alte January gesagt hätte – war: Könnten Sie vielleicht die Musik bitte etwas leiser machen? Tatsächlich hätte sich die alte January vermutlich schick angezogen, wäre in ihre Lieblingssamtschuhe geschlüpft und mit einer Flasche Champagner vor seiner Tür aufgetaucht, fest entschlossen, eine nachbarschaftliche Beziehung zu dem Blödmann aufzubauen.
Aber bis jetzt war dies der drittschlimmste Tag in meinem Leben, und jene alte January war vermutlich dort vergraben, wo man auch die alte Taylor Swift verbuddelt hatte. Also sagte ich: »Könnten Sie vielleicht Ihren Trauriger-Junge-Soundtrack ausschalten?«
Der Umriss lachte und lehnte sich gegen sein Geländer, die Bierflasche lässig in einer Hand. »Sieht es etwa so aus, als wäre ich derjenige, der die Playlist zu verantworten hätte?«
»Nein, es sieht so aus, als wären Sie derjenige, der auf seiner eigenen Party allein in der Dunkelheit sitzt«, erwiderte ich, »aber als ich eben geklingelt habe, um Ihren Jungs zu sagen, die Musik leiser zu machen, konnten sie mich bei dem ohrenbetäubenden Gejammer nicht hören, deshalb frage ich Sie.«
Er betrachtete mich in der Dunkelheit – oder zumindest nahm ich an, dass er das tat, denn keiner von uns konnte den anderen richtig erkennen.
Schließlich sagte er: »Hören Sie, niemand freut sich mehr als ich, wenn diese Nacht vorbei ist und alle aus meinem Haus verschwinden, aber es ist nun mal ein Samstagabend. Im Sommer, in einer Straße voller Ferienhäuser. Und wenn diese Siedlung nicht zufällig und ohne mein Wissen in die kleine Stadt aus Footloose transportiert worden ist, ist es absolut nicht abwegig, dass hier Musik zu hören ist, auch zu dieser Stunde. Und vielleicht – ganz vielleicht – schafft es die neue Nachbarin, die auf ihrer Terrasse stand und so laut Footjob schrie, dass die Vögel scharenweise aufflatterten, ein wenig nachsichtig zu sein, wenn eine schlechte Party länger dauert, als es ihr behagt.«
Jetzt war ich an der Reihe, den schwarzen Fleck vor mir anzustarren.
Verdammt, er hatte recht. Er war ein Blödmann, aber ich auch. Karyns und Sharyns Kifferpartys dauerten viel länger als diese hier, und zwar auch noch an Wochentagen und dann, wenn Jacques Frühdienst in der Notaufnahme hatte. Manchmal nahm ich daran sogar teil, und jetzt kam ich nicht einmal mit einem Gruppenkaraoke an einem Samstag zurecht?
Am schlimmsten war es, dass es in Blödmanns Haus plötzlich ganz still war, bevor mir eine passende Replik einfiel. Durch die erleuchteten Fenster sah ich, wie die Partygäste aufstanden, sich umarmten, verabschiedeten und sich ihre Jacken anzogen.
Ich hatte mich mit diesem Typen um nichts gestritten, und jetzt musste ich die nächsten paar Monate neben ihm wohnen. Wenn ich mal Zucker brauchte, hatte ich dann wohl Pech gehabt.
Ich wollte mich für den Trauriger-Junge-Soundtrack entschuldigen, oder zumindest für die verdammten Hosen, die ich trug. Neuerdings waren meine Reaktionen immer irgendwie unangemessen, und ich konnte ja nicht jedem Fremden, der das Pech hatte, in ihren Genuss zu kommen, die Gründe dafür erklären.
Ich stellte mir vor, wie ich sagte: Tut mir leid, ich wollte mich nicht in eine kleinliche Oma verwandeln. Es ist nur so, dass mein Dad gestorben ist und ich dann herausfinden musste, dass er eine Geliebte und ein Zweithaus hatte, und dass meine Mom davon wusste, mir davon aber nichts erzählte, und jetzt will sie immer noch nicht mit mir darüber sprechen, und dann entschied mein Freund, dass er mich nicht mehr liebte, und meine Karriere ist am Boden, und meine beste Freundin wohnt viel zu weit weg, und PS. das hier ist übrigens das bewusste Sexhaus, und früher bin ich gern auf Partys gegangen, aber seit Neuestem mag ich gar nichts mehr gern, also bitte verzeihen Sie mir mein Benehmen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend. Gute Nacht, und vielen Dank.
Stattdessen spürte ich wieder diesen schrecklichen Schmerz im Bauch. Tränen traten mir in die Augen, meine Stimme quiekte jämmerlich, und ich sagte zu niemand im Besonderen: »Ich bin so müde.«
Der Umriss erstarrte, das konnte ich trotz der Dunkelheit erkennen. Ich hatte erfahren müssen, dass das nicht unüblich war bei Leuten, die spürten, dass eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs stand. In den letzten paar Wochen unserer Beziehung wurde Jacques wie eine dieser Schlangen, die ein Erdbeben im Voraus spüren können, wurde ganz angespannt, wenn sich meine Gefühle Bahn brachen, und beschloss dann, dass wir dringend etwas aus dem Weinladen unten brauchten, um hastig die Wohnung verlassen zu können.
Mein Nachbar sagte kein Wort, ging aber auch nicht weg. Er stand nur betreten da und sah mich im Stockdunklen an. Mindestens fünf Sekunden lang standen wir so da und warteten darauf, was als Erstes passieren würde: ob ich in Tränen ausbrechen oder er davonlaufen würde.
Und dann dröhnte die Musik wieder, ein Carly Rae Jepsen-Hit, den ich unter anderen Umständen sehr mochte, und der Blödmann zuckte zusammen.
Er schaute zu den Schiebetüren und dann zu mir. Er räusperte sich. »Ich werfe sie raus«, sagte er steif, drehte sich um und ging hinein. Wie aus einem Mund schrien bei seinem Anblick alle: »EVERETT!«
Sie schienen kurz davor zu sein, ihn in einen Handstand zu hieven und mit Bier abzufüllen, aber dann rief er einem blonden Mädchen etwas zu, und einen Moment später verstummte die Musik endgültig.
Na ja. Wenn ich das nächste Mal einen guten Eindruck machen wollte, war es vielleicht besser, vorher einen Teller mit LSD-Keksen zu vertilgen.
Kapitel drei
Pete
Ich wachte von Kopfschmerzen und einer Textnachricht von Anya auf: Hey, Schnuckelchen! Wollte nur sichergehen, dass du meine E-Mail mit dem Betreff »Dein großartiger Verstand und die Sommer-Deadline, über die wir geredet haben« bekommen hast.
Dieser Punkt am Ende des Satzes dröhnte in meinem Hirn wie eine Totenglocke.
Meinen ersten richtigen Kater hatte ich mit vierundzwanzig, am Morgen, nachdem ich erfahren hatte, dass Anya mein erstes Buch Kiss Kiss Wish Wish an Sandy Lowe verkauft hatte. (Jacques hatte seinen französischen Lieblingschampagner gekauft, und wir tranken ihn bei unserem Spaziergang über die Brooklyn Bridge aus der Flasche und warteten auf den Sonnenuntergang, weil wir das für ungeheuer romantisch hielten.) Später, als ich auf dem Badezimmerfußboden lag, hatte ich mir geschworen, lieber in ein sehr scharfes Küchenmesser zu fallen, als es jemals wieder zuzulassen, dass sich mein Hirn anfühlte wie ein Ei, das auf einem Felsen in der Sonne von Cancun briet.
Und doch, da lag ich wieder, das Gesicht in ein Kissen mit Fransen gedrückt, und das Hirn brutzelte mir im Schädel. Ich rannte ins Badezimmer im Erdgeschoss. Ich musste mich nicht übergeben, aber ich hoffte, wenn ich wenigstens so tat, würde mein Körper darauf hereinfallen und das Gift aus meinen Eingeweiden herausbefördern.
Ich warf mich vor der Toilette auf die Knie, schlang die Arme um die Schüssel und hob den Blick zum gerahmten Bild, das dahinter an der Wand hing.
Dad und Diese Frau waren darauf am Strand zu sehen. Sie trugen Windjacken, er hatte den Arm um ihre Schulter gelegt, der Wind spielte mit ihrem schon leicht silbrigen blonden Haar und wehte ihm die grauen Locken flach in die Stirn. Sie lächelten.
Und dann, als wäre es ein kleiner lustiger Scherz des Universums, sah ich den Zeitungsständer neben der Toilette, in dem exakt drei Dinge lagen.
Ein zwei Jahre altes Oprah Magazine. Ein Exemplar meines dritten Buches, Nordlicht. Und dieses verdammte Die Offenbarenden – ein gebundenes Buch mit einem glänzenden Sticker darauf, auf dem »Signiert vom Autor« stand.
Ich öffnete den Mund und übergab mich herzhaft in die Schüssel. Dann stand ich auf, spülte mir den Mund aus und drehte das Bild um, sodass ich es nicht mehr sehen musste.
»Nie wieder«, sagte ich laut. Schritt eins auf dem Weg zu einem katerfreien Leben? Wahrscheinlich nicht, wenn man in ein Haus gezogen war, das einen praktisch zum Trinken zwang. Ich würde andere Methoden finden müssen, um damit zurechtzukommen. Wie vielleicht … die Natur?
Ich ging zurück ins Wohnzimmer, fischte die Zahnbürste aus meiner Tasche und putzte mir am Küchenausguss die Zähne. Der nächste wichtige Schritt auf dem Weg zurück ins Leben war eine Kaffee-Infusion.
Wenn ich das Exposé für ein Buch schrieb, lebte ich eigentlich so gut wie ausschließlich in meinen berühmten Kontrollverlust-Hosen, daher hatte ich, abgesehen von einer Kollektion schrecklicher Jogginghosen, so gut wie nichts eingepackt. Ich hatte sogar ein paar Lifestyle-Blogger-Videos über »Capsule-Garderoben« geschaut, um die Anzahl der »Looks« zu steigern, die ich aus den Hotpants, die ich meistens trug, wenn ich zum Stressabbau putzte, und ein paar schäbigen T-Shirts mit berühmten Gesichtern darauf »kombinieren« konnte – Überbleibsel aus einer Phase, die ich in meinen frühen Zwanzigern durchmachte.
Ich zog ein düsteres, schwarz-weißes Joni-Mitchell-Shirt an, zwängte meinen vom Gin aufgeschwemmten Körper in die Denim-Hotpants und zog dazu meine mit Blümchen bestickten Ankle-Boots mit Absatz an.
Ich hatte es mit Schuhen, egal ob sehr billig und kitschig oder sehr teuer und protzig, und wie es sich herausstellte, vertrug sich diese Neigung ziemlich schlecht mit der Capsule-Garderoben-Idee. Ich hatte nur vier Paare eingepackt, und ich bezweifelte, dass irgendwer meine glitzernden Tennisschuhe aus dem Supermarkt oder die Overknee-Stiefel von Stuart Weitzman, für die ich ein Heidengeld ausgegeben hatte, für »klassisch« halten würde.
Ich nahm meine Autoschlüssel und ging zur Haustür. Ich war schon halb draußen im blendenden Licht des Sommermorgens, als ich zwischen den Sofakissen mein Handy brummen hörte. Eine Nachricht von Shadi: Habe mit Geisterhut rumgemacht, gefolgt von einer Reihe Totenschädel-Emojis.
Ich stolperte auf die Veranda hinaus und tippte: WENDE DICH SOFORT AN EINEN GEISTLICHEN.
Ich versuchte, nicht an den peinlichen Showdown mit dem Nachbarn zu denken, als ich die ausgetretenen Stufen hinunter zu meinem Kia trabte. Leider fiel mir stattdessen mein absolutes Hassthema ein.
Dad. Als wir das letzte Mal zusammen mit dem Boot hinausfuhren, ging es im Kia zum See, und er sagte mir auf der Fahrt, er wolle mir das Auto schenken. Es war auch Dad, der mir damals sagte, ich solle es einfach wagen: nach New York zu ziehen. Jacques war schon dort, um Medizin zu studieren, und wir führten eine Fernbeziehung, damit ich bei Mom sein konnte. Dad war viel auf »Dienstreise«, und selbst, wenn ich meinen eigenen Worte glaubte – dass in unserem Leben irgendwann alles gut werden würde –, hatte ein großer Teil von mir immer noch Angst davor, Mom allein zu lassen. Als würde ihr Krebs zurückkommen, sobald ich nicht mehr da war.
»Deine Mom kommt schon damit zurecht«, hatte Dad versprochen, als wir in der kalten Dunkelheit des Parkplatzes saßen.
»Der Krebs könnte zurückkommen«, wandte ich ein.
»Alles kann passieren, January.« Das sagte er damals. »Mom kann etwas passieren, oder mir oder sogar dir, jederzeit. Aber im Augenblick geht es uns gut. Du hast genug für uns getan, Kind. Jetzt tu du mal etwas für dich selbst.«
Vielleicht dachte er, dass mein Umzug nach New York, um mit meinem Freund zusammenzuziehen, im Grunde dasselbe war, wie wenn er in seinem Zweithaus zusammen mit seiner Zweitfrau wohnte. Ich hatte die Uni aufgegeben, um mich während der zweiten Runde Chemotherapie um Mom zu kümmern. Jeden Cent hatte ich ihr gegeben, damit sie die Arztrechnungen bezahlen konnte, und wo war er da gewesen? Am Strand mit Dieser Frau, in einer Windjacke und mit einem Glas Pinot Noir in der Hand.
Ich verdrängte den Gedanken und stieg ins Auto. Das Leder der Sitze war heiß, und ich ließ sofort das Fenster herunter.
Am Ende der Straße bog ich nach links ab, weg vom Wasser, und in die Stadt. Der Meeresarm, der wie ein Finger an der rechten Seite der Straße entlangfloss, glitzerte, und der heiße Wind rauschte in meinen Ohren. Ich schwebte an Horden spärlich gekleideter Teenager vorbei, die sich am Hotdog-Stand links von mir versammelt hatten. Eltern mit ihren Kindern bildeten eine Schlange vor dem Eisladen rechts, und Fahrradfahrer fuhren in Grüppchen zurück zum Strand.
Ich fuhr weiter die Straße entlang, und jetzt rückten die Häuschen näher zusammen, bis sie Schulter an Schulter standen: ein winziges italienisches Restaurant mit einer weinberankten Terrasse direkt neben einem Skate-Shop, der wiederum an einen Irish Pub nebenan anschloss, gefolgt von einem altmodischen Süßwarenladen, und schließlich kam ein Café namens Pete’s Coffee – nicht zu verwechseln mit Peet’s, dem Kaffeeröster aus San Francisco, obwohl das Schild so aussah, als wollte es unbedingt mit der oben erwähnten Kette verwechselt werden.
Ich fuhr in eine Parklücke davor und tauchte in die angenehme Kühle von Pete’s, nicht Peet’s, Klimaanlage. Die Dielen waren weiß gestrichen, die Wände tiefblau und übersät mit Silbersternchen, die zwischen aufgemalten Tischen herumwirbelten, hin und wieder unterbrochen von gerahmten Plattitüden, die jeweils einem »Anonymus« zugeschrieben waren. Der Raum ging in einen gut ausgeleuchteten Buchladen über. Die Worte »PETE’S BOOKS« waren in derselben vielversprechenden Silberfarbe darübergemalt. Ein älteres Ehepaar im Partnerlook saß mit übereinandergeschlagenen Beinen in dem durchgesessenen Arrangement von Sesseln in der hintersten Ecke des Coffeeshops. Abgesehen von der Frau an der Kasse und mir, waren sie die einzigen Leute hier.
»Viel zu schön draußen, um drinnen zu sein, was?«, sagte die Barista, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Sie hatte eine raue Raucherstimme, die zu ihrem blonden Kurzhaarschnitt passte. Ihre winzigen goldenen Ohrringe blinkten im weichen Licht.
Sie winkte mich zu sich, und ich sah, dass sie ihre Fingernägel rosa lackiert hatte. »Komm doch rein. Nicht so schüchtern. Wir sind alle eine Familie hier bei Pete’s.«
Ich lächelte. »Oh Gott, hoffentlich nicht.«
Sie schlug mit der flachen Hand auf den Verkaufstresen, warf den Kopf zurück und lachte, bis sie einen Hustenanfall bekam. »Oh, Familie ist wirklich schwierig«, stimmte sie mir zu. »Und was kann ich für dich tun, Schätzchen?«
»Ich brauche Düsenkraftstoff.«
Sie nickte weise. »Oh, du bist eine von denen. Wo kommst du her, Schätzchen?«
»Gerade aus New York. Eigentlich aus Ohio.«
»Oh, ich habe Verwandte in New York. Im Staat New York, nicht in New York City. Aber du meinst die Stadt, oder?«
»Queens«, nickte ich.
»War ich noch nie«, sagte sie. »Willst du Milch? Sirup?«
»Ein bisschen Milch«, antwortete ich.
»Vollmilch? Halbfett? Magermilch 0,5 Prozent?«
»Überrasch mich einfach. Ich bin nicht so wählerisch, wenn es um Bruchzahlen geht.«
Sie warf erneut den Kopf zurück, lachte und ging ein wenig affektiert zwischen ihren Maschinen herum. »Wer hat dafür auch Zeit? Ich schwöre, selbst in North Bear Shores geht mir alles inzwischen zu schnell. Vielleicht wäre es etwas anderes, wenn ich diesen Düsenkraftstoff trinken würde, von dem du sprichst.«
Eine Barista, die keinen Espresso trank, war jetzt nicht gerade ideal, aber ich mochte die Frau mit den winzigen goldenen Ohrringen. Um ehrlich zu sein, mochte ich sie so sehr, dass ich plötzlich eine gewisse Sehnsucht spürte.
Eine Sehnsucht nach der alten January. Die, die Motto- und Kostümpartys mochte, die es nicht zur Tankstelle oder zum Postschalter schaffte, ohne sich mit jemandem auf einen Kaffee zu verabreden oder auf die Vernissage eines neuen Bekannten eingeladen zu werden. In meinem Handy gab es zahllose Nummern, die zu Sarah aus der Ankerbar, süßer Hund oder Mike, führt diesen neuen Antikladen gehörten. Shadi hatte ich auf der Toilette einer Pizzeria kennengelernt, weil sie in den tollsten Frye-Stiefeln aus der Kabine getreten war, die ich je gesehen hatte. Ich vermisste diese ehrliche Neugier auf Menschen, diesen Funken der Begeisterung, wenn man entdeckte, dass man etwas gemeinsam hatte, oder die Bewunderung, wenn man bei einem anderen ein Talent oder einen schönen Charakterzug entdeckte.
Manchmal vermisste ich es einfach, Menschen zu mögen.
Aber diese Barista war einfach nett. Selbst wenn der Kaffee furchtbar war, würde ich wiederkommen, das wusste ich.
Sie drückte den Plastikdeckel auf den Becher und stellte ihn vor mich hin. »Der erste ist umsonst«, sagte sie. »Ich möchte nur, dass du wiederkommst.«
Ich lächelte, versprach es und steckte meinen letzten Dollar in das Trinkgeldglas. Sie wischte den Verkaufstresen ab. Ich wandte mich schon zum Gehen, als ich plötzlich erstarrte, weil ich Anyas Stimme in meinem Kopf hörte: Heeeey, Süße! Will AUF GAR KEINEN FALL übertreiben, aber du weißt schon, dass Buchclubs und Lesezirkel dein BESTER Markt sind. Wenn du zufällig in einem unabhängigen Buchladen bist, solltest du dich vorstellen und Hallo sagen!
Ich wusste, dass die Anya in meinem Kopf recht hatte. Gerade jetzt konnte ich den Erlös aus jedem einzelnen verkauften Buch gut gebrauchen. Ich setzte also ein Lächeln auf und ging hinüber in den Buchladen, wobei ich mir wünschte, ich könnte die Zeit um eine Stunde zurückdrehen und irgendetwas anderes anziehen, egal was, und müsste mich nicht in diesem Jessica-Simpson-Musikvideo-Outfit von zirka 2002 zeigen.
Der Laden war klein. Die Wände waren mit deckenhohen Eichenregalen bedeckt, und etwas niedrigere Regale bildeten ein Labyrinth im Raum. An der Kasse war niemand, und während ich wartete, warf ich einen Blick hinüber zu den drei Mädchen mit Zahnspangen, die in der Liebesroman-Abteilung standen und kicherten. Ich sah genauer hin, um sicherzugehen, dass sie nicht gerade über eins meiner Bücher lachten. Wir alle vier wären für immer traumatisiert, wenn der Buchhändler mich dorthin zum Signieren führen würde, nur um ein Exemplar von Southern Comfort in den Händen der Rothaarigen mit den Zöpfen zu entdecken. Die Mädchen rangen nach Luft und gackerten, weil die Rothaarige das Cover vor ihre Brust hielt. Es zeigte einen Mann mit nacktem Oberkörper, der eine zurückgebeugte Frau im Arm hielt, während Flammen um sie herum loderten. Eindeutig keins von meinen.
Ich nahm einen Schluck von meinem Latte und spuckte ihn sofort wieder zurück in den Becher. Er schmeckte wie Schlamm.
»Tut mir leid, dass du warten musstest, Schätzchen«, ertönte eine kratzige Stimme hinter mir, und ich drehte mich um und sah, dass sich die Frau durch die schiefen Regalgänge schlängelte. »Diese Knie machen auch nicht mehr so mit wie früher.«
Erst dachte ich, sie wäre die eineiige Schwester der Barista, vielleicht hatten sie gemeinsam das Café mit dem Buchladen darin eröffnet, aber dann sah ich, dass die Frau gerade ihre graue PETE’S-Schürze abnahm, als sie auf die Kasse zusteuerte.
»Kannst du dir vorstellen, dass ich früher mal ein Rollschuh-Derby-Champion gewesen bin?«, sagte sie und ließ die zusammengeknüllte Schürze auf den Verkaufstresen fallen, um sich dann dahinterzustellen. »Tja, ob du’s glaubst oder nicht, das war ich.«
»Im Moment wäre ich kaum überrascht, wenn sich herausstellte, dass du die Bürgermeisterin von North Bear Shores bist.«
Sie lachte rasselnd. »Oh nein, das bin ich leider nicht! Wobei ich sicher ein paar Dinge erledigt kriegen würde, wenn sie mich nähmen! Dieses Städtchen ist ein nettes kleines fortschrittliches Nest hier in Michigan, aber die Leute mit dem Kleingeld sind immer noch Golfsäcke mit Perlenketten.«
Ich unterdrückte ein Lächeln. Das klang so sehr wie etwas, das Dad gesagt hätte. Wieder durchfuhr mich der Schmerz wie ein Pflaster, das ruckartig abgezogen wurde.
»Na, achte gar nicht auf mich und meine Mei-nun-gähn«, sagte sie und zog die dichten aschblonden Brauen hoch. »Ich bin ja nur eine kleine Unternehmerin. Was kann ich denn für dich tun, Süße?«
»Ich wollte mich eigentlich nur vorstellen«, gab ich zu. »Ich bin nämlich Autorin bei Sandy Lowe Books und verbringe hier den Sommer, daher dachte ich, ich sage mal Hallo und signiere Bücher, wenn ihr welche vorrätig habt.«
»Ohhh, noch eine Autorin hier in der Stadt!«, rief sie aus. »Wie aufregend. Weißt du, North Bear zieht viele Künstler an! Wahrscheinlich liegt es an unserer Lebensart. Und am College. Alle möglichen Freigeister sind hier. Einfach eine wunderhübsche kleine Gemeinde. Du wirst es hier lieben …« So, wie sie den Satz in der Luft hängen ließ, nahm ich an, dass sie darauf wartete, dass ich meinen eigenen Namen einfügte.
»January«, sagte ich daher. »Andrews.«
»Pete«, entgegnete sie und schüttelte mir die Hand mit der Heftigkeit eines Soldaten einer Spezialeinheit.
»Pete?«, fragte ich. »So wie im berühmten Pete’s Coffee?«
»Ganz genau die. Mein richtiger Name ist Posy. Blümchen. Aber was soll das bitte für ein Name sein?« Sie machte eine Würgegrimasse. »Mal im Ernst, sehe ich aus wie eine Posy? Sieht überhaupt jemand aus wie eine Posy?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich meine, vielleicht ein kleines Baby, das ein Blumenkostüm aus Polyester trägt?«
»Kaum dass ich sprechen konnte, habe ich das übrigens geändert. Aber egal, January Andrews.« Pete trat an den Computer und tippte meinen Namen ein. »Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir dein Buch haben.«
Ich verbesserte die Leute nie, wenn sie »Buch« statt »Bücher« sagten, aber es ärgerte mich. Ich versuchte, es nicht persönlich zu nehmen – ich mochte Pete wirklich –, aber es traf mich doch. Es gab mir das Gefühl, meine Karriere wäre irgendwie reines Glück. Als müsste ich nur niesen, und schon wäre ein neuer Liebesroman da.
Und dann waren da die Leute, die so taten, als teilten wir einen geheimen Witz miteinander. Wenn sie nach einer Unterhaltung über Kunst oder Politik herausfanden, dass ich heitere Frauenliteratur schrieb, sagten sie gern: Na ja, Hauptsache, es bringt Geld, oder?, und flehten mich praktisch an zu bestätigen, dass ich auf keinen Fall freiwillig Bücher über Frauen oder Liebe schrieb.
»Wir scheinen keine auf Lager zu haben«, sagte Pete schließlich und schaute vom Bildschirm auf. »Aber ich sag dir was, die bestell ich sofort, aber so was von.«
»Das wäre ja toll!«, sagte ich. »Vielleicht könnten wir später im Sommer einen Workshop veranstalten.«
Pete keuchte auf und packte mich am Arm. »Prima Idee, January Andrews! Du solltest zu unserem Buchclub kommen. Wir würden uns so freuen. Außerdem eine super Gelegenheit, die Gemeinde besser kennenzulernen. Der Buchclub ist immer montags. Kannst du Montag einrichten? Morgen?«
Anya in meinem Kopf sagte: Du weißt schon, was Girl on the Train groß gemacht hat, oder? Buchclubs.
Das war vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber ich mochte Pete. »Montags passt mir gut.«
»Fantastisch. Hast du eine E-Mail-Adresse? Dann schicke ich dir meine. Sieben Uhr abends, viel Wein, immer ein irrer Spaß.« Sie holte eine Visitenkarte aus der Schublade und markierte ihre E-Mail-Adresse mit einem violetten Kugelschreiber aus dem Charlie-Brown-Becher auf dem Verkaufstresen. »Du antwortest doch auf E-Mails, oder?«
»Beinahe ständig.«