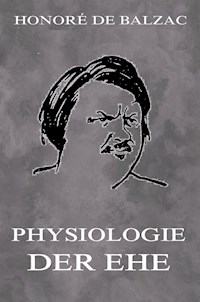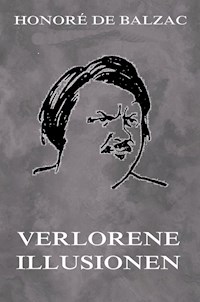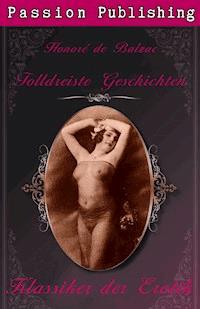1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Honoré de Balzacs Werk 'Verlorene Illusionen' ist eine epische Erzählung über den literarischen Aufstieg und Niedergang des jungen Schriftstellers Lucien de Rubempré im Paris des 19. Jahrhunderts. Mit seinem realistischen Schreibstil und seiner detaillierten Charakterzeichnung zeigt Balzac die verschiedenen Facetten der Pariser Gesellschaft und deckt dabei die Korruption und Intrigen, die hinter den Kulissen des literarischen Betriebs herrschen, schonungslos auf. 'Verlorene Illusionen' ist eine fesselnde Darstellung von Ehrgeiz, Verrat und den hohen Preisen, die für den Erfolg in der Welt der Künste bezahlt werden müssen. Balzacs Werk wird oft als Höhepunkt des literarischen Realismus angesehen und hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Romans als literarische Form gehabt. Honoré de Balzac war ein französischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, der für seine umfangreiche Romanserie 'Die menschliche Komödie' bekannt ist. Als literarischer Gigant seiner Zeit war Balzac berühmt für seine detaillierten Beschreibungen der französischen Gesellschaft und seine genaue Charakterzeichnung. Durch seine eigenen Erfahrungen im literarischen Betrieb konnte er in 'Verlorene Illusionen' ein realistisches und eindringliches Bild davon zeichnen, wie Kunst mit Kommerz und Macht verflochten ist. Mit seinem tiefen Verständnis menschlicher Motivation und seiner kunstvollen Erzählweise bleibt Balzac einer der einflussreichsten Autoren der Weltliteratur. 'Verlorene Illusionen' ist ein unverzichtbarer literarischer Schatz für alle, die sich für die Abgründe der menschlichen Natur und die Welt der Künste interessieren. Balzacs meisterhafte Erzählung bietet nicht nur einen Blick hinter die Kulissen des literarischen Betriebs, sondern auch eine fesselnde Reise in die Tiefen von Ehrgeiz, Betrug und Selbstsucht. Dieses Buch ist ein kraftvolles Zeugnis für die zeitlose Relevanz von Balzacs Werk und wird Leserinnen und Leser aller Generationen gleichermaßen faszinieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Verlorene Illusionen
Books
Inhaltsverzeichnis
Die beiden Dichter
In der Zeit, in der diese Geschichte spielt, waren die Stanhopepresse und die Walzen zur Verteilung der Druckerschwärze in den kleinen Provinzdruckereien noch nicht zur Anwendung gelangt. Trotz der Spezialität, die Angoulême zum Pariser Druckereigewerbe in Beziehungen bringt, bediente man sich dort immer noch der Holzpressen. Die rückständige Druckerei verwendete dort noch die Lederbälle, die mit der Druckerschwärze bestrichen waren und mit denen einer der Drucker leicht über die Lettern fuhr. Die bewegliche Platte, auf der die Form mit den Lettern sich befindet, worauf der Papierbogen gelegt wird, war noch aus Stein und rechtfertigte somit ihre Bezeichnung. Die gefräßigen mechanischen Pressen haben heutzutage diesen Apparat, dem wir trotz seiner Unvollkommenheiten die schönen Bücher der Elzevier, Plantin, Alde und Didot verdanken, so sehr in Vergessenheit gebracht, daß es angezeigt ist, die alten Werkzeuge, für die Jérôme Nicolas Séchard eine abergläubische Zuneigung hegte, zu erwähnen, denn sie spielen ihre Rolle in dieser wichtigen kleinen Erzählung.
Dieser Séchard war ein früherer Drucker, den die mit dem Satz beschäftigten Handwerker in ihrem Jargon einen ›Bären‹ nannten. Das Hin und Her der Bewegung, wie die Drucker vom Farbenbehälter zur Presse und von der Presse zum Farbenbehälter gehen, hat einige Ähnlichkeit mit dem Auf und Ab eines Bären im Zwinger, und so ist offenbar der Spitzname entstanden. Zur Vergeltung gaben die Bären den Setzern den Beinamen ›Affen‹ infolge der fortgesetzten kleinen Bewegungen, die diese Herren machen, um die Lettern den hundertzweiundfünfzig kleinen Fächern, in denen sie enthalten sind, zu entnehmen. In dem unheilvollen Jahr 1793 war Séchard ungefähr fünfzig Jahre alt und verheiratet. Sein Alter und seine Verheiratung befreiten ihn von dem großen Truppenaufgebot, das fast alle Handwerker in die Armeen schleppte. Der alte Drucker blieb allein in der Druckerei zurück, deren Besitzer – alias ›Pinsel‹ – soeben gestorben war und eine kinderlose Witwe zurückgelassen hatte. Das Geschäft schien dem Untergang geweiht: der allein zurückgebliebene Bär war nicht imstande, sich in einen Affen zu verwandeln; denn als Drucker konnte er weder lesen noch schreiben. Ohne sich über seine Unfähigkeit Kopfschmerzen zu machen, versorgte ein Volksvertreter, der es eilig hatte, die schönen Dekrete des Konvents zu verbreiten, den Drucker mit dem Patent eines Buchdruckermeisters und versah seine Druckerei mit Aufträgen. Nachdem der Bürger Séchard dieses gefährliche Patent erhalten hatte, entschädigte er die Witwe seines Meisters, indem er ihr die Ersparnisse seiner Frau brachte, mit denen er das Material der Druckerei zur Hälfte des Wertes bezahlte. Aber das genügte nicht. Die Dekrete der Republik mußten unverzüglich gedruckt werden. In dieser schwierigen Lage hatte Jérôme Nicolas Séchard das Glück, einen Edelmann aus Marseille zu treffen, der nicht auswandern wollte, um seiner Ländereien nicht verlustig zu gehen, und nicht gesehen werden wollte, um seinen Kopf zu behalten, und der nur durch irgendwelche Arbeit Brot finden konnte. Der Graf von Maucombe zog also das schlichte Wams eines Provinzfaktors an; er setzte, las und korrigierte selbst die Dekrete, die den Bürgern, die Adlige bei sich verbargen, die Todesstrafe androhten; der Bär, der jetzt ein Pinsel geworden war, zog sie ab und ließ sie anschlagen; und alle beide blieben heil und gesund dabei. Als im Jahre 1795 der Sturmwind des Schreckens vorübergezogen war, war Nicolas Séchard genötigt, ein anderes Faktotum zu suchen, das zugleich Setzer, Korrektor und Faktor sein konnte. Ein Abbé, der später unter der Restauration Bischof wurde und der damals zu den Eidverweigerern gehörte, trat an die Stelle des Grafen von Maucombe und blieb bis zu dem Tag, wo der erste Konsul die katholische Religion wiederherstellte. Der Graf und der Bischof trafen sich später auf ein und derselben Bank der Pairskammer. Jérôme Nicolas Séchard konnte zwar im Jahre1802 ebensowenig lesen und schreiben wie 1793, aber er hatte genügend auf die hohe Kante gelegt, um sich einen Faktor leisten zu können. Aus dem Gesellen, der sich früher so wenig um die Zukunft gekümmert hatte, war ein Meister geworden, vor dem seine Affen und Bären gewaltigen Respekt hatten. Der Geiz beginnt, wo die Armut aufhört. An dem Tag, wo der Drucker die Möglichkeit vor sich sah, ein vermögender Mann zu werden, ließ das Interesse in ihm einen Verstand erwachsen, der freilich materiell, aber voller Gier, Argwohn und Schärfe war. Seine Praktik kümmerte sich nicht das mindeste um die Theorie. Er hatte gelernt, mit einem hingeworfenen Blick den Preis einer Seite und eines Bogens, je nach der Schriftgattung, abzuschätzen. Er bewies seinen unerfahrenen Kunden, daß es teurer sei, die großen Lettern zu handhaben als die kleinen; wenn es sich um kleine handelte, sagte er, es sei schwieriger, mit ihnen umzugehen. Da die Setzerei der Teil seines Berufs war, von dem er nichts verstand, hatte er eine solche Angst, sich zu irren, daß er nur solche Geschäfte machte wie der Löwe in der Fabel. Wenn seine Setzer gegen Stundenlohn arbeiteten, ließ er niemals ein Auge von ihnen. Wenn er irgendwo einen Fabrikanten in Schwierigkeiten wußte, kaufte er seine Papiere zu niedrigem Preis und stapelte sie auf. Zu der Zeit war er schon Besitzer des Hauses geworden, in dem sich die Druckerei seit unvordenklichen Zeiten befand. Er hatte alles mögliche Glück; er wurde Witwer und hatte nur einen Sohn, er tat ihn in das Lyzeum der Stadt, weniger um ihm einen guten Unterricht zuteil werden zu lassen, als um sich einen Nachfolger heranzuziehen; er behandelte ihn streng, um die Dauer seiner väterlichen Gewalt zu verlängern, und in den Ferien ließ er ihn am Setzkasten arbeiten, wobei er ihm sagte, er solle lernen, sein Brot zu verdienen, um eines Tages seinen armen Vater entschädigen zu können, der sich aufopfere, um ihm eine gute Erziehung zu geben. Als der Abbé ihn verließ, erwählte Séchard aus der Zahl seiner vier Setzer den zum Faktor, von dem ihm der künftige Bischof gesagt hatte, er sei in gleicher Weise rechtlich wie klug. Auf solche Weise war er imstande, den Augenblick zu erreichen, wo sein Sohn die Anstalt übernehmen konnte, die sich alsdann unter jungen und geschickten Händen vergrößern sollte. David Séchard machte auf dem Lyzeum von Angoulême die vorzüglichsten Fortschritte. Obgleich unser Bär, der es auch ohne Kenntnisse und Unterricht zu etwas gebracht halte, die Wissenschaft gründlich verachtete, schickte Vater Séchard seinen Sohn nach Paris, damit er dort die Buchdruckerkunst in ihrer höchsten Ausbildung kennen lernte; aber er empfahl ihm dringend, er solle an einem Orte, den er das Paradies der Handwerker nannte, ein ordentliches Sümmchen zurücklegen, wobei er hinzufügte, er dürfe keinesfalls auf die Börse seines Vaters rechnen, und in diesem Aufenthalt in der Stadt der Weisheit ein zweifelloses Mittel sehen, seine Ziele zu erreichen. David verband in Paris die Erlernung seines Handwerks mit der Vollendung seiner Studien. Der Faktor der Firma Didot bildete sich zu einem Gelehrten aus. Gegen Ende 1819 verließ David Séchard Paris, ohne daß der Aufenthalt dort seinen Vater, der ihn zurückrief, um ihn an die Spitze des Geschäfts zu stellen, einen roten Heller gekostet hätte. Die Druckerei von Nicolas Séchard war zu der Zeit im Besitz des einzigen amtlichen Blattes des Bezirks, hatte die Aufträge der Präfektur und der bischöflichen Kanzlei, und das waren drei Kunden, die einem rührigen jungen Menschen zu einem großen Vermögen verhelfen mußten. Damals kauften die Brüder Cointet, ihres Zeichens Papierfabrikanten, gerade das zweite Druckerpatent der Stadt Angoulême, das der alte Séchard bisher unter dem Schutze der kriegerischen Zeitläufte, die während des Kaiserreichs jeden Aufschwung der Industrie erschwerten, nicht hatte aufkommen lassen; darum hatte er es auch nicht an sich gebracht, und sein Geiz war ein Grund für den Untergang der alten Druckerei. Als der alte Séchard diese Nachricht erhielt, überlegte er sich vergnügt, den Kampf zwischen seiner Druckerei und den Cointet werde nun sein Sohn durchfechten müssen und nicht er.
»Ich wäre in dem Streit unterlegen,« sagte er sich; »aber ein junger Mann, der bei Didot ausgebildet ist, wird damit fertig werden.«
Der Siebzigjährige sehnte den Augenblick herbei, wo er die Last der Geschäfte los wäre. Er wußte zwar wenig von der hohen Kunst der Typographie, aber dafür stand er im Rufe, in einer andern sehr stark zu sein, die die Berufsgenossen recht hübsch die Saufographie genannt haben, in einer Kunst also, die der göttliche Verfasser des Pantagruel sehr geschätzt hat, deren Pflege aber dank der Verfolgungen der sogenannten Temperenzgesellschaften von Tag zu Tag mehr zurückgeht. Jérôme Nicolas Séchard, getreu dem Schicksal, das sein Name, der Trockene, ihm bestimmt hatte, war mit einem unauslöschlichen Durst begnadet. Seine Frau hatte seine Leidenschaft für den Saft der Traube, die übrigens den Bären so natürlich ist, daß Chateaubriand sie bei den richtigen Bären Amerikas beobachtet hat, lange Zeit hindurch in den gehörigen Schranken gehalten; aber die Philosophen haben die Bemerkung gemacht, daß die Gewohnheiten der Jugend im Greisenalter mit großer Stärke wiederkehren. Séchard war eine Bestätigung für dieses psychische Gesetz: je älter er wurde, um so mehr liebte er das Trinken. Seine Leidenschaft hinterließ auf seinem Bärengesicht Spuren, die es höchst originell machten: seine Nase hatte den Umfang und die Form eines großen A von riesigen Dimensionen, seine beiden mit unzähligen Aderchen durchzogenen Backen sahen aus wie manche Weinblätter, die voller violetter, purpurner und oft buntgesprenkelter kleiner Buckel sitzen; man konnte an eine ungeheure Trüffel denken, die mit herbstlichem Weinlaub umrankt war. Unter zwei mächtigen Brauen, die wie zwei schneebedeckte Büsche aussahen, hatten seine beiden grauen Augen, in denen die Schlauheit einer Habgier funkelte, die alles, selbst die Vaterliebe in ihm ertötet hatte, ihren Glanz noch in der Trunkenheit bewahrt. Sein kahler Schädel, der noch von grauen, lockigen Haaren umrahmt war, erinnerte an die Franziskanermönche aus den Erzählungen Lafontaines. Er war untersetzt und beleibt, wie es bei diesen alten Lampen, die mehr Öl als Docht verbrauchen, oft der Fall ist; denn die Ausschweifungen in irgendeiner Sache treiben den Körper in die Richtung, die ihm gemäß ist. Die Trunksucht macht ebenso wie das Studieren den Dicken noch dicker und den Magern magerer. Jérôme Nicolas Séchard trug seit dreißig Jahren den bekannten Dreispitz, der sich noch heutzutage in den Städten mancher Provinzen auf dem Kopf des städtischen Tambourmajors findet. Seine Weste und seine Hose waren aus grünlichem Tuch, überdies trug er einen alten braunen Überzieher, buntgewebte baumwollene Strümpfe und Schuhe mit silbernen Schnallen. Diese Tracht, in der der Handwerksmann noch im reichgewordenen Bürger zu erkennen war, entsprach seinen Lastern und Gewohnheiten so gut, war so sehr der Ausdruck seines Lebens, daß es schien, als ob dieser Wackere völlig angekleidet erzeugt worden wäre; man hatte ihn sich ebensowenig ohne seine Kleidungsstücke vorstellen können, wie eine Zwiebel ohne die Häute. Wenn der alte Drucker nicht schon längst wegen seiner blinden Habgier bekannt gewesen wäre, hätte die Art, wie er sein Geschäft übergab, genügt, ihn zu kennzeichnen. Trotz der Kenntnisse, die sein Sohn von der hohen Schule des Didot mitbringen mußte, nahm er sich vor, das gute Geschäft mit ihm zu machen, das er schon lange hin und her überlegt hatte. Freilich, wenn der Vater ein gutes Geschäft machte, war es unausbleiblich, daß der Sohn ein schlechtes machte. Aber für den Wackern gab es in Geschäften nicht Sohn und nicht Vater. Hatte er zuerst in David sein einziges Kind gesehen, so erblickte er später in ihm nur noch den gegebenen Käufer, dessen Interessen seinen entgegengesetzt sein mußten: er wollte teuer verkaufen, David mußte billig kaufen; sein Sohn war also ein Feind geworden, den es zu besiegen galt. Diese Umwandlung des zärtlichen Gefühls in persönliches Interesse, die bei wohlerzogenen Leuten gewöhnlich langsam, versteckt und heuchlerisch vor sich geht, war bei dem Alten schnell und unverhohlen, und der Bär zeigte, um wieviel stärker die schlaue Saufographie war als die kunstgerechte Typographie. Als sein Sohn anlangte, benahm sich der Ehrenmann ihm gegenüber mit der geschäftlichen Zärtlichkeit, die die Gewandten für ihre Opfer haben: er ging mit ihm um wie ein Liebhaber mit seiner Geliebten; er gab ihm den Arm, er sagte ihm, wo er die Füße hinsetzen mußte, um sich nicht mit Schmutz zu bespritzen, er hatte ihm sein Bett wärmen, Feuer anmachen und ein gutes Abendbrot richten lassen. Nachdem er am andern Tag versucht hatte, seinen Sohn während eines üppigen Mahles betrunken zu machen, sagte Jérôme Nicolas Séchard, der stark bezecht war, zu ihm: »Nun zum Geschäft!« Und das war so kurios zwischen zwei Rülpsgeräuschen eingeschoben, daß David ihn bat, das Geschäft bis morgen zu lassen. Der alte Bär verstand es aber zu gut, aus seiner Betrunkenheit Vorteil zu ziehen, als daß er eine so lange vorbereitete Schlacht aufgegeben hätte. »Außerdem«, sagte er, »habe er fünfzig Jahre lang seine Kugel getragen, jetzt wollte er sie keine Stunde länger schleppen. Von morgen an sollte sein Sohn der Pinsel sein.«
Hier ist es vielleicht am Platze, ein Wort über die Druckerei zu sagen. Sie war an der Stelle gelegen, wo die Rue de Beaulieu auf die Place du Mûrier mündet, und befand sich in diesem Hause seit dem Ende der Regierung Ludwigs XIV. Ebenfalls seit langer Zeit waren die Räume im Innern für die Ausübung dieses Handwerks eingerichtet. Das Erdgeschoß war ein sehr großer Raum, der von der Straße her durch einen alten Fensterverschlag und von einem innern Hof durch ein großes vergittertes Fenster erleuchtet war. Man konnte außerdem durch einen Gang in das Kontor des Meisters gelangen. Aber in der Provinz sind die Vorgänge bei der Buchdruckerei immer ein Gegenstand so lebhafter Neugier, daß die Kunden lieber durch eine Glastür eintraten, die an der Vorderseite von der Straße her zugänglich war, obgleich man dabei einige Stufen hinuntergehen mußte, da sich der Fußboden der Werkstatt unter dem Straßenniveau befand. Die erstaunten Neugierigen achteten niemals auf die Unbequemlichkeiten des Zugangs durch die Engpässe dieser Werkstatt. Wenn sie die gebauschten Papierbogen betrachteten, die an Seilen von der Decke herunterhingen, dann drängten sie sich an den reihenweise aufgestellten Setzkästen entlang, oder sie ließen sich von den Eisenstangen, die die Pressen festhielten, die Frisur in Unordnung bringen. Wenn sie den flinken Bewegungen eines Setzers folgten, der seine Lettern aus den hundertzweiundfünfzig kleinen Fächern seines Setzkastens zusammensuchte, sein Manuskript las, seine Zeile in seinem Winkelhaken noch einmal überlas, während er den Durchschuß einfügte, dann gerieten sie in ein Ries aufgeweichten, feuchten, mit Steinen beschwerten Papieres, oder sie blieben mit dem Rock an der Kante einer Bank hängen; alles zum großen Vergnügen der Affen und der Bären. Niemals war jemand ohne Zwischenfall bis zu den beiden großen Käfigen gelangt, die am Ende dieser Höhle lagen und zwei elende, auf den Hof hinaus gelegene Erker bildeten; dort thronten auf der einen Seite der Faktor, auf der andern der Meister. Im Hof waren die Mauern sehr hübsch mit Weinspalieren geziert, die in Anbetracht des Rufs, in dem der Meister stand, eine anmutende Lokalfarbe gaben. Hinten, an die Grenzmauer angebaut, erhob sich ein verfallener Schuppen, wo das Papier befeuchtet und zurechtgeschnitten wurde. Dort befand sich der Ausguß, auf dem vor und nach dem Druck die Formen abgewaschen wurden; es ergoß sich von da ein Gemisch von der Druckerschwärze und den Abwässern der Haushaltung, das ein solches Aussehen hatte, daß die Bauern, die an den Markttagen in die Stadt kamen, glaubten, der Teufel habe sich in dem Hause gewaschen. An diesen Schuppen stieß auf der einen Seite die Küche, auf der andern ein Holzhaufen. Der erste Stock dieses Hauses, über dem nur noch zwei Mansarden waren, enthielt drei Zimmer. Das erste war ebenso lang wie der Hausgang ohne den Raum, den die alte Holztreppe einnahm, und war von der Straße her durch ein kleines rechteckiges Fenster und vom Hof her durch ein rundes Fensterchen erleuchtet; es diente zugleich als Vorzimmer und als Eßzimmer. Es war einfach weiß getüncht, und man bemerkte an ihm die zynische Einfachheit des Krämergeizes. Die schmutzige Scheibe wurde niemals gewaschen; das Mobiliar bestand aus drei schlechten Stühlen, einem runden Tisch und einem Büfett, das zwischen zwei Türen stand, von denen die eine in ein Schlafzimmer und die andere in ein Wohnzimmer führte; die Fenster und die Türen waren braun von Schmutz; meist waren sie von Haufen weißen oder bedruckten Papiers versperrt; oft konnte man den Nachtisch, die Flaschen, die Teller vom Mittagessen des Alten auf den Papierballen herumliegen sehen. Das Schlafzimmer, dessen Fenster mit Blei eingefaßt war und das vom Hof aus sein Licht empfing, war mit den alten Teppichen behängt, die man in der Provinz am Fronleichnamstag an den Häusern herunterhängen sieht. Es befanden sich darin ein großes, mit Vorhängen drapiertes Säulenbett, auf dem eine Bettdecke aus rotem Rips lag, ferner zwei wurmstichige Polsterstühle, zwei mit einer Stickerei überzogene Nußbaumholzstühle, ein alter Sekretär und auf dem Kamin eine Uhr im Gehäuse. Dieses Zimmer, in dem eine patriarchalische Behaglichkeit zu spüren und das voller brauner Töne war, war von Herrn Rouzeau, dem Vorgänger und frühern Meister Jérôme Nicolas Séchards, eingerichtet worden. Das Wohnzimmer, das die verstorbene Frau Séchard modern eingerichtet hatte, wies ein fürchterliches Getäfel von grellblauer Farbe auf. Die Füllungen waren mit einer Tapete bekleidet, auf der man Szenen aus dem Orient erblickte, die mit Nußfarbe auf weißem Grund gemalt waren. Die Einrichtung bestand aus sechs mit blauem Schafleder überzogenen Stühlen; die Rücklehnen hatten die Form von Lyren. Die zwei Fenster lagen unter einem plumpen Bogen und waren ohne Vorhänge; man sah durch sie auf die Place du Mûrier. Auf dem Kamin standen keine Leuchter und keine Standuhr, und es hing auch kein Spiegel darüber. Frau Séchard war gestorben, ehe sie ihre Verschönerungspläne hatte ausführen können, und der Bär, der den Nutzen von Verbesserungen, die nichts einbrachten, nicht einsah, hatte sich nicht darum bekümmert. In diesen Raum führte pede titubante Jérôme Nicolas Séchard seinen Sohn und wies ihm auf dem runden Tisch eine Aufstellung des Inventars seiner Druckerei vor, die der Faktor unter seiner Leitung gemacht hatte.
»Lies das, mein Junge«, sagte Jérôme Nicolas Séchard und ließ seine weinseligen Augen vom Papier zu seinem Sohn und von seinem Sohn zum Papier rollen. »Hier wirst du sehen, was für eine Perle von Druckerei ich dir übergebe.«
»Drei hölzerne Pressen, von Eisenstangen gehalten, mit gegossener Platte ...«
»Das ist eine Verbesserung, die ich gemacht habe«, unterbrach der alte Séchard seinen Sohn. »Mit all ihrem Zubehör, Farbenbehältern und Gestellen usw. eintausendsechshundert Franken.« – »Aber Vater,« sagte David Séchard und ließ das Verzeichnis sinken, »deine Pressen sind Gerümpel, die keine hundert Taler wert sind, und nur gut zum Feueranmachen.«
»Gerümpel, Gerümpel!« rief der alte Séchard. »Nimm das Verzeichnis und komm mit hinunter! Du sollst sehen, ob eure Erfindungen, diese elende Schlosserarbeit, so laufen wie diese ausgeprobten, wackern alten Maschinen. Nachher hast du nicht mehr das Herz, brave Pressen zu beschimpfen, die wie Postwagen laufen und die noch dein ganzes Leben lang gehen werden, ohne die geringste Reparatur zu brauchen. Gerümpel! Freilich ein Gerümpel, womit du dir die Butter aufs Brot verdienen wirst. Gerümpel, das dein Vater zwanzig Jahre lang bedient hat, das ihm dazu verholfen hat, dich zu dem zu machen, was du bist.«
Der Vater torkelte die holprige, abgetretene, unter seinen Schritten zitternde Treppe hinunter, und es sah aus, als ob er hinschlagen wollte; er öffnete die Gangtür, die in die Werkstatt führte, stürzte sich auf die erste seiner Pressen, die der Schlaue vorher hatte ölen und reinigen lassen; er deutete auf die starken Holzteile, die sein Lehrling gesäubert hatte.
»Ist das nicht eine entzückende Presse?« fragte er.
Es war gerade eine Vermählungsanzeige zu drucken. Der alte Bär ließ das Rähmchen auf den Preßdeckel herunter und den Preßdeckel auf die Platte, die er unter der Presse rollen ließ; er zog den Preßbengel, wickelte die Schnur ab, um die Platte zurückzuführen, und brachte den Preßdeckel und das Rähmchen mit einer Gewandtheit zurück, die einem jungen Bären Ehre gemacht hätte. Die also bediente Presse gab einen so reizenden Schrei von sich, daß es klang wie von einem Vogel, der sich an eine Scheibe gestoßen hat und rasch davonfliegt.
»Gibt es eine einzige englische Presse, die imstande ist, so zu laufen?« fragte der Vater seinen erstaunten Sohn.
Der alte Séchard lief hintereinander zur zweiten und zur dritten Presse und vollzog an jeder nicht minder geschickt das nämliche Manöver. Bei der letzten erblickte sein von Weindunst getrübtes Auge eine Stelle, die der Lehrling übersehen hatte; der Betrunkene fing gehörig zu fluchen an, nahm einen Zipfel seines Überrocks, um sie abzuwischen, wie ein Pferdehändler, der das Fell eines Pferdes, das zum Verkauf steht, glatt streicht.
»Mit diesen drei Pressen hier kannst du ohne Faktor deine neuntausend Franken jährlich verdienen, David. Als dein künftiger Teilhaber erlaube ich nicht, daß du sie durch diese verfluchten gegossenen Pressen ersetzest, die die Schrift abnützen. Du hast in Paris Wunder zu sehen geglaubt, als du die Erfindung dieses verdammten Engländers gesehen hast. Er ist ein Feind Frankreichs, die Gießer hat er reich machen wollen. Ah! Stanhopemaschinen hast du anschaffen wollen! Ich danke für deine Stanhopes, von denen jede zweitausendfünfhundert Franken kostet, fast doppelt soviel, als meine drei prächtigen Pressen zusammen wert sind, und dazu zerbrechen sie einem, da sie nicht elastisch sind, noch die Lettern. Ich bin nicht gelehrt wie du, aber merke dir das eine: das Leben der Stanhopepressen ist der Tod der Lettern. Diese drei Pressen halten sich gut, die Arbeit wird sauber gedruckt, die Leute im Angoumois verlangen nichts anderes. Druck du mit Eisen oder mit Holz, mit Gold oder mit Silber, sie zahlen dir keinen Heller mehr.«
»Ferner«, las David, »fünfzig Zentner Schrift aus der Gießerei von Vaflard ...« Bei diesem Namen konnte der Schüler der Firma Didot ein Lächeln nicht zurückhalten. »Lach du nur! Nach zwölf Jahren sind die Lettern noch wie neu. Das nenne ich mir einen Gießer! Herr Vaflard ist ein Ehrenmann, der dauerhafte Ware liefert; und ich für meinen Teil nenne den den besten Gießer, den man am seltensten braucht.«
»Geschätzt auf zehntausend Franken«, las David weiter vor. »Zehntausend Franken, Vater! Aber das sind vierzig Sous für das Pfund, und die Firma Didot verkauft ihre Cicero neu für sechsunddreißig Sous das Pfund. Die elenden Schusternägel, die Ihr da habt, sind nur den Gußpreis wert, zehn Sous das Pfund!«
»Gibst du der Schreibschrift, der Kursivschrift, der Rundschrift des Herrn Gillé, des frühern kaiserlichen Druckers, den Namen Schusternägel! Das sind Lettern, von denen das Pfund sechs Franken wert ist, Meisterwerke der Schriftgießerei, die vor fünf Jahren gekauft sind und von denen manche noch weiß sind, wie sie aus der Gießerei kamen. Da sieh!«
Der alte Séchard griff nach einigen Fächern, in denen Schriftgattungen lagen, die niemals benutzt worden waren, und zeigte sie ihm.
»Ich bin kein Gelehrter, ich kann nicht lesen und nicht schreiben, aber so viel verstehe ich, daß ich weiß, die Schriften des Hauses Gillé waren die Väter der englischen Schriften deiner Herren Didot. Da ist eine Rundschrifttype,« sagte er, indem er auf einen Kasten wies, dem er ein M entnahm, »eine Cicero-Rundschrift, die noch nicht übertroffen worden ist.«
David sah ein, daß es keine Möglichkeit gab, mit seinem Vater zu diskutieren. Man mußte allem zustimmen oder alles ablehnen, er war zwischen ein Nein und ein Ja gestellt. Der alte Bär hatte alles in sein Verzeichnis aufgenommen bis auf die Schnüre und Trockenleinen. Der kleinste Rahmen, die Bretter, die Geschirre, der Waschstein und die Waschbürsten, alles war mit der Genauigkeit eines Geizhalses auf Ziffern gebracht. Die Gesamtsumme belief sich auf dreißigtausend Franken, einschließlich des Meisterpatents und der Kundschaft. David fragte sich im stillen, ob das Geschäft möglich sei oder nicht. Als der alte Séchard seinen Sohn stumm über den Zahlen brüten sah, wurde er unruhig; denn eine heftige Auseinandersetzung war ihm lieber als eine stille Zustimmung. Bei dieser Art von Geschäften beweist der Streit, daß es sich um einen leistungsfähigen Vertragschließenden handelt, der sein Interesse vertritt. »Wer zu allem topp sagt,« sagte sich der alte Séchard, »der zahlt nichts.« Er belauerte ängstlich das Nachdenken seines Sohnes und zählte dabei die armseligen Utensilien auf, die eine Provinzdruckerei nötig hat; er führte David hintereinander vor: eine Satinierpresse und eine Beschneidemaschine, die zu den städtischen Arbeiten nötig waren, und rühmte ihm, wie nützlich und wie solid gebaut sie wären.
»Die alten Werkzeuge sind immer die besten,« sagte er, »man sollte sie in der Druckerei teurer bezahlen als die neuen, wie es bei den Goldschlägern der Fall ist.«
Entsetzliche Vignetten, die Hymen, Amore, Tote darstellten, die ihren Grabstein hochhoben und dabei ein V oder ein M beschrieben, ungeheuerliche Einfassungen aus Masken für die Theateranzeigen wurden mit Hilfe der weinseligen Beredsamkeit Jérôme Nicolas' Gegenstände von außerordentlichem Wert. Er erklärte seinem Sohn, die Gewohnheiten der Leute in der Provinz seien so festgewurzelt, daß er ganz vergebens versuchen würde, ihnen etwas Schöneres zu geben. Er selbst, Jérôme Nicolas Séchard, hatte versucht, ihnen bessere Almanache zu verkaufen als den auf Zuckerpapier gedruckten »Großen Lütticher Boten«. Aber was! der wahre Große Lütticher Bote war den wunderschönsten Almanachen vorgezogen worden. David würde bald den Wert dieser alten Scharteken erkennen und sie teurer verkaufen als die kostbarsten Neuheiten.
»Ah, ah! die Provinz ist die Provinz, und Paris ist Paris. Wenn so ein Kerl aus dem Houmeau zu dir kommt, um seine Heiratsanzeige bei dir zu bestellen, und wenn du sie ihm ohne einen Amor mit Girlanden druckst, dann hält er sich nicht für verheiratet und bringt sie dir wieder, wenn er nichts weiter darauf steht als ein M, wie bei deinen Didot, die der Ruhm der Buchdruckerkunst sind, aber deren Erfindungen hundert Jahre brauchen, bis sie sich in der Provinz einbürgern. Das ist die Sache.«
Vornehme Naturen sind schlechte Geschäftsleute. David war eine dieser keuschen und zarten Naturen, die vor einer Auseinandersetzung zurückschrecken und die in dem Augenblick nachgeben, wo der Gegner sie etwas empfindlicher trifft. Seine verfeinerten Gefühle und die Herrschaft, die der alte Trunkenbold über ihn ausübte, machten ihn noch ungeeigneter, eine Auseinandersetzung über Geldsachen mit seinem Vater fortzuführen, zumal er ihm die besten Absichten zuschrieb; denn er führte jetzt Gier und Interessiertheit auf die Liebe zurück, die der Drucker für seine Maschinen hegt. Da indessen Jérôme Nicolas Séchard das Ganze von der Witwe Rouzeau für zehntausend Franken in Assignaten übernommen hatte, und da beim jetzigen Zustand der Einrichtung dreißigtausend Franken ein unerhörter Preis waren, rief der Sohn aus: »Vater, du plünderst mich aus!«
»Was, ich? Habe ich dir nicht das Leben gegeben?« sagte der alte Trunkenbold und hob die Hand zur Decke empor. »Aber, David, wie hoch schlägst du denn das Patent an? Überlegst du auch, wieviel das ›Anzeigeblatt‹ wert ist, wo die Zeile zehn Sous kostet? Das Privileg ganz allein hat im letzten Monat fünfhundert Franken eingebracht. Junge, öffne doch die Bücher, sieh nach, was die Anschläge und die Register der Präfektur einbringen und die Kundschaft des Magistrats und der bischöflichen Kanzlei! Du bist ein dummer Kerl, der reich werden kann und nicht will. Du feilschst noch um das Pferd, das dich zu einem so schönen Herrensitz tragen kann, wie mein Marsac ist.«
Beigefügt war dem Inventar ein Gesellschaftsvertrag zwischen dem Vater und dem Sohn. Der gute Vater vermietete der Gesellschaft sein Haus für eine Summe von zwölfhundert Franken, obgleich er es nur für sechshundert gekauft hatte, und er reservierte sich darin eine der beiden Dachkammern. Solange David Séchard die dreißigtausend Franken nicht bezahlt hätte, sollte der Reingewinn zu gleichen Hälften geteilt werden; von dem Tage an, wo er diese Summe seinem Vater bezahlt hätte, sollte er alleiniger Eigentümer der Druckerei werden. David legte Wert auf das Patent, die Kundschaft und die Zeitung, ohne sich um die Pressen zu kümmern; er glaubte, es könnte ihm gelingen, die Schuld abzutragen, und akzeptierte die Bedingungen. Der Vater, der an die Bauernkniffe gewöhnt war und von den weiterblickenden Berechnungen der Pariser nichts wußte, war über einen so schnellen Entschluß erstaunt. »Sollte mein Sohn Geld haben,« fragte er sich, »oder entschließt er sich in diesem Augenblick, mich nicht zu bezahlen?«
Infolge dieser Gedanken fing er an, ihn auszufragen, ob er Geld mitgebracht habe, er könne es ihm ja in Rechnung stellen. Die neugierige Fragerei des Vaters erweckte das Mißtrauen des Sohnes. David blieb zugeknöpft bis zum Halse hinauf. Am nächsten Tag ließ der alte Séchard durch seinen Lehrling seine Möbel in die Kammer des zweiten Stocks bringen; er beabsichtigte, sie durch die Bauernwagen, die sonst leer zurückfuhren, auf sein Landgut bringen zu lassen. Er übergab seinem Sohn die drei Zimmer des ersten Stocks völlig leer, ebenso wie er ihm die Druckerei übergab, ohne ihm einen Heller zur Bezahlung der Arbeiter einzuhändigen. Als David seinen Vater bat, in seiner Eigenschaft als Teilhaber eine Einlage beizusteuern, die zum Weiterbetrieb nötig sei, wollte der alte Drucker von nichts wissen. Er sagte, er habe sich verpflichtet, seine Druckerei zu übergeben, aber kein Geld. Seine Einlage sei schon da. Als er sich von der Logik seines Sohnes bedrängt sah, antwortete er ihm, als er die Druckerei der Witwe Rouzeau abgekauft habe, habe er die Sache ohne einen Sou fertiggebracht. Wenn das ihm, einem armen Arbeiter ohne Kenntnisse, geglückt sei, müsse es bei einem Zögling Didots noch besser gehen. Überdies habe David Geld verdient, was er der Erziehung zu verdanken habe, die mit dem Schweiß seines alten Vaters bezahlt worden wäre, und so könnte er es jetzt gut anlegen.
»Was hast du mit deinem Wochenlohn gemacht?« fragte er ihn und versuchte damit nochmals die Frage zu erhellen, die das Schweigen seines Sohnes am Tage vorher unentschieden gelassen hatte. »Aber habe ich nicht leben müssen? Habe ich nicht Bücher gekauft?« antwortete David ärgerlich. »Ah, du hast Bücher gekauft! Du wirst schlechte Geschäfte machen. Leute, die Bücher kaufen, sind kaum geeignet, sie zu drucken«, antwortete der Bär.
David stand die schrecklichste aller Demütigungen aus, er mußte die niedrige Gesinnung seines Vaters über sich ergehen lassen. Er mußte die Flut gemeiner, weinerlicher, listiger Gründe bestehen, mit denen der alte Geizhals seine Weigerung motivierte. Er drängte seinen Schmerz in seine Seele zurück, er sah sich allein, ohne Hilfe, denn er fand in seinem Vater einen Spekulanten, den er aus philosophischer Neugier bis zum Grunde kennen lernen wollte. Er ließ die Bemerkung fallen, er habe niemals Rechnungslegung über das Vermögen seiner Mutter verlangt. Wenn dieses Vermögen nicht ausreichte, um den Preis der Druckerei zu erlegen, müßte es doch mindestens als Betriebskapital dienen können.
»Das Vermögen deiner Mutter?« sagte der alte Séchard, »aber das war weiter nichts als ihre Klugheit und ihre Schönheit.«
Bei dieser Antwort durchschaute David seinen Vater völlig und sah ein, daß er, wenn er eine Rechnungslegung erhalten wollte, gegen ihn einen unendlichen, kostspieligen und entehrenden Prozeß würde anstrengen müssen. Der vornehme Jüngling nahm die Last auf sich, obwohl er wußte, wie sie ihn drücken mußte und wie schwer es sein würde, den Verpflichtungen gegen seinen Vater nachzukommen.
»Ich werde arbeiten«, sagte er sich. »Schließlich, wenn ich zu schuften habe, dem Alten ist es nicht besser gegangen, und überdies werde ich für mich arbeiten.«
»Ich hinterlasse dir einen Schatz«, sagte der Vater, den das Schweigen seines Sohnes beunruhigte.
David fragte, was das für ein Schatz sei.
»Marion«, sagte der Vater.
Marion war ein plumpes Bauernmädchen, das in der Druckerei unentbehrlich war; sie netzte und beschnitt das Papier, besorgte Bestellungen und die Küche, sorgte für die Wäsche, lud das Papier von den Wagen ab, zog Geld ein und reinigte die Tupfballen. Wenn Marion hätte lesen können, hätte sie der alte Sichard an den Setzkasten gestellt.
Der Vater begab sich zu Fuß auf sein Landgut zurück. Obgleich er über seinen Verkauf, der sich unter dem Namen Beteiligung versteckte, sehr glücklich war, beunruhigte es ihn jetzt doch, nach welchem Modus er bezahlt werden würde. Nach den Erregungen des Verkaufs kommen immer die wegen der Bezahlung. Alle Leidenschaften sind in ihrem Kern jesuitisch. Dieser Mann, der die Erziehung für etwas Unnützes ansah, bemühte sich jetzt, an den Einfluß der Erziehung zu glauben. Er stellte seine dreißigtausend Franken mit den Ehrbegriffen sicher, die die Erziehung in seinem Sohne ausgebildet haben mußte. Als wohlerzogener junger Mann würde David Blut schwitzen, um seinen Verpflichtungen nachzukommen, seine Kenntnisse würden ihm Quellen erschließen, er hatte ein schönes Empfinden gezeigt, er würde zahlen! Viele Väter, die so verfahren, glauben väterlich verfahren zu sein, und diese Überzeugung hatte schließlich der alte Séchard erlangt, als er wieder in seinem Weingut anlangte. Es war in Marsac gelegen, einem kleinen Dorf, das vier Meilen von Angoulême entfernt war. Dieses Landgut, auf dem der frühere Besitzer ein hübsches Wohnhaus erbaut hatte, hatte sich seit 1809, zu welcher Zeit der alte Bär es an sich gebracht, von Jahr zu Jahr vergrößert. Er vertauschte dort die Sorgen der Presse gegen die der Kelter, und er war, wie er gern sagte, seit zu langer Zeit Weinkenner, um sich nicht darauf zu verstehen. Während des ersten Jahres seiner ländlichen Zurückgezogenheit bot Vater Séchard eine sorgenvolle Miene zwischen seinen Weinstöcken; denn er war immer auf seinem Weinberg, wie er früher in seiner Werkstatt gewohnt hatte. Diese unerhofften dreißigtausend Franken berauschten ihn noch mehr als der junge Septembersaft. Er hatte sie in Gedanken schon zwischen den Fingern. Je weniger er die Summe erwarten konnte, um so mehr wünschte er sie einzustreichen. Daher zog ihn seine Ungeduld oft von Marsac nach Angoulême. Er kletterte die Felsenabhänge hinauf, auf deren Höhe die Stadt liegt, und begab sich in die Druckerei, um zu sehen, ob sein Sohn mit dem Geschäft fertig wurde. Die Pressen waren an ihrem Platz. Der einzige Lehrling trug seine Papiermütze auf dem Kopf und reinigte die Tupfballen. Der alte Bär hörte eine Presse über irgendeine Einladungskarte kreischen, er sah seine alten Lettern wieder, er erblickte seinen Sohn und den Faktor und sah, wie beide in ihren Käfigen ein Buch lasen, das der Bär für Korrekturen hielt. Er aß mit David zu Mittag, kehrte dann auf sein Gut in Marsac zurück und grübelte über seine Besorgnisse. Der Geiz hat wie die Liebe die Gabe des zweiten Gesichts für die kommenden Ereignisse, er wittert sie, er nimmt sie voraus. Wenn er von der Druckerei wieder weg war, wo der Anblick seiner Werkzeuge ihn bestrickte, die ihn in die Zeit zurückversetzten, wo er sein Vermögen erworben, fand der alte Winzer bei seinem Sohne beunruhigende Zeichen von Untätigkeit. Der Name Gebrüder Cointet erschreckte ihn, er sah ihn die Firma Séchard & Sohn überflügeln. Kurz, der alte Mann fühlte das Unglück nahen. Diese Ahnung hatte guten Grund: das Unglück schwebte wirklich über dem Hause Séchard. Aber die Geizigen haben einen Gott. Durch ein Zusammentreffen von unvorhergesehenen Umständen mußte dieser Gott dafür sorgen, daß der Preis seines wucherischen Verkaufs vollständig in die Geldtasche des Trunkenbolds kam. Hören wir nun, aus welchen Gründen die Druckerei Séchard zurückging, obwohl es den Anschein hatte, daß sie hätte florieren müssen. David kümmerte sich weder um die religiöse Reaktion, die die Restauration in der Regierung hervorbrachte, noch um den Liberalismus und bewahrte daher in politischen und religiösen Dingen die schädlichste Neutralität. Das war in einer Zeit, wo die Kaufleute der Provinz sich zu einer Meinung bekennen mußten, um Kunden zu haben, denn man mußte zwischen der Kundschaft der Liberalen oder der der Royalisten wählen. Eine Liebesneigung, die im Herzen Davids erwachte, seine wissenschaftlichen Beschäftigungen, seine schöne Natur, all das ließ in ihm die Gewinngier nicht aufkommen, die zum rechten Kaufmann gehört und die ihn veranlaßt hätte, über die Unterschiede nachzudenken, die die Industrie der Provinz von der der Hauptstadt trennen. Die in den Departements voneinander so verschiedenen Nuancen verschwinden in der großen Bewegung von Paris. Die Gebrüder Cointet schlossen sich den monarchistischen Meinungen an, sie hielten ostentativ die Fasttage inne, gingen fortwährend in den Dom, verkehrten mit den Priestern und druckten sofort, als das Bedürfnis bemerkbar war, religiöse Bücher. Die Cointet bekamen also in diesem einträglichen Geschäfte das Oberwasser und verleumdeten David Séchard, den sie des Liberalismus und des Atheismus bezichtigten. »Wie«, sagten sie, »könnte man einen Menschen beschäftigen, der einen von den Septembermördern, einen Trunkenbold, einen Bonapartisten, einen alten Geizkragen zum Vater hätte, der früher oder später ganze Haufen Gold hinterlassen müßte?« Sie wären arm, hätten für ihre Familie zu sorgen, während David ein Junggeselle wäre und einmal sehr reich würde. Er täte auch nur, was ihm behagte usw. Unter dem Einfluß dieser Anschuldigungen übertrugen schließlich die Präfektur und die bischöfliche Kanzlei das Privileg ihrer Druckaufträge den Gebrüdern Cointet. Bald riefen diese gierigen Gegner, denen die Sorglosigkeit ihres Konkurrenten Mut machte, ein zweites Anzeigeblatt ins Leben. Die alte Druckerei war auf die Druckaufträge der Stadt angewiesen, und die Einnahme aus seinem Anzeigeblatt ging auf die Hälfte zurück. Das Haus Cointet, das an den kirchlichen und religiösen Büchern beträchtliche Summen verdient hatte, schlug bald den Séchard vor, ihm ihre Zeitung zu verkaufen, damit sie die Bekanntmachungen des Departements und die Inserate der Behörden ungeteilt hätten. Sowie David diese Nachricht seinem Vater mitgeteilt hatte, stürzte der alte Winzer, den die Fortschritte des Hauses Cointet schon erschreckt hatten, mit der Schnelligkeit eines Raben, der die Leichen auf einem Schlachtfeld gewittert hatte, von Marsac auf die Place du Mûrter.
»Überlaß mir die Verhandlungen mit den Cointet, mische dich nicht in dieses Geschäft«, sagte er zu seinem Sohn.
Der alte Mann hatte bald das Interesse der Cointet erraten, er erschreckte sie durch die Schärfe seiner Bemerkungen. »Sein Sohn habe eine Dummheit begangen, die er gerade noch verhindern konnte«, sagte er.
»Worauf soll unsere Kundschaft sich stützen, wenn er unser Blatt verkauft? Die Advokaten, die Notare, alle Kaufleute des Houmeau sind liberal, die Cointet haben den Séchard Schaden zufügen wollen, als sie sie des Liberalismus bezichtigten, sie haben ihnen damit das Rettungsseil zugeworfen, die Annoncen der Liberalen werden den Séchard verbleiben! Das Blatt verkaufen? Aber ebensogut könnte man die ganze Druckerei und das Patent verkaufen.«
Er verlangte nunmehr von den Cointet sechzigtausend Franken für die Druckerei, um seinen Sohn nicht zu ruinieren: er liebte seinen Sohn, er schützte seinen Sohn. Der alte Winzer bediente sich seines Sohns, wie die Bauern ihrer Frauen: sein Sohn wollte oder wollte nicht, je nach den Vorschlägen, die er einen nach dem andern den Cointet entriß, und er brachte sie nicht ohne Anstrengungen dazu, daß sie eine Summe von zweiundzwanzigtausend Franken für das Journal de la Charente gaben. Aber David mußte sich verpflichten, niemals wieder irgendein Blatt zu drucken, widrigenfalls er dreißigtausend Franken Schadloshaltung zu zahlen hätte. Dieser Verkauf war der Selbstmord der Druckerei Séchard, aber der Winzer beunruhigte sich nicht darüber. Nach dem Diebstahl kommt immer der Mord. Der Ehrenmann hatte im Sinne, diese Summe zur Bezahlung seiner Forderung zu verwenden, und um sie in die Hände zu bekommen, hätte er David noch mit dazu verkauft, insbesondere da dieser lästige Sohn Anspruch auf die Hälfte dieses unverhofften Gewinns hatte. Zur Entschädigung überließ der edelmütige Vater ihm die Druckerei, wobei aber die Bestimmung, daß der Sohn für die Miete des Hauses die famosen zwölfhundert Franken zu zahlen hatte, bestehen blieb. Seit dem Verkauf der Zeitung an die Cointet kam der Alte nur noch selten in die Stadt, er schützte sein hohes Alter vor; aber der wahre Grund war das geringe Interesse, das er an einer Druckerei nahm, die ihm nicht mehr gehörte. Trotzdem konnte er die alte Liebe zu seinen Werkzeugen nicht ganz aufgeben. Wenn seine Geschäfte ihn nach Angoulême führten, wäre es sehr schwer gewesen, zu entscheiden, was ihn am meisten in sein Haus zog, seine hölzernen Pressen oder sein Sohn, zu dem er kam, um pro forma seine Miete zu verlangen. Sein früherer Faktor, der jetzt bei den Cointet war, wußte, was er von diesem väterlichen Edelmut halten sollte; er sagte, »der schlaue Fuchs behielte sich auf diese Weise das Recht vor, sich in die Geschäfte seines Sohnes einzumischen, indem er durch die Aufhäufung der Mietschuld bevorrechtigter Gläubiger würde«.
Die Unbekümmertheit David Séchards hatte Ursachen, die für den Charakter des jungen Mannes bezeichnend waren. Einige Tage nachdem er die väterliche Druckerei übernommen, hatte er einen seiner Studienfreunde getroffen, der damals dem tiefsten Elend preisgegeben war. Der Freund David Séchards war ein junger Mann von ungefähr einundzwanzig Jahren, namens Lucien Chardon, der Sohn eines frühern Regimentswundarztes der republikanischen Armeen, der infolge einer Verwundung seinen Dienst eingebüßt hatte. Seine Naturanlage hatte aus Chardons Vater einen Chemiker gemacht, und der Zufall hatte ihn als Apotheker nach Angoulême geführt. Der Tod überraschte ihn inmitten der Vorbereitungen zur Ausbeutung einer großartigen Erfindung, zu der er mehrere Jahre wissenschaftlicher Studien gebraucht hatte. Er wollte jede Art Gicht heilen. Die Gicht ist die Krankheit der Reichen, und die Reichen zahlen die Gesundheit gut, wenn sie ihrer beraubt sind. Daher hatte der Apotheker dieses Problem aus den vielen ausgewählt, die sich seinem Nachdenken dargeboten hatten. Der selige Chardon hatte in seiner Stellung zwischen Wissenschaft und Erfahrung begriffen, daß allein die Wissenschaft sein Vermögen begründen könnte: er hatte also die Ursachen der Krankheit studiert und sein Mittel auf eine gewisse Lebensweise gegründet, die er jedem Temperament anpaßte. Er starb während eines Aufenthalts in Paris, wo er die Approbation der Akademie der Wissenschaften hatte einholen wollen, und verlor so die Frucht seiner Arbeit. Der Apotheker hatte, da er ein großes Vermögen vor sich sah, in der Erziehung seines Sohnes und seiner Tochter nichts verabsäumt, und so hatte der Unterhalt seiner Familie alle Erträgnisse der Apotheke verschlungen. Auf solche Weise kam es, daß er seine Kinder nicht nur im Elend zurückließ, sondern daß er sie auch zu ihrem Unglück in der Hoffnung auf eine glänzende Zukunft aufgezogen hatte, die mit ihm erlosch. Der berühmte Desplein, der ihn behandelte, sah ihn unter Wutkrämpfen sterben. Die Quelle dieses Ehrgeizes war die leidenschaftliche Liebe, die der alte Wundarzt zu seiner Frau hegte, die das letzte Glied der Familie von Rubempré war und die er im Jahr 1793 wie durch ein Wunder vom Schafott gerettet hatte. Ohne daß das junge Mädchen dieser Lüge hatte zustimmen wollen, hatte er einen Aufschub erreicht, indem er sagte, sie sei schwanger. Nachdem er sich so das Recht verschafft hatte, sie zu seiner Frau zu machen, heiratete er sie trotz ihrer beider Armut. Die Kinder besaßen, wie alle Kinder der Liebe, als Erbe weiter nichts als die wunderbare Schönheit der Mutter, ein oft verhängnisvolles Geschenk, wenn es mit Not und Elend verknüpft ist. Dieses Hoffen, dieses Arbeiten, dieses Verzweifeln hatten die Schönheit Frau Chardons sehr beeinträchtigt, ebenso wie die stufenweis steigende Not ihre Lebensart verändert hatte, aber ihr und ihrer Kinder Mut war ebenso groß wie ihr Unglück. Die arme Witwe verkaufte die Apotheke, die in der Hauptstraße von Houmeau, der bedeutendsten Vorstadt von Angoulême, gelegen war. Der Preis der Apotheke erlaubte ihr, sich dreihundert Franken Leibrente festzulegen, eine Summe also, die für ihre eigene Existenz nicht ausreichen konnte, aber sie und ihre Tochter fügten sich in ihre Lage ohne falsche Scham und übernahmen Lohnarbeit. Die Mutter widmete sich der Wochenpflege, und sie wurde infolge ihrer guten Manieren in den reichen Häusern jeder andern vorgezogen, sie konnte sich dort verpflegen, ohne ihren Kindern etwas zu kosten, wobei sie täglich noch zwanzig Sous verdiente. Um ihrem Sohn die Beschämung zu ersparen, seine Mutter in einer so erniedrigten Lage zu sehen, hatte sie den Namen Madame Charlotte angenommen. Die Frauen, die ihrer Pflege bedurften, hatten sich an Herrn Postel zu wenden, den Nachfolger Herrn Chardons. Die Schwester Luciens arbeitete bei einer sehr ehrenwerten und in Houmeau geachteten Frau namens Prieur, einer Weißwäscherin, die ihre Nachbarin war, und verdiente täglich ungefähr fünfzehn Sous. Sie führte die Aufsicht über die Arbeiterinnen und erfreute sich in der Wäscherei einer Art Vorzugsstellung, die sie ein wenig über die Klasse der Wäscherinnen erhob. Die geringen Erträgnisse ihrer Arbeit zusammen mit den dreihundert Franken Rente von Frau Chardon beliefen sich ungefähr auf achthundert Franken im Jahr, mit denen diese drei Personen sich nähren, sich kleiden und wohnen mußten. Trotz dieser streng eingeschränkten Lebensweise wollte die Summe, die fast völlig von Lucien verbraucht wurde, kaum ausreichen. Frau Chardon und ihre Tochter Eva glaubten an Lucien, wie die Frau Mahomets an ihren Gatten glaubte; ihre Hingabe an seine Zukunft war grenzenlos. Diese arme Familie hauste in Houmeau in einer Wohnung, die sie für einen sehr niedrigen Preis bei dem Nachfolger Herrn Chardons gemietet hatte und die hinten in einem Hofe über dem Laboratorium gelegen war. Lucien hatte eine elende Mansardenstube inne. Angeregt von seinem für die Naturwissenschaften begeisterten Vater, hatte Lucien sich auf dieses Studium geworfen und war einer der hervorragendsten Schüler des Collège von Angoulême, wo er in der dritten Klasse saß, als Séchard seine Studien eben beendet hatte.
Als der Zufall die beiden Studiengefährten wieder zusammenführte, stand Lucien, der es müde war, den schweren Kelch des Elends zu trinken, im Begriff, einen der verzweifelten Schritte zu tun, zu denen man sich mit zwanzig Jahren entschließt. Vierzig Franken monatlich, die David Lucien großmütig gab, indem er sich erbot, ihn zum Faktor auszubilden, obgleich er durchaus keinen brauchte, retteten Lucien aus seiner Verzweiflung. Die Bande dieser solchermaßen erneuerten Studienfreundschaft gestalteten sich infolge der Ähnlichkeit ihres Geschicks und der Verschiedenheit ihrer Charaktere bald enger. Alle beide hatten den Kopf voller großer Pläne, beide besaßen den hohen Geist, der einen Menschen den Höchsten gleichsetzt, und beide sahen sich auf der untersten Stufe der Gesellschaft. Diese Ungerechtigkeit des Schicksals war ein starkes Band. Ferner waren beide von verschiedenen Seiten her bei der Poesie angelangt. Obwohl er für die schwierigsten Forschungen der Naturwissenschaften bestimmt war, drängte es Lucien glühend nach literarischem Ruhm, während David, den sein sinnender Geist zur Poesie bestimmte, seinem Geschmack nach den exakten Wissenschaften zuneigte. Diese Vertauschung der Rollen machte sie zu einer Art geistigen Brüdern. Lucien teilte bald David die großen Gesichtspunkte einer Anwendung der Wissenschaft auf die Industrie mit, die er von seinem Vater empfangen hatte, und David zeigte Lucien die neuen Bahnen, die er in der Literatur beschreiten müßte, um sich einen Namen und ein Vermögen zu machen. Die Freundschaft dieser beiden jungen Leute gestaltete sich in wenig Tagen zu einer von den Leidenschaften, wie sie nur in dieser Jugendzeit entstehen. David erblickte bald die schöne Eva und verliebte sich in sie, wie sich die melancholischen und sinnenden Geister verlieben. Das Et nunc et semper et in saecula saeculorum der Liturgie ist der Wahlspruch dieser unbekannten Dichter, deren Werke in wunderbaren Epen bestehen, die zwischen zwei Herzen entstehen und vergehen. Als der Liebende das Geheimnis der Hoffnungen entdeckt hatte, die die Mutter und die Schwester Luciens auf diesen schönen Dichterkopf setzten, als ihre blinde Aufopferung ihm bekannt wurde, fand er es süß, sich seiner Geliebten zu nähern und ihre Opfer und Hoffnungen zu teilen. Wie die Intransigenten, die noch königlicher als der König sein wollten, übertrieb David den Glauben, den Mutter und Schwester Luciens auf sein Genie setzten, und verhätschelte ihn, wie eine Mutter ihr Kind. In einer der Unterhaltungen, die die ewige Geldnot, die ihnen die Hände band, fortwährend erzeugte, überlegten sie, wie alle jungen Leuten, die Mittel hin und her, wie man schnell zu Vermögen kommen könnte, schüttelten vergebens alle Bäume, die schon von Früheren geplündert worden waren, bis Lucien sich an zwei Ideen erinnerte, die sein Vater ausgesprochen hatte. Herr Chardon hatte davon gesprochen, man könnte durch Anwendung eines neuen chemischen Stoffs den Preis des Zuckers auf die Hälfte bringen, und ebenso ließe sich der Preis des Papiers herabsetzen, wenn man von Amerika gewisse pflanzliche Stoffe bezöge, ähnlich denen, deren sich die Chinesen bedienten und die wenig kosteten. David, der die Wichtigkeit der Frage, die schon bei Didot erörtert worden war, kannte, bemächtigte sich dieser Idee, in der er die Grundlage zu einem großen Vermögen erblickte, und sah Lucien als einen Wohltäter an, dem er ewig dankbar sein müßte.
Man kann sich denken, wie die Herrschaft dieser Gedanken und das ganze Innenleben der beiden Freunde sie unfähig machte, eine Druckerei zu führen. Während die Druckerei der Brüder Cointet, der Drucker und Verleger der bischöflichen Kanzlei, der Eigentümer des Courier de la Charente, der von jetzt an das einzige Blatt des Departements war, fünfzehn- bis zwanzigtausend Franken brachte, belief sich die Einnahme der Druckerei Séchard kaum auf dreihundert Franken im Monat, wovon das Gehalt des Faktors, der Lohn Marions, die Steuern und die Miete in Abzug kamen, so daß David auf hundert Franken im Monat angewiesen war. Tätige und betriebsame Männer hätten neue Lettern angeschafft, eiserne Pressen gekauft, hätten sich bei den Pariser Buchhändlern Werke verschafft, die sie zu niedrigem Preis gedruckt hätten; aber der Meister und der Faktor waren völlig von den Arbeiten des Kopfes in Anspruch genommen und begnügten sich mit den Aufträgen, die ihnen ihre letzten Kunden gaben. Die Brüder Cointet waren endlich hinter den Charakter und die Lebensführung Davids gekommen und verleumdeten ihn nicht mehr; im Gegenteil riet ihnen eine weise Politik, diese Druckerei ihr Leben fristen und sie in einem gewissen anständigen kleinen Umfang bestehen zu lassen, damit sie nicht in die Hände eines gefürchteten Konkurrenten fiel; sie schickten sogar selbst die sogenannten Stadtaufträge. Auf diese Weise existierte David Séchard, kaufmännisch zu sprechen, ohne es zu wissen, nur noch durch eine geschickte Kalkulation seiner Konkurrenten. Die Cointet waren glücklich über das, was sie seine Manie nannten, und benahmen sich gegen ihn dem Anschein nach durchaus ehrenhaft und loyal. Aber sie gingen in Wirklichkeit wie die Verwaltung der Privatpost vor, die eine künstliche Konkurrenz schafft, um eine wirkliche zu vermeiden.
Das Äußere des Hauses Séchard stimmte mit dem schmutzigen Geiz, der im Innern herrschte, wo der alte Bär nie etwas repariert hatte, überein. Der Regen, die Sonne, die Unbilden jeder Jahreszeit hatten der Gangtür das Aussehen eines alten Baumstammes gegeben, so sehr war sie von kleineren und größeren Spalten durchzogen. Die Fassade, die aus Steinen und Ziegeln unsymmetrisch durcheinandergebaut war, schien sich unter dem Gewicht eines verwitterten Daches zu biegen, das über und über mit den Hohlziegeln bedeckt war, aus denen alle Dächer im südlichen Frankreich bestehen. An dem morschen Fensterkreuz befanden sich die fest verschließbaren riesigen Läden, wie sie das heiße Klima erfordert. Es wäre nicht leicht gewesen, in ganz Angoulême ein so rissiges Haus wie dieses zu finden, das nur noch durch die Kraft des Mörtels zusammenhielt. Man stelle sich die Werkstatt vor, die vorn und hinten erhellt, in der Mitte dunkel war, die Mauern mit Plakaten bedeckt und unten von dem Vorbeistreifen der Arbeiter, die sich dort seit dreißig Jahren bewegt hatten, schwarz geworden; ihre Leinen und Stricke an der Decke, ihre Papierstöße, die alten Pressen, die Haufen Steine zum Beschweren des nassen Papiers, die Reihen Setzkästen und am Ende die beiden Käfige, wo sich der Meister und der Faktor, jeder auf seiner Seite, aufhielten: dann hat man ein Bild von der Existenz der beiden Freunde.
Im Jahre 1821 in den ersten Maitagen befanden sich David und Lucien in dem Augenblick, wo gegen zwei Uhr ihre vier oder fünf Arbeiter die Werkstatt verließen, um essen zu gehen, in der Nähe des Hoffensters. Als der Meister sah, wie sein Lehrling die Ladentür, die zur Straße ging, hinter sich geschlossen hatte, führte er Lucien in den Hof, wie wenn der Geruch der Papiere, der Farbenbehälter, der Pressen und des alten Holzes ihm unerträglich geworden wäre. Die beiden setzten sich unter eine Laube, von wo sie jeden sehen konnten, der in die Werkstatt kam. Die Sonnenstrahlen, die auf dem Weinlaub des Spaliers spielten, umschmeichelten die beiden Dichter und hüllten sie in ihr Licht wie in einen Glorienschein. Der Gegensatz der beiden jungen Leute, die einander gegenübersaßen, trat nach Charakter und Aussehen mit solcher Entschiedenheit hervor, daß ein Maler, der sie so gesehen, gleich nach seinem Pinsel gegriffen hätte. David hatte Formen, wie sie die Natur den Menschen mit auf den Weg gibt, die zu großen offenen oder geheimen Kämpfen bestimmt sind. Über seiner breiten Brust saßen starke Schultern, die ebenmäßig zu der Fülle seines ganzen Körpers paßten. Sein Gesicht, gebräunt, gesund, voll, über einem starken Hals, umgeben von einer Flut schwarzer Haare, glich beim ersten Anblick dem der Mönche, die Boileau besingt; aber bei näherer Prüfung entdeckte man in den Falten der aufgeworfenen Lippen, im Grübchen des Kinns, im Schnitt einer breiten Nase, deren eine Hälfte wie schiefgedrückt war, und vor allem in den Augen das unausgesetzte Feuer einer ausschließlichen Leidenschaft, die Schärfe des Denkers, die glühende Melancholie eines Geistes, der die ganze Weite und alle Tiefen des Horizonts umfaßte und durchdrang und der selbst der idealsten Genüsse leicht müde wurde, weil er die Klarheit der Analyse mit hineinnahm. Man ahnte in diesem Gesicht das Aufblitzen des Genies, aber man sah auch die Asche um den Vulkan; die Hoffnung erlosch in diesem Antlitz in einer tiefen Empfindung der sozialen Nichtigkeit, in der die niedrige Abstammung und das mangelnde Vermögen so viele Geister höherer Art festhalten. Neben diesem armen Buchdrucker, dem sein der Intelligenz doch so benachbarter Beruf widerstand, neben diesem Silen, der so schwer auf sich selbst ruhte, der in langen Zügen aus dem Becher der Wissenschaft und der Dichtung schlürfte und sich daran berauschte, um das Elend des Provinzlebens zu vergessen, neben diesem Silen saß Lucien in der anmutigen Haltung, wie sie die Bildhauer für den indischen Bacchus gefunden haben. Sein Gesicht besaß die Linienfeinheit der antiken Schönheit: griechische Stirn und Nase, die weiße Farbe und den Schmelz eines Weibes, Augen, deren tiefe Bläue schwarz wirkte, Augen voller Liebesschmelz, deren Weiß so glänzend war wie bei einem Kinde. Über diesen schönen Augen wölbten sich Brauen, die wie mit einem feinen chinesischen Pinsel gezeichnet waren, und lange kastanienbraune Wimpern beschatteten sie. Die Wangen erglänzten von seidigem Flaum, dessen Farbe mit dem Blond der natürlich gelockten Haare übereinstimmte. Seine weißen Schläfen waren goldig überhaucht. Ein unvergleichlicher Adel prägte sich in seinem kurzen, leicht aufwärts gebogenen Kinn aus. Das Lächeln der gefallenen Engel schwebte auf seinen Korallenlippen, deren Röte durch das Weiß der Zähne noch gehoben wurde. Er hatte die Hände eines Menschen von vornehmer Geburt, elegante Hände, denen die Männer auf den Wink gehorchen mußten und die die Frauen zu küssen lieben. Lucien war schlank und von mittlerer Figur; wenn man seine Füße sah, konnte man versucht sein, ihn für ein verkleidetes junges Mädchen zu halten, um so mehr, als er, wie die meisten durchtriebenen, um nicht zu sagen verschlagenen Männer, Hüften wie die einer Frau hatte. Dieses Anzeichen, das selten täuscht, traf bei Lucien zu, den die Neigung seines rührigen Geistes oft, wenn er den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft analysierte, auf das Gebiet der Verderbtheit führte, wie sie den Diplomaten eigen ist, die den Erfolg für die Rechtfertigung aller Mittel halten, so schimpflich sie auch sein mögen. Es ist die Schattenseite großer Verstandesbegabung, daß sie mit Notwendigkeit alle Dinge erfaßt, die Laster ebensowohl wie die Tugenden.
Diese beiden jungen Leute urteilten um so souveräner über die Gesellschaft, als sie eine niedrige Stellung in ihr einnahmen; denn die Unbekannten rächen oft die Niedrigkeit ihrer Lage mit dem Hochmut ihrer Betrachtungsweise. Aber ebenso war auch ihre Verzweiflung um so bitterer, weil sie gerade dadurch schneller ihrem wahren Geschick entgegengetrieben wurden. Lucien hatte viel gelesen, viel verglichen, David hatte viel gedacht, viel gesonnen. Trotz seines gesunden und bäurischen Aussehens war der Drucker ein melancholischer und kränklicher Geist, er zweifelte an sich selbst; Lucien dagegen hatte einen unternehmenden, aber schwankenden Geist und eine Kühnheit, die im Widerspruch stand zu seiner weichen, fast schwächlichen Gestalt, die voll weiblichen Reizes war. Lucien war im höchsten Maße der Charakter des Gascogners eigen: er war kühn, tapfer, abenteuerlich, ein Charakter, der das Gute übertrieben gut sieht und das Üble nicht allzu schlimm nimmt, der vor keinem Fehltritt zurückschrickt, wenn ein Nutzen dabei herausspringt, und sich nichts aus dem Laster macht, wenn er sich eine Staffel daraus machen kann. Diese Anlage der Ehrsucht wurde damals noch unterdrückt von den schönen Illusionen der Jugend, von der Glut, die ihn die edeln Mittel zu suchen antrieb, die ja ruhmbegierige Männer vor allen anderen anwenden. Er hatte nur erst mit seinen Wünschen und noch nicht mit den Widerwärtigkeiten des Lebens zu kämpfen, mit seiner eigenen Macht und noch nicht mit der Erbärmlichkeit der Menschen, die für schwankende Geister ein so verhängnisvolles Beispiel ist. Lebhaft verführt von seinem blendenden Geist, bewunderte David Lucien, ohne sich über die Irrtümer im unklaren zu sein, in die ihn das französische Ungestüm versetzte. Dieser schlichte Mann hatte einen schüchternen Charakter, der im Widerspruch stand zu seiner kräftigen Konstitution, aber es fehlte ihm nicht an der Festigkeit nördlicher Menschen. Wenn er auch Schwierigkeiten sah, nahm er sich doch vor, sie zu überwinden, ohne zu wanken, und wenn ihm die Festigkeit einer wahrhaft apostolischen Tugend eignete, milderte er sie durch die sanfte Anmut einer unerschöpflichen Nachsicht. In dieser schon nicht mehr jungen Freundschaft liebte einer von beiden wahrhaft vergötternd, und das war David. Und so kommandierte Lucien wie eine Frau, die sich geliebt weiß. David gehorchte mit Vergnügen. Die körperliche Schönheit seines Freundes gab diesem für David eine Überlegenheit, unter die er sich beugte; sich selbst fand er schwerfällig und gewöhnlich.
»Dem Ochsen das geduldige Pflügen, dem Vogel das freie Leben«, sagte sich der Drucker. »Ich werde der Ochse sein, Lucien der Adler!«
Seit ungefähr drei Jahren hatten so die beiden Freunde ihr Schicksal, dessen Zukunft sich so glänzend gestalten sollte, vereinigt. Sie lasen die großen Werke, die seit dem Friedensschluß auf literarischem und wissenschaftlichem Gebiete erschienen waren, die Werke von Schiller, Goethe, Lord Byron, Walter Scott, Jean Paul, Berzelius, Davy, Cuvier, Lamartine usw. Sie wärmten sich an diesen großen Feuern, sie versuchten sich selbst an Werken, die mißglückten oder die angefangen, aufgegeben und glühend wieder aufgenommen wurden. Sie arbeiteten unaufhörlich, ohne die unerschöpflichen Kräfte der Jugend zu ermüden. Beide gleich arm, aber von der Liebe zur Kunst und Wissenschaft verzehrt, vergaßen sie ihr gegenwärtiges Elend und beschäftigten sich damit, die Grundlagen ihres künftigen Ruhms zu legen.
»Lucien, weißt du, was ich eben von Paris bekommen habe?« fragte der Drucker und zog einen kleinen Duodezband aus seiner Tasche. »Höre!«
David las, wie die Dichter zu lesen verstehen, die Idylle von André de Chénier vor, die den Namen »Neère« führt, dann den »Jungen Kranken« und schließlich die Elegie über den Selbstmord die erste in antiken Metren und die beiden andern in Jamben.
»Das ist also Andrè de Chénier!« rief Lucien wiederholt aus. »Es ist zum Verzweifeln«, wiederholte er zum drittenmal, als David, der zu erregt war, um weiterzulesen, ihm den Band überließ.
»Ein Dichter, den ein Dichter wieder entdeckt hat!« sagte er beim Anblick der Unterschrift unter der Vorrede.
»Als Chénier«, fing David wieder an, »diesen Band fertig hatte, hielt er ihn für unwert, veröffentlicht zu werden.«
Lucien seinerseits las das epische Stück »Der Blinde« und mehrere Elegien. Als er zu dem Fragment kam: »Wenn sie glücklos sind, wo ist dann Glück auf Erden –« ließ er das Buch sinken, und die beiden Freunde weinten, denn beide waren leidenschaftlich verliebt. Wie von der Berührung einer Fee waren die Weinranken erglüht, die alten, rissigen, zerbeulten, kreuz und quer von häßlichen Sprüngen durchzogenen Mauern des Hauses waren wie mit Säulen, Gewölbbogen, Basreliefs und unzähligen Meisterwerken einer unbekannten Architektur geziert. Die Phantasie hatte ihre Blumen und ihre Rubine auf den kleinen dunklen Hof geschüttet. Die Kamilla André de Chéniers war für David seine angebetete Eva geworden und für Lucien eine große Dame, der er den Hof machte. In ihrem feierlich wallenden Sternengewand war die Poesie durch die Werkstatt geschritten, wo die Affen und die Bären mit ihren Grimassen hin und her huschten. Es schlug fünf Uhr, aber die beiden Freunde verspürten weder Hunger noch Durst; das Leben war ihnen ein goldener Traum, alle Schätze der Erde lagen zu ihren Füßen. Sie gewahrten ein blaues Stückchen Himmel, wie es die Hoffnung denen zeigt, deren Leben schwer und stürmisch ist und denen ihre Sirenenstimme zuruft: »Eilet, flieget, durch dieses Stückchen Silber oder Azur sollt ihr dem Elend entgehen.« In diesem Augenblick öffnete ein Lehrling namens Cérizet, ein Pariser Junge, den David hatte nach Angoulême kommen lassen, die kleine Glastür, die von der Werkstatt in den Hof führte, und zeigte die beiden Freunde einem Unbekannten, der grüßend näher trat.
»Hier habe ich«, sagte er zu David und zog ein umfangreiches Heft aus der Tasche, »eine Denkschrift, die ich drucken lassen möchte. Möchten Sie kalkulieren, was sie kosten wird.«
»Ich bedaure,« antwortete David, ohne das Heft anzusehen, »wir drucken keine so umfangreichen Manuskripte, Sie müssen sich an die Herren Cointet wenden.«
»Wir haben aber doch eine sehr hübsche Schrift, die sich eignen könnte«, fiel Lucien ein und nahm das Manuskript in die Hand. »Sie müßten die Freundlichkeit haben, morgen wiederzukommen und uns Ihr Werk zur Berechnung der Druckkosten hier zu lassen.«
»Habe ich nicht mit Herrn Lucien Chardon die Ehre?«
»Jawohl«, antwortete der Faktor. »Ich bin glücklich,« sagte der Schriftsteller, »einen jungen Dichter kennen zu lernen, dem eine so schöne Zukunft bevorsteht. Ich bin von Frau von Bargeton geschickt.«