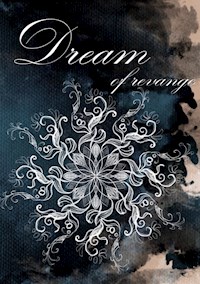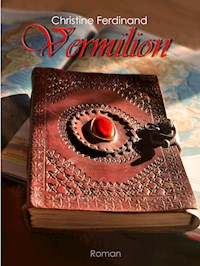
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charlie muss nach einem schlimmen Schicksalsschlag alleine ihr Leben bestreiten. Als sie gerade dabei ist wieder nach vorne zu blicken, kreuzt jemand ihren neuen Weg und stellt erneut alles auf den Kopf. Ob sie auch dieses mal die Kraft hat nach vorne zu blicken?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vermilion
TitelseiteImpressumVermilion
von
Christine Ferdinand
Cover made byAnna Renken
Es ist nicht nur irgendeine Farbe...
...es ist die Farbe, die mein Leben verändern würde.
Obwohl es Ende Juni war, regnete es bereits den ganzen Tag. Ich saß in meinem Zimmer und schaute aus dem Fenster. Die tief hängenden Regenwolken verdunkelten den Himmel. Lautlos strich ich mir eine Strähne von meinen dunklen schulterlangen Haare hinter das Ohr, welches kraftlos nach unten fiel. Ebenso kraftlos wie ich mich bereits seit Wochen fühlte. Wie aus dem nichts überkam mich ein kalter Schauer auf der gesamten Haut. Ruckartig zog ich meine Beine an, umschlang sie mit meinen Armen und legte den Kopf auf die Knie. „Es regnet hier viel zu oft“, flüsterte ich leise durch meine kaum geöffneten Lippen. „In Kanada ist das Wetter sicherlich besser“, sprach ich leise weiter. Mehr und mehr Gedanken verstrickten sich im inneren meines Kopfes. Insgeheim war mir bewusste, das ich hier zu Hause nur schlechtes suchte, um mir die Reise nach Kanada schönzureden. Wobei es sich hierbei nicht nur um eine einfache Reise handelte. Ich war dabei meine Zelte hier in Frankfurt komplett abzubrechen und nach Kanada zu meinem Onkel auszuwandern. Roy, der Bruder meiner Mutter, die ebenfalls ursprünglich aus Kanada stammte, wohnte noch dort. Ich wurde als Kind selbst zweisprachig aufgezogen, sodass dieses kein Hindernis für mich war. Und doch gab es für diesen Schritt, einen ganz besonderen Grund. Kaum einen Monat war vergangen, das ich meine Eltern bei einem Verkehrsunfall verloren habe. Beide waren in einem Taxi von einem Theaterabend auf dem Weg nach Hause, bis der schreckliche Unfall passierte. Seit ich einen festen Job als Friseurin gefunden hatte, begannen meine Eltern des Öfteren sich Zeit für sich zu nehmen. Sie begannen wieder ein Leben als Paar und nicht nur als Eltern von der einzigen Tochter zu sein. „Natürlich ist das okay!“, rief ich meiner Mutter entgegen und rollte mit den Augen. Ich stand mit verschränkten Armen gegen den Türrahmen gelehnt und führte eine Unterhaltung, wie sie so oft in letzter Zeit vorkamen. Mom trat aus dem Badezimmer. Sie hatte ein Knielanges enges schwarzes Kleid an, das ihre in dem Alter noch immer sehr gute Figur, bestens betone. „Das wäre jetzt aber schon das vierte Wochenende in folge. Bist du sicher, dass wir dich nicht zu sehr alleine lassen?“, hakte sie mit Sorge in der Stimme nach. „Nein Mom“, bestätigte ich erneut und sah ihr dabei direkt in die Augen. „Ihr wart jahrelang für mich da. Es ist okay das ihr auch das vierte oder fünft oder zwanzigste Wochenende in Folge ausgeht“, sagte ich und schenkte ihr ein aufrichtiges Lächeln. Mom kam auf mich zu und drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Dann wischte sie, ganz die Mutter in ihr, ihren leichten Lippenstift Abdruck von meiner Stirn. „Habt viel Spaß“, sagte ich zuletzt zu ihr. Sie ging die Treppe runter, wo mein Vater bereits wartete. Ihm hatte ich nur von weitem viel Spaß gewünscht. Hätte ich gewusst das dies die letzte Gelegenheit gewesen war ihn zu sehen, zu fühlen und mit ihm zu sprechen, hätte ich das ganz anders gemacht. Hätte ich gewusst, das dieser Abend, der letzte wäre, hätte ich meine Mutter nicht dazu getrieben wegzugehen. Mitten in der Nacht klingelte es an der Tür. Es war kurz nach zwölf. Ich lag mit meinem Zeichenbuch in meinem Bett und fertigte ein Bild zu Ende. Mit hochgezogenen Brauen stieg ich aus dem Bett und öffnete die Tür. Hatten meine Eltern etwa ihren Schlüssel vergessen? Als ich jedoch die Türklinke berührte, wusste ich allerdings das der nächste Moment mein Leben von Grund auf ändern würde. „Frau Berger?“, sagte eine Polizistin, die neben mir auf der Couch saß. Wir haben ihre Freundin angerufen. Sie wird gleich hier sein. Ich nickte nur. Verschwommen durch meinen dicken Tränenschleier vor den Augen, sah ich zu ihr rüber. Mein Leben wurde soeben von einer auf der anderen Sekunde zerstört. Das eine zwanzigjährige junge Frau allerdings noch nicht bereit war, ohne den Rückhalt ihrer Eltern auf eigenen Beinen zu stehen, konnte sicherlich jeder nachvollziehen. Ich war noch nicht bereit ohne die täglichen Nachrichten meiner Mutter, dem automatischen und doch immer erst gemeinten Satz ‚Fahr vorsichtig!’, von meinem Vater oder dem Licht, welches immer auf der Veranda brannte, wenn ich nach Hause kam, auszukommen. Mit weiteren bitteren Tränen der Trauer verbrachte ich noch viele weitere Tage. Eine warme Träne schlich sich still über meine Wange. Erst als sie mein Kinn erreichte und der feuchte Weg der Träne auszukühlen begann, bemerkte ich es. Die Tränen, das Weinen, die körperlichen Schmerzen sind weniger geworden. Doch innerlich zerriss es mich noch immer. Würde es je vergehen? Alle sagen einen, dass die Zeit alle Wunden heilen würde. Wie viel Zeit jedoch so eine tiefe Wunde benötigte, konnte mir keiner beantworten. Ruckartig stand ich auf und zog tief Luft ein. Ohne darüber nachzudenken, durchquerte ich mit zügigen Schritten mein Zimmer und lief die Treppe runter. Die Familienfotos an der Wand, die mahagonifarbene Dekoration, welche hier überall verteilt war, flog nur so an mir vorbei, ohne etwas davon zu beachten. Am Fuße der Treppe blieb ich stehen. Alles um mich herum war so still. Auch wenn meine Eltern um diese Zeit unter normalen Umständen sowieso gearbeitet hätte, war es jetzt eine andere Stille. Eine Stille, die mein Leben nie wieder so füllen würde, wie es einmal gewesen war. Das einzige, welches dieses Haus erneut zum Leben erwecken würde, wäre eine neue Familie. Ein neuer Besitzer für das was meine Eltern mir hinterlassen hatten. Als ich meiner besten Freundin Nicole von dieser Idee erzählte, konnte sie es nicht fassen, das ich wirklich mein Elternhaus verkaufen wollte. Das Gespräch lag mir noch jetzt in den Ohren. „Aber was, wenn du es bereust? Wie kannst du dir da jetzt so sicher sein?“, Nicoles Hundeblick wirkte leidend. Sie fühlte mit mir. Zwar konnte sie sich nur ein kleines bisschen vorstellen, wie es in mir aussah, konnte sie diesen Schritt von mir nicht verstehen. Wir saßen in meinem Zimmer auf dem Bett. Auch wenn niemand sonst im Haus war, war es für uns selbstverständlich in meinem Zimmer zu sitzen. Als Nicole wieder und wieder an mein Herz appellierte, hob ich den Kopf und schenkte ihr ein ehrliches Lächeln. „Ja, ich bin mir sicher“, sagte ich deutlich und mit fester Stimme. „Dieses Haus ist zwar mein Elternhaus und wird es auch immer sein, aber wenn ich daran denke das meine Eltern nie wieder durch die Tür kommen, dann krieg ich keine Luft mehr“, bei den Worten umfasste ich mit der rechen Hand meinen Hals. Auch der Anflug von einem Lächeln war aus meinem Gesicht vollkommen verschwunden. Nicole atmete tief aus. „Auch wenn ich das nur ansatzweise nachvollziehen kann, denke ich, dass ich dich verstehe“, sagte sie, schluckte und kämpfte mit den Tränen. Es berührte mich sehr, zu sehen wie nah auch ihr das ging. „Und“, sprach Nicole weiter, „wenn du noch Hilfe brauchst, dann versuch ich dir so gut es geht zu helfen. Egal was es ist.“ Ohne Nicole die Chance zu geben weiter zu sprechen, zog ich sie in den Arm und genoss das Gefühl aufgefangen zu werden. Neben meinen Eltern war es nur Nicole die das schaffte. Und genau sie, mein letzter Strohhalm hier vor Ort, würde ich nach der Auswanderung für eine lange Zeit nicht wieder sehen. Ich würde für eine lange Zeit alleine sein. Vorsichtig umklammerten meine Hände das Glas Wasser, welches unberührt vor mir auf der Küchenplatte stand. Unberührt ging ich wieder nach oben. Es war, als wäre ich nicht erst nach meiner Abreise allein und verloren, sondern bereits jetzt. Dieses Gefühl war dunkel, wirkte grau und irgendwie schwer. Meine Mutter sagte bereits, als ich noch ein Kind war, dass ich eine ganz besondere Gabe hätte. Natürlich würde jede Mutter sofort unterschreiben das ihre Kinder alle etwas Besonderes seien, aber bei mir war es anders. Ich kann Dinge nicht nur in Farben sehen, sondern auch in Farben fühlen. In vielen Augen mag das verrückt klingen, doch zum Beispiel dieses Gefühl vom alleine sein, war für mich wie ein sehr dunkles Grau. Ich lag mit verschränkten Armen auf meinem Bett und schaute an die weiße Decke. Mit lauter solchen Gedanken um mein Leben, die Vergangenheit, die Zukunft und dem Bild meiner Mutter vor Augen, schlief ich irgendwann erschöpft ein. Die Sonne schien sanft auf meine Haut und erwärmte die ausgekühlten Stellen. Wie fast jeden Morgen erwachte ich ohne jeglichen Elan. Doch heute war es anders. Als mir klar wurde, was heute für ein Tag war, durchfuhr mich ein Schub von Energie, wie ich es beinahe nicht mehr kannte. Denn heute war der Tag, an dem ich meine Heimat auf unbestimmte Zeit verlassen würde. Niemand würde heute mehr vorbeikommen. Ich wollte den letzten Weg alleine antreten. Nicht einmal Nicole wollte ich jetzt in meiner Nähe haben. Mir war klar, dass ich sonst nicht mehr die Tränen an mich halten könnte. Bereits gestern Vormittag hatte ich alles in die Wege geleitet und Nicole den Schlüssel und sämtliche Papiere vom Haus übergeben. Es würden die nächsten Tage noch ein paar Interessenten für das Haus vorbeikommen. Ein Makler war ebenfalls instruiert und steuerte alles weitere, was dem Verkauf anging. Nicole sollte lediglich für die Unterlagen vor Ort zur Verfügung stehen. Ein letzter tiefer Atemzug. Ich stand im Badezimmer vor dem Spiegel. Im Eiltempo putze ich mir die Zähne und zog mich an. Die Koffer standen bereits unten. Um neun Uhr kam Nicoles Vater Hektor und würde mich zum Flughafen bringen. Mein Blick blieb am kleinen Badezimmerwecker hängen. Es war zwanzig vor acht. Erschreckend stellte ich fest, dass die Panik, mit der ich gerechnet hatte, ausblieb. Mein Puls war ruhig. Fast als würde ein ganz normaler Tag anfangen und nicht der Tag der Tage. Auch die Wimperntusche blieb, wo sie war. Keine Tränen standen in den Startlöchern. Es war, als würde ich momentan nichts fühlen. Als wäre ich von meinen Gefühlen auf null gesetzt. Wie ein Roboter der gerade einfach nur funktionierte. Beinah wie tot. Sollte sich tatsächlich auch so die restliche Zeit von meinem neuen Leben anfühlen? Die Türklingel läutete. Hektor war da. Ich ließ das Geräusch ein letztes mal auf mich wirkten. Wenn man wusste, das alles was man gerade macht, das letzte mal war, bekam es eine ganz andere Bedeutung. Monoton zog ich meine Jacke über, ging zur Tür und öffnete diese. Hektor lächelte mich an. Ich erwiderte es kurz. Hektor nahm die Koffer entgegen und verstaute sie im Wagen. Ein letztes mal schloss ich die Tür hinter mir, ohne sie je wieder zu öffnen. Der Flughafen in Frankfurt war, wie jeden Tag, ziemlich voll. Hektor ließ mich am Seitenstreifen raus. Ohne Worte nahm er mich kurz in die Arme. Eine Stille und doch emotionale Verabschiedung. In seinen Augen spürte ich, dass auch Nicoles Familie mich vermissen würde. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, nahm meine Koffer und drehte Hektor den Rücken zu. Auf dem Weg in die Eingangshalle sah ich, das es kurz vor zehn Uhr war. Der Flug nach Kanada ging erst um elf Uhr. Also gab es noch genug Zeit, um sich keine Sorgen zu machen, das ich den Flieger nicht kriegen würde. Nach über einer Stunde warten, gab ich endlich meine Koffer auf und wurde weitergeleitet zu den Sicherheitskontrollen. In dem Abschnitt des Wartebereiches war es fast genauso voll wie vorne im Flughafen, doch alles war wesentlich kleiner und somit enger. Diese Enge wirkte für mich grün. Es war zu grün, zu grell, einfach zu eng. Ich suchte mir eine hintere Ecke und wartete, bis mein Bereich aufgerufen wurde. Um meine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, zog ich aus meiner Handtasche ein ledernes Buch. Vorsichtig schnürte ich die Lederschnüre auf und öffnete den dicken Umband. Zaghaft, um die anderen Seiten nicht zu zerknicken, suchte ich nach einer leeren Seite. Als ich diese gefunden hatte, zog ich einen Stift aus dem Halfter in der Mitte und verlor mich voll und ganz in eine Zeichnung. Am Anfang war es mir nie bewusst was ich zeichnen würde. Es floss einfach so aus meinen Fingern. Was ich aber ganz genau wusste, das mir die Welt der Skizzen half, um aus dieser Welt mit dem grellen Grün, zu entfliehen. Müde öffnete ich meine Augen. Ich rieb mir mit den Handflächen über das Gesicht, damit mein Blick klarer wurde. Langsam richtete ich mich auf und schaute auf die kleine Uhr auf dem Monitor vor mir. Überraschend stellte ich fest, dass die Flugzeit lediglich noch etwas über eine Stunde betrug. Ich hatte fast den ganzen Flug über geschlafen. Es war mir gar nicht bewusst, wie müde ich gewesen war. Bis jetzt. Gezielt öffnete ich den Anschnaller und stand auf. „Entschuldigung, darf ich mal durch?“, fragte ich mit rauer Stimme den älteren Mann der neben mir saß. Dieser Mann trug einen Anzug und wirkte viel zu elegant für so einen langen Flug. Nachdenklich wartete ich auf eine Reaktion von dem Mann. Er sah von seiner Zeitschrift zu mir auf und verschaffte sofort etwas Platz. Ich ging an ihm vorbei und lief auf direkten weg zur Toilette. Eine Flugbegleiterin im schicken dunkelblauen Kostüm, kam mir entgegen. Sie schenkte mir ein Lächeln, welches ich direkt erwiderte. Ein warmes Gefühl durchfuhr mich. Erleichtert stellte ich fest, dass mir bereits hier über den Wolken den nötigen Abstand gelang, zu der Hölle, die hinter ihr lag.
Die Landung verlief problemlos. Ich war ausgeruht und hellwach. Viele Passagiere kramten hektisch nacheinander die Koffer aus ihren Handgepäckfächern und strömten zum Ausgang. Ich hatte es nicht so eilig. Denn mein Onkel Roy würde mit seiner Frau Donna sicherlich auf sie warten. Es bestand also keine Eile, um Bus oder Bahn zu bekommen. Wackelig, von dem vielen sitzen und dem schauckeligen Gleichgewicht im Flugzeug, stand ich schließlich ebenfalls auf und bahnte mir meinen Weg. Der lange schlauchartige Gang in die Flughafenhalle schloss mich ein. Mit Tunnelblick lief ich bis zum Ende weiter. Ein leises Grummeln stellte sich ein, welches mich ein wenig aus ihrem Bann riss. Auch wenn es früher Vormittag war, herrschte hier allem Anschein nach, viel andrang. „Charlie!“, rief jemand. Ich hob den Kopf und sah Onkel Roy wie er direkt vorne am Anfang des Ausgangs stand. Die Tonart seiner Stimme war mir noch sehr bekannt. Nach dem Unfall meiner Eltern war bereits wenige Tage später die Beerdigung. Onkel Roy war sofort angereist und eine Woche bei mir geblieben. Er war mit mir, der einzige der am Ende unserer Familie übrig blieb. Roy und meine Mutter waren die einzigen Kinder. Roy selbst hatte keine Kinder. Nur Donna, seine jetzige Frau, hatte ein Kind aus erster Ehe. Und dann war da noch ich. Ebenfalls alleine und ohne Geschwister. Nachdem Roy ein paar Tage die Situation in Frankfurt beobachtete hatte und sah, wie schlecht es mir ging, bot er an zu ihm zu kommen. Und genau dieser Einladung bin ich nach kurzer Überlegung gefolgt. „Erweisen wir diesen wunderbaren Menschen nun die letzte Ehre“, beendete der Pastor seine Rede. Jemand legte einen Arm um mich. „Charlie?“, Roy stand neben mir. Ich sah zu ihm auf. Die Tränen waren bereits verschwunden und auch der Gedanke das meine Eltern nie wieder kommen würde, wollte ich einfach nicht wahrhaben. So gut es ging verdrängte ich alles, was mich daran erinnern würde. Genau wie diese Beerdigung. Wie eine Maschine nahm ich die Rose, welche ich in meinen Händen hielt und warf sie in ein tiefes Loch. In diesem Loch waren zwei Särge zu sehen. Doch es berührte mich nicht. Mein Kopf oder auch mein Herz hatten noch nicht verstanden, das die Menschen in den Särgen tatsächlich meine Eltern waren. Ich machte einen Schritt an die Seite, als Roy es mir gleich tat und ebenfalls eine Rose in das Loch warf. Er hingegen weinte. Die Tränen, die immer erneut nachliefen, waren von seinem Taschentuch kaum aufzufangen. Gemeinsam liefen wir schließlich zum Auto und fuhren nach Hause. Roy und ich standen in der Küche. Er bereitete uns einen Tee zu. Anteilslos stand ich neben ihm. Mir war nicht klar, wann ich endlich erwachen würde aus diesem Alptraum. Wann es mir endlich wieder besser gehen würde, etwas fühlen würde. Und wann meine Eltern endlich wieder nach Hause kommen. Das Telefon klingelte. Roy und auch ich hatten keine Motivation ran zu gehen. Bis der Anrufbeantworter ansprang. Wie ein Glockenspiel hallte die lächelnde Stimme meiner Mutter durch die Stille. Mir wurde die Luft zum Atmen genommen. Umso mehr sie sprach, schnürte es mir die Kehle zu. Mir fiel der Becher aus der Hand und zerschellte mit einem lauten Knall in tausend Teile über den Küchenboden. „Sie“, stotterte ich und suchte Roys Blick. Er sah auf komische Art und Weise erleichtert aus, das ich so reagierte. „Nie wieder“, schluchzte ich schließlich, als die Tränen die Kontrolle übernahmen. „Nein“, flüsterte Roy, der ebenfalls bereits zu weinen begann. Der Schmerz in meiner Brust zog sich hoch zu meinem Hals, wo es zu explodieren begann. Ich schluchzte so laut, dass meine Stimme versagte. Ein Zittern übersäte meinen gesamten Körper als ich bemerkte das dies kein Traum, sondern die bittere Realität war. „Roy“, entgegnete ich erfreut, lief um die Absperrung herum und fiel ihm in die Arme. Roy war groß, sehr schlank, hatte dunkle kurze Haare und einen Schnauzer. Wir lösten uns ein wenig und sahen uns in die Augen. Zwar stockte mir immer wieder der Atem, denn Roy hatte dieselben Augen wie meine Mutter, fing genau dieses Merkmal mich schließlich mehr als alles andere auf. Innerlich fühlte ich mich angekommen, mehr zu Hause als ich es die letzten Wochen gefühlt hatte. Ich war angekommen. Roy drückte mich noch etwas weiter von sich weg. In seinen Augen zeichneten sich Tränen ab, die kaum zu übersehen waren. Auch ich spürte, dass die Dämme fast erneut bereit waren zu brechen. Bis Donna mich in die Arme zog. Das kam so unerwartet, dass ich ein wenig zusammen zog. Donna und ich hatten uns das letzte mal vor zehn Jahren getroffen. Der Geburtstag meiner Oma, die zwei Jahre darauf ebenfalls verstarb. „Hallo Charlie“, flüsterte Donna ihr ins Ohr. Mittlerweile war ich ziemlich genauso groß wie Donna. Auch die Statue passte bis auf wenige Unterschiede. „Wie geht es dir? Es tut mir so leid“, sagte Donna und schaute mir in die Augen. Ein sanftes nicken sollte vorerst alle Fragen beantworten. Zu mehr war ich im Moment nicht bereit. Schließlich war ich hier um mit der Vergangenheit abzuschießen und nicht erneut darüber zu sprechen. „Wollen wir dann los?“, fragte Roy der mit noch immer leicht feuchten Augen uns herab sah. Geschickt, und so das es nur wenige Leute bemerkten, steckte er das heimlich hervorgeholte Taschentuch in seine Jeans. Donna und ich nickten gleichzeitig. Roy schnappte sich meinen Koffer. Gemeinsam sammelten wir das weitere Gepäck vom Band ein und gingen zum Auto. Roy parkte den Wagen auf einer Einfahrt von einem unglaublich gemütlichem Haus. Wir waren in einer kleinen Wohnsiedlung gelandet, die im nächst größeren Dort von Abbotsford lag. Gemeinsam stiegen wir aus. Ich folgte Donna auf dem Weg zum Haus. Sie schloss die Tür auf, als ich hinter ihr in das Haus trat. „Willkommen!“, rief sie glücklich und versuchte locker zu klingen. Ohne ein Wort zu erwidern, sah ich mich staunend um. Das Haus wirkte von innen viel größer als von außen. Direkt vor mir, hinter Donna, führte eine breite Treppe ins Obergeschoss. Rechts war eine große helle Küche zu erkennen. Mein Blick schweifte weiter auf die linke Seite, wo ein großer Essbereich den Raum füllte. Ein massiver dunkler Tisch mit passenden Stühlen im vintage Stil stand dort. Das Braun des Tisches mischte sich perfekt mit dem dunklen Geländer der Treppe, den Akzenten an den Türrahmen und weiteren kleinen Details, die überall wiederzufinden waren. „Komm“, sprach Roy, stellte meinen Koffer ab und schloss die Tür hinter sich. Ich schloss meinen mittlerweile weit geöffneten Mund und sah auf zu Roy. „Du wirst oben dein Reich haben. Donna und ich haben alle so umgeräumt das wir uns nur die Küche teilen müssen. Aber mit der Zeit können wir dir sicher auch Oben die Gelegenheit dazu geben“, erklärte Roy. Noch immer sagte ich kein Wort. Mir war die Stimme verloren gegangen, als hätte ich diese im Flugzeug vergessen. „Ich hoffe, das ist okay für dich?“, setzte Roy fragend nach. Auf seiner Stirn machten sich Sorgenfalten breit. Umgehend schüttelte ich den Kopf und riss mich selbst aus der Starre. „Nein. Es ist alles gut. Mehr als das. Ich. Also es ist nur“, ich wusste nicht wie ich die Eindrücke und die Dankbarkeit, die welche ich tief in mir spürte, zum Ausdruck bringen sollte. Schließlich sprach ich nicht weiter, sondern ließ die Tasche fallen und sprang förmlich in Roys Arme. Kurz darauf lag ich auch Donna um den Hals. Das Eis war gebrochen. Nicht nur mit Donna oder Roy, sondern auch mit dem Haus. Mein neues Zuhause. Instinktiv wusste ich, dass ich hier glücklich werden würde. Ich saß auf meinem Bett in meinem neuen Schlafzimmer. Es war ein helles freundliches Zimmer. Nicht zu groß und nicht zu klein. Mit einem großzügigen Bett, einem Kleiderschrank und einem Schreibtisch. Auch hier zog sich das wunderschöne dunkle Braun aus dem unteren Wohnbereich, durch die Möbel. Die Wände hingegen waren weiß. Wahrscheinlich wollten sich Donna und Roy nicht auf irgendeine Farbe festlegen. Und dafür war ich ihnen dankbar. Dank dieser klaren Auswahl bleib Platz für meine innere Farbe. Auf Samtpfoten schlich ich mich aus dem Zimmer und kam in den oberen Flur. Rechts von mir befand sich eine Kammer. Zwar wusste ich nicht, was ich dort hineinlegen sollte, war ich einfach froh über weiteren Platz. Ein Stück weiter auf der linken Seite war die Tür zum Badezimmer. Geradeaus am Ende des Flures lag mein Wohnzimmer. Tatsächlich war es für mich hier wie eine kleine eigene Wohnung. Und das wir uns die Küche teilen mussten, war ich überhaupt nicht böse drum. Es war praktisch wie in einer WG. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht stand ich in meinem neuen Wohnzimmer. Auch hier war, ganz getreu dem Charakter des Hauses, alles mit braunen Akzenten versehen. Eine Couch stand inmitten des Raumes, gegenüber von einem Flachbild TV. Sogar ein paar Pflanzen waren auf einer Kommode und im Raum verteilt. Donna, die das alles mit Sicherheit gemacht hatte, traf total Charlies Geschmack. Überwältigt und überschwemmt vom Adrenalin, welches noch durch meine Adern strömte, liefen für ein paar Sekunden doch die heißen Tränen über meine vor Hitze geröteten Wangen. Still genoss ich, dass ich angekommen war. Nachdem ich alle Eindrücke weitestgehend verarbeitet hatte, beschloss ich meine Koffer auszuräumen. Als alles ausgeräumt war, nahm ich Stimmen von unten wahr. Ohne zu zögern, lief ich über die große Treppe nach unten. Dort bleib ich am Fußende der Treppe stehen und schaute rüber zu Donna und Roy, die in der Küche standen. „Hallo“, begrüßten sie mich freundlich. „Konntest du alles finden?“, fragte Donna nach. Ich nickt kurz und trat in die Küche ein. Donna zeigte auf das ich mich setzten sollte. „Charlie“, sprach Roy, der noch schnell einen großen Schluck aus seinem Kaffeebecher nahm. „Wir wollten gleich noch ein wenig einkaufen. Möchtest du das wir dir die Gegend zeigen und wo du das wichtigste finden kannst?“ Wie ein Blitz durchfuhr mich erneut dieser Energieschub. Der erste Tag in meiner neuen Heimat konnte nicht besser ausklingen. Das ausgeströmte und vor Freude durch die Adern pumpende Adrenalin, verschaffte mir einen kleinen Höhenrausch. „Sehr gerne!“, antwortete ich euphorisch. „Ich zieh mir schnell noch etwas passendes an“, sagte ich und verschwand erneut nach oben. Kaum zehn Minuten später saßen wir alle in Roys Auto. Es war ein großer Geländewagen. Ich nahm die Geräumigkeit positiv entgegen und ließ mich in die großen Sitze sinken, die mich förmlich einschlossen. Ohne es zu merken vielen mir plötzlich die Augen zu. „Charlie?“, jemand rüttelte an meiner Schulter. Ich zuckte zusammen und erwachte erschrocken aus einem traumlosen Schlaf. Roy stand mit weit geöffneter Tür vor mir. „Sollen wir lieber wieder nach Hause fahren?“, bot er mir an. „Nein“, protestierte ich und richtete mich auf. Schnell rieb ich mir die Augen und stieg an Roy vorbei aus dem Auto aus. „Es ist schon gut. Hab gar nicht gemerkt das ich geschlafen habe“, sagte ich überrascht von mir selbst und schenkte ihm ein Lächeln, in der Hoffnung das er sich von seinen Rückzugsplänen ablenken ließ. „Okay, wenn du das sagst. Dann lass uns los“, grinste Roy mir entgegen und warf die Autotür hinter sich zu. Zu Dritt liefen wir durch die Straßen der Innenstadt. Ich kam aus dem Staunen kaum noch raus. In Frankfurt war alles so groß. Die Häuser die City. Zwar waren außerhalb auf dem Dort auch kleiner Häuser, doch mit so einer Zusammengehörigkeit wie es hier der Fall war, verschlug es mir abermals die Sprache. „Roy“, begann Donna zu sprechen. „Ich muss gleich noch eben bei Ally anhalten und mir einen Termin holen“, sagte Donna mit erhobenen Finger. „Ally?“, fragte ich in Donnas Richtung. „Achso, also Ally ist meine Friseurin. Ich muss dringen wieder hin und die Silberstreifen verschwinden lassen“, sie zwinkerte mir unauffällig zu, während Roy zur gleichen Zeit mit den Augen rollte. „Mein Schatz, du bist und bleibst unverwechselbar schön. Auch wenn du dir nicht diese Chemie in die Haare machst“, erklärte er rührend. Donna tat einen Schritt zur Seite und rückte ein Stück weiter an Roy heran. Unauffällig ließ sie, ohne seine Antwort zu kommentieren, ihre Hand in seine gleiten. Verlegen schaute ich kurz zur Seite. Gemeinsam liefen wir weiter durch die Straßen, als ich mein Wort an Donna richtete. „Also wenn du willst, kann ich dir das auch machen. Ich bin ebenfalls Friseurin“, bot ich mich an. Es war für mich selbstverständlich bei dem was die beiden alles bereits für mich gemacht hatten. Ich überlegte kurz warum Roy ihr das nicht erzählt hatte. Wobei so etwas für Männer eh einen ganz anderen Stellenwert hatte, als für Frauen. „Oh wirklich?!“, sagte Donna erfreut. Ihre Augen strahlten auf. Doch plötzlich ändere sich ihre Mimik. Ein unwohles Gefühl machte sich in meine Magengegend breit. War ich doch etwas zu weit gegangen? Schließlich wollte ich mich nicht noch mehr in Donna und Roys leben setzten, als es sowieso bereits der Fall war. „Ich glaube, ich habe eine noch bessere Idee“, ergänzte Donna ihre Gedanken. Wie auf Kommando blieben alle drei stehen. Donna sah mir direkt in die Augen. „Was hältst du davon, wenn ich dich zu Ally mitnehme? Vielleicht kannst du bei ihr einen Job finden. Schließlich bist du ja auch etwas länger hier“, erklärte sie. Mit dieser Antwort hätte ich nicht gerechnet und nickte nur zustimmend. Freudig setzten wir unseren Einkaufsbummel fort. Die Gedanken um die letzten vierundzwanzig Stunden, sowie dem fast Job Angebot, begann mein Körper Warnsignal aufkommen zu lassen. Konnte ich wirklich so viel Glück auf einmal haben? Der nächste Gedanke war, wann dieses Kartenhaus nur zusammenfallen würde?
Am frühen Abend waren wir in einem großen Einkaufszentrum angekommen. Hier bekam man über Kleidung, Duschartikel, Bücher und noch vielen anderen Sachen einfach alles was man irgendwie gebrauchen konnte. Ein Geschäft reihte sich an das andere. Selbst der Weg vom Parkplatz in das Center dauerte gefühlte zehn Minuten. Doch das war es Wert, versprach mir Onkel Roy und er sollte recht behalten. Ein Geschäft mit einer Atelierpuppe sowie einem Menschen großen Torso weckte meine Aufmerksamkeit. Es war, als würde der Laden für mich in einem silbrigen Glanz erstrahlen, welches natürlich nur ich sehen konnte. „Roy, ich würde dort gerne mal hereingehen“, erklärte ich nahezu hypnotisiert und zeigte mit dem Finger in die Richtung. Wir saßen gerade in einem kleinen Kaffee und ruhten unsere müden Beine aus. Ich hingegen hatte nur Augen für dieses Geschäft. Als würde ich versuchen durch die Wände zu schauen, zog es sie mehr und mehr an. „Natürlich“, sagte Roy. „Wir warten hier. Lass dir ruhig Zeit.“ Wie selbstverständlich legte er seine Hand auf die von Donna. Diese kleinen Gesten waren für die beiden wahrscheinlich etwas völlig normales, für mich aber hieß es beschützt und gut aufgehoben zu sein. Mit einem kribbeln in den Fingern und den Füßen, stand ich umgehen auf, schnappte mir meine Tasche und machte mich auf den Weg zu dem Geschäft. Es war in etwa fünfzig Meter entfernt. Mit dem Blick gezielt auf den einen Laden gerichtet, bahnte ich mir den Weg durch die mir entgegen strömenden Menschenmassen. Plötzlich und wie aus dem nichts bemerkte ich erst, dass mich jemand anrempelte, als ich so gerade noch das Gleichgewicht zurückerlangen konnte. Meine Tasche viel dabei zu Boden. Diese Aktion riss mich aus meiner Trance. Ein Mann, etwas älter als ich und mit Brille auf der Nase, entschuldigte sich wieder und wieder bei mir. „Oh, es tut mir wirklich leid. Bitte entschuldigen Sie“, wiederholte er. „Ist schon okay“, antwortete und wollte gerade meine Tasche hochheben, als diese mir bereits von einem anderen Mann vor die Nase gehalten wurde. „Madam“, sagte er mit einer Stimme die mir, bis ins Mark ging. Mein Blick lag sofort auf diesen anderen Mann. Er war ein kleines Stück größer als ich, hatte kurze dunkle Haare und ein markantes Kinn. Seine Augen wirkten offen und doch geheimnisvoll. Nervös presste ich meine Lippen aufeinander. Schnell erlangte ich die Fassung zurück und nahm meine Tasche entgegen. „Danke“, sagte ich kühl. Ich wand meinen Blick ab und wollte gerade meinen Weg fortsetzten, als mir eine Stimme hinterherrief. „Entschuldigung“, ertönte es hinter mir. Ich blieb stehen und drehte mich in die Richtung, aus der sie kam. Der Mann von eben, mit dem markanten Kinn, stand vor mir. „Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber sie sind eine sehr attraktive Frau und das bedeutet sie müssen unbedingt heute Abend mit mir etwas essen gehen“, sagte er mir so einer Ernsthaftigkeit, das ich sprachlos vor Dreistigkeit mit verschränkte Armen vor der Brust dastand. „Ich glaube für die Anforderungen, die du stellst bin ich Überqualifiziert“, antwortete ich wie mit einem rechten Hacken, das der Mund des Mannes stumm offen stehen blieb. Ich lächelte triumphierend und drehte auf dem Absatz um. „Moment“, rief der Mann noch weiter und tippte mich an der Schulter um mich zu stoppen. Genervt drehte ich mich ein weiteres mal um. „Lass mich bitte in Ruhe. Mit deinen plumpen Sprüchen kannst du dir die Highschool Mädchen schnappen die hier herumlaufen“, zischte ich. Im Gewissen das dieses eine eindeutige Aussage war, ganz davon abgesehen das ich keine Lust auf irgendwelche Konversationen mit dem unbekannten Mann hatte, setzte ich meinen Weg endlich ohne weitere Störungen fort.