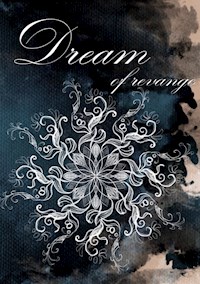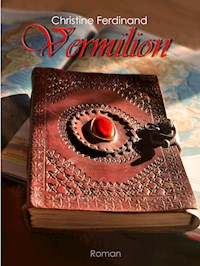Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Amanda ist mit Leib und Seele Physiotherapeutin. Derzeit durchlebt sie allerdings eine sehr schwere Zeit. Sie muss privat viele Verluste und Schicksale ertragen. Als plötzlich Alex in ihr Leben tritt, weiß sie nicht, wie ihr geschieht. Er ist einer der Oberärzte im angrenzenden Krankenhaus. Wie sollen sie miteinander umgehen, wenn doch die Gefühle und Vernunft auf beiden Seiten ständig die Richtung ändern? Eine Reise ins ungewisse und mit vielen Hindernissen wartet auf die beiden. Werden sie am Ende das gleiche Ziel erreichen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 1
Mein Magen zog sich bereits zusammen, als ich aus dem Aufzug in den fünften Stock stieg. Wie in Trance lief ich den langen schlauchartigen Gang entlang. Die Wände waren weiß, wirkten in meinen Augen jedoch fast grau. Das unnatürlich grelle Licht, welches von der Decke schien, ließ den Flur hier auch nicht heller erscheinen. Wie ein Stein, der sich auf meine Brust legte, war die Stimmung wie immer erdrückend. Auch wenn ich diesen Weg schon sehr oft entlanggegangen war, erfüllte es mich innerlich von einem Unwohlsein, wie man es kaum beschreiben konnte. Dieses Gefühl war für mich mittlerweile zum Alltag geworden.
„Guten Morgen Amanda“, sagte die kurz gewachsene Krankenschwester. Sie saß in ihrem kleinen Glaskasten und schaute freundlich über ihre Lesebrille hinweg zu mir auf. Ihr leichtes Lächeln wirkte warm und fürsorglich. Ähnlich wie bei einer gutherzigen Großmutter.
„Guten Morgen Rose. Wie war die Nacht?“, fragte ich mit zittriger Stimme nach. Trotz großer Sorge und Angst im Herzen, diese Worte überhaupt auszusprechen, wagte ich es dennoch zu fragen. Kaum ausgesprochen, ergriff meine rechte Hand automatisch den Kragen meiner dicken Jacke und zog ihn eng vor meiner Brust zusammen.
„Ruhig“, antwortete Rose darauf kurz und knapp. Gleichzeitig versetzte sie ihrem warmen Lächeln mehr Nachdruck. Ich strich mir erleichtert eine dunkle lange Haarlocke hinters Ohr, wohl konzentriert damit nicht noch mehr die Fassung zu verlieren. Rose stand auf, kam aus ihrem abgeschirmten Bereich heraus, legte tröstend kurz ihre Hand auf meinen Oberarm und verschwand. Zu Anfang sagte sie noch so etwas wie: ‚Das wird schon wieder’ oder ‚Besser es passiert nichts, als das etwas Schlechtes passiert’. Nach jedoch mittlerweile über fünf Wochen dieses Zustands, wusste selbst sie als Krankenschwester mit über dreißig Jahren Erfahrung, nicht mehr was sie noch sagen sollte. Auch ich wusste nicht, wieso ich jeden Tag der Hoffnung eine neue Chance gab. In mir herrschte schon länger ein innerlicher Kampf. Ich wusste nicht, was besser wäre. Ich konnte und wollte mich einfach nicht für eine Seite entscheiden. An weniger guten Tagen wollte ich, dass die Hoffnung erlosch und ich endlich mit der ganzen Sache abschließen konnte. Doch dann erhob sich irgendwo in mir wieder der Funken, dass solange keine Verschlechterungen eintraten, alles wieder gut werden würde. Was war allerdings heute für ein Tag? Ich wusste nicht, wohin mich meine Gefühle trieben. Wie zwischen zwei Welten riss es mich bitterlich hin und her. Immer wieder mit der Mühe nicht zerrissen zu werden.
Einen Moment lang, nachdem Rose schon lange weg war, stand ich einfach noch so da. Ein kalter Schauer legte sich über meinen gesamten Körper und rüttelte mich wach. Ich bündelte meine restlichen Kräfte. Langsam hob ich meinen Kopf ein wenig an. Wie jeden Morgen vor der Arbeit bestritt ich auch heute das letzte Stück von diesem grausamen Weg. Ohne es zu fühlen, trugen mich meine Beine weiter durch diesen kalten grauen Gang.
„Drei gelbe Tulpen“, nuschelte ich.
Eins, zwei, drei, vier Schritte.
„Acht orangefarbene Rosen“, formten meine Lippen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf Schritte.
„Ein verwischter Busch Lavendel.“
Dort blieb ich kurz stehen. Ein kleines Stück weiter um die Ecke, dann wäre ich an meinem quälenden Ziel angekommen.
„Vier, fünf, sechs“, sagte ich noch immer leise zu mir selbst und ging um die Ecke herum.
Eine große graue Tür stoppte mich. Es war mehr eine Schleuse. Sie versperrte mir den Weg. Wie gewohnt drückte ich die Klingel und wurde eingelassen. Automatisch desinfizierte ich mir die Hände, nahm ein Gummiband aus meiner Tasche und knotete mir meine Haare zu einem festen Zopf nach hinten. Mit Kittel und Mundschutz ging es durch die nächste Tür. Was dann passierte, realisierte ich meistens erst, wenn ich wieder draußen war.
In einem kühlen Raum, ohne jeglichen Charme, lag er vor mir.
Mein Vater. Er war an diversen Geräten angeschlossen. Ein Schlauch im Rachen zwang ihn dazu weiter zu atmen. Seine Haut aschfahl und blass wie gepudert. Die braunen, leicht grau melierten Haare, waren ein Stück länger als er sie sonst getragen hatte. Sie waren ordentlich zurechtgelegt. Ruhig lag er da und bewegte sich nicht. Und das seit über fünf Wochen. Damals hatte mein Dad einen schweren Autounfall und lag seither im Koma. Seine Hirnfunktionen hatten noch nicht aufgehört, deswegen gaben ihn die Ärzte natürlich nicht auf. Doch ich wusste, das mein Vater dies so nicht gewollte hätte. Er wollte nicht wie ein Stück menschliches Fleisch am Leben erhalten werden. Das waren immer seine Worte, wenn es mal zwischen uns zu diesem Thema kam. Mit seinen neunundvierzig Jahren jedoch, hatte er nie darüber nachgedacht ein Testament oder eine Patientenverfügung zu unterschreiben.
Bei dem Gedanken wie offen, ehrlich und herzlich mein Dad und ich immer miteinander waren, wurde mir abermals bitterkalt. Auch das ich meine Jacke ablegen musste trug natürlich dazu bei. Ich schlug die Hände vor dem Körper zusammen, um mich irgendwie ein wenig zu wärmen. Zeitgleich drehte sich mir der Magen. Der Geruch hier drin war selbst durch den Mundschutz für mich nur schwer zu ertragen. Zwar kannte ich mich mit Desinfektionsmittel aus, schließlich benötigte ich in meinem Beruf als Physiotherapeutin auch solche Materialien, war das hier anders. Es war nicht nur desinfiziert, sondern steril und klinisch rein. War dieser Zustand für diese Station hier allerdings normal, konnte ich nicht anders als mir das würgen zu unterdrücken.
Schnell sah ich auf meine silberne Armbanduhr. Es war schon zwanzig nach neun. Ich musste los, wenn ich noch pünktlich auf der Arbeit sein wollte.
Bevor ich den Raum verließ, streckte ich meine Finger aus und strich vorsichtig über den Handrücken meines Vaters. Er fühlte sich warm und weich an. Fast als würde ich lediglich im Schlaf seine Hand halten. Das Gefühl der Übelkeit verstärkte sich.
Schnell drehte ich mich um und verließ das Zimmer ohne auch nur ein Wort gesagt zu haben. Schuldbewusst stellte ich fest, dass ich, genau das die ganzen Wochen noch nicht gekonnt hatte. Mit meinem Dad sprechen. Doch was sollte ich ihm sagen? Er konnte doch nicht antworten. Und die Fragen, welche offen im Raum standen, würden sowieso nicht beantwortet werden.
Wobei es genau das war, was ich wissen wollte. Wie war das alles passiert? Warum war er die Nebenstraße gefahren, anstatt wie gewohnt die Schnellstraße zu benutzten? Ich brauchte Antworten, die mir einfach keiner geben konnte. Deswegen sprach ich auch nicht darüber. Kein Wort, mit niemanden und vor allem nicht mit meinem Dad. Die Schwestern sagten immer wieder, er würde mich schon hören, egal worüber ich sprach.
Doch an so etwas konnte ich persönlich nicht glauben. Ich rätselte, ob die Einstellung und Erziehung von meinem Vater mich so hat denken lassen. Schließlich war er der einzige für mich. Meine Mutter starb, als ich noch ein Baby war. Mir war es nicht möglich sich an sie zu erinnern. Auch wenn ich wollte, schenkten mir die Fotos von ihr keine Erinnerungen.
Geschwister hatte ich ebenfalls nicht. Mein Dad war einfach alles, was ich hatte. Was würde nur aus mir werden, wenn er mir auch noch genommen würde?
Ich stand bereits wieder in meiner Daunenjacke verpackt vor der Schleuse. Oft erwischte ich mich, wie automatisiert das alles hier für mich bereits ablief. Mir fehlten manchmal die Erinnerung an den Momenten, in denen ich mich zum Beispiel wieder umgezogen hatte. Doch damit befasste ich mich nicht länger und schob auch das zur Seite. Es gab wichtigeres über das ich mir Gedanken machen musste. Bewusst hob ich den Kopf, zog tief die mir bekannte Luft ein. Zwar auch reinlich, aber nicht so ekelerregend steril. Ein weiterer schneller Blick auf die Uhr zeigte mir, dass es bereits fünf nach halb zehn war. Jetzt musste ich mich wirklich ranhalten. Denn bevor ich die Arbeit aufsuchte, gab es eine Art Ritual. Dieses Ritual gab mir die Möglichkeit wenigstens für ein paar Minuten frei zu sein. Frei von den zerreißenden Gedanken um meinen Vater oder was wirklich wäre, wenn er nicht mehr da sei. Vierundzwanzig Jahre war allein er für mich da. Situationen wie meine schwere Teenagerzeit, die Kindheit, die erste zerbrochene Liebe und all diese Abschnitte meines Lebens, hatte er mit mir durchgestanden. Das sollte jetzt das Ende sein? Nur wegen solch einem Vollidioten, der betrunken über die Straße lief? Mein Vater musste ausweichen und war gegen einen Baum gefahren.
So schnell sollte tatsächlich alles vorbei sein?
Mir fielen die Augen zu. Den anstehenden Tränen wollte ich nicht die kleinste Chance geben heraus zu laufen. Ich schluckte den Schmerz herunter. Mit einem rutsch zog ich mir das Gummi aus den Haaren. Die schweren Locken vielen mir über die Schulter und umhüllten mich wie eine Art Schutz. So schnell es daraufhin ging, sauste ich um die Ecke. Plötzlich wurde ich unangenehm von etwas gestoppt. Das letzte was ich sah, war ein weißer Kittel, den ich mit so viel Wucht anrempelte, dass ich rücklings auf dem Hintern landete. Noch von den Gefühlen von eben übermannt, hätte ich wie ein kleines Kind losweinen können. Der Mann, mit dem ich zusammen gestoßen war reagierte sofort.
„Oh Verzeihung. Das tut mir leid. Ist ihnen was passiert?“, fragte er fürsorglich nach. Er beugte sich zu mir herunter. Ich saß noch immer benommen vor ihm auf dem Boden.
„N-nein“, stotterte ich und sortierte die Strähnen, welche mir ins Gesicht ragten. Erst als ich wenig später wieder alles klar erkennen konnte und auch die kindlichen Tränen beiseitegeschoben hatte, betrachtete ich den Mann vor mir. Er trug einen weißen Kittel. Wahrscheinlich war er einer der Ärzte.
Seine dunkelblonden Haare waren etwas länger und saßen absolut akkurat. Leichte Wellen und tolles Volumen zeichnete sich ab. Es war schlichtweg: Perfekt. Keine Ahnung wieso mir das gerade jetzt so genau auffiel. Auf mehr konnte ich mich im Augenblick jedoch nicht konzentrieren. Denn ich saß immer noch direkt vor ihm auf dem Boden. Sein Blick wirkte besorgt und voller Schuldgefühle. Was allerdings noch deutlicher hervorstach, war das klare Blau seiner Augen. Als hätte jemand mit einem Pinsel dieses wunderschöne Blau in die Augen dieses Mannes gemalt.
„Wirklich alles okay?“, fragte er mit dunkler Stimme erneut nach und holte mich ins hier und jetzt zurück. Der klang seiner Stimme, hallte tief in meinem Bauch nach. Ich beendete den Blickkontakt und bemerkte, peinlich berührt, dass ich noch immer auf dem Boden vor ihm saß. Mir schlug das Herz bis zum Hals und wurde immer schneller. Sofort rappelte ich mich auf. Der Mann streckte mir eine Hand entgegen, die ich aber zu spät wahrnahm. Er stütze mich helfend am Ellbogen, was ich durch meine dicke Jacke nicht wirklich spürte.
„Geht es ihnen gut?“, bohrte er ein letztes Mal nach. Auch wenn ich diesen Mann vor mir erst wenige Bruchteile kannte, sah ich ihm an, das dieses hier eine rein professionelle Frage war. Der Arzt in ihm war immer auf das Wohl der anderen bedacht.
„Ja“, sagte ich kaum hörbar. Meine Beine setzten sich in Bewegung. Zügig huschte ich an ihm vorbei, ohne auch nur einen Blick zurückzuwerfen.
Hastig, fast rennend, durchquerte ich die Flure und langen Gänge. Ein erneuter Blick auf die Uhr verriet mir, dass es jetzt für irgendwelche anderen Aufenthalte auf jeden Fall zu spät war.
Ich musste direkt zur Arbeit. Die Praxis, in der ich arbeitete, befand sich im anderen Gebäudeflügel von diesem Krankenhaus.
Umgehend machte ich mich direkt auf den Weg dorthin.
Kapitel 2
Leicht außer Atem betrat ich die Praxis. Ein kontrollierter Blick auf die Uhr zeigte, dass ich auf die Minute genau pünktlich war. Ich lief weiter.
„Hallo Amy“, strahlte Angela mir entgegen. Sie saß mit einem Becher Kaffee in der Hand in dem kleinen Aufenthaltsraum der Praxis. Ihr kurzes dunkles Haar stand zu allen Seiten hin ab. Sie war vielleicht Mitte / Ende dreißig, benahm sich aber gerne wie eine anfangs-zwanzig jährige. Zwar war sie immer nett, liebte sie es jedoch über alles und jeden zu Tratschen, was mir persönlich gar nicht so stand. Die Neugier war ihr bereits wieder ins Gesicht geschrieben. Ihre kleine spitze Nase ragte dann immer ein wenig mehr in die Luft als es normalerweise der Fall war.
„Morgen“, flüsterte ich lediglich kurz und zog mir schnell das weiße Praxishemd über.
„Und?“, war die nächste kurze Frage. Ihre Stimme war leiser als sonst. Auch bei unangenehmen Themen wollte sie sofort alles wissen. Genau wie in diesem Fall fragte sie regelmäßig nach dem Zustand meines Vaters. Ob das jetzt wirklich nur die Neugier war oder sie es einfach nur nett meinte, konnte ich kaum unterscheiden. Vom Prinzip her war es mir sogar egal.
Ich zuckte nur mit den Schultern. Wie seit fast fünf Wochen schon jeden Morgen.
„Er wird schon wieder Amy“, waren die regelmäßigen Worte, die sie sprach, um mich aufzubauen. Ich wollte fest daran glauben, dass sie es nur gut meinte, ignorierte diese Antwort jedoch.
Nicht erneut wollte ich wieder in den Strudel der Schmerzen heruntergezogen werden.
Ganz in Gedanken ging auf einmal die Tür auf und unser Chef Mr. Carlson kam herein. Mr. Carlson trug keinen Kittel, dafür eine weiße Hose und ein weißes Hemd mit seinen Initialen eingestickt. Sein Bauch hatte schon den Ansatz einer kleinen Kugel, doch er war zu eitel dieses zuzugeben. Mr. Carlson hatte keine Haare mehr auf dem Kopf, dafür einen buschigen Bart.
Wenn er nicht mein Chef wäre, könnte ich glatt über ihn lachen.
„Guten Morgen die Damen“, sagte er mit tiefer brummiger Stimme.
„Guten Morgen“, sagten Angela und ich fast im Chor.
„Heute sind die jährlichen Blutspendeaktionen vom Krankenhaus dran. Ich hoffe sie haben beide heute Morgen gut gefrühstückt?“, lachte mein Chef auf und rieb sich leicht die Hände. Sein Blick wanderte von Angela zu mir und wieder zurück.
Geschickt und mit dem Bewusstsein, das ich noch nichts zu mir genommen hatte, lächelte ich verlegen. Natürlich war das von meinem Chef nur eine rhetorische Frage, denn es war ihm egal, wie es uns ging. Hauptsache wir kamen pünktlich zur Arbeit und taten das, was er wollte. Das zeigte mir deutlich die Situation mit meinem Vater. Mr. Carlson konnte mir keinen Urlaub oder unbezahlt freigeben, weil wir hemmungslos unterbesetzt waren.
Persönlich konnte er meine Situation natürlich durchaus verstehen, aber auch ich musste ihn verstehen, denn schließlich hing seine Existenz und die von Angela und mir mit dran.
Gewiss war dies emotionale Manipulation, doch er hatte recht.
Wir waren alle auf den Job angewiesen, deswegen konnte ich nicht so einfach fehlen. Und was würde es meinem Vater bringen, wenn ich zu Hause sitzen würde und mir meinen Kopf über ihn zerbrach? Die Arbeit lenkte mich einfach noch ein Stück weit ab und hält mich weites gehend in der Realität.
„Dann wollen wir mal los“, ermutigte uns Mr. Carlson und klatschte motivierend die Handflächen aneinander.
Angela, Mr. Carlson und ich liefen bestimmt zehn Minuten durch Gänge, die aussahen wie ein Ei dem anderen. Überall war es weiß, grau sowie hier und da ein bisschen Orange zu sehen.
Das war die offizielle Farbe des Krankenhauses und durfte natürlich nicht fehlen. Am Ziel angekommen, durchquerten wir eine letzte große automatische Tür, bis wir endlich bei der Blutspende ankamen. Es war ein großer Raum und dennoch standen wir am Rande einer großen Menschenmenge. Und selbst hinter uns kamen noch welche nach. Obwohl jedem ein Termin und ein Zeitraum zugeordnet wurde, wirkte es total überfüllt.
Automatisch umfassten meine Arme meinen Oberkörper.
Angela bemerkte meine Reaktion.
„Und, Angst?“, fragte sie nach und stieß mich mit ihrem Ellbogen in die Seite. Da ich erst seit vier Monaten in diesem Krankenhaus am Arbeiten war, hatte ich so eine Aktion noch nicht mitgemacht. Mein vorheriger Arbeitgeber hatte eine private Praxis, dort gab es so etwas überhaupt nicht. Deswegen war mir auch im Moment die ganze Situation ein wenig Unbehagen.
Angela, die noch immer mit ihrer neugierigen Nase zu mir aufschaute und auf eine Antwort wartete, lächelte mich frech an.
Ich schüttelte schnell und angestrengt den Kopf. Ich wollte ihr nichts über meine Gefühle preisgeben. Zudem konnte ich so viele Menschen auf einen Haufen grundsätzlich nicht leiden. Am liebsten wäre ich alleine. So viel und so oft es ging, einfach nur alleine. Meine Gedanken schweiften ab. Alleine – hallte es in meinem Kopf nach. Das war vor wenigen Wochen noch anders gewesen. Nur zu gerne war ich weggegangen und hatte mich mit Freunden getroffen. Es gab sogar einen festen Freund in meinem Leben. Er hieß Greg und war Polizist. Mit ihm war es jedoch eine Woche nach dem Unfall meines Vaters vorbei. Er kam mit meiner Veränderung nicht klar. Mein Rückzug in mein schützendes Schneckenhaus war für ihn emotional nicht zu ertragen, so erklärte er sich den Schlussstrich. Angela hatte ich das noch gar nicht erzählt. Wenn so ein Thema auf den Tisch kam, zog ich mich nur zu gerne einfach zurück. Da konnte Angela noch so sehr nachbohren, ich ließ dann niemanden an mich ran. Mehr und mehr dieser Gedanken der Vergangenheit flogen in meinem Kopf herum. Kraftlos und Schutzlos ausgeliefert, ließ ich jeden dieser Erinnerungen einfach zu.
Gefühlte Ewigkeiten später waren wir endlich dran. Angela erzählte in der Zwischenzeit von dies und jenem. Gedanken abwesend hörte ich zu. Sie bemerkte nicht, dass ich nicht ganz mit dem Kopf bei der Sache war. Im Großen und Ganzen erzählte sie sowieso nur von ihren Katzen oder dass sie ein neues Waschmittel ausprobiert hatte. So sehr ich sie auch als Arbeitskollegin schätzte, musste ich privat nicht wirklich was mit ihr zu tun haben. Das zeigte mir auch der heutige Tag aufs Neue. Und doch war ich froh, dass ich dieses hier nicht alleine durchstehen musste. Wieder so ein Zwiespalt meiner Gefühle.
Nach einer weiteren Aufteilung der Menschenmassen betraten wir gemeinsam einen nächsten überschaubaren Raum. Hier saßen mehrere Ärzte und Schwestern, die bereit waren, an unser Blut zu kommen.
Ich folgte Angela, ohne wirklich zu wissen, wo ich hinmusste. Mein Blick ging nach links und rechts. Bis ich schließlich an dem Gesicht von einer direkt vor mir wartenden Schwester hängen blieb. Sie war noch sehr jung. Noch jünger als ich. Vielleicht gerade zwanzig.
„Hallo“, sagte sie freundlich und lud mich somit ein sich weiter mit ihr zu Unterhalten. Ihre Stimme klang kleinlaut und zierlich.
Es passte zu ihrem äußeren Erscheinungsbild.
„Hi“, entgegnete ich kurz.
„Ihr Name und Abteilung?“, fragte sie leicht aufgewühlt und zog eine Mappe mit diversen Blättern hervor
„Amanda Rogers aus dem Physiozentrum, Abteilung zwölf.“
Ein kurzes Lächeln und schnell suchte die junge Schwester vor mir in der Liste nach meinem Namen.
„Ah, da sind sie ja. Dann können wir ja so anfangen“, sagte sie irgendwie erleichtert, dass mit dem Formellen wenigstens alles stimmen würde.
Sie wies mich an, mich vor ihr auf den kleinen Stuhl zu setzen, was ich auch tat. Wie üblich krempelte ich meinen Ärmel hoch. Sofort fing sie an meinen Arm abzubinden. Dann desinfizierte sie die Stelle und nahm eine Nadel. Die junge Schwester sah hoch konzentriert aus. Auf ihrem Schild stand lediglich „Schwester Mandy“. Wie oft Mandy das wohl schon gemacht hatte? Verträumt und so dumm wie ich war, beobachtete ich letztendlich alles genau und schaute mir jeden Schritt an, den sie machte. Obwohl ich wusste, dass ich kein Blut sehen konnte, sah ich ganz in Gedanken zu, wie sie wieder und wieder versuchte die Kanüle zu setzen. Auch wenn kein Blut floss, wurde mir anders. Sie fand noch immer keine Vene und gab schließlich nach etlichen Versuchen auf. Hilflos sah sie sich um. Bis sie den Blick fixierte. Jemand kam zu uns rüber.
„Gibt es ein Problem?“, fragte ein Mann, welcher hinter mir stand. Ich schickte ein Stoßgebet Richtung Himmel. Mir war egal, wer mir jetzt noch eine Nadel in den Arm steckte, ich wollte nur, dass es schnell vorbeiging.
„Ja, Dr. Bennett. Ich finde die Vene nicht“, gab Mandy kleinlaut zu. Sie fühlte sich nicht gut dabei, wahrscheinlich vor einem ihrer Chefs, so dazustehen.
Der Mann hinter mir lachte leise auf. Es klang jedoch in meinen Ohren nicht abwertend, sondern irgendwie aufmunternd. Er ging um mich herum und schaute sich meinen Arm an. Bewusst sah ich sofort auf die andere Seite, um nicht doch noch Blut zu sehen.
„Versuchen sie es das nächste Mal weiter unten“, sagte er freundlich und erklärte Mandy alles mit einer angenehmen Ruhe und Gelassenheit. Die Hände des Arztes drückten sanft auf meinen Arm. Durch die Handschuhe hindurch spürte ich die Wärme, die dankbar auf meinen kalten Arm überging.
„Ich werde das übernehmen“, beschloss er schließlich.
„Ja Sir“, erwiderte Mandy ein wenig verstört und machte sofort platz.
Noch immer war mein Blick zur Seite gerichtet. Mein Arm wurde ein weiteres Mal desinfiziert, als sich plötzlich nichts mehr tat.
Zögernd wagte ich einen Blick auf die andere Seite. Der Mann hielt ihn fest, tat aber nichts. Ich folgte seinen Armen und landete schließlich in seinem Gesicht. Er begann zu lächeln.
„Sie sind es doch“, sagte er mit einem immer breiter werdenden Lächeln.
Zunächst wusste ich nicht, was er meinte, doch dann sah ich seine Augen. Das einmalige Blau. Der Mann vor mir war derjenige, den ich oben bei meinem Vater im Flur fast umgerannt hatte. Meine Augen weiteten sich. Sofort spürte ich, wie die Hitze in meine Wangen schoss. Ich wurde rot. Als wenn das heute Morgen nicht schon peinlich genug war, erfüllte mehr und mehr Blut meinen Kopf.
„Ich hoffe, es geht ihnen gut. Sie sehen etwas blass aus?“, erkannte der Arzt vor mir und zog die Augen ein Stück weit zusammen. Blass – dachte ich. Trotz der Hitze in meinen Wangen? So ein Mist! Jetzt machte sich das nicht zu mir genommene Frühstück doch bemerkbar.
„Doch, doch, alles gut“, log ich und begann schwerfallend zu lächeln.
Zögernd sah der Arzt wieder runter zu meinem Arm. Langsam machte er weiter. Zu meinem eigenen Schutz blickte ich jetzt nur in das konzentrierte Gesicht von Dr. Bennett vor mir.
„Ok, dann werde ich mal den Zugang legen“, erklärte er und sah kurz auf. Ein paar Strähnen vielen ihm leicht ins Gesicht.
Ich nickte zögernd und fixierte ihn weiterhin. Mit dem ersten Stich hatte Dr. Bennett gleich die Vene getroffen, schloss den Beutel an und mein Blut floss nur so hinein. Mein Blick jetzt fest auf den Beutel mit der dunklen Flüssigkeit gerichtet, holte Dr.
Bennett mich unfreiwillig in die Wirklichkeit zurück.
„Das war's schon“, sagte er ein wenig wehmütig, zog sich die Handschuhe aus und schmiss sie in einen Eimer vor sich. Ich sah ihn erneut nur an, nickte dankend, sagte jedoch nichts. Die feinen Haare in meinem Nacken stellten sich auf. Erst jetzt bemerkte ich, auch wenn man sich leicht in seinen Augen verlieren konnte, dass sein Blick so durchdringen war, dass es einen fesselte. Wenn er einen ansah, dann sah er nur denjenigen an. Fixierte sich voll und ganz auf die Person, um auch ja keine Reaktion zu verpassen. Automatisch musterte ich das perfekte Gesicht dieses Mannes weiter. Das Kinn und die Wangenknochen wirkten leicht kantig. Er hatte zwei kleine parallel sitzende Muttermale unterm Auge. Es passte alles so perfekt zusammen. Seine Haut schien makellos. Er war vielleicht gerade Anfang dreißig und doch schon so professionell.
Erst als Dr. Bennett von einem anderen Kollegen angesprochen wurde, trennten sich unsere Blicke. Er stand umgehend auf und wollte dem Kollegen gerade folgen, als er sich noch einmal zu mir zuwendete.
„Ich komme später noch mal wieder“, versprach er neben mir stehend.
Bei den Worten überkam mich ein Hitzeschwall. Was war nur los mit mir? Saß die Peinlichkeit, auf dem Boden vor ihm gelegen zu haben, noch so tief?
Erst als seine Gegenwart von mir nicht mehr zu spüren war, entspannte sich mein Körper und ich atmete stoßartig aus.
In den nächsten paar Minuten versuchte ich mich ein wenig zu entspannen. Das war aber gar nicht so einfach, bei dem ganzen Blutbeuteln, die hier herumlagen. Stur sah ich aus dem Fenster, bis mir die Augen zufielen. Den Tumult um mich herum blendete ich aus. Bewusst versuchte ich an was Schönes zu denken. Was ich allerdings nur sah, waren blaue Augen. Wunderschöne blaue Augen.
Plötzlich legte sich eine Hand auf meine Schulter. Nahezu ertappt, riss ich die Augen auf und sah mich um. Die junge Schwester Mandy stand neben mir „Sie sind fertig“, sagte sie mit einem Lächeln auf den Lippen.
Anscheinend hatte sie keinen Ärger bekommen. Auch ihre Körperhaltung zeigte mir, dass sie wesentlich entspannter war als vor dieser Aktion. Sie setzte sich auf den Hocker vor mir und zog sich Handschuhe über.
„Es tut mir leid, dass das gerade so schiefgelaufen war“, entschuldigte sie sich mit leidigem Ausdruck in den Augen.
„Kein Problem“, sagte ich lächelnd.
Sie zog den Beutel ab und verschloss ihn. Dann entfernte sie gekonnt die Nadel und klebte mir ein Pflaster auf die Stelle.
„Ist hier alles okay?“, fragte ein Mann mit dunkler warmer Stimme. Mittlerweile war mir die Stimme bekannt. Dr. Bennett musste hinter mir stehen. Das zeigte mir auch die wiederkehrende Nervosität der Schwester vor mir und ihr immer wieder aufschauender Blick.
„Ja, Dr. Bennett“, sagte die Schwester ohne Augenkontakt zu halten. An ihrer schüchternen Einstellung der Ärzte gegenüber müsste sie noch ein wenig Arbeiten. Wenn sie den Beruf länger machen wollte, müsste sie sich noch ein ganz schön dickes Fell zulegen.
„Und bei ihnen Miss Rogers?“, erkundigte sich Dr. Bennett, der mittlerweile hinter der Schwester stand. Diese packte unverzüglich den Rest zusammen und verschwand. Wir waren alleine, soweit das hier möglich war. Seine Augen sahen direkt in meine. Wieder schoss diese Hitze in meine Wangen.
„Ja“, entgegnete ich schnell und deutlich auf seine Frage. Noch im selben Atemzug stand ich auf um ihn zu zeigen das wirklich alles gut war. Wir standen dicht voreinander.
„Sehr schön. Dann“, er ließ den Satz unausgesprochen. Wieder dieser Blick. Er fesselte mich und doch wollte ich wegsehen. Es war nahezu Schmerzhaft, wenn er einen so ansah. Als würde er alles von einem aufsaugen und nur durch diesen einen Blick alles erfahren. Und ich wollte nicht das er wusste, wie es mir wirklich ging. Er wusste schon zu viel. Das ich etwas mit der Intensivstation zu tun hatte und wie durcheinander ich war, als wir zusammenstießen. Dr. Bennett war eine sehr aufmerksame Person, mit äußerst guter Menschenkenntnis. Ich wollte nicht, dass er noch mehr erfuhr. Ruckartig löste ich meinen Blick und schaute mich um, ob ich Angela irgendwo entdecken konnte.
Auch Dr. Bennett löste seine Starre.
„Ok, wenn dann bei ihnen alles soweit in Ordnung ist“, fasste er abschließend und professionell zusammen.
„Ja danke“, bestätigte ich und setzte ein freundliches Lächeln auf. Das konnte ich mittlerweile perfekt inszenieren.
Dr. Bennett drehte sich herum und machte sich auf den Weg zur Tür. Umso mehr Abstand er nahm, umso mehr spürte ich die Hitze aus meinem Körper entweichen.
„Na dann“, flüsterte ich zu mir selbst und machte mich ebenfalls auf den Weg zur Tür.
Sogleich ich mich herumgedreht hatte, hörte es überhaupt nicht mehr auf sich zu drehen. Sofort gaben meine Beine nach und ich landete hart auf den Boden.
„Dr. Bennett“, hörte ich noch jemanden mit einer schrillen Stimme rufen, als alles andere endlich ruhig wurde.
Kapitel 3
Das Rauschen in meinen Ohren ließ mir keine Ruhe. Nur zögernd bekam ich die Kontrolle über meinen Körper zurück. Das erste was ich spürte, war das ich auf etwas weichem lag. Mist – war ich wirklich Ohnmächtig geworden? Verdammt! Wie spät mochte es wohl sein? Ich musste wieder zurück zur Arbeit. Jemand umfasste mein Handgelenk, vermutlich um meinen Puls zu kontrollieren. Die Hand verschwand. Zaghaft öffnete ich meine Augen und starrte an eine grell weiße Decke. Vorsichtig sah ich mich ein wenig um. Ich befand mich in einem kleinen Raum auf einer Liege. Sonst war nichts zu sehen. Außer Dr. Bennett, der rechts neben mir saß. Er fing mich umgehen mit seinem Blick ein. Ruckartig sah ich zurück an die Decke.
„Na da sind sie ja wieder“, sagte er erleichtert.
Genau Dr. Bennett war gerade derjenige, den ich jetzt nicht an meiner Seite haben wollte. Nur kurz erwiderte ich erneut seinen Blick, sah mich dann schnell weiter im Raum um. Bei jeder neuen Begegnung mit ihm vielen mir mehr und mehr perfekte Kleinigkeiten an ihm auf.
Kontrolliert und ja nicht zu schnell, begann ich mich aufzusetzen. Dr. Bennett bemerkte, was ich vorhatte, und stand ebenfalls auf.
„Schön langsam. Sie können ruhig noch ein wenig liegen bleiben“, befahl er mir fast.
„Danke“ und diesmal war es von mir wirklich ernst gemeint.
„Aber ich muss zur Arbeit“, erklärte ich mich kurz. Mit verschränkten Armen und einem Ausdruck im Gesicht, vor dem ich mehr als Respekt hatte, stellte er sich vor mich.
„Das werden sie nicht. Ich habe schon mit ihrem Chef gesprochen und sie für den Rest des Tages arbeitsunfähig gemeldet“, war seine Antwort. Mein Körper reagierte, bevor ich darüber nachgedacht hatte.
„Was?“, entsetzt sprang ich auf. Mein Puls beschleunigte, das Pochen auf der Hinterseite meines Kopfes nahm deutlich zu. Ich wusste, dass Mr. Carlson das überhaupt nicht gutheißen würde.
Die Angst meinen Job zu verlieren trieb mir den Schweiß auf die Stirn.
Dr. Bennett, ganz der aufmerksame Arzt, reagierte sofort. Er legte mir stabilisieren die Hände auf meine Schultern und zwang mich wieder zum Sitzen. Immer noch besser als umfallen – lachte mein inneres ich auf. Von seiner schnellen Reaktion kam ein Schwung seines Duftes zu mir herüber. Eine Mischung aus kräftigem Lavendel, Vanille und doch irgendwie fruchtig. Es benebelte mich zusätzlich. Wie konnte man nur so attraktiv sein?
„Nicht das sie sich noch eine Gehirnerschütterung zugetragen haben“, wieder dieser besorgte Blick. Kleine Falten bildeten sich auf seiner Stirn. Dr. Bennett zückte daraufhin seine kleine Taschenlampe aus der Tasche und leuchtete mir damit in die Augen. Dann umfasste er meinen Kopf. Vielmehr legte er ihn in seine Hände, sodass ein weiterer Versuch wegzuschauen unmöglich war. Sanft schob er ein paar meiner langen dunklen Locken nach hinten, dass seine Hände meine Wangen direkt berührten. Die innere Wärme kam zurück und erfüllte mich vollkommen. Merkwürdigerweise konnte ich ihm in diesem Augenblick ohne Zögern direkt ansehen. Die Falten auf seiner Stirn verschwanden, sein Atem stockte, meiner setzte kurz aus.
Die vorherige Professionalität des Arztes war verschwunden.
Seine Lippen gingen auf und zu als würde er was sagen wollten. Jedoch kam kein einziger Ton hervor. Auch sein Puls erhöhte sich. Das war deutlich an der Schlagader an seinen Schläfen zu erkennen. Meine Hände krallten sich verschwitzt in den gummiartigen Bezug der Liege fest.
Was würde das hier werden? Schrie ich mir innerlich zu. Dem kurzen Zögern, verdankte ich einen klaren Moment, und zog sanft mein Gesicht ein Stück aus seinen Händen zurück. Ob ich das wollte? Ich wusste es nicht. Doch das war für ihn ebenfalls der Moment, erneut in die Realität zurückzufinden.
„Ich denke, es ist alles okay soweit“, sagte Dr. Bennett leicht brüchig, löste sich und ging ein wenig auf Abstand. Nervös stand er vor mir und suchte hilflos nach einer Ablenkung in seinen Taschen. Als er nichts fand, strich er sich durch seine dunkel blonden Haare und schenkte mir ein letztes Mal seine Aufmerksamkeit.
„Dann ruhen sie sich heute aus und wenn sie starke Kopfschmerzen bekommen oder sich übergeben müssen, suchen Sie bitte den nächsten Arzt auf“, sagte er abschließend wie aus dem Lehrbuch, drehte sich um und verschwand. Alleine saß ich da, ohne zu wissen, was gerade passiert war. Noch immer krallten sich meine Hände an der Liege fest. Fast schmerzhaft, lockerte ich bewusst alle meine Muskeln. Selbst mein Kiefer war fest zusammengebissen. Ich schüttelte ein wenig den Kopf. Wie üblich versuchte ich auch hier, die schlechten oder komischen Gedanken abzuschütteln. Es gelang ein Stück weit. Doch um tatsächlich wieder klar denken zu können, wusste ich, was mir genau jetzt helfen würde.
Langsamer als sonst lief ich durch die Gänge. Im Treppenhaus machte sich mein Aufprall bemerkbar. Jede Stufe brachte meinen Kopf mehr zum Pochen. Und da ein Fahrstuhl in den letzten zwei Stockwerken nicht fuhr, musste ich das in kauf nehmen. Endlich, die letzte Stufe, die erlösende Tür. Ich betrat die oberste Fläche und den höchsten Punkt unseres Krankenhauses. Ein eiskalter Windhauch schlug mir meine Haare ins Gesicht. Für einen Moment war ich blind, bis ich die Mähne mit einem Zopfband schnell bändigte. Ich hatte keine Jacke mit, lediglich meine Handtasche. Schützend legte ich abermals meine Arme um mich herum. Daraufhin lief ich rechts aus der Tür raus und an die hinterste Ecke des Daches. Der Ausblick haute mich immer aufs Neue um. Mir war nicht klar, wie hoch über den Dächern ich war und doch kam einen von hier alles so klein, so weit weg und unwichtig vor. Es existierten hier oben keine Gesetzte, Regeln oder Pflichten. Es mochte albern klingen, aber hier oben fühlte ich mich stark mein Leben zu meistern. Denn es war noch nicht all zu lange her, als ich mein Leben tatsächlich beenden wollte. Und so bin ich an diesen Platz gelangt. Dieser Ort hatte mir am tiefsten Punkt meines Lebens die Kraft zurückgegeben, die ich gebraucht hatte, um weiter zu machen.
Mit mir und dem Leben sowie mit dem Schicksal.
„Ach Dad“, begann ich zu sprechen. „Ich weiß nicht, warum ich hier denke, dass du mich hören kannst, aber ich glaube, ich schaff das alles nicht mehr“, flüsterte ich unter den herannahenden Tränen. Mit zittriger Stimme sprach ich weiter in das Nichts vor mir. „Mir wächst alles über den Kopf und ich weiß nicht zu wem ich gehen kann“, gestand ich offen. Zwar war mein Körper völlig ausgezehrt, mobilisierten sich die letzten traurigen Gefühle in mir. Ich setzte mich auf den Rand des Vorsprungs, schaute in die Ferne und ließ meine Gedanken schweifen. Streng genommen, war ich nicht alleine. Natürlich hatte ich noch Freunde. Schließlich hatten nicht alle Panik bekommen, wie Greg, und sind davongelaufen. Meine Mitbewohnerin Samantha, war zum Beispiel eine, die wirklich immer für mich da war. Auch wenn ich mal einen Tritt in den Hintern nötig hatte, tat sie dieses. Sie war meine beste Freundin.
Und doch hatte ich Angst, ihr über meine wahren Gefühle zu berichten. Was wenn sie mich eventuell einweisen lassen würde oder sich auch von mir ab wand?
Gute und schlechte Szenarien wie diese gingen mir noch eine ganze Weile durch den Kopf. Erst spät verließ ich meinen Rückzugsort. Ein Stück gestärkter und doch nicht so wie sonst machte ich mich für heute auf den Weg nach Hause.
Am nächsten Morgen betrat ich mit gemischten Gefühlen die Praxis. Die Nacht war fast schlaflos ausgegangen, was meine Energie am heutigen Tag auf ein neues Tief legte.
Als ich unseren Aufenthaltsraum betrat, sah ich Angela dort bereits sitzen wie sie ihren Kaffeebecher fest umklammerte. Jetzt war ich es die als Erstes etwas wissen wollte, noch bevor sie guten Morgen sagen konnte.
„Und?“, fragte ich direkt darauf los. „Ist der Chef sauer auf mich, weil ich gestern nicht mehr da war?“ Nervös und gespannt auf die Antwort zog ich mir meinen Kittel über.
„Pffff!“, machte Angela und eine komisch wirkende Geste dazu. Ich verzog fragend das Gesicht. Dann sah sie mich mit einem Blick an, den ich nicht richtig deuten konnte. Sie zögerte, mit dem was sie sagen wollte. Das hatte nichts Gutes zu bedeuten. Schließlich begann sie zu erklären.
„Wenn einer der neuen Chefärzte persönlich für dich bürgt, dass du für gestern unfähig bist zu arbeiten, dann wird unser Mr. Carlson sich hüten und auch nur einen Mucks gegen dich zu sagen Schätzchen“, sagte Angela und nahm einen großen Schluck Kaffee.
Mein Mund blieb offen stehen. Zwar verstand ich, was Angela gesagt hatte, doch das Dr. Bennett einer der Chef Ärzte sein sollte, wollte mir einfach nicht in den Kopf gehen. Er war so jung, so anders, so überhaupt nicht der Chefarzt.
„Chefarzt?“, flüsterte ich mehr zu mir.
Angela stand auf. Noch immer dieser komische Gesichtsausdruck.
„Ja, Dr. Bennett. Einer der neuen Chefärzte, die seit ein paar Monaten hier angestellt sind!“, zischte sie gereizt. Schon fast genervt nahm sie einen weiteren Schluck aus ihrem Becher.