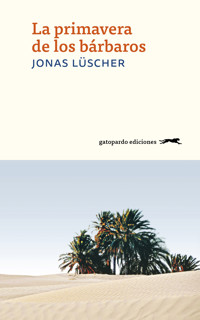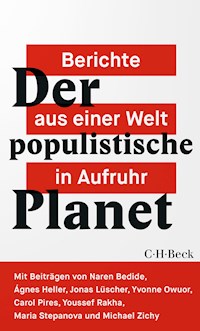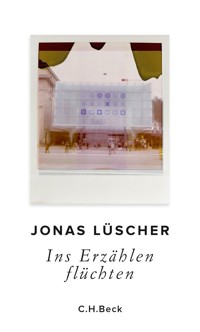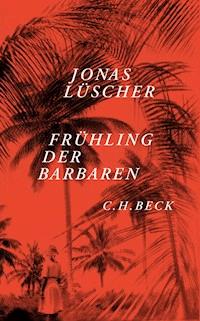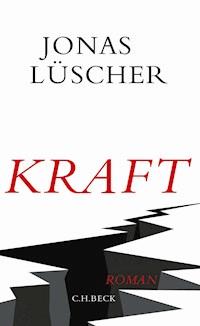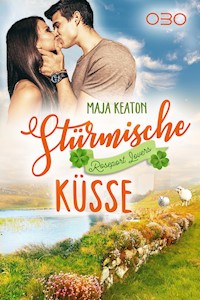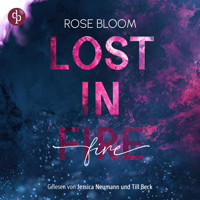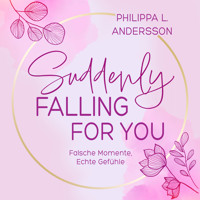Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von einer Gegenwart, die gern mehr über ihre Zukunft wüsste. Der neue Roman von Jonas Lüscher
Ein algerischer Soldat gerät in den ersten deutschen Giftgasangriff, beschließt, einer müsse damit aufhören, steht auf und geht. Im Kairo der Zukunft beobachtet eine Stand-up-Comedian eine Androidin beim Lachen über ihre Witze. Ein böhmischer Weber wird durch einen automatisierten Webstuhl ersetzt, raubt einen Hammer und attackiert den Apparat. Wovon träumen wir Menschen des Kapitalismus, wovon unsere sich zunehmend gegen uns erhebenden Maschinen? Im einzigartigen Spiegelraum dieses Romans ist kein Konflikt vorbei und noch jede Geschichte möglich. Klug und irrsinnig, komisch und scharf erzählt Jonas Lüscher auf der Höhe seiner Kunst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Ein algerischer Soldat gerät in den ersten deutschen Giftgasangriff, beschließt, einer müsse damit aufhören, steht auf und geht. Im Kairo der Zukunft beobachtet eine Stand-up-Comedian eine Androidin beim Lachen über ihre Witze. Ein böhmischer Weber wird durch einen automatisierten Webstuhl ersetzt, raubt einen Hammer und attackiert den Apparat. Wovon träumen wir Menschen des Kapitalismus, wovon unsere sich zunehmend gegen uns erhebenden Maschinen? Im einzigartigen Spiegelraum dieses Romans ist kein Konflikt vorbei und noch jede Geschichte möglich. Klug und irrsinnig, komisch und scharf erzählt Jonas Lüscher auf der Höhe seiner Kunst von einer Gegenwart, die gern mehr über ihre Zukunft wüsste.
Jonas Lüscher
Verzauberte Vorbestimmung
Roman | Hanser
Die Technik wird uns retten
und die Liebe auch.
PeterLicht
Unablässig stellen die Menschen einen Schirm her, der ihnen Schutz bietet, auf dessen Unterseite sie ein Firmament zeichnen und ihre Konventionen und Meinungen schreiben; der Dichter, der Künstler aber macht einen Schlitz in diesen Schirm.
Deleuze/Guattari
I. Hinter dem Adrenalin
Habe ich dir, sagte Aimé, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen, jemals von jenem Soldaten erzählt, der vor Ypern in seinem Graben kauerte, es war der 22. April, gegen Ende des ersten Kriegsjahres, die Sonne stand bereits tief am Himmel, und der sich, so vermag ich allerdings nur zu vermuten, von seinen Kameraden, die teils an den mit Sandsäcken und Flechtwerk gestützten Grabenwänden lehnten, teils ihre Köpfe vorsichtig über die Brustwehr streckten, Blick und Lauf gegen Norden gerichtet, dadurch unterschied, dass er mit seinen Gedanken bereits bei dem war, was er verloren hatte, und nicht bei dem, was er zu verlieren drohte — sein Leben, seinen Verstand, im besten Fall ein Bein, ein Arm, sein Augenlicht —, und der schon gar nicht, anders als die meisten der Männer, die mit ihm den Graben teilten, mit seinen Gedanken bei dem war, was er hatte, als da waren: Läuse am Sack und im verfilzten Haar, Flohbisse entlang beider Flanken, einen Grabenfuß, der kurz vor dem Wundbrand stand, ein Summen im Ohr, das er selbst im Lärm der sich mit einem Wimmern und Kreischen nähernden Granaten zu hören vermochte; des Weiteren waren da die Ratten, die die feuchte Grabensohle bevölkerten und ihm über die Stiefel huschten, die Toten, von denen er reichlich um sich hatte, mit zerfressenen Gesichtern, die aus hohlen Augen in den Himmel Flanderns starrten, eingearbeitet in den Schlamm der Anschüttung, mit zerrissenen Uniformröcken im Stacheldraht hängend oder ganz und gar zersprengt den aufgepflügten Boden bedeckend. Nein, sagte Aimé, an die Dinge, die er hatte, dachte er nicht, denn er war in Gedanken bei Claire, die er bereits verloren wusste, obwohl sie ihm täglich schrieb und ihn ihre Briefe mit einer Regelmäßigkeit erreichten, die unseren Soldaten in Erstaunen versetzte.
Ein Gefühl des Befremdens überkam ihn, wenn ihm die Umschläge übergeben wurden, im Schutz eines Unterstandes, zwischen Balken und Brettern und mit Sandsäcken beschwerter Dachpappe, begleitet vom Stöhnen der Verwundeten, das den Gestank nach Schweiß und Pisse, nach verwesendem Fleisch und abgebranntem Pulver durchdrang. Fremdkörper, ganz und gar unangemessen in dieser Welt, schienen ihm diese Briefe. Und unangemessen schien ihm auch der Aufwand, der betrieben wurde, um sie aus Claires Zimmer in Clermont-Ferrand, mit dem indischen Sekretär aus Mangoholz und dem Blick in die Platanen auf dem Boulevard Trudaine, siebenhundert Kilometer, mitten durch einen Krieg, nach Norden zu transportieren, wo sie ihren Empfänger nie erreichten, denn er existierte schlicht nicht mehr.
Den Jacques — nennen wir ihn der Einfachheit halber Jacques; eine Geschichte über einen Namenlosen, auch wenn es sich um einen Soldaten handelt, erzählt sich schlecht —, den Jacques also, an dessen Gesicht sich Claire, an ihrem Sekretär sitzend, der einmal ihrem Onkel, einem französischen Textilhandelskaufmann in Pondichéry, gehört hatte, zu erinnern versuchte, diesen Jacques gab es nicht mehr. Er hatte sich allmählich vermischt mit einem neuen Jacques, und es hatte Tage gegeben, an denen keiner der beiden wusste, wer er war, der eine nicht mehr, der andere noch nicht, bis sich der alte ganz im neuen aufzulösen begann und Jacques sich eines Nachts verwundert auf den Waffenrock klopfte, feststellte, dass er nun ein Anderer war, daran dachte, dass er Claire diesen bemerkenswerten Vorgang sofort in einem Brief schildern musste, und im selben Moment begriff, dass er sie verloren hatte. Daran gab es keinen Zweifel, dafür kannte er Claire gut genug.
Aimé hielt inne, schaute dem Rauch nach, der sich im Schirm der Stehlampe verfing. Vergiss diesen Jacques, sagte er, drückte den Zigarettenstummel mit übertriebener Kraft im Aschenbecher aus, als sei es möglich, zugleich mit der Glut eine Erinnerung zu ersticken, und setzte mit dem Anzünden einer nächsten Zigarette mit seiner Geschichte neu an: Vergiss Jacques, so heißt doch jeder (und vergiss Aimé, denke ich mir, so heißt doch keiner), vergiss ihn, sagte also … F. (F., Aimé, macht das wirklich einen Unterschied?), vergiss ihn und vergiss Claire und den Schreibtisch des Jesuiten aus Pondichéry, das ist doch Kitsch (und dieses Gerauche? Das ist doch auch Kitsch. Das kann ich doch bleiben lassen — als würde eine Geschichte glaubhafter, wenn man sie mit dem Geruch von Tabak imprägniert und mit bedeutungsschweren Rauchwolken dekoriert).
Habe ich dir, fuhr F. fort, jemals von jenem Soldaten erzählt — ich werde der Versuchung, ihm einen Namen zu geben, diesmal widerstehen —, der vor Ypern in seinem Graben kauerte, ein Algerier, fünfundzwanzig Jahre jung … oder alt, zu alt, hatte man in seinem südalgerischen Heimatdorf befunden, um noch eine Frau zu finden und etwas aus sich zu machen, zudem ziemlich hässlich, entstellt von den Pocken, an denen er als Kind fast gestorben wäre, mit Zähnen, die ihm bereits im Mund verfaulten, bevor ihm der schüttere Bart zu sprießen begann, aber klug genug, um zu begreifen, dass es zu Hause in Timiaouine, diesem Kaff an der Grenze zu Mali, trotz der endlosen Weite aus Sand und Stein keinen Platz für ihn gab, worauf er sich nach Oran aufmachte, nur um zu lernen, dass es trotz der Weite des Meeres, das sich vor der Stadt im Horizont verlor, auch dort keinen Platz für ihn gab.
Gelegentlich aber zumindest Arbeit. Hilfe beim Entladen eines Schiffes. Ein paar Wochen auf einer der vielen Baustellen der Stadt. Genug zum Überleben, aber nichts, was nach Zukunft roch. Ganz anders als die Geschichte, die ihm der Rekrutierungsoffizier der Armée d’Afrique erzählte, von einem Krieg in Europa, den es zu kämpfen gelte, gegen die Deutschen, die er ihm als ein sagenumwobenes Volk von Unholden beschrieb, regiert von einem zwirbelbärtigen, einfältigen Kaiser, brutal, gemein, aber gleichzeitig hasenfüßig, also kein Gegner, vor dem man sich zu fürchten brauche, weshalb auch nur mit einem kurzen Krieg zu rechnen sei und er davon ausgehen könne, spätestens zum Ende des Jahres wieder heimzukehren, als Held mit Orden auf der Brust und Sold in der Tasche.
Der junge Algerier äußerte zaghaft den Wunsch, dass er, wenn er denn schon mal drüben sei, lieber nicht zurückkäme, sondern sein Glück in Paris versuchen wolle. Auch das, gab der Offizier sich überzeugt, sei möglich. Die Nation kümmere sich um ihre Soldaten, und junge Männer wie er, Kämpfer, vom Krieg zurechtgestutzt, seien in Paris willkommen. Gerade nach einem Krieg, damit müsse man rechnen, gebe es für einen wie ihn reichlich zu tun. Das ließ ihn für einen kurzen Moment aufhorchen, denn er wusste genug vom Krieg, um zu registrieren, dass diese Bemerkung mit jener über die zu erwartende Kürze und Harmlosigkeit des Krieges im Widerspruch stand, aber er traute seiner eigenen Schlussfolgerung nicht, und statt sich nach der Tür zu drehen, bemühte er sein Gesicht um einen Ausdruck, von dem er hoffte, er vermittle seinem Gegenüber gleichermaßen entschlossenen Mut und die notwendige Demut gegenüber der Republik.
Nicht dass die schmucke Uniform, mit der man ihn zu locken versuchte, die Lederstiefel mit Wickelgamaschen, die weiße Pluderhose, der breite rote Gürtel und das hellblaue Jäckchen mit den roten Paspeln, geradezu nach Freiheit roch, aber sie roch allemal besser als seine fleckige Djellaba. Er hatte, so glaubte er zumindest, nichts zu verlieren und krakelte ein paar Kringel auf ein Dokument, dessen Inhalt ihm der Rekrutierungsoffizier generös zusammengefasst hatte, war der junge Algerier doch des Lesens nicht mächtig und der französischen Sprache nur mangelhaft kundig.
Daraufhin brachte man ihn mit ein paar anderen jungen Männern in eine Kaserne am Stadtrand von Blida, einer kleinen Garnisonstadt am Fuße des Atlas, wo man ihn für ein paar Wochen in der Kunst des Schießens unterrichtete, viel anschrie, ihm den Imperativ der französischen Wörter Attacke und Vorwärts einbläute und das Laufen neu beibrachte, obwohl er der Meinung war, dass er das eigentlich ganz gut beherrsche — eine Meinung, die, als er sie einmal zu äußern wagte, mit noch mehr Geschrei quittiert wurde, woraufhin er sich abgewöhnte, überhaupt eine zu haben. Auch in der Kaserne schien es für ihn keinen Platz zu geben; wo immer er stand, saß oder lag, gab es jemanden, der ihn aufscheuchte, wegbefahl, anrempelte, ihm mit dem Stock, wahlweise auch mit der Reitpeitsche, drohte oder ihn zwang, von da nach dort zu rennen. Am 1. August erreichte sein Bataillon die Order zur Mobilmachung, und damit galt auch seine Ausbildung als beendet.
L’enthousiasme est général, lässt sich in einem dünnen Büchlein mit dem Titel »Historique du 1er Régiment de Marche de Tirailleurs Algériens« nachlesen, und wollen wir niemanden der Geschichtsklitterung bezichtigen, so müssen wir davon ausgehen, dass die allgemeine Enthusiasmierung auch unseren Soldaten aus Timiaouine ergriffen hatte. Am 3. August des Jahres 1914 erklärte Deutschland Frankreich den Krieg, und noch selbentags machte man sich auf den Fußmarsch nach Algier, wo das Regiment am 5. Richtung Frankreich verschifft wurde, und obwohl an Bord ein arges Gedränge herrschte, hatte der Soldat, an der Reling stehend, zum ersten Mal in seinem Leben das Gefühl, am richtigen Ort zu sein — bis ihn ein französischer Offizier aufforderte, seinen Platz zu räumen und sich in den Bauch des Schiffes zu seinesgleichen zu verziehen. Dort blieb er, bis sie unter der Eskorte des Mittelmeergeschwaders Toulouse erreichten.
Mit dem Zug brachte man sie nach Norden, über Avignon nach Anor an der belgischen Grenze. Von da an mussten sie marschieren, sechzig Kilometer kamen sie weit, bis kurz vor Charleroi, wo das Schlachten und Morden begann. Es war der 22. August, immer noch im Jahr 1914, und es zahlten den Versuch, die Deutschen in die Sambre zu treiben und das Städtchen Châtelet zurückzuerobern, siebenundzwanzigtausend französische Soldaten mit ihrem Leben. Von den neunhundert Kameraden, mit denen er die feine Ausbildung in Blida empfangen und den Platz im Bauch des Schiffes geteilt hatte, überlebten nur vierhundert, von den neunzehn befehlshabenden Offizieren, ungeachtet der Stärkung durch frische Seeluft, die sie bei der Überfahrt genossen hatten, gerade deren fünf, und gleichwohl, so lässt sich in den Büchern nachlesen, seien die Moral und der Zusammenhalt intakt geblieben, trotz der schweren körperlichen Entbehrungen und der mannigfaltigsten seelischen Erschütterungen, die der übereilte Rückzug mit sich brachte, seien Ordnung und Disziplin ganz parfait gewesen, ja, es sei sogar — und hier sind wir nun vielleicht doch gut beraten, der Schilderung, wie wir sie in der »Historique du 1er Régiment de Marche de Tirailleurs Algériens« finden, mit Skepsis zu begegnen —, es sei nun sogar die Wiederaufnahme der Offensive mit Enthusiasmus begrüßt worden.
Zumindest stelle ich mir gerne vor, sagte F., dass es nach diesem 22. August und dem darauf folgenden zweiwöchigen Rückzug wenigstens bei unserem Soldaten mit dem Enthusiasmus nicht mehr weit her war. Doch ungeachtet dessen hieß es nun auch für ihn wieder attaque! und en avant!. Die folgenden Monate, fuhr F. fort, schildere ich dir nach Art der erwähnten Gedenkschrift, also extrem verdichtet, auf Daten, Flurnamen und Anzahl Toter reduziert, mit gelegentlicher Vermeldung des Pegelstandes der allgemeinen Moral. Eine Art der Berichterstattung, die mich selbst im höchsten Maße erstaunte, nachdem ich das Vorwort jenes Büchleins gelesen hatte, in welchem dem Leser ganz anderes in Aussicht gestellt wurde, zumal als Leser nicht einer wie ich, sondern toi tirailleur survivant, du, überlebender Tirailleur, angesprochen wurde, der sich durch das Lesen dieser mit dem leuchtend roten Blute seiner Waffenbrüder geschriebenen Seiten in die Lage versetzt sehe, jene furchtbaren Minuten des Kampfes, an denen er teilgenommen habe, wiederzuerleben und dabei mit Stolz zu denken: »J’étais là!« Aber damit nicht genug des Pathos, denn es wurden im Weiteren auch jene angesprochen, denen kein »Ich war da!« mehr über die kalten Lippen kam, und zwar im vertraulichsten Ton: … für dich, ja auch für dich, kleiner Tirailleur, gefallen auf dem Feld der Ehre, schreiben wir diese Zeilen, so steht es in jenem Vorwort, um die Welt von deinem heroischen Handeln in Kenntnis zu setzen. Der Rest des Büchleins dann aber eben ganz anders im Stil; eine beinahe nüchterne Auflistung — du verzeihst, wenn ich sie gelegentlich ironisch kommentiere, anders wäre sie kaum zu ertragen:
Für den September wird vermeldet. — Rückzug über Ribemont, Chavonne, Passy-sur-Marne, Montmirail, bis am 5. die Retraite, nach zweihundertfünfzig Kilometern Fußmarsch und zahllosen Scharmützeln mit den nachrückenden Deutschen, die eher einer stolpernden Flucht über aufgeworfene Äcker als einem geordneten Rückzug gleicht, in der Nähe von Provins ein Ende findet. Nun eben wieder enthusiastische Offensive. Vormarsch über Château-Thierry, Baslieux und Cauroy-lès-Hermonville. Am 15. beim Bauernhof Sainte-Marie und am 17. bei Pontavert massive Feindbegegnungen. Am 19. Überquerung der Aisne bei Maizy und Besetzung des Plateau de Paissy.
Oktober. — Das Bataillon richtet sich in den von den Deutschen gegrabenen Schützengräben auf dem Plateau ein. Ende des Monats wird es mit Zug und Lastwagen nach Belgien gebracht. Bei Luighem stoßen die Soldaten auf Gegenwehr und graben sich zweihundert Meter vor dem Dorf ein.
November. — Das Bataillon besetzt die Gräben entlang des rechten Yserufers und widersetzt sich zahlreichen feindlichen Attacken.
Dezember. — Am 10. Marsch nach Vlamertinghe zum Gehöft Langhof. Dort Angriff auf die deutschen Gräben. Trotz aufgeweichtem Gelände und verheerender Verluste durch deutsches Maschinengewehrfeuer nähern sich die algerischen Soldaten den feindlichen Linien bis auf wenige Meter und graben sich dort ein. Am 15. erobern sie Poperinghe, wo sich das Regiment reorganisiert. Am 31. verbringt man das Bataillon nach Montdidier.
Januar — Februar — März 1915. — Das Bataillon bezieht Quartier in Montdidier, ab 16. März in Abbeville, dann ab 20. März wieder in Montdidier.
April. — Per Eisenbahn zweihundert Kilometer zurück nach Belgien. Am 20. beziehen die Männer Quartier in Poperinghe, das sie im Vorjahr erobert hatten. In der Nacht vom 21. auf den 22. lösen sie im Sektor Langemark die dort stationierten Zuaven ab. Der Feind verhält sich ruhig. Der Tag verläuft friedlich.
Es kommt mir, sagte F., bei dieser Art der Schilderung immer wieder Tucholsky in den Sinn, der in denselben Krieg verwickelt war wie unser junger Algerier, allerdings in doppelter Hinsicht auf der anderen Seite, tat er doch seinen Dienst in einem deutschen Regiment an der Ostfront, von wo er seinem Freund Blaich schrieb, es hacke sich die Menschheit durch Fleisch und Blut einen Weg der Idee durch lebendige Menschen — in den Fibeln lese sich das nachher recht hübsch, man dürfe nur nicht dabei sein.
Nun, unser Soldat war dabei, und der Tag verlief friedlich, die Sonne stand bereits tief am Himmel. Er kauerte in seinem Graben und unterschied sich in nichts von seinen Kameraden, die teils an den mit Sandsäcken und Flechtwerk gestützten Grabenwänden lehnten, teils ihre Köpfe vorsichtig über die Brustwehr streckten, Blick und Lauf gegen Norden gerichtet, denn auch unser Soldat war, wie die anderen, mit seinen Gedanken bei dem, was er zu verlieren drohte — sein Leben, seinen Verstand, im besten Fall ein Bein, einen Arm, sein Augenlicht —, außerdem war er bei dem, was er hatte, als da waren: Läuse am Sack und im verfilzten Haar, Flohbisse entlang beider Flanken, einen Grabenfuß, der kurz vor dem Wundbrand stand, ein Summen im Ohr, das er selbst im Lärm der sich mit einem Wimmern und Kreischen nähernden Granaten zu hören vermochte; des Weiteren waren da die Ratten, die die feuchte Grabensohle bevölkerten und ihm über die Stiefel huschten, die Toten, von denen er reichlich um sich hatte, mit zerfressenen Gesichtern, die aus hohlen Augen in den Himmel Flanderns starrten, eingearbeitet in den Schlamm der Anschüttung, mit zerrissenen Uniformröcken im Stacheldraht hängend oder ganz und gar zersprengt den aufgepflügten Boden bedeckend. Ansonsten war es, wir haben es gehört, zumindest an jenem 22. April friedlich.
Um 18 Uhr, unser Soldat hatte gerade mit seinem Kameraden den Platz getauscht und streckte nun seinerseits vorsichtig den Kopf über die Brustwehr, tauchte über den deutschen Gräben eine bräunlich-grüne Wolke auf, an deren Rändern sich die Sonnenstrahlen brachen und eine goldgelbe Aureole erzeugten. Träge, die Nähe des Bodens suchend, wälzte sich die Wolke durch das Niemandsland heran. Eine Erscheinung, die unseren Soldaten und jene seiner Kameraden, die wie er in der Wüste aufgewachsen waren, an zu Hause erinnerte, an jenen Moment, an dem sich am Horizont aus blauem Himmel ein Sandsturm aufbaute und der einem bedeutete, dass man besser die Ziegen zusammenzutreiben hatte und sich auf den Heimweg machte. Das allgemeine Erstaunen war groß, so etwas hatte man in Flandern noch nicht gesehen. Sand konnte es nicht sein, solchen gab es hier kaum, stattdessen nur Schlamm und Dreck, festgetreten durch tausend schwere Stiefel, von keinem noch so starken Wind in den Himmel emporzuwirbeln.
Die Vorgesetzten fürchteten eine Finte der Deutschen, eine künstliche Wolke, hinter der sich der Feind anschlich. Man gab Befehl, mit aufgepflanztem Bajonett die Brustwehren zu besetzen und sich feuerbereit zu halten. Unser Tirailleur beobachtete gebannt das Schauspiel. Rechts vor ihm, etwa fünfzig Schritte entfernt, das wusste er, erstreckte sich eine ihrer vorgelagerten Sappen, ein im Zickzack in Richtung des Feindes vorangetriebener Laufgang, in dem die Späher saßen. Die Wolke, die in dichten Schlieren vorwärts kroch, schien für einen Augenblick stillzustehen. Ihm war, als ginge ein kleiner Ruck durch das Gebilde. In Bodennähe ballte sich eine kleine, wirbelnde Walze, die vornüberkippte und genau dort, wo er die Sappe vermutete, im Erdreich zu verschwinden schien. Für einen Moment war es ganz still.
Dann Geschrei. Rufe, Husten. Mehr Geschrei. Das Schlagen von Gewehrkolben auf Wellblech. Eine Unruhe packte die Männer im Laufgraben. Schwere Stiefel auf den hölzernen Laufstegen. Aus den Sappen drangen keuchende, hustende, röchelnde Laute und immer wieder der Ruf ana akhtanek, ana akhtanek, ich ersticke. Taumelnd tauchten die ersten seiner Kameraden aus dem Sappengang auf, wie blind, aber mit weit aufgerissenen Augen strichen sie an den Grabenwänden entlang, die Hände um die Hälse gelegt, würgend, kotzend, vornübergebeugt sanken sie in den Schlamm, riefen nach Wasser, nach Luft, nach Hilfe, rieben sich mit schmutzverkrusteten Fingern die tränenden Augen. Dann Kugeln. Durch die Wolke pfiffen sie, aus Karabinern und Maschinengewehren, schlugen wie Platzregen im Schlamm der Brustwehren auf, zerfetzten blauen Zwilch, durchschlugen Schädeldecken, drangen durch Fleisch.
Wahllos feuerte unser Soldat auf den unsichtbaren Feind, wahllos und ebenso blind feuerte dieser zurück. Vor ihm schien die Wolke einen Moment zu zögern, geriet ins Schlingern und Tanzen, erhob sich in wogenden Schleiern vom Erdreich, driftete über ihn hinweg. Sprachlos blickte er in den gelben Himmel über ihm, aus dem sich kräuselnde Fasern senkten, die sich wie brennende Nesselfäden über sein Gesicht legten, in seine Augen flammten, in seine Lunge drangen, sich mit Gewalt in seinem Körper Platz zu schaffen versuchten und alles Leben aus ihm herausdrängen wollten, wie Geister, die sich eines Leibes bemächtigen. Das Gewehr ließ er fallen, mit einem Ruck riss er seinen Rock auf, als müsse er seiner brennenden Brust mehr Platz verschaffen, und fing an zu laufen. Immer den Graben entlang, nach hinten, über Winselnde und Sterbende hinweg, bis es kein Weiterkommen gab, weil sich die Leichen türmten, und er die Grabenwand erklomm, auf allen vieren durch die aufgepflügte Erde kroch, während die Kugeln aufspritzend neben seinen Händen, neben seinem pockennarbigen Gesicht im Boden aufschlugen. Hinter ihm die Wolke, dahinter die Deutschen, vor ihm freies Feld, vom wochenlangen Artilleriefeuer in eine narbige Kraterlandschaft zerschossen. Er richtete sich auf, lief, sprang, stolperte über Stacheldraht, Gräben, Granattrichter, sah, wie sein Nebenmann aufschrie und zusammenbrach, überhaupt fielen um ihn die Männer in den blauen Uniformen wie Kegel, manche stumm, andere schreiend, manche wie totes Holz, andere zappelnd und zuckend. Mit dem Gesicht voran fiel er in einen Granattrichter, sog gierig das faulige Wasser in seine brennende Kehle. Er musste weiter, nur weiter, weg von der Wolke, weg vom ihr folgenden Feind, nur weg. Die Beine wollten ihm nicht gehorchen, die Muskeln zitterten, der Kiefer malmte, mit seinen Fäusten zog er sich selbst am Haar. Um ihn infernalisches Gebrüll, heiseres Französisch, ersticktes Arabisch, atemloses Englisch. Sein Geist sagte: kämpfen, rennen, laufen, flüchten. Sein Leib war ein einziges Zittern. Dann ein einzelner klarer Gedanke: Nicht mit ihm. Nicht Teil dieser Maschinerie sein. Nicht mehr rennen, nicht mehr feuern, nicht mehr töten, nicht mehr kämpfen.
Einer musste damit aufhören.
Das Zittern verschwand. Die Fäuste öffneten sich. Ganz ruhig lag er in seiner Pfütze, sah, wie alles um ihn rannte, hörte, wie alles schrie, sah die Wolke näher kommen, sah, wie sie sich über den Rand seines Trichters wälzte, den Himmel über ihm gelb verfärbte, zum Stillstand kam, kurz pulsierte, als finde in ihrem Innern ein ganz eigener Kampf statt, sich in Sand verwandelte, der ihm auf den bloßen Kopf rieselte, sich auf seinen Schultern absetzte, mit feinem Geräusch in die Pfütze plätscherte. Über ihm der blaue Himmel. Um ihn Stille.
Vorsichtig kroch er aus seinem Krater. Da standen seine Kameraden, Sand auf den ausgebreiteten Handflächen, ungläubige Blicke. Weiter hinten die Deutschen. Reglos, die Blicke auf die Gewehre in ihren Händen gerichtet. Als sähen sie etwas ganz und gar Überraschendes, ließen sie die Waffen fallen. Schauten sich um, wie aus einem anderen Leben getreten. Kein Geräusch. Unser Soldat bückte sich, hob vom Sand neben seinen Stiefeln eine Handvoll auf und ließ ihn in seine Rocktasche rieseln. Dann wandte er sich Richtung Süden, dorthin, wo er Paris vermutete, und ging los.
F. schwieg. Blickte mich erwartungsvoll an. Aber das alles ist nicht geschehen, sagte ich. Nein, das ist es nicht, sagte er. Aber möglich wäre es vielleicht. Dann, wenn einer einfach aufhört.
Verehrer von Wundern
Ich selbst habe mir
Einen unvergleichlichen Ort der Ruhe geschaffen
Die durch meiner Hände Arbeit gezogene Furche
Wird in der glorreichen Vergangenheit meines Lebens eingraviert bleiben
Und nach meinem letzten Atemzug werde ich in der Unendlichkeit weiterleben.
Ferdinand Cheval
Einer lebt, wenn sein Name genannt wird.
Sprichwort im Alten Ägypten
II. Der Schatten des Traums des Briefträgers
An Aufhören war nicht zu denken. Nicht, solange er gebraucht wurde. Und Platz auf dieser Welt gab es nur für die, die gebraucht wurden. Nein, sagte er, an Aufhören sei nicht zu denken. Und Platz gebe es auf dieser Welt nur für jene, die gebraucht würden. Sie meine ja nur, sagte sie und zuckte mit den Schultern, das klinge nicht gut, dabei klopfte sie sich mit der flachen Hand auf die Brust und deutete mit dem Kinn in seine Richtung. Ihre Nägel waren lang und rot lackiert. Er winkte ab. Der Husten, das sei nichts. La guerre, sagte er, nicht der letzte, der vorletzte, als ob das alles erklären würde: das Pfeifen in seiner Lunge, den Schweiß, der ihm auf der Stirn stand und in den steifen Wollkragen seiner dunkelblauen Uniformjacke lief, die Tatsache, dass er in seinem Alter noch immer Briefe austrug.
Und im Grunde genommen war das auch so, zumindest schien ihm, wenn er über sein Leben nachdachte, wozu er allerdings selten Zeit fand, als habe sich alles in jenem Moment entschieden, als er sich in Oran in das Rekrutierungsbüro an der Place Kléber locken ließ und es wenig später als Rekrut der Armée d’Afrique durch den Hinterausgang wieder verließ. Nicht in jenem Moment, in dem ihn Boubeker, vor Aminas Augen, einen nutzlosen, pockennarbigen Idioten geschimpft hatte, nicht am Tag darauf, an dem er im Morgengrauen sein Dorf verlassen hatte, nicht, als er an der Reling stand und einen kurzen Moment Zeit hatte, zurück auf Algier zu schauen, das langsam in der Ferne verschwand. Nein, es war in jenem Augenblick, an dem er in den frühen Morgenstunden vom Hafen kam, wo man ihn ohne Arbeit weggeschickt hatte, und sich an der Place Kléber von einem Offizier in sauberer Uniform ansprechen ließ.
Lange war das her, sehr lange. Er wusste nicht einmal mehr das Jahr. Ziemlich am Anfang des Krieges musste es gewesen sein. Er wusste nicht viel von der Geschichte, hatte nie gelernt, wann sich was zugetragen hatte, und deshalb fiel es ihm schwer, die Ereignisse in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Und sein Stand in der Welt, das war nichts, worüber er nachdachte. Zumindest nicht, was die Vergangenheit betraf. Die Gegenwart, das schon, die Zukunft auch. War er noch zu gebrauchen? Würde er auch in Zukunft noch zu gebrauchen sein? Um diese Frage kreisten seine Gedanken, wenn er die Zeit hatte, ihnen freien Lauf zu lassen.
Sie schien ernsthaft besorgt um ihn. Zwang ihn, sich wenigstens für einen Augenblick an einen der kleinen runden Tische zu setzen, die auf dem Trottoir nebeneinanderstanden. Nur um etwas zu Atem zu kommen. Ein Schluck Wasser vielleicht? Es sei heiß heute. Er müsse genügend trinken. Er willigte ein. Warum nicht. Er war fast am Ende seiner Tour, und es war erst elf. Sie verschwand im dunklen Innern des Cafés, um sein Wasser zu holen, den dünnen Stapel Briefe und Werbeprospekte für das Café, den er ihr eben kurzatmig und hustend überreicht hatte, in der Hand. Die Terrasse war leer. Er saß allein unter der Markise, seine Posttasche auf dem Stuhl neben ihm. Die Tischplatte glänzte rot. Mit den Fingern fuhr er über den glatten Kunststoff, über die chromstählernen gebogenen Armlehnen seines Stuhles. Auch sie glänzten. Alles war neu. Nicht nur das Mobiliar. Das ganze Café, das Gebäude, in dessen Erdgeschoss man es eingerichtet hatte, die Gebäude, die daran anschlossen, die Häuser gegenüber, die Straßen, die scharfen, weißen Linien auf dem schwarzen Asphalt, die Verkehrsschilder, die Blumenkübel aus Faserzement. Es kam ihm vor, als sei er in letzter Zeit immer öfter von neuen, glänzenden, beinahe unbenutzten Dingen umgeben. Das schien ihm, er hätte nicht wirklich sagen können, weshalb, ein gutes Zeichen. Erst hatte er gefürchtet, für einen wie ihn werde es keinen Platz und keine Verwendung geben, in dieser neuen, makellosen Welt. Aber dann war es doch weitergegangen. Oder sogar gerade deswegen.
Sie bauten eine ganze neue Stadt, am Rande der alten. Er wusste nicht, wer genau sie baute. Solche Dinge schienen ihm immer undurchsichtig und schwer verständlich. Wie konnte es sein, dass man einfach so eine neue Stadt baute, wer konnte so etwas verantworten. Es musste der Staat sein, wer sonst war groß und mächtig genug, eine ganze Stadt zu bauen? Auch wenn es nur eine Vorstadt war.
Es kämen eben so viele Menschen. Aus dem Maghreb, aus seiner alten Heimat, von den Komoren, aus Griechenland, aus Italien … Und für sie baue man diese Städte, hatte ihm seine Tochter erklärt, die in der Stadtverwaltung arbeitete. Lyon platze aus allen Nähten, es brauche neuen Wohnraum.
Die Straßen waren breit und gerade, die Häuser, strenge geometrische Körper, waren wie Bauklötze entlang dieser Straßen angeordnet und warfen scharfe Schatten über den frischen Asphalt und dahinter Riegel um Riegel und dazwischen nackte Erde, aus der wie Flaum schüttere erste hellgrüne Halme sprossen. Manchmal ein Spielplatz. Hinter die Fensterfronten entlang der Straßen zogen Läden ein. Supermarché, Hypermarché … Aber keine Restaurants und nur selten ein Café. Eigentlich war dieses hier, vor dem er nun saß, das einzige auf seiner Runde.
Sie stand bald wieder an seinem Tisch. Stellte ein großes Glas Wasser vor ihn hin. Verschwenderisch zur Hälfte mit Eiswürfeln gefüllt. Das war auch etwas Neues, diese Eiswürfel in den Gläsern. Das kalte Wasser sandte einen elektrischen Schmerz durch einen seiner Backenzähne. Er ließ sich nichts anmerken. Hätte gerne die Eiswürfel aus dem Glas gefischt, aber er fürchtete, die junge Frau zu beleidigen. Ihre Freundlichkeit galt nicht nur seiner Uniform. Dafür hatte er im Lauf seines Lebens ein Gespür entwickelt. Vielleicht gerade weil ihm Freundlichkeit in den ersten fünfundzwanzig Jahren seines Lebens nur selten zuteilgeworden war, nicht in Timiaouine, nicht in Oran, nicht in der Kaserne von Blida und schon gar nicht in den Schützengräben von Flandern. Und auch nicht in der langen Reihe von Lazaretten, durch die er geschleust worden war, mit verbrannter Lunge und verätzten Augen, auf der Flucht vor den vordringenden Deutschen, quer durch die Etappe, auf Pritschen von Lastwagen und Pferdekarren und manchmal zu Fuß, die Hand auf der Schulter des ebenso blinden Vordermannes. Lazarette in Zeltstädten, Lazarette in Scheunen, Lazarette in Schulhäusern mit eingestürzten Dächern und in halb ausgebrannten Klöstern. Er erinnerte sich an eine französische Nonne, in Algerien geboren, die ihm ein Glas Pfefferminztee brachte. Das war ein Akt der Freundlichkeit. Der einzige in vielen Jahren. Einer aus Solidarität mit dem fremden Mann, der, wenn auch unter unterschiedlichen Voraussetzungen, dasselbe Land Heimat nannte.
Und als er dann, nachdem er wieder einigermaßen zu sehen in der Lage war, in einen Zug nach Lyon gesetzt wurde und in der dortigen Bahnhofshalle, einem spitzgiebligen Gerüst aus rußigem Stahl, das einen überwältigenden Raum schuf, in dessen Weiten das Geschrei Tausender Soldaten und das Fauchen der Lokomotiven widerhallten, nach Luft rang und schließlich willenlos mit dem Strom Kriegsversehrter, im Gegenstrom zu den kampfeslustigen Unversehrten, die hinein in die Halle, auf die Bahnsteige, in die Züge, an die Front drängten, hinaus auf die Straße gespült wurde, auf der er sich die nächsten zwei Jahre durchschlagen sollte, da war das auch nicht der Beginn eines Lebens, in dem ihm viel Freundlichkeit entgegengebracht wurde.
Als aber der Krieg kein Ende nehmen wollte und in sein viertes und fünftes Jahr ging, wurde es auf den Straßen Lyons leerer und leerer, und es verschwanden vor allem die Männer, und da wurde dann erstaunlicherweise das Versprechen des Rekrutierungsoffiziers, man werde für einen wie ihn in Frankreich sicherlich Verwendung finden, doch noch wahr. Die Farbe seiner Uniform wechselte von Hellblau zu Dunkelblau. Bei der Post konnte man ihn brauchen, als Briefträger. Sein Französisch war mittlerweile leidlich, etwas Lesen und Schreiben, genug, um die Adressen auf den Umschlägen zu entziffern, hatte ihm ein Invalider der Tapferkeit, ein beinamputierter Lehrer aus Vienne, der an einer Schüttelneurose litt, in einem Männerwohnheim beigebracht, in dem er manchmal im Winter für ein paar Nächte ein Bett gefunden hatte. In normalen Zeiten wäre das beunruhigende Pfeifen, das bei jedem Atemzug seinen Lungen entwich, vielleicht ein Grund gewesen, ihn vom Postdienst auszuschließen, aber in diesen Jahren konnte man nicht wählerisch sein, wenn es um die Besetzung unentbehrlicher Stellen ging, selbst die große Postes, Télégraphes et Téléphones nicht.
Mit der neuen Uniform kam die Freundlichkeit in sein Leben, aber er lernte rasch, dass mit ihr nicht er gemeint war, sondern die Uniform, der Briefträger an sich, der Beamte, der Nachricht brachte von den Vätern, Ehemännern und Söhnen, die an der Front in den Gräben hockten. Die Freundlichkeit wich kühler Distanz und manchmal sogar heißer Verachtung, sobald die Leute sein gebrochenes Französisch hörten. Für einige bestand die Provokation, so lernte er, gerade in der Kombination aus der vertrauten Uniform und seiner ungewöhnlichen Erscheinung; ein junger Mann mit den Atemgeräuschen eines greisen Asthmatikers, mit Pockennarben unter einem grünlichen Bartschatten, der sich bereits gegen Mittag abzuzeichnen begann, braungebrannt, aber mager, die Schritte federnd, doch der schmale Rücken von der schweren Ledertasche gebeugt. Als er sich alt genug vorkam, probierte er es mit einem buschigen Schnurrbart, so wie ihn viele seiner Kollegen trugen, aber der Bart verlieh ihm ein gefährliches Aussehen, das wollte er nicht, auch wenn sich, als er ihn im Gesicht trug, einige nicht mehr trauten, ihre Verachtung zu offensichtlich zu zeigen.
Während des nächsten Krieges wurde es etwas leichter. Es gab mittlerweile in Lyon so viele wie ihn. Und irgendwann wieder zu wenige Männer für die viele Arbeit. So kam er sich zumindest, wenn schon nicht geschätzt, wenigstens gebraucht vor. Doch seit der Krieg um die Unabhängigkeit Algeriens im Gange war, wurde ihm meist wieder mit offener Feindseligkeit begegnet.
Sie stand nun an einem der Blumenkübel und zupfte welke Blüten von der üppigen Klematis. Die fleckigen Blätter sammelte sie auf dem Tablett, das sie in ihre linke, knochige Hüfte stemmte. Er hatte den Eindruck, sie sei zwar auf ihre Tätigkeit konzentriert, aber dennoch beobachte sie ihn aus dem Augenwinkel oder lausche zumindest seinem pfeifenden Atem. Brav trank er sein kaltes Wasser, kam sich plötzlich wie ein Kranker vor — das machte die Fürsorge, die ihm die Kellnerin zuteilwerden ließ. Es war zu heiß, um sich ihrer zu erwehren. Als sie wieder an ihm vorbeiging, um abermals im dunklen Inneren des Cafés zu verschwinden, nahm sie das Glas mit, in dem die angeschmolzenen Eiswürfel klimperten, und tauchte bald wieder mit einem frisch gefüllten auf. Er protestierte zaghaft, er müsse weiter, und klopfte auf die Ledertasche, aber sie klopfte sich, wie ein Echo, wieder auf die Brust: Ein wenig sitzen noch, sagte sie in einem Ton, der zwischen Empfehlung und Befehl changierte. Und um ihm die Entscheidung zu erleichtern, griff sie sich den Stuhl ihm gegenüber, zog ihn vom Tisch weg und setzte sich.
Sie schwiegen, bis ihm das Schweigen unfreundlich erschien. Nicht viel los, sagte er dann. Ja, es sei ruhig, sagte sie. Es sei oft ruhig bei ihr um diese Zeit, das habe er beobachten können, erwiderte er. Sie machte eine unbestimmte Bewegung, die die ganze neue Nachbarschaft zu umfassen schien. Die Menschen, die hier lebten, sagte sie, arbeiteten tagsüber. Von denen habe niemand Zeit, morgens ins Café zu kommen. Alle jung. Es fehlten die Alten, die Pensionisten. Und überhaupt fehle den Leuten das Geld fürs Café. In dem Gasthof, in dem sie früher gearbeitet habe, seien um diese Zeit auch nur die Alten gesessen. Die Jungen kämen höchstens ganz in der Frühe vorbei, auf einen schnellen Kaffee, oder nach Feierabend. Hier aber sähe man keine Alten. Es ist zu neu hier, sagte sie, sie passen nicht hierher.
Ob sie aus Lyon sei, fragte er, nachdem sie wieder eine Weile geschwiegen hatten. Hauterives, sagte sie und deutete vage nach Südosten. Ein Dorf nur, brauche er nicht zu kennen. Ob er fragen dürfe, sagte er, was sie hierher nach Lyon gebracht habe, in die Cité? Er war sich nicht sicher, ob ihm diese Frage zustand, aber auf die Frage nach ihrer Herkunft hatte sie offen geantwortet, und da sie ein so unverhohlenes Interesse an seiner Gesundheit an den Tag legte, schien es ihm angebracht, auch ein gewisses Interesse an ihrer Person zu zeigen. Überhaupt waren seine Bedenken gänzlich unbegründet. Sie antwortete mit einem lauten, kurzen Auflachen, das ihn an einen jungen Hund erinnerte, und sagte, seinen Blick suchend: Der Briefträger hat mich nach Lyon gebracht. Dann wandte sie ihren Blick ab, schaute die neue, baumlose, vielspurige Straße hinunter, in der sich die heiße Luft staute. Ein anderer Briefträger, er hat mich hierhergebracht, erklärte sie, das Gesicht von ihm weggedreht. Und nach einer kurzen Pause löste sie ihren Blick von der Straßenschlucht und blickte ihn wieder an. Eigentlich, sagte sie, war es der Schriftsteller, aber der kam wegen dem Briefträger Cheval nach Hauterives.
Wann genau, mit welchem Verkehrsmittel und in wessen Begleitung der Schriftsteller Peter Weiss des Briefträgers Cheval wegen nach Hauterives gereist ist, lässt sich nicht genau rekonstruieren. Selbst der überaus gewissenhafte, ja, beinahe obsessiv zu nennende Biograf S., geboren 1936, Studiendirektor a. D., der in, zumal für einen Promovenden, bereits fortgeschrittenem Alter in den frühen Nullerjahren des neuen Jahrtausends eine Promotionsschrift zu den Frankreichreisen des jungen Weiss, das heißt, die Jahre 1947 bis 1966 abdeckend, an der Humboldt-Universität zu Berlin einreichte, eine Arbeit, die ihn zehn Jahre gekostet hatte und die er neun Jahre später mit einem zweiten Band, die Jahre 1967 bis 1982 abdeckend, vollendete und, wie bereits beim erste Band mit dem optimistischen Untertitel »Prolegomena zu einer Biografie« versehen, im Röhrig Universitätsverlag publizieren ließ — insgesamt ein Unternehmen von über tausend Seiten, eine metikulöse und überaus detailreiche, um nicht zu sagen kleinteilige Arbeit, eine akribische Spurensuche von überwältigender Ausführlichkeit, die den Biografen S., wir werden noch sehen weshalb, in eine gewisse Nähe zum Briefträger Cheval stellt, selbst dieser derart gewissenhafte Biograf S. war nicht in der Lage, zweifelsfrei zu eruieren, wann und wie genau der Schriftsteller Weiss nach Hauterives gereist ist.
Gesichert festzustellen sei lediglich, so S., dass der Schriftsteller am 25. Juli des Jahres 1960 von Paris losfuhr und am 28. Juli, also drei Tage später, in Biot im Süden Frankreichs, ungefähr auf halber Strecke zwischen Cannes und Nizza gelegen, ankam, wo seine damalige Lebensgefährtin und spätere Frau Gunilla Palmstierna bereits seit einiger Zeit bei gemeinsamen Freunden zu Gast war und eine Ausstellung ihrer Keramiken vorbereitete.
Verwirrung über die Details der Reise stiftete Weiss selbst mit seinen überlieferten Notizen zum Jahr 1960, welche er allerdings erst gut zwanzig Jahre später, im Jahr 1980 oder 1981, kurz vor seinem Tod, verfasste und die schon allein durch diesen großen zeitlichen Abstand zu den Ereignissen das Misstrauen des Biografen S. verdienten, wie dieser in einer Fußnote anmerkt, und in denen der Schriftsteller von einer Expedition durch Paris am 24. Juli des Jahres 1960 berichtet, angeführt von dem buddhistischen Fluxuskünstler Robert Filliou, bei der sie in einer größeren Gruppe, zu der auch der Schweizer Künstler Daniel Spoerri gehört habe, morgens früh um vier an der Port Saint-Denis losgegangen seien, an den Prostituierten vorbei, die »mit den glattgespachtelten Masken ihrer Gesichter den ersten Schimmer des Tageslichts« aufgefangen hätten, zu den Markthallen, wo sie im Gedränge der Fuhrleute am Schanktisch einer Bar Zum rauchenden Hund einen Morgenkaffee zu sich nahmen und über die Freitreppe der Sacré Cœur zum Obelisken des Geistes der Bastille und von dort weiter zum Père Lachaise gegangen seien, um das Grab Gertrude Steins aufzusuchen. An der Place de la Contrescarpe habe man im Café des Cinq Billards etwas Wegzehrung eingenommen, bevor man sich über die Luxembourggartens, wie es in Weiss’ Notizen heißt, zur Pension Orfila begab, in der der von Weiss verehrte Strindberg einmal gehaust hatte und nächtens von verstörenden Albträumen heimgesucht worden war, und an der Statue Balzacs vorbei zum Louvre, wo man sich die Mona Lisa ansah, um dann über die Oper und die Tuilerien das Grab des unbekannten Soldaten zu besuchen, bevor man sich, es war inzwischen Abend, in die Mansarde Fillious in der Rue des Rosiers begab, wo Weiss schließlich mit Spoerri, zu später Stunde, durch eine Luke auf das Dach kletterte und ihm dieser »im violett werdenden Licht« von seiner bevorstehenden Ausstellung im Stedelijk Museum berichtet habe. Von der Mansarde aus, notierte Weiss zwanzig Jahre später, habe er sich, nein, hätten »sie« sich — bloß wen dieser Plural umfasste, blieb unbeschrieben — »vorbei an den letzten Überlebenden der Nacht, die in den Aquarien der Cafés verschwammen«, zum Bahnhof begeben.
Es wäre also der Morgen des 25. Juli gewesen, an dem Weiss, so die gesicherte Überlieferung, die Reise nach Biot antrat — aber bestimmt nicht mit dem Zug, ist sich der Biograf gewiss, sondern, so habe ihm auch Weiss’ Witwe in Stockholm bestätigt, mit dem Auto. Gunilla Palmstierna-Weiss nämlich glaubte sich zu erinnern, ihr Mann sei in Begleitung seines Freundes, des Fotografen Christer Strömholm in dessen Wagen gereist. Am Steuer, so Biograf S., müsse in diesem Fall Strömholm selbst gesessen sein, da Weiss erst ab 1964 einen Internationalen Führerschein besessen habe.
Weshalb S. den Notizen Peter Weiss’ und dessen Gang zum Bahnhof im Morgengrauen misstraut, hat noch weitere Gründe, die uns hier nicht zu interessieren brauchen, die für die Autofahrt sprechende Erinnerung Palmstierna-Weiss’ kam dem Biografen jedenfalls gelegen, denn bei dieser Tour, die, das wissen wir, drei Tage dauerte, hätte sich ein Abstecher nach Hauterives trotz erheblichen Umweges durchaus unterbringen lassen, und überhaupt, vermerkt der Biograf, sei ohne Auto schlecht hinzukommen; dies eine Tatsache, die ich aus eigenem Erleben bestätigen kann.
Sonntagnachmittag, Mitte Februar, die Pandemie ging in ihr drittes Jahr. Gepackt hatte ich leicht. Mit einer Viertelstunde Verspätung verließ der Zug München, und bereits in Augsburg ließ ich mich von der Durchsage, der Anschluss in Stuttgart sei nicht zu erreichen, entmutigen und stellte gleich die ganze Sinnhaftigkeit meines Unternehmens in Frage. Paris geriet damit außer Reichweite, zumindest für diesen Tag. Ein Hotel in Stuttgart wäre zu suchen oder eines zu beziehen, das die Bahn zuwies; ein Abendessen im Bahnhofsviertel, dazu das Gefühl, bereits gescheitert zu sein, gescheitert und gestrandet in Stuttgart.
Ich war ein schlechter Reisender geworden, unsicher, gereizt, verletzlich. In nervöser Erwartung, die Mitreisenden könnten sich einer hygienischen Verfehlung schuldig machen, suchte ich nach freigelegten Nasen, nach unter dem Kinn hängenden Masken. Die Essenden strafte ich mit strengen Blicken. Ich darf das — bin schließlich Direktbetroffener, schwerer Verlauf, beinahe nicht überlebt, seither Risikopatient mit Narben auf der Lunge — kein Wunder, dass ich besorgt bin. Ich schäme mich trotzdem, versuche vermutlich deswegen, in jeder individuellen Verfehlung eine gesamtgesellschaftliche Krise der Solidarität auszumachen. Vielleicht doch lieber in Ulm aussteigen und den Zug zurück nach München nehmen. Die ganze Reise noch einmal überdenken. Man könnte ja morgen noch einmal einen neuen Versuch unternehmen.
Was allein gegen die aufsteigende Panik hilft, ist sich vor Augen zu führen, dass man so wahnsinnig gerne ja gar nicht lebt. Nur hat man … Nur habe ich das mit dem Sterben ja ausprobiert. Akute respiratorische Insuffizienz — läuft aufs Ersticken hinaus. Da wehrt sich die menschliche Natur zu sehr dagegen, als dass das ein leichter Abgang sein könnte. Nicht ohne Grund, war die Atemluft bei den alten Ägyptern Symbol für Freiheit und Wahrheit; und Atemnot die gängiste Metapher für Not und Bedrängnis.
Ich blieb in Ulm trotzdem sitzen.
Mitreisende wurden zu Gegenreisenden. Überhaupt war der Begriff des Mitmenschen beinahe nutzlos geworden. Zumindest verlogen. Jeder eine Bedrohung, jedes Miteinander eigentlich ein Gegeneinander. Nur die Perspektivübernahme zeigte einen Ausweg: Jeder ist des anderen Bedrohung, also auch ich die eines jeden anderen; das musste ich mir immer wieder in Erinnerung rufen.
Und eben, wenn die Panik aufstieg, mich zu überzeugen versuchen, dass es vor allem das Vegetative ist, das sich an das Leben klammert. Dies eine Lüge natürlich, aber eine, die sogleich belohnt wurde. Nicht nur mit einer gewissen Ruhe, sondern ganz konkret mit einer neuen Durchsage: Der Anschluss wartete. Paris rückte wieder in Reichweite.
Französische Provinz im Dunkeln. Nancy, Metz, Reims, nicht dass ein Halt in diesen Städten einen großen Umweg bedeutet hätte, aber wir ließen sie an uns vorbeiziehen, touchierten im besten Fall ihre Peripherien. Das TGV-Netz orientiert sich an der idealen Geraden. Eine Art neoliberales Versprechen, dass man ohne Umwege die wichtigen Ziele erreichen kann, dass sich überhaupt das Notwendige vom Marginalisierbaren unterscheiden lässt.
Ich hatte mich lange nicht zu dieser Reise durchringen können und erst in letzter Minute ein Zimmer gebucht. Das Hotel lag an der Rue René Boulanger — Gewerkschafter, Mitglied der Résistance, in Nantes verhaftet, am 7. März 1940 im Alter von 42 Jahren von der Gestapo zu Tode gefoltert —, in Gehweite vom Gare de l’Est. Es war merklich wärmer als in München und die nächtliche Stadt verströmte den Geruch eines ungelüfteten Schlafwagenabteils. Das Zimmer war, wie immer in Paris, ein winziger Verschlag, das Fenster zeigte in einen taubenkotverkrusteten Lichthof. Der Geruch im Zimmer frischer als auf der Straße, aber weniger vertraut, geradezu fremd.
Schon immer war ich in Hotelzimmern mit Verdrängen beschäftigt gewesen. Lichtschalter, Fernbedienungen, Toilettensitze, Zahnbecher, Kopfkissen … Nur nicht an die zahllosen Vorschläfer denken, zumindest keine konkreten Bilder aufsteigen lassen. Das Problem unlösbar und dennoch bislang gut zu handhaben. Weit vom Neurotischen entfernt — es muss doch, da bin ich sicher, jedem so gehen, der ein Mindestmaß an Vorstellungskraft besitzt. Seit der Pandemie aber hatte das Thema eine neue Dringlichkeit, die Sensibilisierung war hoch, die Verdrängungsleistung kaum mehr zu bewerkstelligen.
An der Porte Saint-Martin gab es trotz der späten Stunde anstandslos noch etwas zu essen. Ich hatte mich an einen kleinen runden Tisch auf dem Gehsteig gesetzt, von oben glühte eine elektrische Heizspirale, und ich hatte neben dem Teller Peter Weiss’ »Kopenhagener Journal« liegen, das Tagebuch jenes für Weiss so schicksalhaften Jahres 1960, ein »Wendejahr«, wie es der Biograf S. nennt; und mir, der ich mein Wendejahr, das ich fast nicht überlebt hätte, eben gerade hinter mich gebracht hatte, fiel wieder einmal auf, dass der Schriftsteller in jenem Jahr und ich in diesem Moment ziemlich genau gleichen Alters waren. Ich schlug den dünnen Band auf und las noch einmal den Abschnitt über den Traum des Briefträgers Cheval.
Das Zimmer hatte ich, wie es meiner Gewohnheit entsprach, ohne Frühstück gebucht und war für einen Augenblick froh, dass ich nach diesen letzten Jahren noch Gewohnheiten hatte.
Früh ging ich zu Fuß durch die Kälte zum Gare de Lyon, hatte vor, noch etwas mitzubekommen von Paris, das ich so lange nicht mehr gesehen hatte. Mein Weg führte mich den Boulevard hinunter an der Place de la République vorbei zur Bastille und dann rechter Hand den Canal Saint-Martin entlang. Schon wieder der heilige Martin, Schutzheiliger der Reisenden; immerhin. Und zudem sein Satz: Den Tod fürchte ich nicht, weiter zu leben lehne ich aber nicht ab. Am Tresen des Café l’Autobus gegenüber der Place Pasdeloup, an der Ecke Amelot-Oberkampf, trank ich einen Espresso und aß ein Croissant. Mit Hilfe meines Desinfektionssprays wurde ich das buttrig klebrige Gefühl an den Fingern los.
Lyon Centre Ville nur eine ferne Ahnung, selbst die Wohnriegel der Vorstädte waren nicht zu sehen, dafür hielt der Zug einen kurzen Augenblick in Santiago Calatravas Pterodactylusskelett, unweit des Aéroport Antoine de Saint-Exupéry — Schriftsteller, Pilot, Bürger Lyons, vermutlich am 31. Juli 1944 vom späteren deutschen Sportreporter Horst Rippert über dem Mittelmeer vom Himmel geschossen. Valence erreichten wir mit einer Verspätung von zwanzig Minuten, und ich wartete eine geraume Weile an einer Busstation vor dem TGV-Bahnhof, der mitten im Nirgendwo zu stehen schien.
Es regnete kräftig, die Tropfen waren kalt, von beinahe pastöser Konsistenz, und schienen sich nicht entscheiden zu können, ob sie zu Flocken kristallisieren wollten. Geräuschlos fielen sie auf den nassen Asphalt des halbleeren Parkplatzes. Kurz vor Mittag stieg ich in einen Bus. Eine halbe Stunde dauerte die Fahrt durch Industriegürtel und Vorstadt, vorbei an Möbelläden, Autohändlern und einer erstaunlichen Anzahl von Sanitärbetrieben. Kreisverkehr folgte auf Kreisverkehr, der Bus wand sich in einer trostlosen Polonaise aus Kleinwagen und mit Reklame für Handwerker beklebten Transportern um faulige Blumenbeete, an deren Rändern die zur Seite gekehrten Schneereste langsam den Dieselruß absorbierten.
François-Désiré Bancel, glühender Republikaner, so stand es auf dem Sockel der Statue, drehte dem Bahnhof Valence-Ville den Rücken zu. Den Mantel im Wind gebauscht, die Rechte hoch erhoben, die Linke um einen geschlossenen Regenschirm geklammert, das bärtige Kinn gereckt, den Blick fest geradeaus, als wolle er seine Besitzansprüche über die vor ihm liegende, regennasse Hauptstraße, die Dönerläden, die Cafés, die nackten Platanen anmelden. Aber die Straße trug nicht seinen Namen, stattdessen war sie nach Pierre Semard benannt — Bahngewerkschafter, Kommunist, am 7. März 1942 im Alter von 55 Jahren von den Nazis im Gefängnis von Évreux ermordet.
Ich hatte meinen Anschluss verpasst, und der nächste Zug, der mich wieder ein Stück rhoneaufwärts bringen sollte, fuhr erst in zwei Stunden. Gerne hätte ich dem glühenden Republikaner seinen nutzlos geschlossenen Regenschirm entwunden. In einem chinesischen Billigladen fand ich zwischen Plastikbecken, Morgenmänteln aus Polyester und winkenden Katzen einen Regenschirm für drei Euro neunzig. Beim Aufspannen bemerkte ich, dass der Schirmstoff mit einem feinen Faden an den Kugelspitzen festgenäht war, und fragte mich, ob es für diesen Arbeitsgang eine Maschine gab oder ob das jemand von Hand hatte nähen müssen. Und natürlich fragte ich mich, wie sehr der Kauf dieses Schirms meine Schuldlast erhöhte, zumal der Regen, wie um der Problematik des Kaufs auch noch seine Sinnlosigkeit beizufügen, im Moment des Aufspannens nachließ und nur Minuten später ganz versiegte.
Da war sie, jene Durchlässigkeit, die mich nur überkam, wenn ich alleine reiste. Sie hatte sich am Vorabend angeschlichen, als ich am Gare de l’Est aus dem Zug ausgestiegen war und die Luft eine ganz andere gewesen war und ich draußen auf der Straße, vor dem Fenster eines Jagdgeschäfts, einen betrunkenen Sapeur hatte stehen sehen, der sich mit den Handflächen an der Scheibe festhielt, seine Nase am Glas platt drückte und einem ausgestopften Fuchs, der zähnefletschend, mit schreckstarr aufgerissenen Augen, zwischen Büchsen und Flinten, Ferngläsern und mit zahllosen Taschen und Schlaufen versehenen tarnfarbenen Westen, im Fenster stand, in die Augen stierte und, so stellte ich mir vor, sich vorstellte, wie sich der Pelz des Tiers am Kragen seines Kamelhaarmantels machen würde.
Flussaufwärts folgte der Zug der Rhone. Möbelhäuser, Baumärkte, Zementwerke, zersiedeltes Land, Arbeitsplätze. Auf der anderen Flussseite die Weinberge, Côtes du Rhône. Der Zug war erstaunlich spärlich besetzt, hielt an leeren Bahnhofsgebäuden, vor denen Fahrscheinautomaten standen, deren Wechselgeldladen mit Kaugummis verklebt waren.
In Saint-Vallier-sur-Rhône stieg ich aus. Auch dort das Bahnhofsgebäude verlassen, die Tür zum Wartesaal abgesperrt, dafür ein gläserner Unterstand an der Südseite, Pissflecken in den Ecken, daneben der Fahrkartenautomat, Kleinwagen auf dem Parkplatz. Der Bus, der mich endlich zum Palast des Briefträgers bringen sollte, fuhr erst in Stunden. Hundert Meter flussabwärts in Richtung des Städtchens spannte sich eine Brücke über den Strom, eine Straße führte am Ufer entlang, in den Häusern alle Rollläden unten, trotz des Blicks auf den Fluss. Vor den Schaufenstern mit Ketten verschlossene Scherengitter, oder sie waren gleich mit Pressspanplatten vernagelt, an etwa jedem fünften Haus eine Tafel, die es zum Verkauf anbot. Lastwagen donnerten in engem Takt vorbei, ihr Dröhnen hallte von den Wänden und verlor sich über dem Wasser.
Eine Straße dahinter empfing mich überraschende Ruhe, Friedhofsruhe. Die meisten Geschäfte waren geschlossen, manche, schien mir, für immer. In einer Agentur für Zeitarbeit saß eine Dame im Angorarollkragenpullover vor einem Heizlüfter und blickte auf die leere Straße hinaus. Der Hunger ließ mich auf das Schild des Kebab King zusteuern, die Auslage hinter der trüben Scheibe leer, die Tür verschlossen — vielleicht wegen der Schulferien, suchte ich nach einer Erklärung. Etwas weiter in das Städtchen hinein versprach eine Leuchtreklame Snack Bar — Jeux, Glacier — Casse Crouter à toute heure!, aber ich traute mich nicht hinein. Durch das Fenster in das dunkle Lokal blickend, erkannte ich eine Bar, die Regale an der Rückwand, wo die Flaschen und Gläser hätten stehen sollen, leer. Ein paar ältere Männer, nordafrikanisch aussehend, saßen auf Plastikstühlen, tranken Tee aus kleinen Gläsern und spielten Domino. Es wirkte nicht, als sei ich willkommen, eher wie eine private Versammlung.
Mein leerer Magen trieb mich die Straße hinunter, die den Namen Jean Jaurès trug — Sozialist, Pazifist, am Vorabend des Ersten Weltkriegs von einem Nationalisten durch das Fenster des Café du Croissant erschossen. Die Halal-Metzgerei geschlossen, vor den Fenstern von Dupont Électroménager die Rollgitter heruntergelassen, gegenüber im Caprice de l’Océan die Küche kalt. Das Hotel du Voyageurs hatte schon lange keine Reisenden mehr empfangen. An der Place Aristide Briand — Sozialist, Antinationalist, Friedensnobelpreisträger, Vordenker der europäischen Einigung, Initiator des Briand-Kellogg-Pakts — stand ich zunehmend verzweifelt vor der verschlossenen Tür der Bar de l’Univers und entschloss mich, einer melancholischen Regung folgend, die Rue Président Wilson — genug der Friedensnobelpreisträger — rechts liegen zu lassen und der Rue de Verdun zu folgen. Am Dragon d’Or rüttelte ich wider besseres Wissen an der Tür, studierte die vielen Seiten der Karte, die mit vergilbten Klebestreifen von innen am Glas klebten und eine schier unüberschaubare Fülle an vietnamesischen Speisen, fein säuberlich durchnummeriert, auflisteten.
Einen Hoffnungsschimmer bot ein kleines Reformhaus gegenüber, in dem ich einen bärtigen Mann in den Tiefen des Verkaufsraumes ausmachte, der, angetan mit einer ledernen Schürze und ebensolchen Sandalen, zwischen röhrenförmigen Glasbehältern Wache hielt, die an den Wänden aufgereiht hingen und den Blick auf ihre Füllstände freigaben. Ich glaubte, Hülsenfrüchte zu erkennen, Körner, Makkaroni, Reis, Nüsse und Haferflocken. Angestrengt starrte ich aus der Kälte heraus in das Halbdunkel des geheimnisvollen Ladens, konnte aber nichts finden, was sich ohne Kochvorgang hätte verzehren lassen oder mit dem ich roh meinen Hunger hätte stillen wollen. Auch hatte ich kein Gefäß dabei, welches ich unter die Röhren hätte halten und befüllen können, so dass ich den Rückzug antrat, als inmitten des krautigen Bartes des Ladenbesitzers ein breites Lachen aufging und der Mann mich mit ausholender Geste zum Betreten seines Geschäftes aufforderte.
Links vom Rathaus die Post, ein viel zu großes Gebäude, das von der vergangenen Bedeutung dieser Institution zeugte. Durch eine schmale Lücke zwischen Post und Rathaus stieg ich eine kurze Treppe hinunter, im Wunsch, an das Ufer der Galaure zu kommen, die unweit von hier in die Rhone mündete und die Kleinstadt in zwei Teile schnitt.
Auf einer Brücke über die Galaure blieb ich in der Mitte stehen, blickte flussaufwärts, irgendwo an ihrem Oberlauf, wusste ich, musste Hauterives liegen, mein Ziel, zu dem — wie hatte der Biograf S. geschrieben — ohne Auto schlecht hinzukommen war.
Auf dem Rückweg zum Bahnhof fiel mir an einer Hauswand eine kleine Marmortafel auf, die an drei Männer erinnerte: René Mouton, René Muzzolini, Georges Seguret — Résistants, morts en déportation.
Als ich wieder die Avenue Jean Jaurès hochging, es musste bereits das dritte oder vierte Mal sein, und es schien mir, als blicke die Frau im Angorarollkragenpullover mir misstrauisch hinterher, senkte sich bereits die Dämmerung über den Ort. Im Caprice de l’Océan brannte nun Licht. Ich betrat das leere Lokal und erkundigte mich bei der Dame, die hinter dem Tresen konzentriert mit irgendwelchen Papieren beschäftigt war, ob es möglich sei, ein Glas Wein zu bekommen. Auf ihr Nicken hin setzte ich mich an einen der Tische. Ein junger Mann, blass, mager, mit gekrümmten Schultern, in einem lächerlichen gelben Trainingsanzug, fegte die braunen Fliesen. Über seinem Kopf hing in der Ecke ein Fernseher, eine junge Chansonnière sang, begleitet von einem Fernsehorchester, dirigiert von einem Fernsehmaestro mit telegenen grauen Dirigentenlocken, eine Version von Barbaras Klassiker »Göttingen«. Die junge Musikerin, die mir gänzlich unbekannt war, schritt wie einst Barbara bei einem Fernsehauftritt im Jahr 1967, den ich mir gelegentlich, in schlaflosen Nächten, in denen ich mich aufzulösen fürchtete, auf Youtube ansah, eine Showtreppe hinunter, setzte sich aber nicht an den Flügel, sondern hängte sich eine Gitarre um den Hals. Ich schämte mich für meine nostalgische Anwandlung, meine Übellaunigkeit, aber mir fehlte die markante Nase Barbaras, ihr rollendes R, mit dem sie von den Kindern Göttingens sang und von der Versöhnung nach dem Krieg, mir fehlte die seltsame Jahrmarktorgel, die sich im Original im Hintergrund die Moll-Tonleiter hinaufschleppte und wieder trunken herunterpurzelte. Ich war ungnädig gestimmt. Der Wein, der im schmutzigen Glas kam, war mir sauer.