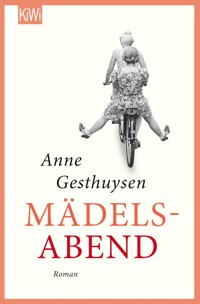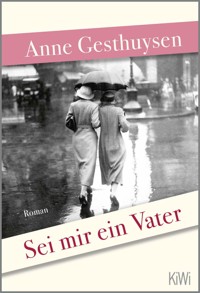19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Pastorin am Niederrhein, eine Mutter, die unermüdlich für ihr Kind kämpft, und eine Dorfgemeinschaft, die Schicksal spielt: Anne Gesthuysens neuer Roman ist da! In der kleinen Gemeinde Alpen am Niederrhein laufen die Vorbereitungen für das jährliche Spargelfest auf Hochtouren. Während die Zelte aufgebaut werden und der Chor rund um Ottilie Oymann über »diskriminierungssensible Sprache« in alten Liedtexten streitet, hat die Pastorin Anna von Betteray ganz andere Sorgen. Raffaela, ein Mädchen, das seit einem Unfall geistig behindert ist, liegt im Koma. Sie wurde bewusstlos aufgefunden, niemand weiß, was passiert ist. Umso mehr brodelt die Gerüchteküche. Wurde das Mädchen Opfer einer Gewalttat? Stecken Drogendealer oder Spargelstecher dahinter? Die Polizei folgt den spärlichen Spuren, das Dorf ermittelt eifrig mit. Auch ihre eigene Familie bereitet Anna Kummer: Ihre Schwester Maria kämpft mit ihrer Sucht und Ängsten, ihr Neffe Sascha sucht nach Halt, und ihre Mutter versucht ständig, sie zu verkuppeln. Als unvorhergesehene Ereignisse die Familien zusammenbringen, zeigt sich: Hoffnung kann blühen, wenn man es am wenigsten erwartet. Voll psychologischem Feingefühl und mit hinreißendem Witz erzählt Anne Gesthuysen von Schuldgefühlen und Mutterliebe, der Kraft einer Gemeinschaft und einem Leben, das endlich gelebt werden will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Gesthuysen
Vielleicht hat das Leben Besseres vor
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Anne Gesthuysen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Anne Gesthuysen
Anne Gesthuysen wurde 1969 am unteren Niederrhein geboren. Nach dem Abitur in Xanten studierte sie Journalistik und Romanistik. In den 90er-Jahren arbeitete sie bei Radio France. Als Reporterin hat sie für WDR, ZDF und VOX gearbeitet, schließlich auch als Moderatorin. Ab 2002 moderierte sie das »ARD-Morgenmagazin«. Diese Nachtschichten gab sie nach dem großen Erfolg ihres ersten Romans »Wir sind doch Schwestern« Ende 2014 auf, um sich tagsüber an den Schreibtisch zu setzen und weitere Bücher zu schreiben. 2015 erschien ihr zweiter Roman »Sei mir ein Vater«, 2018 folgte »Mädelsabend«. Sie lebt mit ihrem Mann, Frank Plasberg, ihrem Sohn und dem Goldendoodle Freddy in Köln.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Eine junge Pastorin am Niederrhein, eine Mutter, die unermüdlich für ihr Kind kämpft, und eine Dorfgemeinschaft, die Schicksal spielt: Anne Gesthuysens neuer Roman ist da!
In der kleinen Gemeinde Alpen am Niederrhein laufen die Vorbereitungen für das jährliche Spargelfest auf Hochtouren. Während die Zelte aufgebaut werden und der Chor rund um Ottilie Oymann über »diskriminierungssensible Sprache« in alten Liedtexten streitet, hat die Pastorin Anna von Betteray ganz andere Sorgen. Raffaela, ein Mädchen, das seit einem Unfall geistig behindert ist, liegt im Koma. Sie wurde bewusstlos aufgefunden, niemand weiß, was passiert ist. Umso mehr brodelt die Gerüchteküche. Wurde das Mädchen Opfer einer Gewalttat? Stecken Drogendealer oder Spargelstecher dahinter?
Die Polizei folgt den spärlichen Spuren, das Dorf ermittelt eifrig mit. Auch ihre eigene Familie bereitet Anna Kummer: Ihre Schwester Maria kämpft mit ihrer Sucht und Ängsten, ihr Neffe Sascha sucht nach Halt, und ihre Mutter versucht ständig, sie zu verkuppeln. Als unvorhergesehene Ereignisse die Familien zusammenbringen, zeigt sich: Hoffnung kann blühen, wenn man es am wenigsten erwartet.
Voll psychologischem Feingefühl und mit hinreißendem Witz erzählt Anne Gesthuysen von Schuldgefühlen und Mutterliebe, der Kraft einer Gemeinschaft und einem Leben, das endlich gelebt werden will.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Raphaël Lorand
ISBN978-3-462-32098-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1 »Der Lenz ist da«
2 Ein düsteres Wiedersehen
3 Die Sekunde ihres Lebens
4 »Der Spargel wächst«
5 Die Pferdeflüsterin
6 »Drum lasst uns in die Wälder ziehn«
7 Kairos
8 »Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama«
9 »Die Mädchen singen Tralala«
10 Verbrennende Erde
11 Schuldig im Sinne der Anklage
12 Entzugserscheinungen
13 »Die ganze Welt ist wie verhext«
14 Das Streben nach Glück
15 Und sie trafen sich vor dem Altar
16 Schwerste Hilfe
17 Das Glück mit Füßen treten
18 »Mädchen lacht, Jüngling spricht«
19 »… hält es jetzt für seine Pflicht«
20 Das Ende der Maskerade
21 Gänseblümchenlotterie
22 Die Suppenkasparin
23 Er tanzte nur wenige Sommer
24 Brot und Spielchen
25 Kistenschlacht
26 Auf der Couch mit Doktor Gruber
27 Wer ist denn die Glückliche?
28 Hühnersuppe mit Schuss
29 Auf Sand gebaut
30 Ein missverständliches Schweigen
31 Offenbarungen nach Johannes
32 Die Stunde der Wahrheit
33 »Fräulein woll’n Sie oder nicht?«
Nachwort
Zitatnachweise
Für Emma
1»Der Lenz ist da«
»Pffft«, machte Tante Ottilie und zuppelte sich ein Stück Schale aus dem Mund. »Den haste aber nicht ordentlich geschält«, tadelte sie ihre Nichte.
»Ich habe den geschält gekauft«, antwortete Mechthild von Betteray. »Also meiner schmeckt ganz hervorragend. Ist auch wirklich à point gekocht, Anna, das muss ich dir lassen.«
»Die haben doch ’ne Maschine, warum ist der denn so schlecht geschält?«, fragte Tante Ottilie und kaute angestrengt. »Ist halt nicht die Qualität wie bei uns. Aber das sage ich dir ja jedes Jahr.« Sie schmatzte wie ein Sommelier bei der Weinverkostung.
»Unsinn. Ein königliches Gemüse wie Spargel kann nur von einem Schloss kommen.« Mechthild nickte unterstützend mit dem Kopf, konnte dann aber auch nicht mehr an sich halten, als Tante Ottilie sich vor Lachen fast verschluckt hätte.
»Herrlich«, sagte die schließlich. »Was geht es uns gut, wenn wir uns darüber streiten können, welcher von den wunderbaren Spargelorten hier am Niederrhein der bessere ist.«
Anna von Betteray saß mit den beiden alten Damen in ihrer Küche. Ihre Mutter Mechthild hatte aus Walbeck, einem berühmten Spargeldorf an der niederländischen Grenze, die ersten Stangen mitgebracht. Walbeck und dort vor allem das Schloss Walbeck, eine malerische Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert, eröffnete die Saison immer etwas früher als die anderen Orte am Niederrhein. In Veen, wo seit nun drei Jahren Anna lebte und als evangelische Pastorin arbeitete, ging der Verkauf erst in ein paar Tagen los.
Sie hatte den obligatorischen Schinken direkt vom Bauernhof besorgt, die Kartoffeln organisiert.
Ottilie Angenendt hatte mit über neunzig Jahren zum voraussichtlich letzten Mal geheiratet, es war bereits ihre fünfte Ehe, aber, als Katholikin betonte sie das stets, sie sei kein einziges Mal geschieden: Sowohl ihr letzter Ehemann, Hannes Oymann, als auch der davor, Hektor Mathiopoulus, als auch der davor, Albrecht Hansen, und der davor, Günter Kamps, hatten je früh das Zeitliche gesegnet. Mit dem, was sie ihr hinterlassen hatten, konnte sich Tante Ottilie zusammen mit ihrem aktuellen Ehemann, Bernd Angenendt, ein bequemes Leben in der Seniorenresidenz Burg Winnenthal leisten. Sie bewohnten dort ein schönes Apartment mit barrierefreiem Bad, einem Schlafzimmer und einer geräumigen Wohnküche.
Wenn sie Familie oder Freundinnen zu Besuch hatte, zog sich Bernd höflich zurück und ließ die Damen »allein schnattern«. So drückte er es aus, und niemand nahm es ihm krumm. »In unserem Alter sind Klischees wie Fahrbahnbemalung: einfach hilfreich«, sagte Tante Ottilie nur und lachte schelmisch.
Anna wusste, was ihr die Spargelzeit bedeutete. Für sie waren es die besten Monate im Jahr.
Nicht nur, weil sie das edle Gemüse schätzte. Sie freute sich auf den alljährlichen Auftritt des Winnenthaler Seniorenchors, denn Tante Ottilie liebte das Rampenlicht.
Jedes Jahr zur Saisoneröffnung gab der Gesangsverein im berühmten Veener Spargelzelt ein Potpourri der guten Laune zum Besten. Die Zutaten waren immer gleich: ein paar bekannte Lieder, passend zum Frühling, die Bernd Angenendt, ehemaliger Leiter des Veener Kirchenchors, mit den Damen einübte, und Texte, die sich über das junge Gemüse und den aktuellen Dorftratsch lustig machten. Den steuerte Ottilie bei. Sie hatte Mechthild und Anna gebeten, mit ihr zu »brähnstormen«.
Doch noch bevor die Teller leer waren, hatten sich die Damen bereits ihrem Lieblingsthema zugewandt: Annas Liebesleben, das, zugegeben, nicht gerade ereignisreich war. Sie verausgabten sich mit Feuereifer an dem Projekt, Anna an den Mann zu bringen, respektive den Richtigen für sie, geschiedene, adelige, evangelische Pastorin, zu finden, was kein leichtes Unterfangen war, zumal die Definitionen von »Mr Right« deutlich auseinandergingen.
»Aber Graf Maximilian Konstantin Petrus Maria von Egmond zu …«
»Mama, wir kennen seinen Titel«, ging Anna genervt dazwischen. Ihre Mutter war eine gebürtige Bürgerliche und ausgesprochen stolz auf ihren Adelsstatus, den sie durch ihre Heirat mit Heinrich von Betteray erlangt hatte. Sie hatte die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass auch ihre jüngste Tochter, Anna von Betteray, geschiedene Khoi, eines Tages »nach oben« heiraten, sich mit einem Grafen, Herzog oder vielleicht sogar einem Prinzen vermählen würde. Die erste Ehe mit Tyiam Khoi, geschlossen in Las Vegas vor einem Friedensrichter, hatte sie als strenge Katholikin schlicht ignoriert, die Scheidung wortlos nickend zur Kenntnis genommen, während Anna vor Kummer kaum hatte atmen können.
Freddy kam angelaufen und legte das Köpfchen auf Annas Knie. Sie glaubte ein missbilligendes Schnauben zu hören. Freddy war ein Mini-Goldendoodle, der bedingungslos auf sein Frauchen fixiert war, jede emotionale Schwingung wahrnahm und es als seine Pflicht ansah, für Ausgleich zu sorgen.
Tante Ottilie betrachtete den Hund. »Sie wird jedenfalls keinen Mann finden, der ihr so zu Füßen liegt wie dieser«, sagte sie nachdenklich. »Und der junge Herr Graf ist dazu ohnehin zu eitel, wenn du mich fragst. Aber was ist denn mit den anderen Kandidaten, die noch im Rennen sind?«
»Wer soll das bitte sein?«, fragte Anna mürrisch.
»Na der Bestatter und der Kriminalist.«
»Haha.« Anna räumte die Teller zusammen. »Ihr fallt doch nicht auf das Dorfgequatsche rein, oder? Und bevor wir das Niveau noch weiter senken, lasst uns lieber über existenziellere Dinge reden. Wir müssen endlich eine Lösung für den Jungen finden. So kann es doch nicht weitergehen: Sein Vater sitzt im Knast, und seine Mutter ist alle halbe Jahre in der Klap…«, sie biss sich in letzter Sekunde auf die Lippen, »…in der Klinik.«
Mechthild von Betteray senkte den Kopf. Ihre blonden Haare waren sorgsam auftoupiert und mit Elnett-Haarspray zu einem Helm verklebt. Keine einzige Strähne wagte es, aus der Reihe zu tanzen. Sie hielt die Augen geschlossen, als koste es sie Kraft, nicht in Tränen auszubrechen. Ihre Lippen zitterten.
Es machte Anna traurig, ihre Mutter so zu sehen. Eine Flut von Gefühlen übermannte sie, einige davon waren kindisch, geprägt von Eifersucht auf Maria. Alle Aufmerksamkeit und aller Stolz der Mutter hatte seit jeher der schönen, sensiblen großen Schwester gegolten, dem Prinzesschen, das einen Grafen geheiratet hatte, sich in Gesellschaft der Reichen und Schönen bewegte und nun mit einem kräftigen Rumms in ihrer persönlichen Hölle gelandet war.
Sie empfand keine Genugtuung bei dem Gedanken, im Gegenteil, Anna schüttelte sich. Es ging Maria im Moment so schlecht, dass ihr Sohn Sascha bei Anna lebte und niemand wusste, ob und wann sich dieser Zustand wieder ändern würde.
»Mama«, sagte sie beschwichtigend, »wir kriegen das schon wieder hin. Sie ist in Behandlung, das ist das Wichtigste. Und ich würde deshalb auch dafür plädieren, dass sie noch ein paar Monate in der Obhut der Ärzte bleibt.« Damit es diesmal endlich klappt mit dem Entzug, dachte Anna, aber sie sprach es nicht aus.
»Der Junge braucht seine Mutter«, warf Mechtild schniefend ein. »Du darfst ihn ihr nicht wegnehmen!«
Wieder versetzte es Anna einen Stich. Sie liebte ihren Neffen aus tiefstem Herzen, und sie hatte die zwei Jahre genossen, in denen er bei ihr und Freddy gewohnt hatte. Ein bisschen wie ihr eigenes Kind. Und doch lebte Sascha nicht bei ihr, weil sie es so wollte, sondern weil seine Mutter nicht in der Lage war, sich um ihn zu kümmern. Sie schnaubte verächtlich und fragte sich, ob sie sich empörte, weil der Gedanke ihrer Mutter so gemein war, oder weil sie sich ein bisschen ertappt fühlte.
»Sascha ist bei Anna fantastisch untergebracht. Er bekommt alles, was er braucht!«, warf Tante Ottilie ein und lächelte sie versöhnlich an.
»Ihm fehlt eine vernünftige Vaterfigur«, antwortete Mechtild trotzig.
»Du meinst den Vater, der mit seinem blöden Adelstitel im Knast gelandet ist?« Langsam reichte es ihr.
»Er ist unschuldig«, sagte ihre Mutter.
»Er ist rechtskräftig verurteilt.« Anna spürte die Hand ihrer Tante auf ihrem Arm, als ihre Mutter den Lieblingsschwiegersohn weiter verteidigte.
»Als er die Cum-ex-Geschäfte gemacht hat, waren sie noch nicht gegen das Gesetz. Man kann das nicht einfach rückwirkend ändern. Ein Gottfried von Moitzfeld wird sich noch dagegen zur Wehr setzen.«
Anna wollte etwas erwidern, doch Tante Ottilie schüttelte beschwichtigend den Kopf.
»Und ja, genau!«, fuhr Mechthild von Betteray fort, »Sascha braucht einen Vater, der seinen Sohn im christlichen Glauben erzieht und ihn unsere Werte lehrt, genau so einen braucht der Junge.«
Nun sah auch Tante Ottilie Mechthild entgeistert an. »So was wie ›Du sollst nicht stehlen‹, ›Du sollst nicht lügen‹ oder ›Du sollst nicht ehebrechen‹, das sollte ausgerechnet er ihm beibringen?« Selbst ihre sonst immer harmoniebestrebte Großtante konnte sich den Sarkasmus dabei nicht verkneifen.
Mechthild schnappte nach Luft, schwieg aber. Offenbar fiel ihr nichts mehr ein, womit sie den geliebten Schwiegersohn, dessen verwandtschaftliche Verflechtungen bis ins englische Königshaus reichten, verteidigen könnte. Graf Gottfried von Moitzfeld saß in Düsseldorf im Gefängnis, er war wegen Steuerbetrugs in Millionenhöhe zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Zwei Jahre davon hatte er bereits abgesessen und die Zeit hinter verschlossenen Türen verbracht, wie fast alle Menschen, die währenddessen durch die Pandemie an ihr Zuhause gefesselt waren.
»Sascha braucht tatsächlich einen Vater«, seufzte Anna schließlich, da sie die Stille nicht mehr ertragen konnte. »Ich merke von Tag zu Tag, wie er sich verändert, hin- und herschwankt zwischen einem Kind und einem Halbstarken. Manchmal komme ich nicht mehr an ihn ran. Und ich habe Sorge, dass er unglücklich ist.«
»Herrgott, Kindchen!«, unterbrach Tante Ottilie sie lachend. »Der Junge ist vierzehn. Jeder ist in diesem Alter unglücklich. Unglücklich, unsicher und orientierungslos.« Sie schaute auf ihre Fingernägel. »Und außerdem suchen wir ja gerade nach einem Mann für deinen Haushalt. Nicht wahr, Mechthild?« Sie stupste ihre angeheiratete Nichte an, doch Mechthild von Betteray nagte an ihrer Unterlippe und schwieg. »Komm schon, Mechthild!«, sagte Ottilie. »Die Situation ist ernst, aber sie wird nicht dadurch besser, dass du sie …« Freddy unterbrach ihren Gedanken mit ohrenbetäubendem Gebell, und alle drei zuckten erschrocken zusammen. Der Hund hatte es sich angewöhnt, Anna zu bewachen, und in seinen Augen war jeder ein potenzieller Aggressor: vom Amazon-Boten bis zur Haushälterin des Pfarramts der Gemeinde Alpen, Roswitha Erbs. Die besonders. Auch jetzt. Anna wusste, dass es Frau Erbs war, die an der Tür stand, noch ehe sie sie öffnete. Sie hatte in den vergangenen Jahren einen siebten Sinn dafür entwickelt. Wobei es den eigentlich nicht gebraucht hätte. Denn Frau Erbs’ unerbittliche Art, die Klingel schrillen zu lassen, brachte nicht nur den Hund zur Weißglut.
Hektisch versuchte Anna, ihn zu beruhigen, während sie mit der linken Hand nach der Klinke der Haustür tastete. »Ich komme ja schon!«, schrie sie. »Frau Erbs, nehmen Sie bitte den Finger von der Klingel!«
Die Haushälterin des Pfarramtes war eine aufdringliche, zutiefst neugierige Person, der es beinahe körperliche Schmerzen bereitete, wenn nicht alle Informationen bei ihr zusammenliefen.
Frau Erbs stand auf der Schwelle, einen Fuß vorangestellt, als wollte sie verhindern, dass man ihr die Tür vor der Nase wieder zustieß.
»Frau Erbs!«, begrüßte Anna sie und machte keinerlei Anstalten, sie hereinzubitten. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich heute Mittag für Sie nicht zu erreichen bin. Was auch immer es ist, es muss warten.«
Die Haushälterin starrte Anna an, bleich im Gesicht, als wäre der Sensenmann ihr erschienen.
»Raffaela!«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Raffaela liegt im Koma.«
2Ein düsteres Wiedersehen
Heike Müller kniete vor dem Bett, die Stirn war gegen die Matratze gelehnt. Auf dem Laken hatte sich ein nasser Fleck gebildet. Sie hatte sich eine lange Kette mit schwarzen Perlen um die knochigen Finger geschlungen. Ein Kügelchen nach dem anderen floss durch ihre Hände, während sie andächtig murmelte. »Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.«
Ihre Stimme war rau und brüchig. Immer wieder wurde ihr Singsang von heftigem Schluchzen unterbrochen. Die trauernde Frau hatte nicht erkennen lassen, ob sie das Eintreten der Notfallseelsorgerin bemerkt hatte.
Als Anna ihre Stelle als Pastorin der evangelischen Gemeinde Alpen angetreten war, hatte sie auch die Leitung einer konfessionsübergreifenden Notfallseelsorge übernommen. Diese Arbeit, auch wenn sie sehr aufwühlend war und ihr viel abverlangte, lag ihr besonders am Herzen, deutlich mehr als der Pastorinnenalltag. Eine Weile stand Anna still in der Tür und wartete geduldig auf ein Zeichen.
Hinter dem Bett piepste ein EKG-Gerät, ein Blick darauf verriet, dass Raffaelas Herz langsam, aber regelmäßig schlug. Die Beatmungsmaschine rauschte und summte wie ein Blasebalg.
Das Krankenzimmer war karg. Die Wände pastellgelb tapeziert, über dem Krankenbett hing ein schlichtes Bronzekreuz, ein weißer Stein prangte in der Mitte. Rechts neben der Eingangstür war das Bad, links ragte eine abgrundtief hässliche Schrankwand in den Raum, ein typisches Krankenhauszimmer.
Anna hatte nach ihrer »Geschichte«, wie sie die schlimmste Erfahrung ihres Lebens nannte, lange Zeit in einem solchen Zimmer gelegen, mehr tot als lebendig. Und sie hatte Stunden damit verbracht, sich zu fragen, warum Krankenzimmer immer so schrecklich aussahen. Warum es immer so freudlose Räume waren, als sollten sie einem den Abschied vom Leben erleichtern.
Sie schloss die Augen und horchte in sich hinein. Ein beklemmendes Gefühl überkam sie, ein leichter Schwindel, als wäre sie unterzuckert. Seit Jahren litt sie an Diabetes, hatte aber gelernt, mit der Krankheit umzugehen. Als sie die ersten Muster vor ihren Augen tanzen sah, kniete sie sich vor das Bett und faltete ebenfalls die Hände.
Erst jetzt schien die Trauernde sie wahrzunehmen. Sie griff nach Annas Fingern und umklammerte sie. »Anna«, sagte sie. Mehr nicht. Anna wunderte sich über die seltsam vertraute Ansprache. Sie konnte sich nicht erinnern, Heike Müller schon einmal begegnet zu sein. Aber ihr Dorf war klein, Raffaelas Mutter wusste sicher, wer sie war, auch wenn sie nicht in die evangelische Kirche ging. Soweit sie wusste, war Raffaela katholisch. Sie kannte das Mädchen nur aus Erzählungen, es gab in dem kleinen Ort nicht viele Kinder mit einer geistigen Behinderung.
Nach einer Weile ließ Heike Müller von ihr ab und legte die Hände vors Gesicht. »Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld«, betete sie weiter.
Anna hätte sie gerne getröstet, doch für den Moment konnte sie nur abwarten.
Sie war von Frau Erbs zum Krankenhaus beordert worden, »ein Notfall«, hatte sie gesagt, ohne die Genugtuung in der Stimme, die Anna von ihr kannte, wenn sie Informationen weitergab. Die Haushälterin war zutiefst erschüttert gewesen. Da Frau Erbs nicht in der Lage dazu gewesen war, hatte ihr bislang niemand gesagt, was passiert war. Sie vermutete, dass Raffaela einen Unfall gehabt haben musste. Über ihre geistige Behinderung hinaus war Raffaela, soweit Anna wusste, nicht krank gewesen.
Bis zum Hals lag ein Tuch über dem Körper des Mädchens. Es schien, als hätte man es bereits für den Tod bereitgelegt, ein Leichentuch, das man ihr nur noch über das Gesicht ziehen musste. Anna schüttelte sich bei dem Gedanken. Die Hände des Mädchens waren am Bettgestell festgebunden. Anna zog die Augenbrauen hoch. Die Mutter des Mädchens folgte ihrem Blick. »Sie hatte Spasmen«, sagte sie. »Die Ärzte mussten sie festschnallen.« Anna nickte. »Sie hat einen gequälten Geist. Nicht so wie die Downies.« Anna zuckte bei dem Wort zusammen, doch die Frau schien das nicht zu bemerken. »Alle Downies, die ich kenne, sind glückliche Kinder. Sie freuen sich ihres Lebens. So war Raffaela nie. Sie hasst es, behindert zu sein. Sie wollte immer genauso sein wie alle anderen. Wie all die gesunden Kinder. Mit Behinderten will sie nichts zu tun haben. Und die Gesunden können mit ihr nichts anfangen. Sie ist oft einsam, eine kleine, traurige Seele.«
Anna konnte den Schmerz, den diese Mutter über das Unglück ihrer Tochter empfand, nachfühlen.
»Hast du eigentlich Kinder, Anna?«
Sie wunderte sich erneut über die vertraute Anrede, sagte aber nichts dazu, sondern schüttelte den Kopf. »Nein, aber mein Neffe lebt seit einiger Zeit bei mir. Ich habe ihn nicht geboren, aber ich liebe ihn sehr. Daher kenne ich die Trauer, wenn man einem geliebten Kind die Last, die es erdrückt, nicht abnehmen kann.«
Heike Müller sah ihr lange in die Augen. Es fiel Anna schwer, diesen Blick zu deuten. Sie verbot sich zu mutmaßen und beschloss zu warten, bis die Mutter ihre Gedanken preisgeben wollte.
Erst als die Frau sich wieder ihrer Tochter zuwandte, regte sich etwas in Annas Gedächtnis. Überrascht starrte sie Heike Müller an, dachte angestrengt nach. Sie kannte diese Frau, sie hatte das Gefühl, dass sie sie vor langer Zeit gekannt hatte.
»Heike, bist du das?« Es fiel ihr wie Schuppen von den Augen. »Die hübsche Heike mit den rotblonden Zöpfchen?« Erschrocken hielt sie sich die Hand vor den Mund.
Heike lächelte kurz. »Heike Ingensiep. Genau, so hieß ich damals.« Dann verdunkelte sich ihr Gesicht wieder. »Es kommt mir vor, als wäre das in einem anderen Leben gewesen.« Sie wandte sich wieder ihrer bewusstlosen Tochter zu.
Es musste fast ein Vierteljahrhundert her sein, dass sie und Heike sich zuletzt begegnet waren. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass eine Freundin aus Kindertagen hier in ihrem Dorf lebte. Heike dagegen schien es gewusst zu haben, kein Wunder, sie hieß ja auch immer noch von Betteray mit Nachnamen, außerdem hatte sich der ganze Ort wochenlang das Maul zerrissen, als sie in ihre alte Heimat zurückgekehrt war, um die Stelle des alten Pastors zu übernehmen.
Anna riss sich zusammen, um ihre Wiedersehensfreude oder auch nur die Neugier, die damit einherging, im Zaum zu halten. Die üblichen Fragen waren nicht angebracht. Also blieb sie stumm.
Mit einem plötzlichen Quietschen öffnete sich die Tür. Beide Frauen erschraken, als ein Tross von Medizinern den Raum betrat.
»Mein Name ist Doktor Haderbruth, Frau Müller?« Der Arzt betonte den Namen merkwürdig, als würde er entweder sich selbst oder Heike infrage stellen. Mit einem Räuspern kam er näher und fuhr mit ernster Stimme fort. »Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber ich kann im Moment leider nichts für Ihre Tochter tun. Wir müssen abwarten, ob der liebe Gott sie zu sich holt oder bei uns lässt.«
Die Stille, die nach diesem Satz eintrat, war erdrückend. In Annas Ohren rauschte es. Die fünf Mediziner schauten betreten zu Boden, sie schienen allesamt den Atem anzuhalten. Heike schaukelte mit ihrem Oberkörper vor und zurück. Anna hörte, wie ihre Fingernägel über das Laken des Bettes kratzten.
Das Schweigen senkte sich über sie wie eine schwere Decke, und Anna hatte das Gefühl, daran zu ersticken. Der Chefarzt hielt den Kopf gesenkt, vielleicht betete auch er. Und so standen sie da in ihren weißen sauberen Kitteln, minutenlang, bis sich Anna entschied, die Situation aufzulösen.
»Können Sie uns sagen, was genau mit Raffaela passiert ist?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete Doktor Haderbruth. Anna sah ihn fragend an, versuchte dann, zu einem der anderen Ärzte Blickkontakt herzustellen. Ein Mitte dreißigjähriger Mann schaute unsicher zu seinem Chef, dann wieder zu Anna.
»Sie ist aus einem noch nicht bekannten Grund ohnmächtig geworden und unglücklich gefallen. Möglich wäre in der Folge eine Unterversorgung mit Sauerstoff oder ein Schädel-Hirn-Trauma, obwohl …« Er schien an seiner Theorie zu zweifeln und führte den Satz nicht zu Ende. »Auf jeden Fall ist sie in einen Graben gefallen, wie wir von den Rettungskräften gehört haben. Aus dem Schlick konnte sie sich in ihrem Zustand nicht befreien.« Er rieb sich mit dem Zeigefinger ein Auge.
»Danke«, sagte Anna. »Vielleicht könnten Sie uns jetzt noch einen Moment allein lassen?«
Der Chefarzt räusperte sich. »Es ist mir wirklich unangenehm, aber ich muss Ihnen noch eine Frage stellen, Frau Müller.« Er wartete, aber Heike reagierte nicht. »Frau Müller«, setzte er erneut an. »Ich weiß, das ist nicht leicht für Sie. Aber … wenn wir wissen wollen, warum Ihre Tochter ohnmächtig geworden ist und wie dieser … dieser Unfall passieren konnte, dann müssen wir einige …«, er stockte, »Untersuchungen des Gehirns vornehmen. Dazu brauchen wir Ihre Einwilligung.«
Heike schnappte nach Luft. Sie begann zu würgen, dann schüttelte sie heftig den Kopf.
»Ich denke, das ist nicht der richtige Moment für diese Besprechung«, ging Anna dazwischen, bevor Heike eine Antwort geben konnte. Sie stand noch völlig unter Schock, ihre Tochter rang mit dem Tod, sie war nicht in der Lage, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Aus ihrer Erfahrung als Notfallseelsorgerin wusste Anna, dass es manchmal eine Weile dauerte, bis die Seele verstand. Erst dann konnte man der Frage nachgehen, warum etwas geschehen war.
Der Chefarzt nickte seiner Gefolgschaft zu und trat an die trauernde Mutter heran. Er legte ihr sanft die Hand auf die Schulter. »Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen«, sagte er. Dann gab er Anna ein Zeichen und ging vor die Tür. Sie folgte ihm langsam, unsicher, ob es ihr zustand, vom Arzt ins Vertrauen gezogen zu werden.
Als er die Tür zum Krankenzimmer von außen geschlossen hatte, sah er Anna ernst an. »Haben Sie Raffaela gekannt?«, fragte er.
Sie wiegte den Kopf. »Nein, eigentlich nicht. Ich kenne ihre Mutter von früher, aber wir haben uns über zwanzig Jahre nicht gesehen. Aber ich weiß natürlich, wer Raffaela ist. Worum geht es denn?« Sie wunderte sich, dass Doktor Haderbruth konsequent in der Vergangenheitsform von Raffaela sprach. Er schien nur wenig Hoffnung zu haben.
Der Arzt rieb sich die Hände, als verteilte er eine sterile Lösung zwischen den Fingern. »Ich habe Raffaela damals behandelt, als es passierte. Und ich wüsste gerne, ob der Unfall in ihrer Kindheit mit ihrem Koma heute zusammenhängt. Oder ob es andere Einwirkungen von außen gab. Darum möchte ich Sie bitten, mit Frau Müller über die Untersuchungen zu sprechen und ihr zuzuraten.« Doktor Haderbruth machte eine Pause, musterte sie, schien sich die Frage zu stellen, ob die junge Notfallseelsorgerin die richtige Adressatin für sein Anliegen war. Gerade als er weitersprechen wollte, ertönte das Geräusch von Absätzen hinter ihnen. Sie schauten beide in den hellen Flur, der die Krankenhausstationen miteinander verband. Die Wände waren zur Hälfte gekachelt, darüber leuchtete die gleiche an Vanillepudding erinnernde Raufasertapete wie im Krankenzimmer. Es waren die Schritte einer Nonne. Sie lief an ihnen vorbei, murmelte dem Chefarzt einen Gruß zu. »Schwester«, nickte der zurück.
Anna nahm den Faden wieder auf. »Sie haben gerade von einem früheren Unfall gesprochen. Was meinen Sie damit? Was ist passiert?«
»Ach, ich dachte, Sie kennen Heike Müller und ihre Geschichte.« Es klang wie der Tadel eines Lehrers, der von seinem Schüler enttäuscht ist.
»Helfen Sie mir doch schnell auf die Sprünge«, bat sie ihn.
»Raffaela war nicht von Geburt an beeinträchtigt. Sie war ein kräftiges kleines Mädchen, als sie geboren wurde. Doch dann kam es zu einer schweren Hirnblutung.«
Er seufzte. »Wir mussten damals die Schädeldecke öffnen, um der Schwellung Raum zu geben. Danach waren ihre geistigen und motorischen Fähigkeiten sehr stark eingeschränkt.« Er schloss kurz die Augen, dann beugte er sich zu Anna und senkte die Stimme. »Es gibt noch etwas anderes, das ich untersuchen müsste.« Er räusperte sich. »Wissen Sie, sie hatte Hämatome an den Armen. Wie nach einem Gerangel. Ich würde gerne ausschließen, dass …«, er zögerte, »dass jemand an dem Unfall beteiligt war.«
»Das ist doch Quatsch«, entfuhr es Anna unwillkürlich, und sie wunderte sich im selben Moment über die Vehemenz, mit der sie widersprach.
»Warum?«, fragte er knapp und runzelte die Stirn.
Anna biss sich auf die Lippen. Sie schluckte. »Wer würde denn so etwas tun?«, fragte sie krächzend.
Er lachte sarkastisch. »Sie sind Pastorin, Sie glauben an Unfehlbarkeit. Das ist schön, aber auch ein wenig naiv«, sagte er. Der Chefarzt sah sie von oben herab an, was seiner Größe geschuldet war. Er war fast zwei Meter groß, hatte schütteres Haar, das einen Kranz um sein Haupt bildete, und war dem Rentenalter vermutlich nicht mehr fern. Sicherlich hatte er schon einiges an menschlichem Leid und Elend gesehen. Er war schlank, hatte schmale Lippen, die ihn bitter erscheinen ließen. Offenbar war er schnell gewillt, das Schlechteste anzunehmen, dachte Anna und unterdrückte ein Seufzen.
Sie war immer noch nicht sicher, ob sie verstand, was er sagen wollte.
»Glauben Sie ernsthaft, dass jemand das Mädchen absichtlich zu Fall gebracht hat?«, fragte sie schließlich mit einer Mischung aus Skepsis und Abwehr.
»Bitte legen Sie mir so etwas nicht in den Mund«, sagte Doktor Haderbruth scharf. »Ich möchte nur wissen, ob die Hämatome an den Unterarmen und der Zustand des Kindes in einem Zusammenhang stehen. Ich bin Wissenschaftler. Ich halte mich an Fakten, ohne sofort wilde Schlüsse zu ziehen.«
»Entschuldigen Sie, wenn ich Sie missverstanden habe. Aber was haben Sie mir denn sagen wollen?« Anna war dieses Gespräch zusehends unangenehm.
Der Arzt verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich denke, es wäre gut, wenn jeder das macht, was er am besten kann. Und ich möchte Sie bitten, Frau Müller eine medizinische Untersuchung ihrer Tochter nahezulegen. Aber bitte ohne diese ARD-Tatort-Mutmaßungen.« Er lächelte schmal und drehte sich auf dem Absatz um.
Ärzte!, dachte Anna und schüttelte den Kopf. Leise ging sie wieder in das Krankenzimmer zurück, in dem Raffaela lag. Heike hatte sich inzwischen den einzigen Stuhl des Raumes herangezogen und saß neben dem leblos wirkenden Körper ihrer Tochter. Anna bemerkte, dass sie eine Hand unter das Laken geschoben hatte. Sie schluckte. Der Anblick war schwer zu ertragen. Es gab keinen echten Trost, die Wahrscheinlichkeit, dass Raffaela aus dem Koma nicht mehr erwachte, war zu groß.
Sie stellte sich an das Fußende des Bettes und hielt sich verstohlen daran fest. Jetzt galt es zu warten, bis sie gebraucht wurde.
Heike Müller atmete ruhig, äußerlich machte sie nicht den Anschein, aufgewühlt zu sein.
»Raffaela kann Ärzte nicht ausstehen«, sagte sie. Ein Lächeln umspielte ihre Lippen. »Wenn ich mit ihr zum Zahnarzt muss, dann beißt sie die Zähne so fest aufeinander, dass man es knacken hört. Sie will partout nicht, dass jemand in sie reinguckt. Ich kann nichts machen. Für alle notwendigen Behandlungen muss man ihr eine Vollnarkose verabreichen.«
»Warum hat sie so große Angst vor Ärzten?«, fragte Anna.
»Ich vermute, sie hat nie verwunden, dass man ihr als Baby den Schädel aufgesägt hat.« Sie rollte mit den Augen. »Ich weiß, das klingt verrückt. Aber ich glaube, sie hat das alles gespeichert. Die Ärzte haben behauptet, Raffaela würde nichts mehr mitkriegen, ihr Gehirn sei nicht mehr funktionsfähig nach der Hirnblutung. Aber das stimmt nicht. Sie kann sich nur nicht so deutlich mitteilen. Deshalb ist sie immer so wütend.«
Sie sah auf und schaute Anna an. Ihre Augen waren strahlend blau. Heike war eine sehr schöne Frau mit einem gewinnenden Lächeln. Nicht umsonst hatten ihre Eltern sie immer nur »die hübsche Heike« genannt. Sie war schlank, drahtig und hatte ein ebenmäßiges Gesicht mit einer kleinen Stupsnase und geschwungenen Lippen. Entfernt erinnerte sie Anna an Julia Roberts. Man sah ihr jedoch die Sorgen an, tiefe Falten hatten sich in ihre Haut gegraben.
Sie nahm das Tuch von Raffaelas Hals und faltete es ordentlich auf Schulterhöhe. Dann küsste sie die Stirn ihres Mädchens, schmiegte die Wange kurz an ihre. »Ich tu dir das nicht an, mein kleiner Schatz. Du wirst nie wieder leiden, es wird niemand in dich reingucken.« Sie stand auf und ging zu ihrem Mantel, der in einem Knäuel auf dem Boden vor dem Schrank lag. Auf Raffaelas Wange war eine Träne zurückgeblieben. Sie rann langsam hinab. Es sah aus, als hätte das Mädchen geweint.
»Ist jemand bei dir, wenn du nach Hause gehst?«, fragte Anna.
»Nein«, antwortete Heike, ohne sich umzudrehen. Sie ging ein paar Schritte, überlegte es sich dann anders und kam zurück. »Mach dir keine Gedanken um mich. Ich habe mich vor vierzehn Jahren jede Nacht von meinem Kind verabschiedet. Dieser Schmerz ist ein alter Bekannter.«
3Die Sekunde ihres Lebens
Xanten im Mai 2008
Sie blinzelte in die Sonne, Wärme durchflutete sie. Heike ging zur Kaffeemaschine, hörte, wie die Bohnen gemahlen wurden, und sog den würzigen Geruch ein. Sie liebte Kaffee, trank ihn den ganzen Tag über, aber in der Früh würde sie ohne eine starke Tasse nicht funktionieren. Sie war ein klassischer Morgenmuffel, brauchte lange, bis sie aus den Federn kam, und noch länger, bis sie das erste Wort sprechen konnte. Zu Beginn ihrer Beziehung mit Kai hatte er liebevoll darüber gespottet, an guten Tagen hatte er ihr sogar einen Kaffee ans Bett gebracht. Kai hatte Charme, das musste man ihm lassen, er war ein Menschenfischer: gut aussehend, zugewandt, hatte immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Alles schien leicht, nichts anstrengend, mittlerweile, nach vier Ehejahren, hatte sie leider festgestellt, dass auch nichts an ihm besonders tiefschürfend war. Er war ein oberflächlicher Mensch, mit sich im Reinen, hedonistisch, und wenn man Teil seines Glücks war, wurde man liebevoll umsorgt. Heike war eine Schönheit, das wusste sie. Die Männer waren ihr nachgelaufen, solange sie denken konnte. Warum sie sich für Kai entschieden hatte, hätte sie heute nicht mehr zu sagen vermocht. Sie hatte beeindruckendere Typen als ihn am Start gehabt, manche waren reicher, andere klüger, wieder andere witziger. Aber Kai war von allem etwas, und das hatte Heike zugesagt. Es gab Freundinnen, die ihre Skepsis geäußert hatten, vorsichtig gefragt hatten, ob Kai bei all seiner Selbstverliebtheit noch Gefühle für jemand anderen aufbringen könne. Im Grunde, dachte Heike manchmal, hatte sie sich nicht für einen Mann entschieden. Sie hatte sich aufpicken lassen. Kai war einfach hartnäckig gewesen und der Erste, der sich getraut hatte, ihr die entscheidende Frage zu stellen.
Es war ein merkwürdiger Moment gewesen, weder romantisch noch besonders. Sie hatten zusammen zu Abend gegessen und sich nichts zu sagen gehabt. Nach einem »Risotto der Ruhe«, so hatte sie es später getauft, war er aufgestanden, war vor ihr auf die Knie gegangen und hatte gefragt, ob sie ihn heiraten wolle. Heike hatte nicht lange nachgedacht. Sie hatte einfach »Ja« gesagt. Es hätte sich nicht gehört, eine solche Frage abzulehnen. Kai hatte diesen Moment nicht geplant, es schien eine völlig spontane Eingebung gewesen zu sein, er hatte weder einen Ring noch Champagner noch ein paar Worte der Liebe für sie vorbereitet. Kurz nach der Hochzeit war Heike schwanger geworden. Sie hatte Kinder haben wollen, solange sie denken konnte, mit welchem Mann, war nebensächlich. Nun war es Kai geworden, und sie hatten inzwischen zwei, Johannes und Raffaela.
Sie umfasste die Kaffeetasse mit beiden Händen und genoss die frühen Sonnenstrahlen. Sie hatte nicht besonders viel geschlafen in der Nacht, aber das machte ihr nichts aus. Die Kleine war quengelig gewesen, und sie hatte sie alle zwei Stunden gestillt. Zu allem Unglück war dann auch noch Joe zu ihnen ins Ehebett gekrabbelt, und zu viert war es zu eng geworden. Da Kai in der Woche fit sein musste, war er schließlich ins Arbeitszimmer auf die Couch geflüchtet. Raffaela war schon ein Jahr alt, aber sie wurde nachts immer noch gestillt. Heike empfand die körperliche Verbundenheit zwischen Baby und Mutter beinahe als heilig, als übernatürlich schön, unabhängig von all den Vorteilen für die Gesundheit und das Immunsystem des kleinen Menschen. Sie hatte sich nie viele Gedanken über Gott gemacht, aber in ihrer Mutterschaft hatte sie ihn oder sie gefunden. Sie hatte sich eine Zeit lang sehr für Naturreligionen interessiert, ihr gefiel die Vorstellung einer Göttin. Heike atmete tief durch, trank einen Schluck von ihrem Kaffee und sah auf die Uhr. Es war halb neun, bis sie Joe aus dem Kindergarten abholen musste, blieben ihr noch vier Stunden. Genug Zeit, um ein paar der Umzugskartons auszupacken. Sie waren gerade erst in das Haus auf dem Xantener Berg gezogen. Seine Eltern hatten ihnen bei der Finanzierung zur Seite gestanden. Es war perfekt. Sollte sie je wieder arbeiten wollen, war das Rathaus in Xanten nah, sie könnte im Sommer dorthin radeln. Eines Tages würden die Kinder ebenfalls mit dem Rad zum Gymnasium fahren können. Kai arbeitete in Alpen, auch er hatte es nicht weit. Er war im Marketing bei einem der größten Arbeitgeber der Region beschäftigt, der Maschinenfabrik Lemken. Ihr Ehemann war ein guter Verkäufer, vermutete Heike und lächelte in sich hinein. Wenn sie ihre Arbeit als Beamtin nicht wieder aufnehmen, sich ausschließlich um die Kinder kümmern wollte, hätten sie trotzdem genug Geld, um davon zu viert oder sogar zu fünft zu leben. Das Haus war groß genug, es hatte Platz für drei Kinderzimmer. Es war ein altes Arbeiterhaus, in unmittelbarer Nähe zur Hees, einem kleinen Waldstück, das auf einer der wenigen Anhöhen am unteren Niederrhein lag. Eine eiszeitliche Moräne hatte den Xantener Berg geschaffen, wobei die Bezeichnung »Berg« eine Übertreibung war. Es hatte früher, als im Januar noch ordentlich Schnee gefallen war, gerade so gereicht, um rodeln zu können.
Eine Wiese auf dem Xantener Berg war für kleinere Kinder reserviert gewesen. Meist kamen die Mütter mit und setzten sich gemeinsam mit ihren Sprösslingen auf den Schlitten oder standen mit einer Thermoskanne Tee beieinander und tauschten die neuesten Gerüchte aus. Die größeren Kinder, die Jugendlichen, die trafen sich in der Hees. Eine steile Abfahrt zog sich wie eine Bobbahn durch den Wald. Schnee lag nur wenig mitten im Wald, sodass die Abfahrt aus Eis oder gefrorenem Schlammschnee bestand. »Todesbahn« wurde die Bahn genannt, denn wer mit Karacho aus der Kurve rutschte, konnte sich sehr wehtun. Heike erschauderte beim Gedanken daran, dass sie sich im Winter 1986 einen Arm gebrochen hatte. Sie hatte damals noch nicht in Xanten, sondern in Kevelaer gewohnt, aber ihre Mutter kam aus Birten und hatte hier Verwandte. Ihre Cousins hatten sie überredet, die gefährliche Abfahrt zu nehmen. Danach hatte sie die Todesbahn nie wieder betreten.
Sie fragte sich, ob sie wohl heute noch existierte. Egal. Der Tag war viel zu schön, um sich an Winter und Schmerzen zu erinnern.
Heike machte sich einen Plan: Sie würde drei Kisten auspacken, dazwischen einen Spaziergang mit der Kleinen unternehmen. Vielleicht würde sie bis ins Dorf gehen und Johannes abholen. Wenn er auf dem Heimweg müde würde, könnte er sich problemlos auf das extra dafür installierte Trittbrett ihres Kinderwagens stellen. Vorausgesetzt, das Wetter spielte mit. Sie suchte auf der Anrichte nach der Fernbedienung, öffnete den Bildschirmtext und stellte mit Genugtuung fest, dass es für den Rest der Woche frühlingshaft bleiben würde.
Sie rührte einen Möhrenbrei für Raffaela an, setzte sich mit ihr auf die Terrasse und ließ sie spielen. Wie alle Kinder in dem Alter nahm sie den Plastiklöffel in ihr kleines Händchen, schaute ihre Mutter grinsend an und warf ihn in hohem Bogen hinter sich. »Das machst du bitte nicht noch einmal«, ermahnte Heike und konnte sich ein Grinsen kaum verkneifen. Natürlich wiederholte Raffaela ihren Trick wieder und wieder, und jedes Mal tat Heike ihr den Gefallen, den Löffel aufzuheben, sie liebevoll zu tadeln und das Besteck wieder aufs Tischchen zu legen. Schließlich nahm Heike ihr den Löffel ab, um sie zu füttern, was Raffaela mit einem empörten Quieken quittierte. Sie blies die Wangen auf und prustete Heike das pürierte Gemüse ins Gesicht. Dabei lachte sie sich scheckig. Heike konnte nicht anders als mitzulachen. Es war zu niedlich, wie das Baby sich über das Unheil freute, das es angerichtet hatte. Der Mensch war offenbar von Natur aus schadenfroh, dachte Heike mit anthropologischem Interesse.
Nach dem Essen legte sie Raffaela bäuchlings in den Laufstall und machte sich ans Auspacken. Sie zog wahllos einen Karton heran und erwischte die Bücher. Sie war erleichtert. Bücher ein- und ausräumen ging schnell.
Es waren Bücher, von denen sie sich nicht hatte trennen können. Kai las wenig, ab und zu ein Sachbuch. Im Gegensatz zu ihm liebte sie es, abends mit einem Glas Wein im Sessel zu sitzen und ein gutes Buch zu lesen. Vor allem die Amerikaner hatten es ihr angetan, Jonathan Franzen, T. C. Boyle, Toni Morrison natürlich, aber auch Philip Roth und Jonathan Safran Foer. Sie hatte ein paar Semester amerikanische Literatur studiert, bevor sie sich für die Beamtenlaufbahn entschieden hatte, also kannte sie auch die ganzen Klassiker wie Hemingway, Steinbeck, Bellow. Sorgfältig schob sie die Bücher in das noch leere Regal, begann zunächst, sie nach Epochen zu sortieren, war unzufrieden, versuchte es mit dem Alphabet, um sie schließlich nach Größe und Farbe geordnet einzuräumen. Sie trat einen Schritt zurück, prüfte ihr Werk und war zufrieden.
Sie warf einen Blick auf Raffaela und bedauerte, dass sie den Laufstall nicht in den Garten stellen konnte. Er war zu unhandlich und sperrig.
Sie nahm einen zweiten Karton auf, wuchtete ihn ins Wohnzimmer und schaute hinein. Fotoalben. Versonnen blätterte sie in einem dunkelrot marmorierten Einband. Jede Seite bestand aus durchsichtigem, inzwischen leicht vergilbtem Plastik, das unterteilt war und Raum für vier Fotos bot. Es waren versammelte Bilder aus ihrer Kindheit. Sie blieb an einem Foto hängen, das sie mit drei oder vier Jahren zeigte, und musste laut lachen. Das kleine Mädchen mit rotblonden Zöpfen starrte in die Kamera und weinte, es zeigte auf einen Jungen, der verstohlen einen Ball vom Boden aufhob. Heike glaubte sich noch an diese Szene erinnern zu können. Sie hatte mit einem älteren Nachbarsjungen Fußball gespielt. Es war ein schwerer Lederball gewesen. Er hatte den Ball mit seinen Fußballschuhen gut getroffen, er war ihr mitten ins Gesicht geflogen. Sie betrachtete das Bild. Interessant, dachte sie. Heutzutage regte man sich über Menschen auf, die an Unfallstellen gafften oder fotografierten. War das früher anders gewesen? Sie hatte damals offensichtlich geweint, und ihre Mutter hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als die Polaroidkamera zu holen und auf den Auslöser zu drücken. Empörend! Sie lachte und blätterte weiter. Auf dem nächsten Bild war sie erneut mit dem Nachbarn zu sehen, sie saßen stolz im Sandkasten und matschten zufrieden mit einer Gießkanne herum. Heike erinnerte sich, dass sie eines Tages darin Kartoffeln gepflanzt hatten. Ein Foto zeigte, wie sie stolz neben der ausgebreiteten Ernte saß.
Und dann wusste sie plötzlich, was sie tun wollte. Sie klappte das Album zu und hob Raffaela aus dem Laufstall. »Komm, meine Süße«, säuselte sie, »du kriegst jetzt einen Spielplatz!«
Liebevoll küsste sie die Kleine und warf sie ein paar Zentimeter in die Höhe. Raffaela quietschte vor Vergnügen. Ihre Haare wehten, sie ruderte mit den Beinchen in der Luft herum. »Na gut, du wilde Maus«, rief Heike und sauste mit ihrer Kleinen durch die Wohnung. Dabei hielt sie das Baby bäuchlings in den ausgestreckten Armen. Beide lachten und lachten, bis Heike beinahe umgefallen wäre. Sie hatte keinen besonders gut ausgeprägten Gleichgewichtssinn, ihre Füße fühlten sich manchmal taub an, wie eingeschlafen.
Sie zog ihrer Tochter eine Jacke an, setzte ihr ein Mützchen auf und legte sie in die Babyschale. Raffaela war groß für ihre vierzehn Monate, ihre Füße hingen deutlich über den Rand. »Du wirst laufen lernen müssen, mein Schätzchen«, seufzte Heike. »Bald kann die Mama dich nicht mehr tragen.« Raffaela gurrte glücklich. Sie ließ das Köpfchen zur Seite fallen und entspannte sich.
Kleiner Satansbraten, dachte Heike und erinnerte sich an die unzähligen Nächte, die sie mit Raffaela durch die Wohnung gelaufen war oder sie im Buggy auf- und abgefahren hatte. Einige Monate lang hatte Raffaela partout nicht in ihrem Bettchen schlafen wollen. Nur das sanfte Schaukeln auf dem Arm oder im Kinderwagen hatte sie zur Ruhe gebracht. Aber wehe, sie hatte es gewagt, das vermeintlich tief schlafende Kind wieder ins Bettchen zu legen. Sofort war das Geschrei losgegangen und hatte zu allem Unglück auch noch Johannes aufgeweckt. Ein Klassiker, den alle jungen Mütter kannten.
Raffaela schmatzte zufrieden und war so gut wie eingeschlafen, als Heike die Babyschale ins Auto hievte und festschnallte.
Als sie nach fünfzehn Minuten auf dem Parkplatz des Baumarktes in Alpen ankamen, überlegte Heike, was sie nun mit dem schlafenden Baby machen sollte. Aufwecken war keine Option, denn Raffaela würde sicher den ganzen Baumarkt zusammenbrüllen vor Wut. Was, wenn sie die Kleine einfach im Auto ließe? Es war nicht sehr heiß draußen, keine zwanzig Grad, selbst hier drin würden die Temperaturen bestimmt nicht über fünfundzwanzig Grad steigen. Wenn sie die Fenster etwas öffnete, kam zudem genug Luft herein. Sie ließ die Scheiben je einen Zentimeter runter, stieg aus und schloss ab. Dann ging sie ein paar Meter auf den Eingang des Marktes zu, verlangsamte ihre Schritte, drehte sich um. Sie konnte nicht. Ihr Magen drehte sich um bei dem Gedanken, ihr Kind allein zurückzulassen. Es war irrational. Natürlich würde niemand das Baby aus dem Auto klauen. Sie waren in Alpen, nicht in einem finsteren Viertel einer Großstadt. Die Kleine würde auch nicht im Wagen ersticken, das Auto würde nicht plötzlich in Flammen stehen, und doch … Sie schaffte es nicht. Kopfschüttelnd trottete sie zurück zum Auto, hob Raffaela, die auch sofort zu protestieren begann, vorsichtig aus der Babyschale und drückte sie sanft an sich. Raffaela liebte die Stelle zwischen Hals und Schlüsselbein, schniefte und schnüffelte ein wenig, dann entspannte sie sich wieder.
Das fühlt sich besser an, dachte Heike vergnügt und löste einhändig einen großen Einkaufswagen von der Kette. Raffaela sträubte sich ein bisschen, als Heike sie vorsichtig in den Kindersitz bugsierte. Als sie den Wagen in Bewegung setzte, öffneten sich die Augen des Kindes weit. Es strahlte, gluckste vor Freude und riss mit seinen Händchen an dem Stahlgerippe, wie ein Kutscher, der oben vom Bock aus die Pferde antreiben will. Heike tat ihm den Gefallen und ließ den Wagen ein wenig tanzen, drehte ihn einmal um die eigene Achse, um dann nach einem Blick auf die Uhr eilig Richtung Gartenabteilung zu streben.
Sie musste nicht lange suchen, bis sie fand, wonach sie gesucht hatte: eine große, dreißig Zentimeter tiefe Plastikschale in Blau, nutzbar als Planschbecken oder als Sandkasten. Die Schale hatte die Form einer Herzmuschel. Heike wusste genau, wo sie sie hinstellen würde: in die vordere Ecke des Gartens. Dort hätte man von der Terrasse aus den perfekten Blick darauf, könnte aber auch schnell mal etwas in der Küche holen, ohne das Kind lang allein lassen zu müssen.
Heike war eine Helikoptermutter, sagte zumindest Kai. Er fand ihre Vorsicht, Sorge und Aufopferungsbereitschaft für die Kinder maßlos übertrieben. Er sah in seinem Sohn einen kleinen Spielkameraden, darüber hinaus schien er zu glauben, seine Arbeit wäre mit der Gabe der Gene getan. »Wir sind früher von rauchenden Eltern eingenebelt worden, Anschnallgurte gab es nicht, von Kindersitzen oder Fahrradhelmen ganz zu schweigen. Und wir haben es auch überlebt«, pflegte er zu sagen, wenn Heike sich mal wieder Gedanken um die Sicherheit und Gesundheit der Kleinen machte. Sie hatte, um Schadstoffe zu vermeiden, seit sie nicht mehr voll stillte, jede Mahlzeit für Raffaela selbst zubereitet, hatte Brei gekocht und eingefroren, selbstverständlich nur gutes Biogemüse verwendet.
»Morgen hast du eine schöne Spielecke, mein Schatz«, erklärte sie ihrer Tochter. »Wir suchen gleich noch ein Schäufelchen und eine Gießkanne und …« Sie stockte. Sie schlug sich mit der flachen Hand lachend an die Stirn. »Sand, brauchst du, nicht wahr? Was wäre denn ein Sandkasten ohne Sand?«
Heike schob die Plastikschale unten in die Ablage des großen Einkaufswagens. Die blaue Herzmuschel schleifte leicht über den Boden, aber es würde gehen.
Im nächsten Gang ließ sie den Wagen mit Raffaela kurz stehen, behielt ihn aber im Auge und entschied sich schnell für ein Sandspielzeugset, dann lief sie weiter zu den Sandsäcken. Die Säcke waren in Fünfundzwanzig-Kilo-Paketen gestapelt, sie überlegte kurz, vier davon würde sie wohl brauchen. Mühevoll wuchtete sie den Sand in den Einkaufswagen. Raffaela hüpfte jedes Mal leicht nach oben, wenn einer der schweren Säcke in den Gitterkorb fiel. Sie gluckste, es schien ihr zu gefallen.
Vorsichtig bugsierte Heike die schwere Last zur Kasse, zahlte und verließ den Baumarkt. Der Wagen klapperte über die Pflastersteine des Parkplatzes, es kostete Heike viel Kraft, ihn in der Spur zu halten. Mit einem Mal blockierte das linke Hinterrad und gab ein blechernes Geräusch von sich. Dann hörte sie das helle Knirschen von Metall, und das Rad knickte unter der Last weg. Der Einkaufswagen begann, wie in Zeitlupe nach links zu kippen, die Sandsäcke gerieten ins Rutschen. Verzweifelt stemmte Heike sich dagegen, doch es war zu spät.
Mit der Wucht von hundert Kilo klatschte Raffaela aus einer Höhe von gut einem Meter dreißig auf den Asphalt. Das Knacken von Knochen drang in Heikes Ohr, und sie spürte, dass ihr Leben, wie sie es kannte, in diesem Moment vorbei war.
4»Der Spargel wächst«
Martinchen stand auf und machte eine Bogenspannbewegung wie Usain Bolt nach einem siegreichen Hundert-Meter-Lauf. Dann gab er Anna High Five, und sie ließen sich lachend gegen die Rücklehne der alten Holzbank am Stammtisch im Gasthof zur Deutschen Flotte zurückfallen.
Der etwas rundliche junge Mann feierte ihren gemeinsamen Sieg beim Doppelkopf. Freddy bellte aufgeregt und drehte sich im Kreis. »Schon gut, Junge«, sagte Martinchen zu dem Goldendoodle und streichelte ihn zur Beruhigung. »Deinem Frauchen droht keine Gefahr! Ich pass auf sie auf, versprochen.«
»Na, wer hier auf wen aufpasst, ist ja wohl noch nicht raus«, entgegnete Anna amüsiert. »Wenn ich die Dulle nicht aufbewahrt hätte, wäre das Spiel ganz anders ausgegangen.« Anna hatte den letzten Stich mit dem höchsten Trumpf, der Herzzehn, der sogenannten »Dulle«, gewonnen und damit genug Punkte für den Sieg ergattert.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten war Anna endlich angekommen in ihrer Gemeinde. Inzwischen hatten sich alle, selbst die Presbyterinnen, an sie gewöhnt. Tante Ottilie, die ihre Ohren überall hatte, ging sogar so weit zu behaupten, die Dorfgemeinschaft habe sie regelrecht ins Herz geschlossen. Und Anna hatte sich an die beständig brodelnde Gerüchteküche gewöhnt und nahm das Gerede mit Humor.
Ihr, der unglücklich Geschiedenen, wurden Verhältnisse mit Thomas Kamps, dem Bestatter, Martinchen, dem schwulen Postboten, oder Volker Janssen, dem LKA-Mann aus Düsseldorf, angedichtet. Die Indizienlage war für die geschwätzigen Niederrheinerinnen eindeutig: Der Bestatter war bei jeder Trauerfeier, die Anna hielt, nicht nur anwesend, sondern wirkte »wie erleuchtet«, Martinchen hatte einmal bei Anna übernachtet, um auf Freddy aufzupassen, da hatte noch keiner wissen dürfen, dass er sich nichts aus Frauen machte. Und der LKA-Mann hatte ihr bei der Suche nach ihrem verschwundenen Neffen Sascha drei Jahre zuvor auffällig engagiert geholfen. Er war es gewesen, der die Ermittlungen gegen den Vater von Sascha, Graf Gottfried von Moitzfeld, geleitet hatte.
Diese Männer zählten inzwischen zu Annas engsten Freunden, ebenso wie der Dorfschulrektor Schang Schmitz und seine Frau Karin sowie die hawaiianische Sängerin Malia, die das Leben verrückterweise nach einigen Umwegen in das kleine Dorf am Niederrhein verschlagen hatte.
Anna war nur knapp zwanzig Kilometer weiter nördlich in Kevelaer geboren und aufgewachsen, doch ihre Studienjahre in Düsseldorf ließen sie in den Augen der Menschen aus dem Dorf zu einer fremden Städterin werden. Für die Alten war sie damit eine Bedrohung, für die Jungen eine Verheißung. In Wahrheit war sie weder das eine noch das andere, aber ihre unverblümte Art, mit der sie eine Sonntagspredigt zum Thema gleichgeschlechtliche Liebe gehalten hatte, hatte nicht wenige im Dorf irritiert. Doch das war lange her.
Thomas war als Geber an der Reihe und mischte die Karten sorgfältig, wobei er die ganze Zeit derart verschmitzt grinste, dass man glauben konnte, er hätte sich alle Asse in den Ärmel gestopft. Er zählte laut beim Austeilen und räumte damit jeden Zweifel aus. Schang und Karin Schmitz beäugten ihr gemeinsames Blatt. Die beiden waren so eng verbunden, dass sie sich nicht einmal vorstellen konnten, beim Kartenspielen gegeneinander anzutreten. Also spielten sie zusammen, wobei sie sich mit dem Halten der Karten und dem Entscheidungsrecht konsequent abwechselten.
»Sagt jemand was?«, fragte Martinchen in die Runde, bevor er das Kreuzass spielte. Schweigend bedienten die anderen die Farbe. »Schlimm, was der kleinen Raffaela zugestoßen ist«, sagte Thomas in die Stille hinein. Er wollte beiläufig klingen, warf Anna jedoch einen verstohlenen Blick zu. Anna mochte keine Neugier, das wusste er, er tastete sich also vorsichtig heran. »Weiß man schon, wer sie so zugerichtet hat?«
Anna sah den Bestatter fragend an. »Was meinst du mit ›so zugerichtet‹?«
Martinchen räusperte sich, wandte sich dem Hund zu und kraulte ihn kraftvoll hinter den Ohren. Freddy konnte es nicht leiden, wenn er für Übersprungshandlungen herhalten musste. Er jaulte empört auf und verkroch sich unter der Bank hinter Annas Beinen. Martinchen wurde rot. Er hatte sich vor einigen Monaten selbst einen Goldendoodle-Welpen namens Gloria zugelegt. Doch den hatte er heute Abend bei seiner Mutter zu Hause gelassen.
»Nun, sie soll doch angegriffen worden sein. Sogar ziemlich brutal, hört man.« Thomas Kamps hatte sein sonst so breites Grinsen abgelegt.
»Wer behauptet so etwas?«, fragte Anna ungehalten. »Immer diese Rederei im Dorf.« Martinchen sprang seinem Freund zur Seite.
»Die Bäckerin hat es meiner Mutter erzählt«, erklärte er. »Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Irgendjemand muss sie umgeschubst haben, und dann ist sie in dem kleinen Graben fast ertrunken.«
»Der Graben da ist höchstens dreißig Zentimeter tief«, sagte Schang skeptisch.
»Aber das reicht ja leider, wenn man ohnmächtig ist«, gab Thomas zu bedenken.
»Schluss jetzt! Das gibt es doch nicht!« Anna knallte die Karten auf den Tisch. »Wieso erzählt ihr so einen Unsinn? Noch weiß niemand, was genau passiert ist. Das Schlimmste ist, dass nur wenig Hoffnung für sie besteht.« Anna schluckte, als sie sich an die bedrückende Szene im Krankenhaus erinnerte. »Es war auf jeden Fall ein furchtbares Unglück«, sagte sie trotzig. »Bitte verbreitet nicht auch noch solche Gerüchte, es ist schon schlimm genug für Heike.«
Martinchen sah verlegen auf seine Karten, Thomas Kamps holte gerade Luft, um sich zu verteidigen, als Freddy anschlug. Der Hund bellte jeden Neuankömmling so kraftvoll an, dass man ihn für einen Kampfhund hätte halten können. Doch sein lockiges sandfarbenes Fell und die braunen Kulleraugen ließen ihn aussehen wie ein Stofftier, er war viel zu niedlich, um einen Angreifer in die Flucht zu treiben. Aber, da er nicht in den Spiegel gucken konnte, hielt sich Freddy für einen Wachhund und egal, wo er sich befand, er war im Dienst.
»Na, du kleiner Killer«, wurde er von Volker Janssen begrüßt. Der LKA-Mann kraulte ihn ausführlich hinter den Ohren, diesmal ließ er es sich gefallen und genoss die Zuwendung, was Martinchen mit einem beleidigten »Na, toll!« quittierte. »Gut, dass ich Gloria habe.«
Volker Janssen hatte sich drei Jahre zuvor von seiner Ehefrau getrennt. Da er einen Fall am Niederrhein zu bearbeiten hatte, hatte er Düsseldorf verlassen und war in sein Elternhaus gezogen. Inzwischen hatte er die Stallungen auf dem stillgelegten Bauernhof zu einer Wohnung ausgebaut und beschlossen, vorerst in Alpen zu bleiben, zumal seine Mutter, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollte, mit ihren dreiundachtzig Jahren etwas tüdelig geworden war.
Anna war froh, dass sie nicht die Einzige war, die aus der Stadt in die Heimat zurückgekehrt war. Sie trafen sich regelmäßig.
Tante Ottilie machte weit mehr daraus, als es war. Ihre über neunzigjährige Großtante war eine hoffnungslose Romantikerin. Sie hatte immer ein gutes Händchen für Männer gehabt, auch ihr aktueller Ehemann, den sie im Seniorenheim Burg Winnenthal kennengelernt hatte, war ein Glücksgriff. Die beiden waren ein wunderbares Paar. Das war der einzige Grund, warum Anna ihr die Neckereien nicht übel nahm.
»Also, welche Sau wird heute durchs Dorf getrieben?«, fragte Volker Janssen fröhlich in die Stammtischrunde, während er zur Begrüßung mit der Faust auf den Tisch klopfte.
Martinchen sah Thomas an, dann Anna, dann hielt er das Schweigen nicht mehr aus. »Raffaela liegt im Koma«, platzte er heraus.
»Raffaela? Ist das nicht das behinderte Mädchen? Na, wie heißt die noch gleich mit Nachnamen? Die da oben am Xantener Berg wohnt.«
»Darf man ›behindert‹ noch sagen?«, fragte Martinchen und gab sich die Antwort gleich selbst. »Ich glaube, man spricht von Menschen mit Handicap.«
Schang Schmitz sah den Postboten überrascht an. »Raffaela Müller. Genau«, antwortete er schließlich. »Sie hat mit ihrer Mutter und dem Bruder recht zurückgezogen gelebt. Der Junge war ein herausragender Schüler. Netter Junge, sehr wohlerzogen. Das Mädchen übrigens auch.«
»Mein Gott, wie traurig. Was ist ihr denn zugestoßen?« Volker Janssen setzte sich und zog sich die Jacke aus.
»Du hast wohl noch nicht mit deiner Mutter gesprochen?«, fragte Martinchen vorsichtig. Volker ignorierte die Frage, schaute zu Anna. »Was ist passiert?«
»Sie hatte einen Unfall«, sagte Anna langsam. »Sie ist ohnmächtig geworden und in den kleinen Graben in der Hees gefallen.«
Thomas schnaubte. »Das klingt aber etwas sehr harmlos, oder? Ehrlich gesagt, heißt es, sie sei übel zugerichtet worden. Die Leute im Dorf sagen, sie sei angegriffen worden. Ihr Leben hängt am seidenen Faden.« Er fing sich einen zornigen Blick von Anna ein, hielt dem aber stand.
»Das ist nur Gerede«, erklärte sie Volker schnell. »Ich war im Krankenhaus und habe mit Raffaelas Mutter und den Ärzten gesprochen.«
»Und, was sagen die über die Unfallursache?«, fragte Volker Janssen. Es war die routinierte Frage eines Kriminalisten.
»Sie wissen noch nicht genau, was passiert ist. Sie müssten ein paar Untersuchungen vornehmen, um herauszufinden, warum sie ohnmächtig geworden ist. Aber …«, Anna überlegte, wie sie es am besten in Worte fassen konnte, Heikes Versprechen an ihre Tochter hatte sie sehr berührt. Volker missdeutete ihr Zögern. »Aber was?«, fragte er scharf.