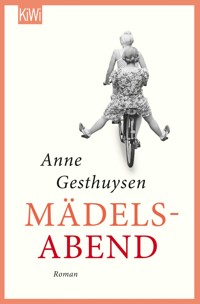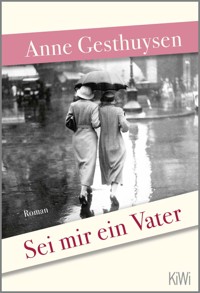9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von einer jungen Pastorin am Niederrhein, die ihre Gemeinde aufmischt, vom Aufwachsen zweier ungleicher Schwestern in Adelskreisen und vom Mut, den es braucht, ein Leben selbst zu gestalten, wenn alles vorherbestimmt scheint. Die Bürger der Gemeinde Alpen sind skeptisch, als Anna von Betteray die Vertretung des erkrankten Pastors übernimmt. Schließlich ist sie geschieden, blaublütig, mit Mitte dreißig viel zu jung für den Posten und eine Frau. Der einzige Mann an ihrer Seite: ihr Hund Freddy. Während Anna versucht, ein dunkles Kapitel ihrer Vergangenheit zu bewältigen und die Gemeinde behutsam zu modernisieren, gerät das Leben ihrer Schwester Maria komplett aus den Fugen. Ihr Mann wird verhaftet, kurz darauf verschwindet auch noch ihr Sohn. Ausgerechnet sie, die in den Augen der standesbewussten Mutter die Vorzeigetochter war, die auf Schützenfesten zur Königin gekrönt wurde und einen Grafen heiratete, während Anna mit schmutzigen Hosen im Stall spielte und sich in die falschen Männer verliebte. Erst in der Not überwinden die Schwestern ihre Gegensätze – und erhalten Unterstützung von überraschender Seite. Denn wenn es darum geht, einen kleinen Jungen zu finden, halten die Alpener fest zusammen. Und allen voran: Ottilie Oymann aus dem Seniorenstift Burg Winnenthal! Anne Gesthuysen erzählt in ihrem neuen Roman mit unvergleichlichem Witz, großer Herzenswärme und Feingefühl von einer Familie, die sich erst verlieren muss, um sich zu finden. »Stimmungsvolles Drama um Rivalität unter Schwestern, Resilienz und Leben am Niederrhein, Heimat der Autorin.«Hörzu
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Anne Gesthuysen
Wir sind schließlich wer
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Anne Gesthuysen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Anne Gesthuysen
Anne Gesthuysen wurde 1969 am unteren Niederrhein geboren. Nach dem Abitur in Xanten studierte sie Journalistik und Romanistik. In den 90er-Jahren arbeitete sie bei Radio France. Als Reporterin hat sie für WDR, ZDF und VOX gearbeitet, schließlich auch als Moderatorin. Ab 2002 moderierte sie das »ARD-Morgenmagazin«. Diese Nachtschichten gab sie nach dem großen Erfolg ihres ersten Romans »Wir sind doch Schwestern« Ende 2014 auf, um sich tagsüber an den Schreibtisch zu setzen und weitere Bücher zu schreiben. 2015 erschien ihr zweiter Roman »Sei mir ein Vater«, 2018 folgte »Mädelsabend«. Sie lebt mit ihrem Mann, Frank Plasberg, ihrem Sohn und dem Goldendoodle Freddy in Köln.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als Anna von Betteray die Vertretungsstelle in Alpen am Niederrhein antritt, wird sie von den Dorfbewohnern mit Argwohn betrachtet. Sie sind sich einig: Eine junge Adelige, die, abgesehen von ihrem Hund Freddy, keinen Mann an ihrer Seite hat und noch dazu geschieden ist, passt nicht hierher. Während Anna bei dem Versuch, die Gemeinde sanft ins 21. Jahrhundert zu überführen, gegen allerlei Widerstände zu kämpfen hat, gerät das Leben ihrer Schwester Maria komplett aus den Fugen. Ihr Mann wird verhaftet, kurz darauf verschwindet auch noch ihr Sohn. Ausgerechnet sie, die in den Augen der standesbewussten Mutter die Vorzeigetochter war, die auf Schützenfesten zur Königin gekrönt wurde und einen Grafen heiratete, während Anna mit schmutzigen Hosen im Stall spielte und sich in die falschen Männer verliebte. Um den Jungen zu finden, versuchen die Schwestern, ihre Gegensätze zu überwinden. Und merken bald, dass sie nicht allein sind: Denn wenn es darum geht, einen kleinen Jungen zu finden, halten die Alpener fest zusammen.
Inhaltsverzeichnis
Fisternölleken
Was Leib und Seele zusammenhält
Kindheit im guten Glauben
Ein Ständchen in Ehren
Die ersehnte Prinzessin
Schlafes Bruder
Gerüchteküche
Der passende Prinz
Eine Seele in Not
Die Fassade bröckelt
In flagranti
Ein gescheitertes Kind
Königin von Schravelen
Immer Ärger mit den Jungs
Ein unverhofftes Wiedersehen
Grenzgänger
Die Königin hat einen in der Krone
Von einem, der auszog, um daheimzubleiben
Zur deutschen Flotte
Adel verpflichtet
Die Wahrheit kommt per Post
Die Saat des Zweifels
Gräfin vom Latzenbusch
Auf der Suche nach dem verlorenen Kind
Am Rande des Latzenbusch
Die Wahrheit über Maria
Das Ende aller Hoffnung
Ein Ruf aus der Gemeinde
Enthüllungen jeglicher Art
Der Prinz kommt aus Amerika
Rendezvous mit dem Teufel
Strategieplanung am Fußballfeld
Eine brillante Spur
Schach der Dame
Teamarbeit auf der Königsallee
Rückwärtsgewandt
Stein um Stein
Schicksal lässt sich nicht vermeiden
Von David und Jonathan
Auf der Jagd nach der Feuergans
Wie die Jungfrau zum Kinde
Danksagung
Leseprobe »Vielleicht hat das Leben Besseres vor«
Fisternölleken
Anna spürte den Nebel aufziehen. Die Konturen ihres Gegenübers verschwammen, ihr wurde ein wenig schwindelig. Neben ihrer Kaffeetasse stand eine Zuckerdose. Sie überlegte, ob sie sich ein Klümpchen nehmen sollte, dann wäre ihre Benommenheit sicher schnell verflogen, aber ihre Hand zitterte, und den Triumph wollte sie ihm nicht gönnen.
Peng. Der schwere Glasaschenbecher knallte auf die Tischplatte. Sie zuckte zusammen.
»Das war Ihr Platz! Da hätten Sie sitzen müssen. Da sitzt immer der Geistliche an runden Geburtstagen! Aber diesmal war der Platz leer!«
Anna sah, wie sich am Haaransatz des alten Mannes ein Schweißtropfen löste und langsam über die dünne Haut an den Wangenknochen lief. Herr Mahlberg redete sich so langsam in Rage.
»Blamiert bin ich! Bis auf die Knochen! Im ganzen Dorf!«
Peng! Peng! Peng! Zum Rhythmus der Sätze ließ er den Aschenbecher auf den Mahagonitisch im Chippendalestil knallen. Anna kniff die Augen kurz zusammen, doch der Nebel wollte sich nicht lichten. Sie versuchte, die bunten Römer in der Vitrine der Art-déco-Kredenz zu fixieren. Die dunklen Möbel nahmen ihr die Luft, ihr war, als hätte jemand eine staubige Wolldecke über ihr ausgebreitet. Nur vereinzelt drangen Sonnenstrahlen durchs Fenster und hinterließen einige Lichtflecken auf dem Teppich. Anna sah kleine schwebende Partikel, die gemächlich durch den Lichtkanal waberten. Sie wurde schläfrig und unterdrückte mühsam ein Gähnen.
»Hören Sie mir gefälligst zu!«, herrschte Herr Mahlberg sie an.
Beinahe hätte sie »Ja, Papa« geantwortet.
»Verstehen Sie das? Der Pfarrer kommt immer, wenn jemand runden Geburtstag feiert. Nur bei mir war er nicht. Was sollen die Leute denn von mir denken? Dass ich nicht regelmäßig in die Kirche gehe? Nicht genug gespendet habe? Und nun schleichen Sie sich heimlich einen Tag später ins Haus. Heute brauche ich Sie hier nicht mehr. Gestern hätten Sie da sein sollen.«
Anna hatte ihm seinen achtzigsten Geburtstag versaut, so viel hatte sie verstanden. Und sie ahnte, dass sie von Roswitha Erbs, der Haushälterin des Gemeindepfarrers, falsch instruiert worden war. Die dürre Frau in ihren Sechzigern hatte sich kaum Mühe gegeben, ihr Missfallen zu verbergen, als Anna vor ein paar Tagen vor ihr gestanden hatte.
Pfarrer van Bebber war sehr plötzlich erkrankt, und die rheinische Landeskirche hatte sie kurzerhand zum Probedienst nach Alpen an den Niederrhein geschickt. Frau Erbs, die dem Pfarrer seit beinahe zwanzig Jahren zur Seite stand, hatte sie eingewiesen. Beerdigungen, Predigten und runde Geburtstage gehörten zu ihren Hauptaufgaben, hatte sie erklärt, die junge Pastorin gemustert und hinzugefügt: »Nun ja, manchmal ist es den Leuten lieber, wenn man nicht zur offiziellen Feier erscheint, sondern erst in den Tagen darauf vorbeikommt. Vor allem wenn es nicht der echte Pastor ist.«
Anna hatte die Spitze überhört, das Gesagte für bare Münze genommen, und nun hatte sie den Schlamassel. Herr Mahlberg hatte sich inzwischen gesetzt, schimpfte aber unvermindert laut und schlug mit der Faust auf das kaffeebefleckte Spitzendeckchen. Der Krach hallte dumpf in Annas Kopf nach, sie versuchte mit aller Kraft, die aufkommenden Erinnerungen zu verdrängen. Wenn du etwas nicht ändern kannst, dann musst du dich entspannen. Vitali Klitschko hatte diesen Satz in einer Fernsehdokumentation gesagt. Anna straffte die Schultern und atmete tief durch.
»Da brauchen Sie gar nicht so zu schnauben. Das gehört sich einfach nicht. So etwas tut man hier im Ort nicht.« Anna setzte kurz dazu an, das Missverständnis auszuräumen, ließ es dann aber. Ihre Hand zitterte noch immer, sie musste dringend etwas gegen die Unterzuckerung tun.
»Ach nee, jetzt kommen Se plötzlich doch noch«, hatte die alte Dame an der Tür zur Begrüßung gesagt. »Herrmann, da ist eine Frau von der Gemeinde!«, rief sie über die Schulter ins Haus hinein.
»Wat denn, heute?«
»Ja, gestern war sie ja nicht da.«
»Ich komm«, hörten sie ihn oben grollen. »Die wird mich kennenlernen.«
»Dafür bin ich ja da«, sagte Anna lachend, doch Frau Mahlberg bedeutete ihr mit einem Augenrollen, dass Scherze nicht angebracht waren. Sie gingen durch einen engen, dunklen Flur, an einer Tür vorbei, die offenbar lange nicht mehr benutzt worden war, an ihr klebten dicke Spinnenweben. »Da haben meine Schwiegereltern früher gewohnt«, sagte die Dame und hielt sich am Geländer einer knarzenden, mit Teppich belegten Treppe fest, die nach oben führte, wo Herr Mahlberg sie bereits erwartete. Er hatte sich nicht einmal mehr die Zeit für Höflichkeitsfloskeln genommen, sondern direkt mit seinem Donnerwetter losgelegt.
Anna bedauerte, dass sie Freddy nicht mitgenommen hatte. Wahrscheinlich hätte er den Kopf schief gelegt und gebellt, das tat er, sobald sie sich unwohl fühlte. Es war sein Job. Freddy war ein Goldendoodle und ein fast fertig ausgebildeter Diabetikerhund. Sie hatte leicht erhöhte Zuckerwerte, die, so vermuteten die Ärzte, durch einen Schock ausgelöst worden waren. Anna hatte ihre Krankheit ganz gut im Griff, auch ohne Insulinspritzen, sie musste lediglich gering dosierte Tabletten nehmen. Nur ab und zu, vor allem in Stresssituationen, glitt sie in die Unterzuckerung ab.
»Mehr ist dazu nicht zu sagen« war das Mahlberg’sche Schlusswort, danach stand er auf und ließ sie allein mit seiner Frau zurück.
Die seufzte tief und zog die Stirn in Falten, es war nicht eindeutig zu erkennen, wessen Benehmen sie tadeln wollte. Dann erhob sie sich ebenfalls und machte ihr klar, dass sie nun gehen könne. Als sie die Haustür erreichten, wurde Anna schwarz vor Augen. Sie lehnte die Stirn an die Wand. Das half immer.
Frau Mahlberg erschrak. »Kindchen, da musst du dich nicht selbst bestrafen. Das macht man doch nicht. Nun lass mal gut sein, so schlimm war es auch wieder nicht. Der alte Griesgram hat völlig übertrieben.«
Anna winkte ab. »Könnte ich vielleicht ein kleines Stückchen Zucker bekommen?«, fragte sie.
»Ach wat, du setzt dich mal schön in die Küche, ich mach dir was zu essen. So weit kommt das noch, dass du hier rausgehst und mir vor der Tür zusammenbrichst. Wat sollen die Leute denn sagen?«
»Vielen Dank, aber …«
»Keine Widerrede, ich wärme dir ein paar ordentliche Rouladen und ein lecker Sößchen auf. Dat hat noch jeden wieder auf die Beine gebracht.«
Anna riss sich zusammen und lächelte sie an. »Bitte! Ich komme gerne auf Ihre Rouladen zurück. Aber nicht heute. Jetzt brauche ich nur ein Stück Zucker.«
»Ich verstehe«, sagte die alte Frau, drehte sich auf dem Absatz um und gab der schweren Holztür mit ihrem ausladenden Hinterteil einen Schubs. Langsam und leise quietschend fiel sie ins Schloss.
Anna stolperte verdutzt einen Schritt zurück. Hätte sie erklären sollen, dass sie schleunigst zu ihrem Hund musste, bevor er in der guten Stube von Frau Erbs Unheil anrichtete? Freddy war gerade mal drei Jahre alt. Er war als Welpe zu ihr gekommen, sie liebte ihn wie ein eigenes Kind. Und er liebte sie wie eine Mutter. Wann immer sie böse Erinnerungen heimsuchten, schmiegte er sich an sie, legte ihr den Kopf auf das Knie und schaute sie mit treuen Augen an. Dunkle Gedanken hatten keine Chance. »Wenn Sie Hunde mögen, dann ist jetzt der richtige Moment, sich einen anzuschaffen«, hatte ihr die Therapeutin damals geraten.
Mit einem Ruck wurde die Tür wieder geöffnet, ihr kam ein Tablett mit einer Flasche und zwei Schnaps-Pinnekes entgegen.
»Ein Stückchen Zucker alleine macht schließlich auch nicht glücklich«, sagte Frau Mahlberg mit einem Lächeln, nahm einen der Zuckerwürfel, ließ ihn ins Glas fallen und goss Schnaps ein. »Hier, das nenne ich ein ›Fisternölleken‹.« Während sich die alte Dame ebenfalls einschenkte, dachte Anna kurz darüber nach, was wohl ihr Arzt dazu sagen würde. Dann nahm sie das Gläschen, stieß mit Frau Mahlberg an und kippte den Kurzen runter.
Es gab Situationen, in denen war Vernunft einfach nicht hilfreich.
Was Leib und Seele zusammenhält
Anna wohnte während ihrer Vertretungszeit in Pastor van Bebbers Dienstwohnung, die sich direkt neben dem evangelischen Gotteshaus im Alpener Dorfkern befand. Sie hatte sich im Internet über ihre zukünftige Wirkungsstätte informiert und sich sofort verliebt, als sie die Kirche das erste Mal gesehen hatte. Auch jetzt blieb sie kurz stehen, um sie zu betrachten, obwohl es sie nach Hause zog, wo Freddy auf sie wartete. Mit mehr als vierhundert Jahren galt sie als älteste reformierte Pfarrkirche Deutschlands. Der Architekt, Johannes von Pasqualini, hatte zu Beginn des 17. Jahrhunderts etwas kreiert, was damals als sehr modern galt: eine Wandpfeilerkirche im frühbarocken Stil. Anna lächelte, als sie ihren Weg fortsetzte. Früher waren am Niederrhein also noch Trends gesetzt worden, dachte sie, öffnete die Gartenpforte und zog den Haustürschlüssel aus der Tasche. Damals, als der Herzog von Jülich-Kleve-Berg Wilhelm der Reiche seinem Nachfolger noch ein ordentliches Erbe hinterlassen hatte, genug, um eine teure Kirche zu bauen. Diese Information hatte sie von ihrer Familie, die, selbst adelig, jedes große Haus vom Niederrhein bis nach London kannte.
Als sie die Tür hinter sich ins Schloss fallen ließ, wurde sie stürmisch von Freddy begrüßt. Der Hund stand auf den Hinterbeinen und schmiegte sich an sie. Dann drehte er sich im Kreis, sprang erneut an ihr hoch und legte sich auf den Rücken, damit sie ihm den Bauch kraulte.
»Na, mein Junge! Hast du mich vermisst?«, murmelte sie gedankenverloren. Und als hätte der Hund die Frage bejaht, fügte sie hinzu: »Ich dich auch.« Sie setzte sich auf den Boden und tollte ein wenig mit ihm herum, vergrub die Nase in seinem weichen Fell und merkte, wie sie sich allmählich entspannte.
»Frau Doktor von Betteray!?« Frau Erbs betonte jede einzelne Silbe, es klang, als hätte sie ein professionelles Sprachtraining genossen. Anna zuckte zusammen und sah auf. Die Haushälterin hatte eine Kladde in der Hand und schaute sie über den Rand ihrer Lesebrille hinweg unverhohlen feindselig an. Sie schien nicht glücklich über die Wahl, die der Superintendent des Kirchenkreises Moers getroffen hatte. Wahrscheinlich war ihr alles an Anna suspekt: ihr Alter, ihr Geschlecht, ihr Name, ihr Titel und die Tatsache, dass sie unverheiratet beziehungsweise geschieden war. Sie lebte ebenfalls im Haus, das Büro der Pfarrgemeinde verband die beiden Wohnbereiche.
Anna räusperte sich, stand auf und zog ihren Pullover glatt. Wie ein Schulmädchen stand sie vor Frau Erbs, die ungeduldig gewartet hatte.
»Nun, es gibt Probleme bei der Notfallseelsorge, darum müssten Sie sich kümmern. Ein Polizist hat sich über Herrn Henrichs beschwert. Ich denke, das sollten Sie sich mal anhören.«
»Herr Henrichs …?« Anna war sich sicher, den Namen noch nie gehört zu haben.
»Der junge Postbote aus Veen, etwas moppelig, ein lieber Kerl. Er ist einer von fünf Freiwilligen der Notfallseelsorge. Pastor van Bebber ist für die Kreise Wesel und Kleve zuständig«, antwortete Frau Erbs. »Normalerweise passiert hier sehr wenig, wir sind ja auf dem Land, da ist die Welt noch in Ordnung.« In ihrer Stimme schwang Stolz mit, offenbar arbeitete sie sehr eng mit dem Pastor zusammen.
»Was war denn los?«
»Eine schlimme Geschichte oben in Emmerich. Ein junger Mann hat Pflanzengift getrunken.«
Anna verzog das Gesicht. Die Haushälterin nickte. »Er muss furchtbar ausgesehen haben. Als die Nachbarin ihn fand, hat er noch gelebt …« Sie machte eine Pause, überlegte und fügte schließlich murmelnd an: »Jedenfalls ein bisschen. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Die Nachbarin stand so unter Schock, dass man die Notfallseelsorge angerufen hat. Und so kam Martinchen ins Spiel.«
»Martinchen?«
»Ja, so wird er in Veen genannt, weil er immer noch ein bisschen aussieht wie ein dickes Baby.« Die grauhaarige Dame biss sich auf die Lippen. Anna zog die Augenbrauen hoch. »Nun, er sieht noch sehr jung aus«, ergänzte Frau Erbs.
»Verstehe. Warum hat man sich über ihn beschwert?«
Die Haushälterin schüttelte den Kopf, und Anna wunderte sich, dass sich dabei nicht ein Haar bewegte. Ihre Frisur war aus Beton. Sie erkannte das Elnett-Haarspray am Geruch, es war das gleiche, das ihre Mutter täglich benutzte.
»Nun, Martinchen ist hingefahren und hat sich um die Nachbarin gekümmert. Er hat ihr wohl gesagt, er würde ihr erst mal ein Butterbrot schmieren, das hätte seine Oma auch immer getan, um ihn zu trösten. ›En ordentlichen Dubbel zwischen de Zähne, dann gibt et keine Träne‹, sei ihr Motto gewesen. Er hat Brot geholt, Butter, Käse und Wurst, hat dazu ein Spiegelei gemacht, eine ›Gesundheitsschnitte‹, wie er es nennt.«
»Und dann?«
»Dann hat die Frau gesagt, sie bekomme keinen Bissen runter. Sie wolle nichts essen.« Frau Erbs hob die Schultern. »Ja, wat sollter machen? Dat kannst du ja nicht verkommen lassen. Also hat er die Gesundheitsschnitte selbst gegessen.« Sie machte eine kurze Pause. »Und dann wohl noch eine. Und noch eine. Und am Ende war der Kühlschrank leer gefuttert.« Anna hatte Mühe, ein Grinsen zu unterdrücken, als sie sich die Szene vorstellte. Aber natürlich verstand sie, dass die Nachbarin darüber nicht lachen konnte.
»Wie kann denn so etwas passieren?«, fragte sie mit leichtem Vorwurf in der Stimme.
»Das macht das Martinchen immer, wenn er nervös ist, sagt seine Mutter. Das hat er nicht im Griff.«
»Wieso haben Sie mit seiner Mutter darüber gesprochen?«
Die Haushälterin schaute sie fragend an. Anna hielt dem Blick eine Weile stand.
»Okay. Ich werde mich darum kümmern«, versprach sie schließlich seufzend. »War sonst noch etwas, während ich den Geburtstag von Herrn Mahlberg nachgefeiert habe?« Frau Erbs war ihr Sarkasmus nicht entgangen, sie blickte indigniert auf die Kladde, die sie in den Händen hielt.
»Ihre Frau Mutter hat angerufen und bittet um Rückruf.« Sie drehte sich auf dem Absatz um und verschwand.
Alles an dieser Frau, die Statur, die Strenge, der tadelnde Blick, der Geruch ihrer Haare, erinnerte Anna an ihre Mutter, da hätte sie ebenso gut zu ihr nach Kevelaer ziehen können. Sie nahm sich vor, an Frau Erbs zu üben. How to get along with your mother. Sie ging die Treppe zu ihren Privaträumen hinauf, um dort in Ruhe zu telefonieren.
Mechthild von Betteray, geborene Busmann, war sehr katholisch, sie erzählte jedem, der es wissen wollte, man könne ihre Ahnenlinie bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen, bis zu jenem Hendrik Busmann, der 1641 die Stimme Mariens vernommen hatte, was ihn und seine Frau dazu animiert hatte, die Marienkapelle in Kevelaer zu bauen, die bis heute Pilger aus aller Welt, darunter durchaus auch schon mal ein Papst, anzog. Anna hielt es allerdings für genauso wahrscheinlich, dass die Vorfahren ihrer Mutter schlicht und ergreifend aus dem nordfranzösischen Ort Bus kamen. Denn dort, in der Nähe von Lille, lebten heute noch Verwandte. Doch diese Vermutung hatte sie immer für sich behalten, ebenso wie jene, dass ihre Mutter ihren Vater Heinrich von Betteray vor allem wegen seines Titels geheiratet hatte. Die von Betterays waren zwar nur Etagenadel, aber die Hochzeit hatte ihr den Sprung in die bessere Gesellschaft und ein abgesichertes Leben auf einem Hof mit hundertfünfzig Morgen Land in der Nähe von Kevelaer ermöglicht.
Sie waren nicht besonders wohlhabend, aber, so betonte Mechthild von Betteray stets, »man war schließlich wer« am unteren Niederrhein.
Anna gehörte zu den Menschen, die sich gerne vor unangenehmen Telefonaten drückten, so lange es ging. Jetzt hatte sie gleich zwei vor der Brust. Sie stand eine Weile unschlüssig mit ihrem Handy in der Hand in ihrem Schlafzimmer, dann entschied sie sich, mit Freddy eine Runde spazieren zu gehen und dabei zu telefonieren. Zur Not würde sie auflegen und behaupten, die Verbindung wäre unterbrochen worden. Sie liebte ihre Mutter, sie ertrug sie nur oft nicht.
Sie fuhr nach Birten an den Altrhein, genoss die Septembersonne und sah Freddy zu, wie er hin und her flitzte, jeden Baum markierte und sich immer wieder vergewisserte, dass sein Frauchen noch in der Nähe war. Er hüpfte durch das Schilf, traute sich sogar ein paar Schritte ins Wasser, um dann sogleich stolz zu Anna zu rennen und freudig an ihr hochzuspringen.
»Hallo, Mama!«, sagte sie ins Telefon, nachdem es eine halbe Ewigkeit in der Leitung getutet hatte, und streichelte den Kopf des Hundes.
»Anna, Schätzchen. Leg schnell auf, ich ruf dich zurück!«
»Mama, das ist nicht nötig. Ich rufe vom Handy aus an, und ich habe eine Flatrate.«
»Was hast du? Ich kann dich so schlecht verstehen. Ich rufe dich besser im Pfarrhaus an.«
»Ich bin nicht zu Hause, Mama. Ich bin unterwegs. Sprich doch einfach mit mir.« Es tutete wieder. Annas Mutter hatte aufgelegt. Mechthild von Betteray hasste Handys, genauer gesagt, sie ignorierte, dass es tragbare Telefone gab, daher kannte sie auch Annas Nummer nicht. Sie beschloss, einige Minuten zu warten, ihre Mutter würde erneut mit Frau Erbs sprechen und dabei erfahren, dass Anna nicht im Haus war. Sie warf ein Stöckchen, doch Freddy konnte nichts damit anfangen. Er rannte hinterher, kaute dann aber nur ein bisschen darauf herum und ließ es schließlich achtlos liegen, um einen Schmetterling zu verfolgen.
»Mama, bitte leg jetzt nicht auf. Du wolltest doch mit mir sprechen«, sagte Anna. Sie hörte ein leicht beleidigtes Räuspern.
»Es geht um mein Fest.« Sie machte eine Pause, als erwarte sie umgehend Gegenwehr, doch Anna schwieg. »Also, ich muss sicher nicht betonen, dass mir mein fünfundsiebzigster Geburtstag eine Menge bedeutet und ich mir sehr große Mühe gebe …«
»Aber das weiß ich doch, Mama. Ist doch auch verständlich«, unterbrach Anna sie schnell. Das Fest, das am übernächsten Wochenende stattfinden sollte, wurde seit fast einem Jahr geplant.
»Wir haben die ganze Scheune geschmückt, die Nachbarn kommen zum Kränzen, na, du kennst das ja. Ich erwarte hundertzwanzig Gäste, darunter auch die Familie van Elst und die von Ravensteins, sogar der Hochadel wird vertreten sein.«
Anna unterdrückte ein Gähnen. Mit »Hochadel« war höchstwahrscheinlich die Familie ihres Schwagers gemeint, der einer Apothekerdynastie aus Emmerich entstammte. Einer seiner Vorfahren hatte sich vor Jahrhunderten mit dem Haus Kleve von der Mark verbunden. Ihre Namensvetterin Anna von Kleve war, wenn auch nur kurz, im Jahre 1540 die Gemahlin von Heinrich VIII. und somit englische Königin gewesen. Allerdings war sie angeblich wenig ansehnlich gewesen, sodass der König die Ehe recht schnell wieder hatte annullieren lassen. Ihr Schwager wurde dennoch nicht müde zu betonen, dass seine Familie verwandtschaftliche Beziehungen zum englischen Königshaus habe.
»Dein Schwager bringt seinen Cousin mit, und …«
»Mama, was wolltest du mir sagen?«, unterbrach Anna die Litanei.
»Ich wollte dich nur bitten, dich ordentlich anzuziehen. Das ist alles. Ich hoffe, das ist nicht zu viel verlangt.«
»Was meinst du damit? Ich trage ein Kollarhemd!«
»Aber das kannst du doch wenigstens an meinem Geburtstag mal im Schrank hängen lassen. Zieh dir doch zur Abwechslung ein hübsches Kleid an. Gottfried sagt, sein Cousin habe durchaus Interesse an einer Ehe.«
»Oh Gott, wir sind doch nicht im Mittelalter.«
»Bitte, mein Kind, tu es für mich. Ich freue mich auch, wenn ich damit angeben kann, wie hübsch meine jüngste Tochter ist«, säuselte sie.
Es war nicht das erste Mal, dass sie versuchte, Anna zu verkuppeln. Die Unverblümtheit, die sie dabei an den Tag legte, machte sie zunehmend fassungslos. Dennoch gelang es ihr nicht, ihrer Mutter den Wunsch abzuschlagen.
»Also gut, ich werde sehen, was sich machen lässt«, versprach Anna. Sie blickte dabei auf Freddy und wünschte sich ein Fell.
Kindheit im guten Glauben
»Anna! Endlich!« Sascha kam auf sie zugerannt und flog ihr in die Arme. »Es war so langweilig ohne dich«, flüsterte der blonde Junge ihr ins Ohr. »Niemand von denen spielt Fußball. Die sind sich alle zu fein.« Er verdrehte die Augen und ließ keinen Zweifel daran, was er von der Geburtstagsgesellschaft in der Scheune hielt.
»Hm, verstehe«, murmelte Anna und zwinkerte ihm verschwörerisch zu. »Ich fürchte, wir müssen erst Kirchgang und Essen über uns ergehen lassen. Aber dann verspreche ich dir ein Torwarttraining, das sich gewaschen hat. Am besten auf der Wiese hinter der Scheune, damit du so richtig in die Mocke fliegst.«
»Spielst du in den Klamotten?«, fragte Sascha und schaute sie skeptisch von oben bis unten an. Anna trug ein langes dunkelgrünes Seidenkleid, das sie vor Jahren in einem Designeroutlet erstanden hatte. Es war sehr schlicht, das gefiel ihr. Wenn es schon ein Kleid sein musste, dann durfte es nicht auch noch Rüschen oder anderen Firlefanz haben. Ihre flachen schwarzen Ballerinas passten hervorragend dazu, nur auf dem Fußballfeld würde sie damit nicht weit kommen.
»Fang du nicht auch noch an, an meinem Outfit herumzumeckern«, lachte sie. »Ich habe noch eine Jeans und Turnschuhe im Auto. Und jetzt nimm Freddy und bring ihm das Stöckchenholen bei, während ich mich ins Getümmel werfe. Okay?« Sie hielt ihrem Neffen die Hand zum Abklatschen hin, er schlug ein.
»Check!«, rief der Elfjährige und griff nach der Leine des Goldendoodle. Freddy schaute sein Frauchen verwirrt an. Der Hund entfernte sich nicht gerne weiter als nötig von ihr. »Na, lauf schon, Freddy«, ermunterte sie ihn. »Geht spielen. Ich komme schon allein zurecht.« Sie streichelte ihn, atmete einmal tief durch und lief die lange Auffahrt zum Herrenhaus entlang.
»Da ist meine süße kleine Tochter ja endlich«, flötete ihre Mutter. Anna sah sich unwillkürlich um, sie konnte kaum gemeint sein. Wohl eher ihre Schwester Maria. Doch die war nicht in der Nähe. Maria war das Gegenteil von Anna: zart, auffallend hübsch, sie hatte schon immer ein besonders enges Verhältnis zur Mutter gehabt. Sie war nie aufsässig gewesen, hatte sich immer die richtigen Freundinnen ausgesucht und, noch wichtiger: die richtigen Freunde. Sie hatte schließlich sogar einen reichen, adligen Mann geheiratet. Maria von Moitzfeld war immer adrett gekleidet und ließ sich die Haare, genau wie ihre Mutter, zu einem braven Bob schneiden, der jeden Morgen am Ansatz auftoupiert wurde, um den dünnen Strähnen etwas mehr Volumen zu geben. Eine Frisur, die Anna insgeheim als »Adelshäubchen« verspottete. Mechthild von Betteray vergötterte ihre älteste Tochter. Die beiden telefonierten täglich, natürlich auf dem Festnetz, da Maria keinen Beruf ausübte und fast immer zu Hause in ihrer Villa am Xantener Latzenbusch hockte, während ihr adeliger Ehemann in seinem Büro in einer Düsseldorfer Privatbank arbeitete. Anna war es ein Rätsel, dass diesem unglaublich biederen Ehepaar ein so wunderbar wilder Junge wie ihr Neffe Sascha entsprungen war.
In diesem Moment erreichte ihre Mutter sie, umarmte sie überschwänglich und zog sie mit sich. Bald darauf erkannte Anna, wem das Theater galt: Die Eltern ihres Schwagers standen ganz in ihrer Nähe. Anna lächelte ihre Mutter an, es war schließlich ihr Geburtstag. »Mama, du siehst fantastisch aus!«, sagte sie und meinte es auch so. Mechthild von Betteray hatte nur wenige Falten rund um die Augen, die sie dezent geschminkt hatte, und trug zur Feier des Tages ein wunderschönes dunkelblaues Kleid, das ihrer Figur schmeichelte. Obwohl sie sieben Kinder geboren hatte, war ihre Taille schmal geblieben. Wenn sie ausgeschlafen war, wirkte sie beinahe wie eine Frau in den mittleren Jahren. »Alles Liebe zum Geburtstag, liebste Mama.« Sie hielt ihr ein kleines Geschenk hin. Darin befand sich ein Schnappschuss aus den Achtzigerjahren. Auf dem Bild saß Anna auf einem braunen Shetlandpony, ihre Mutter stand daneben und hielt sie fest.
»Nein, wie hübsch«, rief Mechthild beim Auspacken. Du siehst genauso aus wie ich in dem Alter«, sagte sie. »Das gleiche Mündchen, das Näschen …«
»… und vor allem die Haarfarbe!«, unterbrach Anna sie ironisch. Ihre Mutter redete Unsinn. Die dunklen Haare hatte sie von ihrem Vater. Ihre Mutter und ihre Schwester hingegen waren blond.
»Aber dieses Kleidchen, das sieht aus wie eines aus meiner Kindheit«, beharrte Mechthild. Erst jetzt nahm Anna verblüfft wahr, dass sie auf dem Foto Mädchensachen trug. Sie hatte als Kind Kleider und Strumpfhosen gehasst, auch heute noch trug sie lieber Hosen, selbst unter dem Talar. Sie verkniff sich eine Antwort, umarmte ihre Mutter erneut und machte Platz für die anderen Gratulanten. Nur ein paar Schritte hinter dem Hochadel stand ihre Schwester. Maria hatte die Bescherung verfolgt und kam nun auf sie zu.
»Guten Tag, Anna. Wie lieb, dass du Mutti den Gefallen getan und deinen Talar im Schrank gelassen hast. Sie spricht so ungern darüber, dass du evangelisch geworden bist.«
Anna schluckte. »Wie wäre es denn mit einer herzlichen Umarmung vor dem Tadel?«, schlug sie schnell vor.
»Natürlich, kleine Schwester. Hast du Sascha schon gesehen? Er wird nachher zu Mamas Ehren auf der Geige spielen. Er ist ganz nervös und erwartet dich sehnsüchtig. Und nicht nur er.« Maria zwinkerte ihr verschwörerisch zu. »Vielleicht klappt es ja diesmal. Du wirst direkt neben ihm sitzen.«
»Neben Sascha? Wie schön«, antwortete Anna, ahnte aber, dass ihr Neffe nicht gemeint war.
»Nein, neben Gottfrieds Cousin natürlich. Er heißt Graf Maximilian Konstantin Petrus Maria von Egmond zu Anholt. Du wärst eine Gräfin.«
Anna stöhnte leise, doch ihre Schwester plauderte munter weiter.
»Das Foto mit Stefan ist aber wirklich zauberhaft«, säuselte sie. Richtig, dachte Anna, das Shetlandpony hatte Stefan geheißen. Sie hatte auf ihm reiten gelernt, er war ein echter Satansbraten gewesen. Sie erinnerte sich noch gut daran, dass er jedes Mal, wenn ihr Vater sie auf seinen Rücken gehievt hatte, sofort versucht hatte, ihr ins Knie zu beißen, was ihm oft auch gelungen war.
»Bist du nicht kurz nach dieser Aufnahme im Krankenhaus gelandet?«, fragte Maria.
Anna schaute sie fragend an.
»Ja, ja, ich kann mich noch genau erinnern«, sagte ihre Schwester. »Stefan ist plötzlich losgerast, und du hast dich an seiner Mähne festgekrallt und laut geschrien. Er ist die ganze Zeit um den Kirschbaum gerannt, das weiß ich noch. Und irgendwann fing er auch noch an, wild zu buckeln.«
Anna grinste. Dass sie im Krankenhaus gelandet war, hatte sie verdrängt, aber ihr kamen nun andere Bilder von diesem Nachmittag ins Gedächtnis. »Und hast du dich nicht die ganze Zeit an den Baumstamm gedrückt, weil du Angst hattest, Stefan würde dich umrennen?«
»Nicht ganz.« Maria lachte. »Ehrlich gesagt hatte ich weniger Angst vor dem Pony als vor dir. Du warst schrecklich wütend, nachdem er dich abgeworfen hatte. Du lagst in der Matsche, dein hübsches Kleidchen war zerrissen und dreckig, du hattest eine Platzwunde über dem Auge. Aber das hat dich nicht davon abgehalten, schimpfend hinter Stefan herzurennen. Papa musste dich mit aller Kraft festhalten, so sehr hast du getobt.« Anna schüttelte schmunzelnd den Kopf. »Na, zum Glück ist keine Narbe zurückgeblieben. Narben passen nicht zu einer zukünftigen Gräfin«, schloss Maria und zwinkerte ihr noch einmal zu.
Anna rollte mit den Augen und schaute sich in der festlich geschmückten Scheune um. Die Nachbarn hatten ganze Arbeit geleistet. Sie hatten aus Tannenzweigen Girlanden geflochten, die mit roten und weißen Papierröschen verziert waren. Solche Nachbarschaftsfeste hatte sie früher geliebt. Man traf sich in einer Scheune, die Kinder durften im Stroh toben, während die Männer die Zweige zusammenbanden und die Frauen aus Papierschnipseln Röschen formten. Dabei wurde sehr viel getrunken und gesungen. Sogar ihre dünkelhafte Mutter hatte sich an diesen Tagen fröhlich unters Volk gemischt. »Schön, oder?«, fragte Maria und folgte ihrem Blick. »Ich schaue mal, ob meine Schwiegereltern etwas brauchen. Wir sehen uns später.« Sie legte ihr kurz die Hand auf den Arm und ließ sie stehen.
Anna nahm sich ein Glas Sekt von einem der Stehtische und schlenderte durch die Scheune. Hier und da grüßte sie jemanden lächelnd, bemüht, nicht zu lange zu verharren, um kein Gespräch beginnen zu müssen. Ihr Blick blieb am geschmückten Dachbalken hängen. Hier etwa musste es gewesen sein. Damals, in ihrer Kindheit, hatte ein geistig behindertes Mädchen im Ort gewohnt, das etwa fünf Jahre jünger gewesen war als sie selbst. Sabine war bei jedem Kränzen mit dabei gewesen und hatte mit den anderen Kindern gespielt, während die Erwachsenen den Kranz vorbereiteten. Sie hatte immer laut gesungen und war wohl diejenige gewesen, die diese Abende am meisten genossen hatte. Als sie etwa sieben Jahre alt war, schoben die Kinder in der Betteray’schen Scheune Stroh zu einem großen Haufen zusammen, flochten ein dickes Seil aus Tauen und banden es an einen der Dachbalken. Es war mal wieder Annas Idee gewesen. Sie war die Wildeste von allen und dachte sich die gefährlichsten Mutproben aus. Diesmal galt es, sich in Tarzanmanier an das Seil zu hängen und durch die Scheune zu schwingen, sich im richtigen Moment fallen zu lassen, um sicher im weichen Strohhaufen zu landen. Man brauchte Kraft in den Armen, um sich lang genug festhalten zu können, es war ein großartiges Spiel. Sabine quiekte vor Vergnügen, als der stämmige Christian ihr einen kräftigen Schubs gab. Sie flog über die anderen hinweg und ließ das Seil los. Es gab einen dumpfen Knall, dann war Stille. Sabine war nicht mehr zu sehen. Die Kinder standen um den Haufen herum und warteten darauf, dass das Mädchen herauskrabbelte, doch nichts geschah. Schließlich schlug Edgar, Sabines älterer Bruder, Alarm. »Mama, da ist was nicht in Ordnung«, schrie er. Anna fühlte ein unangenehmes Kribbeln im Nacken. Alle um sie herum schienen sich in Zeitlupe zu bewegen, in ihren Ohren begann es zu rauschen. Sie sah Gertrud Verweyen aufspringen, ihr Stuhl kippte um, sie rannte zum Strohhaufen und begann wie von Sinnen zu graben. Maria warf ihrer Schwester einen finsteren Blick zu. Anna und die anderen Kinder suchten nun ebenfalls hektisch nach dem Mädchen, während die Erwachsenen starr vor Entsetzen am Tisch saßen. Halme stoben durch die Luft, bis ausgerechnet AA sie entdeckte.
»H… hü… hü…«, machte AA, der eigentlich Andreas Abel hieß, und so genannt wurde, weil er fürchterlich stotterte, wenn er nervös war. Natürlich hänselten die Kinder im Dorf ihn, aber sie respektierten doch, dass der Junge mehr Zeit brauchte, um zu sprechen, und wussten, dass man ihm nicht helfen durfte. Also starrten ihn nun alle an und warteten. »I… I…«, stotterte er und zitterte am ganzen Leib.
»Mensch, AA!«, schnaubte Gertrud Verweyen. »Ich hab da heute keine Zeit für.« Sie stolperte auf ihn zu. »Sabine«, schrie sie kurz darauf und wischte ihrer Tochter das Stroh aus dem Gesicht. Vorsichtig zog sie das Kind zu sich heran.
»Ge… ge… ge…funden«, stammelte AA. Anna liefen die Tränen über die Wangen, als sie das Mädchen sah. Kreideweiß, die Augen geschlossen. Keiner sagte einen Mucks, es war totenstill.
»Buh!«, schallte es plötzlich durch die Scheune und Sabine brach in gackerndes Gelächter aus. »Reindelet! Ich hab euch alle reindelet.«
Sie kicherte über ihren gelungenen Streich, bis ihre Mutter ihr eine klatschte und sie im nächsten Moment wieder an sich drückte. »Ich erwürge den Kerl, der dir solche Sachen beibringt«, sagte sie halb weinend, halb lachend, während ihre Tochter sich empört die Wange rieb. Sabines Opa hatte sich, wie sich herausstellte, diesen Streich mit seiner Enkelin ausgedacht.
Anna musste lächeln, als sie an die Geschichte zurückdachte.
Nach dem Sektempfang fuhr die Gesellschaft zur Kirche, in der Annas älterer Bruder Josef die Messe las. Er war katholischer Priester in einer Gemeinde in Coesfeld, hatte aber für Mutters Jubeltag natürlich die Marienbasilika organisiert. Fast die ganze Familie von Betteray saß in der vordersten Bank und lauschte andächtig: Mechthild und vier ihrer sechs Kinder sowie sieben Enkelkinder. Es fehlte nur Annas Bruder Johannes, der wenig Kontakt zur Familie hatte. Er lebte in den USA, in Palo Alto, und arbeitete im Silicon Valley, bei einer großen amerikanischen Bank. Fast nie kam er zu Familienfesten, schickte aber immer üppige Blumenbouquets, die er, wie man hörte, von einem Floristen in Kevelaer penibel nach seinen Vorgaben zusammenstellen ließ. Annas ältester Bruder Heinz war schon sechzehn gewesen, als sie geboren worden war, Roland vierzehn und Johannes neun. Anna hatte zu keinem der drei ein enges Verhältnis.
Mit Josef hingegen, dem katholischen Priester, hatte sie sich in ihrer Jugend sehr gut verstanden, sie hatten über Gott und die Welt sprechen können. Doch das hatte sich geändert, als Anna mit vierzehn aus Protest gegen die rückschrittlichen Ansichten der katholischen Kirche die Firmung verweigert hatte. An einem Sonntag hatte sie bei Kaffee und Kuchen der versammelten Familie ihre Entscheidung mitgeteilt.
»Herrgott, sei unserer armen Seele gnädig«, hatte ihre achtzigjährige Oma gezetert und die Hände zum Himmel gehoben. Der Rest der Familie hatte betreten geschwiegen, bis Mechthild Josef gefragt hatte, ob er seiner Schwester nicht den Teufel austreiben könne. Anna wusste bis heute nicht, ob die Frage ernst gemeint war. Ihre Mutter war nicht tief religiös, der Glaube war für sie so etwas wie das Zähneputzen: Ohne ging es schlechter. Der wöchentliche Kirchgang war ausgesprochen wichtig für die gesellschaftliche Akzeptanz am unteren Niederrhein, vor allem im Wallfahrtsort Kevelaer.
Auch wenn Anna die Konfession gewechselt hatte, die katholischen Reflexe hatte sie noch immer. Deshalb zuckte sie nun kurz zusammen, als sich ihre Familie erhob, um am Abendmahl teilzunehmen. Sie blieb sitzen, sodass sich alle an ihr vorbeidrängen mussten.
»Blamier uns nicht«, zischte Maria ihr zu und gab ihr ein Zeichen, aufzustehen und nach vorne zum Altar zu gehen.
»Aber ich bin nicht berechtigt, am katholischen Abendmahl teilzunehmen«, flüsterte Anna zurück.
»Es geht heute ausnahmsweise nicht um dich, sondern um Mama«, presste ihre Schwester zwischen den Zähnen hervor, bemüht, ihren freundlichen Gesichtsausdruck nicht zu verlieren.
»Ich bleibe bei Sascha«, sagte Anna schnell. Der Junge hatte die erste heilige Kommunion wegen einer Maserninfektion verpasst, es hatte noch keinen Nachholtermin gegeben, er musste deshalb ebenfalls sitzen bleiben. Doch als sie sich gerade zu ihm gesellen wollte, sah sie, wie ihre Mutter die Augenbrauen hochzog und mit dem Kinn auf den Altar deutete. Ihr Blick war nicht etwa herrisch. »Tu es mir zuliebe«, besagte er.
Seufzend stand Anna auf. Sie hatte keine Ahnung, was passieren würde, wenn sie vor Josef stand. Aber das war nun sein Problem, dachte sie trotzig.
Zögerlich stellte sie sich in die Schlange der Gläubigen. Jeder von ihnen formte die Hände zu einem Gefäß, damit der Priester die Hostie hineinlegen konnte. Sie trat vor ihren Bruder.
»Der Leib Christi«, sagte Josef monoton und sah auf. Er stutzte, die Hand samt Hostie zuckte zurück. Er sah sie vorwurfsvoll an, einen Moment lang fürchtete Anna, er würde sie in der Kirche vor allen Leuten maßregeln. Doch er besann sich eines Besseren, legte die Hostie zurück in die Schale und dann seine Hand auf die ihre.
»Amen«, antwortete Anna. Sie war erleichtert.
Ein Ständchen in Ehren
»Wo ist eigentlich Gottfried?«, fragte Anna ihre Schwester vor der Kirche. Sie hatte ihren Schwager noch nicht gesehen, konnte sich aber nicht vorstellen, dass Mechthilds Lieblingsschwiegersohn die Gelegenheit zur Selbstdarstellung verpassen würde.
»Der kommt direkt zum Hof«, antwortete Maria.
Anna meinte ein leichtes Grollen in ihrer Stimme zu vernehmen. Oha, dachte sie, im siebten Himmel ziehen Wolken auf. »Ist alles in Ordnung bei euch?«, fragte sie deshalb.
»Natürlich! Was soll denn nicht in Ordnung sein? Gottfried hat nur ausgerechnet heute einen Termin, den er nicht verschieben konnte. Er arbeitet sehr viel in letzter Zeit. Aber er bringt seinen Cousin mit, und dann kümmern wir uns mal um dich.« Maria lächelte ihr zu, tätschelte ihr die Wange, drehte sich auf dem Absatz um und ging zu der Traube aus Nachbarn und Freunden, die sich um ihre Mutter gebildet hatte.
Anna rührte sich nicht vom Fleck und beobachtete die Szenerie. Die Jubilarin stand vor der Marienbasilika, umringt von Gratulanten, und hielt ihr perfekt geschminktes Gesicht der milden Herbstsonne entgegen. Sie hatte eine besondere Ausstrahlung, die sie leider nur Maria vererbt hatte. Es war, als würde ein Scheinwerfer ihnen Glanz verleihen. Betrat eine der beiden einen Raum, drehten sich alle Köpfe in ihre Richtung. Anna hatte sich neben der schönen Schwester manchmal wie Aschenputtel gefühlt.
Sie hörte ein Tapsen auf dem Asphalt, drehte sich um und musste lachen. Ihr Prinz war zwar etwas haarig, aber sie hatte keinen Zweifel an seiner Liebe. Sascha hatte Freddy aus ihrem Ford Fiesta geholt, sie hatte ihn nicht mit in die Kirche nehmen dürfen. Nun zerrte er an der Leine, um zu seinem Frauchen zu gelangen.
»Können wir endlich Fußball spielen?«, maulte Sascha. »Bis zum Essen dauert es doch mindestens noch eine Stunde. Ich verspreche auch, dass ich mich nicht dreckig mache.«
»Das will ich doch hoffen, immerhin wirst du nach der Suppe deinen großen Auftritt haben«, sagte Anna und knuffte ihren Neffen in die Seite.
»Erinner mich bloß nicht daran. Mir wird ganz schlecht, wenn ich dran denke.«
»Ach was, das wird wunderbar. Und du kannst dich auf ein sehr wohlwollendes Publikum freuen.«
»Ich kann aber gar nicht spielen. Mama gibt immer damit an, dass ich Geige lerne. Aber ich kann fast nichts. Und was ich kann, klingt scheiße.«
»Das sagt man nicht«, tadelte sie ihn und verkniff sich ein Lachen. Erst als sie sah, wie sich Sascha verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel wischte, wurde ihr bewusst, dass er wirklich in Not war. »Ach komm, so schlimm wird es schon nicht werden. Du führst mir dein Stück mal vor, und dann sehen wir weiter.« Sie nahm ihn an die Hand und ging mit ihm zum Auto, um zurück zum elterlichen Hof am Rande der Schraveler Heide zu fahren. Die anderen machten sich ebenfalls zum Aufbruch bereit.
Der Betrieb wurde inzwischen von ihrem Bruder Heinz geführt, der mit seiner zweiten Frau Ute drei erwachsene Kinder hatte. Keines davon schickte sich an, den Hof zu übernehmen, die beiden Söhne lebten im Ausland, und Tochter Maya hatte sich für einen Bergbauern im Allgäu entschieden.
Die drei Kinderzimmer waren also wieder verwaist, Annas sah immer noch so aus wie damals, als sie es mit achtzehn Jahren verlassen hatte.
Ihre Eltern hatten auf der Wiese hinter dem Kuhstall, etwa dreihundert Meter vom Hof entfernt, einen sogenannten »Altenteil« gebaut, einen modernen Bungalow mit eigener Zufahrt, damit sie bis ins hohe Alter hinein in den eigenen vier Wänden würden bleiben können. Leider war es ihrem Vater nicht vergönnt gewesen, so lange zu leben. Er starb noch vor seinem siebzigsten Geburtstag. Mechthild wohnte nun allein dort.
Anna und Sascha kamen vor dem Rest der Festgesellschaft an und setzten sich in das Wohnzimmer des Bungalows. Der Junge packte seine Geige aus und schaute sich das Instrument unschlüssig an.
»Na, trau dich«, ermunterte ihn Anna. »Wir kriegen das schon hin.« Sascha nahm sich Zeit, um die Geige zwischen Kopf und Schulter zu platzieren. Seine kleinen Finger suchten die richtigen Stellen auf den Saiten, dann atmete er einmal tief durch. Er setzte den Bogen an und spielte einen Ton. Es klang jämmerlich. Der Junge schloss die Augen und verbeugte sich. Anna sah ihn verdutzt an. Die Verbeugung dauerte deutlich länger als sein Spiel. Schließlich richtete er sich wieder auf. »Das war’s!«
»Oh, ähm …gut!«, sagte Anna zögernd. »Kannst du noch etwas anderes spielen?«
Ihr Neffe schüttelte den Kopf. Er wagte es nicht, ihr in die Augen zu sehen.
»Ich verstehe.« Sie runzelte die Stirn. Der arme Kerl hatte nicht übertrieben. »Das reicht nicht ganz für ein Geburtstagsständchen, fürchte ich. Komm mit.« Sie zog Sascha hinter sich her zum Hof, wo sie in Annas früheres Zimmer huschten, in dem noch immer ihre alte Gitarre an der Wand hing. »Ich kann zwar auch nicht gut spielen, aber wenn ich dich begleite, müsste es gehen. Du spielst deinen Ton, und ich zupfe dazu Happy Birthday.« Sie probten eine Weile, bis das Quietschen der Geige im Ton der Gitarre quasi unterging. Es war nicht wirklich schön, aber der Junge war zufrieden.
»Du bist meine Rettung! Jetzt blamiere ich mich wenigstens nicht alleine«, rief er und fiel Anna um den Hals. Stimmt, dachte sie, so, wie es aussah, würde vor allem sie sich blamieren. Einem Elfjährigen würde man diesen Auftritt sicher verzeihen, ihr nicht. Aber sei’s drum. Sie war es gewohnt, den Spott und Groll der Familie auf sich zu ziehen.
»Können wir danach denn noch Fußball spielen?«
Anna lachte. »Du bist unverschämt, junger Mann.« Sie wuschelte ihm durchs Haar und überlegte. »Ganz ehrlich: Ich vermute, wenn dein Vater kommt und seinen Cousin mitbringt, werde ich nicht abkömmlich sein. Ich kann jedenfalls nichts versprechen.«
»Papa kommt heute gar nicht, glaube ich.«
»Natürlich kommt dein Vater. Er wird pünktlich zum Essen da sein.«
»Wohl nicht. Mama ist nämlich böse auf ihn. Ich glaube, er hat ihr Geld gestohlen oder so.« Anna musste lachen. In Anbetracht der Tatsache, dass Gottfried sehr reich war und ihre Schwester Maria vermutlich nicht einmal ein eigenes Konto hatte, war diese Behauptung ziemlich absurd.
»Wie kommst du denn darauf?«, hakte sie nach. »Die beiden teilen sich doch ihr Geld.«
»Keine Ahnung. Ich habe aber genau gehört, wie Mama geschrien hat, dass Papa betrogen hat.«
Der Satz traf Anna wie ein Schlag in die Magengrube.
»Da bist du ja endlich!« Maria schob ihren Sohn vor sich her, als sie in die Scheune traten, und bugsierte ihn zu seinem Platz. Der arme Junge saß am Familientisch zwischen der tauben Tante Greta und Onkel Rudolf, der gern schlüpfrige Witze machte. Das einzig Gute war, dass Sascha die vermutlich noch gar nicht verstand.
Anna hingegen hatte Glück gehabt. Neben ihr saß ihre Lieblingsgroßtante Ottilie mit ihrem Ehemann. Sie war die jüngste Schwester ihrer inzwischen verstorbenen Großmutter, aber lange nicht so frömmelnd. Im Gegenteil. Tante Ottilie war mit ihren stolzen zweiundneunzig Jahren eine lebenslustige Frau, die auf Burg Winnenthal im Seniorenheim lebte und gerade zum fünften Mal geheiratet hatte. »Aber nicht ein Mal geschieden«, betonte sie immer wieder lachend, wenn sie in katholischer Gesellschaft schräge Blicke erntete. Sie hatte die ersten vier Ehemänner überlebt, da diese deutlich älter gewesen waren als sie. So tragisch das Ableben jedes einzelnen auch gewesen sein mochte, es hatte Tante Ottilie eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit beschert, die sie nunmehr mit ihrem neuen Mann genoss. Anna umarmte die alte Dame innig.
»Na, mein Kind! Da bin ich aber froh, dass ich neben dir sitzen darf«, flüsterte Tante Ottilie zur Begrüßung. »Ich hatte schon befürchtet, ich müsste neben der Schwerhörigen sitzen. Da wäre ich gleich wieder gegangen. Die hört nämlich ihr eigenes Schmatzen nicht«, sagte sie und knuffte Anna sanft. »Wie geht es dir denn mit der neuen Stelle? Hast du dich inzwischen eingelebt? Man hört ja so einiges.«
Anna sah sie erstaunt an. »Ich bin doch gerade mal sechs Wochen im Ort, was kann es denn da schon zu hören geben?«
»Tja, es hat sich natürlich herumgesprochen, wie du den alten Mahlberg hast abtropfen lassen.«
»Oh mein Gott! Das war wohl der schlimmste Einstand, den man sich vorstellen kann. Aber wieso weißt du denn davon?«
Tante Ottilie lachte herzlich. »Burg Winnenthal gehört nun mal zu Alpen, und wie du weißt, habe ich meine Ohren überall. Es gab Zeiten, da bin ich als sprechende Zeitung mit dem Rad von Hof zu Hof gefahren. Das schaffe ich heute nicht mehr. Aber es war auch nicht nötig, denn seine Frau hat es im ganzen Dorf rumerzählt. Weißt du, ich kenne Bernadette Mahlberg ganz gut. Ich glaube, sie hat sich einfach diebisch gefreut, dass sich endlich mal jemand nicht vom alten Griesgram hat einschüchtern lassen.«
»Also ehrlich gesagt war ich total eingeschüchtert. Und es tat mir auch schrecklich leid, aber …«
»Papperlapapp. Ich bin sicher, die alte Erbs hat dich reingelegt. Sie will alle Fremden rausekeln. Mach dir nichts draus. Die braucht immer etwas Zeit, bis sie ihr Herz entdeckt. Ich werde demnächst mal die Info streuen, dass du meine Lieblingsnichte bist. Dann wissen alle, wo sie dran sind.« Sie drückte liebevoll ihren Arm und blickte auf den leeren Stuhl neben Anna. »Ach, und übrigens sagt man dir ein Verhältnis mit dem Bestatter nach.«
»Wie bitte?«
»Ja, die Leute sagen, du wärst auf Beerdigungen immer so fröhlich, und das könne nur daran liegen, dass du in den Bestatter verliebt seist. Es fällt nämlich auf, dass der auch immer anwesend ist.« Tante Ottilie lachte laut.
»Das ist doch völlig absurd. Natürlich ist der Bestatter anwesend, wenn jemand beerdigt wird. Und ich bin die Pastorin, was soll das dumme Gerede?«
»Denk nicht weiter drüber nach. Bei uns im Seniorenheim sterben die Menschen gerade wie die Fliegen. Grippewelle. Die Leute lenken sich halt ab mit dem Geschwätz. Dann muss man nicht an den Tod denken. Ist doch lustig. Reg dich nicht auf.«
Anna konnte darüber nicht lachen. Es war anstrengend, in einem Dorf zu arbeiten, in dem die meisten Leute einen nicht akzeptierten. Tatsächlich war der Sohn des Bestatters, Thomas Kamps – und der, so vermutete sie, war wohl gemeint, sein Vater war schließlich um die achtzig –, einer der wenigen, die ihr freundlich begegneten.
»Hat deine Mutter den Platz neben dir frei gelassen, damit du die Innung nicht blamierst?«, neckte Tante Ottilie sie weiter.
»Ich fürchte, es ist noch schlimmer: Meine Schwester will mir mal wieder irgendeinen Grafen auf den Hals hetzen.«
Tante Ottilie pfiff anerkennend. »Dann benimm dich ausnahmsweise mal anständig. Schau, da kommt dein Galan auch schon.« Sie inspizierte den jungen Mann in Gottfrieds Schlepptau unverhohlen. »Ich liebe Familienfeste!« Sie rieb sich die Hände, Anna streckte ihr die Zunge raus.
»Anna, liebste Schwägerin, wie schön, dich zu sehen.« Gottfried trug die braunen Haare wie immer stramm nach hinten gegelt. Er überrumpelte sie mit einer etwas steifen Umarmung und Wangenküsschen. Bislang hatte sie nie das Gefühl gehabt, dass ihr Schwager ihr herzlich zugewandt war. »Darf ich dir deinen Tischherrn vorstellen?«, sagte er formvollendet. »Graf Maximilian Konstantin Petrus Maria von Egmond zu Anholt.«
Sie hörte neben sich ein leises Prusten. »Oh Gott, Schätzchen, bitte heirate ihn. Der Name ist die beste Vorbeugung gegen Altersdemenz.«
Anna reichte dem Mann die Hand und fragte sich, ob sie aufstehen solle oder nicht.
»Bitte nenn mich einfach Max«, sagte er, nahm ihre Hand und hauchte einen Kuss darauf.
»Äh … Ja. Anna.«
»Freut mich, dich kennenzulernen, Anna. Mein Cousin hat mir schon viel von dir erzählt.« Sie zwang sich zu einem Lächeln. Sie hatte keine Ahnung, was er über sie wusste, war sich aber relativ sicher, dass Gottfried ihm nichts von ihrem Beruf, ihrer Konfession und erst recht nichts von ihrer Scheidung erzählt hatte. Was blieb also, um sie anzupreisen?
Während sie noch darüber nachdachte, begann Graf Max, von sich zu sprechen. Er tat es in einem heiteren Plauderton, den Anna nur bewundern konnte. Nicht, dass er ihr unsympathisch gewesen wäre, aber sie fühlte sich unwohl. So wie der Mann das leichte Tischgespräch scheinbar mühelos beherrschte, kam sie sich neben ihm dumm und plump vor. Sie warf Tante Ottilie einen kurzen Blick zu, sah sie an seinen Lippen kleben und drückte sich samt Stuhl ein wenig nach hinten.
Small Talk war noch nie ihr Ding gewesen. Ihren Ex-Mann Tim hatte sie auf einer Studentenparty kennengelernt. Sie war im dritten Semester gewesen, er hatte kurz vor dem juristischen Staatsexamen gestanden. Ein Schmerz durchfuhr sie, als sie daran dachte. Auf einmal hatte er neben ihr am Tresen gestanden und einen Saft bestellt.
»Trinkst du aus religiösen Gründen keinen Alkohol?«, fragte sie ihn. Sie studierte Theologie, deshalb fand sie die Frage naheliegend. Er lachte. »Gehst du immer so offen mit deinen Vorurteilen um?«
»Oh Gott, nein …«, stammelte sie und musste dann zugeben, dass sie sehr wohl voreilige Schlüsse gezogen hatte. Tim hatte glänzende schwarze Haare, braune Augen und einen dunklen Teint. Er lachte, nahm das Glas Kirschsaft entgegen und stellte sich vor. Er hieß Tiyam Khoi, wurde von allen aber Tim genannt, seine Eltern stammten aus dem Iran und hatten als Christen vor der Revolution und den Ayatollahs flüchten müssen. Die Stunden vergingen im Flug, mit ihm fiel es ihr leicht zu reden, irgendwann verließen sie die Party und spazierten am Rheinufer entlang. Anna war fasziniert von ihm. Er und seine Familie schienen das Gegenteil der von Betterays zu sein: urban, international, bürgerlich, intellektuell. Am Morgen wurden sie von der aufgehenden Sonne geweckt, sie waren am Flussufer Seite an Seite eingeschlafen. Ohne ein weiteres Wort verabschiedeten sie sich. Anna fand es magisch. Fast war sie enttäuscht, als sie vor ihrer Haustür den Schlüssel aus der Jackentasche zog und eine Visitenkarte herausfiel. Er musste sie ihr heimlich zugesteckt haben.
»Oh, es geht los!«, sagte Graf Max, stupste sie sanft an und riss sie aus ihren Gedanken.
Ihr Bruder Heinz, Familienoberhaupt und Gastgeber, hatte sich erhoben und schlug mit der Gabel an sein Weinglas, um die Gäste zu begrüßen und die Jubilarin hochleben zu lassen. Es ging schnell, adelig oder nicht, die niederrheinischen Landwirte machten nicht gern viele Worte.
Nach der Suppe winkte ihr Sascha wild zu. Es war so weit. Anna bemerkte ein leichtes Ziehen im Magen. Sie kannte das nur zu gut. Vor jedem Gottesdienst spürte sie es. Sie schluckte, dachte daran, wie sich Sascha wohl fühlte, und verschwand in der Waschküche, wo er bereits auf sie wartete.
»Mann, ich hab schon gedacht, du hättest es vergessen.«
»Wie könnte ich? Bist du auch nervös?«, fragte sie, als sie sah, dass Sascha kreidebleich war. Der Junge nickte. »Das ist gut«, sagte Anna. »Wenn du nervös bist, dann schießt Adrenalin ins Blut. Das ist so etwas wie eine Superkraft.« Sascha sah sie zweifelnd an. Sie hörten, wie Maria ihren Sohn ankündigte. Er hatte ihr offenbar nichts von ihrem Plan erzählt. »Los, geh du zuerst raus und verbeuge dich. Ich bin gleich hinter dir.«
»Auf gar keinen Fall gehe ich vor.« Sascha schüttelte vehement den Kopf.
»Komm schon, ich bin ja da.«
Anna linste durch den Türspalt, alle starrten erwartungsvoll in ihre Richtung. Kurz entschlossen schubste sie Sascha hinaus und folgte ihm. Er baute sich, wie besprochen, vor seiner Oma auf und verbeugte sich in alle Richtungen. Anna stellte sich mit der Gitarre daneben. Sie fing den Blick ihrer Schwester auf, Entgeisterung und Empörung lagen darin.
Der Junge bereitete sich vor, es war totenstill im Raum. Alle Anwesenden musterten die beiden mit ihren Instrumenten skeptisch. Geigenmusik passte so gar nicht in eine niederrheinische Scheune. Sascha setzte den Bogen an und ließ ihn über die Saiten schrappen, man hörte ein paar Gäste nach Luft schnappen. Selbst die Gitarre konnte das Kreischen der Geige nicht übertönen. Marias Lächeln war eingefroren. Sascha blickte Anna verzweifelt an. Sie fürchtete, er würde einfach hinausrennen und die Violine auf den Boden schmeißen.
»Das war zum Stimmen, jetzt geht es los!«, rief sie und hoffte, dass sie die anderen mitreißen konnte. »Eins, zwei, drei …«, zählte sie und nickte Sascha aufmunternd zu. Der versuchte, der Geige einen weiteren Ton abzupressen. Anna zog das U besonders lang, als sie kraftvoll zu singen begann: »Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück …« Tante Ottilie war die Erste, die verstand, was los war. Sie war eine leidenschaftliche Sängerin, die vermutlich in jungen Jahren mit ihrem hohen C Fensterglas zum Bersten hätte bringen können, nun schmetterte sie los, so laut sie konnte, bis auch ihr frisch angetrauter Ehemann Bernd freudig einstimmte und sich schließlich der ganze Saal genötigt sah mitzusingen. Tapfer wiederholte Sascha seinen Ton, doch der ging bereits im Lärm unter.
Hundertzwanzig geladene Gäste waren nun in Hochstimmung. Einmal in Fahrt gebracht, ließen sie die Jubilarin immer wieder hochleben, bis Tante Ottilie ihr komplettes Geburtstagsrepertoire zum Besten gegeben hatte. Der Applaus war ohrenbetäubend, Sascha strahlte. Mechthild von Betteray stand auf und bedankte sich bei ihrem »bislang jüngsten Enkelchen«. Wobei sie ja die Hoffnung nicht aufgebe, dass auch Anna langsam mal loslege, sie wolle schließlich als Oma nicht aus der Übung kommen. »Wir sehen ja, wie gerne du Kinder hast. Fehlt im Moment nur noch der richtige Mann«, lachte sie und zwinkerte Graf Max zu. Anna kam es vor, als würde sie gerade bei eBay versteigert. Hastig verzog sie sich in die Waschküche, wo nicht nur Sascha, sondern auch ihre Schwester bereits auf sie wartete.
»Musste das sein?«, fuhr Maria sie ohne Umschweife an.
Anna sah sie verblüfft an. »Aber Maria, ich wollte doch nur …«
»Es geht nicht immer nur um dich. Das war Saschas großer Auftritt. Das Geburtstagsständchen des elfjährigen Enkels. Da hattest du nichts zu suchen.«
»Mama«, setzte Sascha an, doch er kam nicht weit.
»Du hältst dich da raus, mein Schatz. Du hast das ganz toll gemacht. Ich bin nur wütend auf deine Tante. Und das ist eine Diskussion unter Erwachsenen. Bring deine Geige weg und setz dich wieder an den Tisch!« Der Junge schaute Anna entschuldigend an, zuckte die Schultern und verließ die Waschküche.
»Maria, es tut mir leid. Ich dachte, ich würde helfen.«
Ihre Schwester lachte auf und schüttelte den Kopf. »Das glaube ich dir nicht. Du hältst es einfach nur schwer aus, nicht im Mittelpunkt zu stehen, das war schon immer so.«
Maria strich sich das Kleid glatt, drehte sich auf dem Absatz um und rauschte davon. Anna schluckte. Sie brauchte frische Luft. Freddy lag auf seiner Decke in ihrem alten Kinderzimmer. Sie kraulte ihn. Der Goldendoodle sprang an ihr hoch und wedelte mit dem Schwanz. Offenbar hatte auch er Lust auf einen kleinen Spaziergang.
Nach einer Viertelstunde hatte sie sich gefangen und nahm ihren Platz bei Tisch wieder ein.
»Großartig, meine Liebe. Das habt ihr zwei wunderbar gemacht.« Tante Ottilie knuffte sie erneut. »Ich fürchte, das wäre sonst ganz schön schiefgegangen. Aber so … herrlich! Der ganze Saal hat mitgesungen. Und deine Mutter war so stolz auf ihre Familie. Du weißt ja, wie wichtig ihr das ist.«
Anna lächelte dankbar. Inzwischen war der Hauptgang aufgetragen worden. Graf Max schien sich königlich zu amüsieren. Er reichte Anna den Rotkohl an. »Darf ich dir auftun?«, fragte er und wartete gar nicht erst auf eine Antwort.
»Ich habe mich eine Weile mit Zwölftonmusik auseinandergesetzt«, begann er süffisant. »Ich muss sagen, auch euer Vortrag war sehr … experimentell.«
Es war nett gemeint, es war nur der völlig falsche Moment.
»Lieber Max, es tut mir schrecklich leid, aber ich interessiere mich nicht für Zwölftonmusik, ich interessiere mich nicht fürs Wetter, nicht für Adelstitel und, auch wenn meine Schwester dir vielleicht etwas anderes erzählt hat, erst recht nicht dafür, einen Ehemann zu finden. Bitte nimm es mir nicht übel, ich möchte nur, dass keine Missverständnisse aufkommen.«
Graf Max hob die Hände wie zur Kapitulation und lächelte. »Zauberhaft, dieses Temperament. Aber ich habe verstanden.« Dann wandte er sich um und parlierte mit der Tischnachbarin zu seiner Rechten.
»Uiuiui«, machte Tante Ottilie, »den wirst du wohl nicht mehr heiraten. Nun, wenn du mich fragst, war der ohnehin zu jung. In dem Alter halten sie noch so lange durch.« Anna versuchte sich an einem Grinsen. Doch in Gedanken war sie woanders. Sie beobachtete ihre Schwester, die hinter ihre Mutter getreten war und sich nun lachend zu ihr hinunterbeugte.
Schravelen, April 1985
Die ersehnte Prinzessin
»Warum drängt die sich einfach dazwischen?«, fragte Maria ihre Mutter und schaute empört auf die andere Seite des Ehebettes, wo ihre kleine Schwester mit dem Vater raufte.
Mechthild strich ihrer Tochter die blonden Strähnen aus der Stirn. »Du weißt doch, wie sie ist, Prinzesschen«, sagte sie sanft.
Anna lachte gackernd und sprang auf dem Bett herum, die Haare standen ihr wirr vom Kopf ab.
Der Tag hatte so schön begonnen. Die Sonne hatte sie geweckt, die Vögel hatten leise vor dem Fenster des Elternschlafzimmers gezwitschert. Maria hatte in der Nacht zuvor das Kinderzimmer, das sie sich mit Anna teilte, verlassen und sich zu ihrer Mutter gekuschelt, peinlich darauf bedacht, die Ritze zwischen den beiden Matratzen nicht zu überschreiten. Es war ihr zur Gewohnheit geworden. Eine Zeit lang hatte ihr Vater noch versucht, sie ins Kinderzimmer zurückzuschicken, doch sie hatte unter heftigen Albträumen gelitten und stundenlang geweint, sodass er schließlich aufgegeben hatte.
Heute früh waren ihre Eltern bester Laune gewesen. Sie lagen im Bett und plauderten miteinander, ihre Mutter hatte Maria auf die andere Seite gelegt und war ein bisschen näher zum Vater gerückt, hielt sie aber weiterhin im Arm. Maria döste immer wieder weg und baute die Gespräche der Eltern in ihre luziden Träume ein.
Plötzlich wurde sie jäh aus ihrem dämmrigen Zustand gerissen, als die Tür aufflog, die Klinke gegen den Schrank knallte und ein Wirbelwind über sie hereinbrach: Anna. Gut gelaunt schmetterte sie ein fröhliches »Guten Morgen« in die Runde und rannte auf das Bett zu. Maria drängte sich eng an ihre Mutter, sie fürchtete ein Donnerwetter, doch das blieb aus.
»Da ist ja endlich mein Mädchen«, rief ihr Vater stattdessen. Anna stürzte sich mit einem Urwaldgeheul auf ihn, die beiden kitzelten sich und lachten laut. Und obwohl sie in den Armen ihrer Mutter lag, fühlte Maria sich, als wäre sie gerade aus dem Paradies verstoßen worden.
Maria war vier Jahre älter als ihre Schwester. Ihre Mutter hatte sich immer eine Tochter gewünscht, eine Prinzessin, der sie die Haare kämmen konnte und die ihre schönen Kleider nicht gleich schmutzig machen würde, so wie es ihre Söhne taten. Dass es schon vor Maria dieses ersehnte Mädchen gegeben hatte, war der Achtjährigen erst vor einem halben Jahr bewusst geworden. Die ganze Familie war am Totensonntag nach der Messe, wie alle Katholiken in Kevelaer, zum Friedhof gefahren, um für die Seelen der Verstorbenen zu beten. Maria erinnerte sich noch genau an diesen Tag, ihr war unheimlich zumute gewesen. Sie fragte sich, was mit den vielen verstorbenen Seelen auf dem Friedhof wohl passierte. Waren sie noch hier, zwischen Bäumen und Blumen, womöglich übellaunig, immer versucht, die Lebenden zu erschrecken? Sie drückte sich eng an ihre Mutter, als sie die schmalen Wege entlanggingen und schließlich vor einem Grab stehen blieben. Anna rannte lachend herum und musste von einem ihrer großen Brüder eingefangen werden.
Maria sah ihren Vater, der seiner Frau liebevoll die Tränen von der Wange wischte, ihr etwas zuflüsterte und sie aufs Haar küsste.
»Wie sie wohl geworden wäre«, sagte Mechthild sehr leise, doch Maria hatte die Frage gehört.
»Wer denn?«, wollte sie wissen und zupfte ihre Mutter am Kleid. Sie wies stumm auf den Grabstein. Maria war seit einem Jahr in der Schule und konnte inzwischen schon gut lesen, sie beugte sich vor und entzifferte die schnörkeligen Buchstaben und Zahlen.
Eva von Betteray
1968–1968
»Wer ist Eva?«, fragte sie überrascht. »Deine Schwester«, antwortete ihre Mutter und kniete sich neben sie.
Maria verstand nicht. »Eva ist Anna?«
»Nein! Eva ist deine Schwester. Sie ist jetzt ein Engel«, sagte Mechthild behutsam. Maria starrte auf die Schnittblumen, die sie auf das Grab gelegt hatten. Violette Fetthennen. Sie hatte sich den lustigen Blumennamen gemerkt. Ihre Mutter schluchzte leise und schmiegte sich an sie. »Versprich mir, dass du mich nie verlässt«, flüsterte sie ihr ins Ohr. Maria nickte eifrig. »Das verspreche ich dir!«, sagte sie und legte ihr Händchen zur Bekräftigung aufs Herz ihrer Mutter.