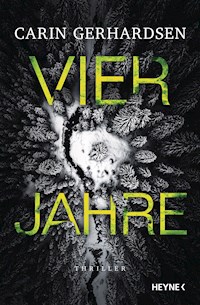
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Winter 2014: Gotland ist bedeckt von einer dicken Schicht Schnee. Eine junge Frau steigt bei einem fremden Mann ins Auto, auf der anderen Seite der Stadt macht sich ein Liebespaar auf den Weg zu einem heimlichen Treffen. Kurze Zeit später wird die Stille der schwedischen Wälder zerrissen von zwei kollidierenden Autos. Ein Unfall, der nicht nur einem Mann das Leben kostet, sondern auch verheerende Folgen für alle Beteiligten hat … Doch das Schlimmste daran: Unter der Eisschicht liegt eine Wahrheit begraben, die erst Jahre später an die Oberfläche drängt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Drei Fremde vereint durch einen tödlichen Unfall. Doch niemand von ihnen kennt die ganze Wahrheit.
Jeanette
»Die Scherbe saß wie eine Messerklinge zwischen Sehnen und Knorpel, sie musste das Atmen unmöglich machen. Er hatte eine Platzwunde auf der Stirn, und dem Winkel nach zu urteilen war das Genick sehr wahrscheinlich gebrochen.«
»Wozu sollte sie den Notruf wählen, wenn der Mann ohnehin schon tot war? Sie müsste ihren Namen nennen und in der polizeilichen Vernehmung sagen, was sie mitten im Winter an diesem unterkühlten Ort gewollt hatte. Alles würde herauskommen, ihr Mann würde alles erfahren und alle anderen auch.«
Jan
»Sollte er einen Notruf absetzen? Damit die Polizei herkam? Das war keine so gute Idee. Denn obwohl Jan nüchtern war, würde ein Alkoholtest mit Sicherheit positiv ausfallen. Er würde sich verdächtig machen, und dieser Verdacht würde unangenehme Kreise ziehen, was ganz ungut wäre.«
Sandra
»Natürlich musste er dafür bestraft werden; die Frage war nur, wie.«
Die Autorin
Carin Gerhardsen studierte zunächst Mathematik an der Universität Uppsala und arbeitete anschließend als Informatikerin, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Ihr Debüt hatte sie bereits 1992. Ihre Bücher stürmen regelmäßig die schwedischen Bestsellerlisten. Vier Jahre ist ihr erstes Buch bei Heyne.
CARIN GERHARDSEN
VIER JAHRE
THRILLER
Aus dem Schwedischen von Nike Karen Müller
Die Originalausgabe DET SOM GÖMS I SNÖ erschien 2018 bei Bookmark Förlag Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 11/2019 Copyright © 2018 by Carin Gerhardsen Published by Arrangement with Nordin Agency Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Anita Hirtreiter Umschlaggestaltung: Favoritbüro, München unter Verwendung von GettyImages/ © coberschneider
Eine Lüge ist wie ein Schneeball; je länger man ihn rollt, desto größer wird er.
MARTIN LUTHER
41-Jähriger spurlos verschwunden
Am Dienstagabend ging bei der Polizei ein Notruf ein. Ein Mann war gegen acht Uhr morgens mit dem Auto zu seiner Arbeitsstelle in Visby gefahren. Nachdem er den Vormittag über in der Firma gewesen war, verließ er um die Mittagszeit sein Büro. Als er am Nachmittag nicht zu einem Termin erschien, kontaktierte ein Mitarbeiter die Ehefrau, die ihn im Laufe des Tages als vermisst meldete.
Die Polizei hat zusammen mit Verwandten und Betriebsangehörigen eine Liste mit möglichen Aufenthaltsorten des Vermissten erstellt. Die Umgebung wurde abgesucht, aber eine detailliertere Suche gestalte sich schwierig, da keine genauen Anhaltspunkte vorliegen, so die Polizei. Das Handy des Vermissten war zuletzt in der Nähe seiner Arbeitsstätte eingeloggt.
Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der 41-Jährige bekleidet mit einer dunklen Hose, einem hellen Hemd und einer schwarzen Jacke. Er ist von durchschnittlicher Statur, eins achtundsiebzig groß und hat kurze dunkle Haare und braune Augen.
Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um den Vermissten zu finden.
GOTLANDS ALLEHANDA
2014
Januar
I
Jeanette
Erst als sie die befahreneren Routen um Visby hinter sich gelassen hatten und auf der Landstraße waren, konnte sie aufatmen. Immer der gleiche Stress, die gleiche Angst, dass jemand sie wiedererkennen würde, wenn sie im falschen Auto saß, die falsche Person neben sich. Die Lügerei am Arbeitsplatz: eine Besorgung, die gemacht werden musste, ein Zahnarzttermin, ein spätes Mittagessen mit einer Freundin.
Man muss erfinderisch sein, wenn man sich der verbotenen Liebe hingibt, und gut Theater spielen können.
Jeanette besaß ihrer Ansicht nach keine dieser Eigenschaften. Und trotzdem saß sie hier mit klopfendem Herzen und roten Wangen und setzte ihre Ehe aufs Spiel.
Was machte sie da eigentlich? War es das überhaupt wert?
Sie beobachtete ihren Liebhaber verstohlen von der Seite. Wie er mit einer seiner großen Hände lenkte, den Daumen der anderen locker ins Steuer eingehakt hatte. Wie die Adern auf dem Handrücken hervortraten. Wie der wachsame Blick alles registrierte, was auf der Straße passierte und in der Umgebung. Wie der Brustkorb sich unter der aufgeknöpften Jacke mit jedem Atemzug hob.
»Wie war’s?«, wollte er wissen. »Hat jemand nachgefragt?«
»Ich habe gesagt, dass ich neue Fliesen aussuchen muss. Fürs Bad.«
»Und da hat sich keiner gewundert?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Wollt ihr euer Bad neu machen?«
»Keine Ahnung«, entgegnete sie. »Anscheinend.«
Wozu ein neues Badezimmer? Ihr Mann dachte, dass ein neues Bad alles besser machen würde, aber sie brauchte etwas ganz anderes. Offensichtlich. Denn sie saß hier und riskierte ihr komfortables Leben für ein Schäferstündchen mit dem Mann einer anderen.
»Ich lüge den anderen im Betrieb auch nicht gerne was vor«, sagte er. »Früher gehen unter einem Vorwand. Aber es ist, wie es ist.«
Ihr Verhältnis dauerte jetzt schon einen guten Monat. Nichts, was sich noch länger als Ausrutscher bezeichnen ließe. Jede Woche stahlen sie sich ein paar Mal auf diese Weise davon, und sie konnte an nichts anderes mehr denken.
Im Grunde genommen kannte sie ihn gar nicht besonders gut. Ihr Arbeitsplatz lag neben seinem, sie war in einem Möbelhaus tätig, und er betrieb eine Autowerkstatt. Sie zeigten sich nie zusammen, riefen sich nie an, tauschten keine geheimen Mitteilungen auf dem Parkplatz aus. Was es zu sagen gab, wurde in seinem Wagen verhandelt, stets tagsüber, und mit Überstunden an anderen Tagen kompensiert. Niemand dürfte einen Verdacht haben, also hatten sie auch nichts zu befürchten und konnten sich dem Verlangen des anderen hingeben, der Wärme im Körper danach und der Sehnsucht nach dem nächsten Treffen.
»Es ist, wie es ist«, wiederholte sie. »Soll das etwa so weitergehen?«
Er lächelte. »Was meinst du denn? Bist du mit deinem Leben zufrieden, oder hast du den Mut, noch mal neu anzufangen?«
Sie wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Traute er sich denn, diesen Schritt zu tun und seine Frau für sie zu verlassen? Ihre Antwort hing von seiner ab. Sie wollte ihm nicht die Genugtuung verschaffen, dass er genau wusste, woran er bei ihr war, wenn er ihr nichts gab, woran sie sich klammern konnte.
Ihre Beziehung zu ihm war voller Leidenschaft. Sie befand sich in einem Krankheitszustand, konnte weder nachts schlafen noch sich tagsüber konzentrieren. Aber würde dieser Zustand anhalten, wenn sie ihrem Ehemann gegenüber ehrlich wäre, die Scheidung einreichen und ihr gemeinsames Zuhause zur Kriegszone erklären würde? Würde dieses Hals-über-Kopf-Verliebtsein alldem standhalten? Und wie lange?
Vielleicht war es das, was sie brauchte, Bestätigung. Dass sie es wert war, geliebt zu werden, wert, Liebe zu machen. Nun hatte sie diese Bestätigung bekommen, und möglicherweise genügte das ja. Ihr Liebhaber hatte ihr so viel Energie und Lebensfreude gegeben, wodurch sie zu einem ganz neuen Menschen geworden war. Was jedoch nicht automatisch bedeutete, dass sie gleich ihren Mann verlassen und damit ihr Zuhause und ihre finanzielle Sicherheit aufgeben würde. Das war der Reiz des Neuen, dessen war sie sich bewusst. Sie konnte die Affäre einfach beenden und wieder in ihr altes Leben zurückkehren.
Das versuchte sie sich einzureden. Aber sie musste daran denken, wie der nackte Körper ihres Geliebten duftete, wie sein heißer Atem und die Laute der Lust bald das Auto erfüllen würden.
Dennoch war sie hin und her gerissen. Kam sich leicht pathetisch vor, wie sie so dasaß wie ein Schulmädchen und von einer Zukunft träumte, die es auf diese Weise mit Sicherheit nicht geben würde. Und sie fühlte sich schmutzig. Sie log und betrog, nur für ein paar kurze, vergängliche Stunden der Hingabe in der Woche. Ihr Liebhaber war das exakte Gegenteil. Er nahm das Leben, wie es kam, und hatte dabei immer ein Lächeln auf den Lippen. Würde sie ihn nicht länger treffen wollen, würde ihm das sicher nicht allzu viel ausmachen.
Sie näherten sich dem Platz für ihr Stelldichein, und im Wagen stieg der Puls. Er legte ihr eine Hand auf den Schenkel, und sie konnte kaum an sich halten. Wollte sich die Kleider vom Leib reißen und sich auf ihn stürzen, seine Lippen und seine Umarmung spüren, überwältigt von einer Wärme in ihrem Körper.
Der Himmel verdunkelte sich, und es begann leicht zu schneien. Der Wettervorhersage zufolge sollte es erst in den Nachtstunden frieren, aber die Straßen sahen schon jetzt glatt aus. Sie näherten sich dem alten Kalksteinbruch bei Madvar. Für einen Augenblick verloren die Reifen die Bodenhaftung, und der Wagen schlingerte bedenklich.
2
Sandra
Mit Einkäufen beladen stand sie vor dem XL-Bygg auf dem Parkplatz und ärgerte sich über ihre eigene Dummheit. Endlich war sie zum Baumarkt gefahren, um Weihnachtsschmuck und Außenbeleuchtung zu Schnäppchenpreisen zu shoppen. Natürlich ohne zu bedenken, dass sie wie immer viel zu viel kaufen würde, obwohl das Auto in der Werkstatt war und ihr Vater ihr nicht helfen konnte. Eigentlich wollte sie lediglich so viel kaufen, wie sie zur Bushaltestelle tragen konnte, aber nun war sie bepackt wie ein Esel.
Der Boden war nass und rutschig, und sie wollte ihre Papiertüten und Kartons nicht abstellen. Zu allem Übel hatte sie keine Handschuhe, denn als sie morgens aus dem Haus gegangen war, war es viel wärmer gewesen.
Zwei Mal hatte sie sich ein Taxi gerufen, und beide Male war ihr für die folgenden Minuten ein Wagen versprochen worden. Als sie jetzt ihre Einkäufe abstellte, um nochmals anzurufen, waren bereits vierzig Minuten vergangen.
»Das ergibt keinen Sinn«, sagte sie und versuchte verärgert zu klingen, obwohl sie einfach bloß müde war. »Ich wohne auf dem Land, und ich kann ja wohl schlecht zu Fuß bis nach Vejdhem laufen.«
»Merkwürdig«, entgegnete die Stimme am anderen Ende der Verbindung. »Da muss es sich um ein Missverständnis handeln. Ich schicke sofort ein Taxi los.«
Ja, das sollte man meinen, und Sandra hätte zu diesem Zeitpunkt eine ungehaltene Bemerkung machen können. Doch sie war nicht sonderlich schlagfertig, sondern eher wortkarg, sodass sie sich höflich bedankte und das Gespräch beendete. Sie seufzte schwer, warf einen resignierten Blick auf ihre Einkäufe und suchte im Handy mit vor Kälte klammen Daumen nach einem kurzweiligen YouTube-Clip, um sich damit die Wartezeit etwas zu verkürzen.
Ehe sie sich dem Clip zuwenden konnte, tauchte ein Mann vor ihr auf. Sie hatte ihn bereits vor einer Weile bemerkt, als er mit eiligen Schritten auf dem Weg vom Baumarkt zum Auto an ihr vorbeigegangen war. Offenbar hatte er es sich nun anders überlegt und war umgekehrt.
»Vejdhem«, sagte er. »Wollen Sie nicht dorthin?«
Er sah nett aus, erinnerte sie mit seinem dichten, dunklen Haar und den ergrauten Schläfen an eine jüngere Ausgabe ihres Vaters.
»Ja«, gab Sandra zurück. »Ich warte schon seit über einer halben Stunde auf mein Taxi, das wohl nicht mehr kommt.«
»Das kriegen wir hin«, meinte der Mann. »Ich muss in dieselbe Richtung, ich kann Sie also ein Stück mitnehmen.« Daraufhin bückte er sich und griff nach ihren Einkäufen, konnte sie alle auf ein Mal tragen und ging auf sein Auto zu.
»Danke«, sagte Sandra erleichtert und folgte dem Mann. »Das ist wirklich nett von Ihnen. Dann kann ich das Taxi ja wieder abbestellen.«
»Finden Sie, das haben die verdient?«, entgegnete er mit einem Grinsen.
Sandra erwiderte nichts, denn sie war dem Taxiunternehmen wirklich nichts schuldig.
Er lud ihre Einkäufe in den Kofferraum und hielt ihr die Beifahrertür auf. Sie stieg ein und versuchte, ihren kalten, kurzen Fingern Wärme einzuhauchen.
»Es ist richtig kalt geworden plötzlich«, bemerkte sie, als sie losfuhren.
»Das ist die sibirische Kälte, die kommt jetzt zu uns«, sagte er ironisch mit einem Seitenhieb auf die alarmierenden Schlagzeilen in den Abendzeitungen.
Er hatte Humor, das erleichterte jeden Small Talk. Sie würden nun ohnehin eine Zeit lang zusammen im Auto verbringen.
»Wohnen Sie in der Nähe von Vejdhem?«, fragte Sandra.
»Nein, aber ich muss etwas erledigen in Ihrer Gegend, es ist also nicht mal ein Umweg für mich.«
Die Unterhaltung verlief unangestrengt. Sandra kam kaum zu Wort, doch das wollte sie auch gar nicht. Sie hörte mit gewissem Interesse zu, wie der Mann von seinem Faible für die Geschichte der Insel Gotland erzählte, wie er die Tabellenplätze der Hockeyliga zusammenfasste, in der Gotland ebenfalls auftauchte, und wie er sein Engagement für Menschenrechte und Umweltschutz sowie gegen Hunger und Krieg erläuterte. Er sorgte dafür, dass im Auto nie peinliche Gesprächspausen entstanden, und Sandra war dankbar dafür.
Dennoch fand sie, dass er etwas zu nachlässig fuhr. Dass er nicht besonders aufmerksam war, wenn er andere Fahrzeuge überholte oder an Kreuzungen, und dass er sie, anstatt den Blick auf die Straße zu heften, oft ansah, wenn er mit ihr redete. Dann ging ihr auf, sowohl seine Gesprächigkeit als auch die fehlende Konzentration beim Fahren könnten damit zusammenhängen, dass er nicht ganz nüchtern war. Obwohl es nicht mal drei Uhr nachmittags war. Denn wenn man genauer darüber nachdachte, hing doch Alkoholdunst im Auto, oder? Aber zum Glück war nicht viel Verkehr auf den Straßen, und bald würde sie ja zu Hause sein.
Nun fuhren sie am alten Kalksteinbruch bei Madvar vorbei. Von einem Moment auf den anderen hatte sich die Fahrbahn in blankes Blitzeis verwandelt, und anstatt abzubremsen, gab der Mann in der Kurve Gas.
3
Jan
Er zog den Hosenschlitz zu, schloss Knopf und Gürtel. Beugte sich vor und küsste sie zärtlich auf Mund und Wangen. Sie verströmte eine intensive Wärme und duftete nach Frau. Shampoo, Hautcreme, Seife oder ein dezentes Parfum – irgendetwas Anziehendes, das ihn lockte, bei ihr in ihrer Wärme zu bleiben. Aber er beherrschte sich, und kurz darauf saß er auf dem Fahrersitz, trotz allem bester Laune.
Als er den Zündschlüssel ins Schloss schob, ging die Musik an. Er drehte die Lautstärke auf und legte einen Kavaliersstart hin. Auch wenn die Reifen heutzutage dabei nicht mehr quietschten, liebte er diesen abrupten Vorwärtsruck des Wagens und das Gefühl, in den Sitz gepresst zu werden. Im Takt mit den Bässen trommelte er auf das Lenkrad und bog auf die Landstraße.
Plötzlich war es da, wie aus dem Nichts. Als er die Kurve bei der Schlucht hinter sich gelassen hatte, geriet das Auto auf der Gegenfahrbahn in sein Blickfeld, kam bei Blitzeis mit hohem Tempo auf ihn zugerast.
In dem Augenblick, als er es registrierte, wusste er, dass das schiefging. Für einen von ihnen oder beide. Er hatte Friktionsreifen, ein Ausweichmanöver war undenkbar, und selbst wenn er die Bremse durchtrat, würde er nicht rechtzeitig zum Stehen kommen. Er wollte nur, dass es vorbei war. Schnell.
4
Jeanette
Mit zitternden Händen klopfte sie sich die Kleider ab. Erde, Lehm, Zweige, Laub. Überall lag gesplittertes Glas. Es sah unwirklich aus, das übel zugerichtete Blech und die Glassplitter in der Natur verstreut. Sie war so erschüttert, dass ihr Körper ihr nicht mehr gehorchte und sie mit den Zähnen klapperte. Trotzdem war sie geistesgegenwärtig genug, ihr Handy herauszuholen. Um dieses völlig irreale Bild festzuhalten.
Im Innenraum war überall Blut. Der Mann auf dem Fahrersitz war eingeklemmt, in seinem Hals steckte eine große Glasscherbe.
Erneut stellte sie fest, dass er vermutlich bereits tot war. Die Scherbe saß wie eine Messerklinge zwischen Sehnen und Knorpel, sie musste das Atmen unmöglich machen. Er hatte eine Platzwunde auf der Stirn, und dem Winkel nach zu urteilen war das Genick sehr wahrscheinlich gebrochen.
Jeanette rang mit sich. Wozu sollte sie den Notruf wählen, wenn der Mann ohnehin schon tot war? Sie müsste ihren Namen nennen und in der polizeilichen Vernehmung sagen, was sie mitten im Winter an diesem unterkühlten Ort gewollt hatte. Alles würde herauskommen, ihr Mann würde alles erfahren und alle anderen auch. Sollte sie wirklich ihre Zukunft aufs Spiel setzen? Nein, man war selbst seines Glückes Schmied, und sie musste einen alles entscheidenden Entschluss fassen, hier und jetzt.
Das tat sie. Mühsam schleppte sie sich zum Kofferraum zurück, die Klappe stand nach dem Unfall offen. Sie griff nach ihrer Schultertasche und hängte sie sich um. Warf einen sorgenvollen Blick auf das lädierte Auto und seinen Lenker. Aber ihr Entschluss stand fest. Sie begann, die Schlucht hinaufzuklettern.
Die Dunkelheit senkte sich herab, und das Schneetreiben wurde dichter.
5
Sandra
Zuerst war sie regelrecht paralysiert und wusste nicht, wohin mit sich. Ein Gefühl der Unwirklichkeit überwältigte sie, als würde sie selbst das alles gar nicht erleben. War das alles bloß ein böser Traum? Sie kannte die Antwort, konnte sie aber nicht verinnerlichen.
Sandra passierten solche Sachen einfach nicht. Sie war zu pompös oder zu trist, zu langweilig. Sie hatte eine behütete Kindheit gehabt: Da sie keine Geschwister hatte, wurde sie von ihren Eltern verhätschelt und musste nie selbst ein Problem lösen. Folglich verfügte sie nicht über die nötige Erfahrung, um vernünftig zu reagieren, wenn etwas Unvorhergesehenes geschah.
Sie sollte natürlich die Polizei verständigen. Verbrecher durften nicht frei herumlaufen, nur weil die Menschen keine Kraft hatten oder sich nicht trauten, sie anzuzeigen. Sie saß am Küchentisch, mit dem Telefon in der Hand, unfähig, einen Anruf zu tätigen. Sich weder bei der Polizei noch bei ihren Eltern oder sonst irgendjemandem zu melden.
Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen, geschweige denn sich verständlich ausdrücken. Was sollte sie tun? Wie würde der morgige Tag aussehen, wenn sie aus dem heutigen nichts Brauchbares machte?
Ihr taten sämtliche Glieder weh, sollte sie da nicht wenigstens zum Arzt gehen?
Nein, nicht heute. Sie war körperlich und seelisch dazu nicht in der Lage. War nicht in der Verfassung, sich untersuchen oder verarzten zu lassen. Und schon gar nicht, sich für das zu rechtfertigen, was passiert war. Denn dann würde mit Sicherheit die Polizei eingeschaltet und sie zur Rechenschaft gezogen werden: Warum hatte sie nicht schon eher einen Notruf abgesetzt? Warum hatte sie nichts unternommen? Wie hatte sie das zulassen können? Der Alkoholgeruch im Auto war schließlich eindeutig genug.
Sandra wusste, dass sie nicht fähig war, kluge Entscheidungen zu treffen und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Nicht bloß heute, sondern jeden Tag. Wie sollte es ihr also gelingen, dies jetzt zu ändern, wo das Schicksal sich so grausam zeigte?
Inzwischen war es draußen dunkel geworden. Es schneite in dicken Flocken, und das Thermometer am Fenster war auf unter null gefallen. Ihr Blick zuckte zur Küchenbank und blieb an der Whiskyflasche hängen.
Schließlich überwand sie ihre Trägheit und stand auf. Stolperte zur Küchenbank, griff sich die Flasche und setzte sie an die Lippen. Dann trank sie mit gierigen Schlucken, wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und trug die Flasche wieder in die Speisekammer zurück. Anschließend ging sie ins Bad und stellte sich unter die Dusche.
6
Jeanette
Unentwegt ging ihr derselbe Gedanke durch den Kopf: »Es hätte sowieso keinen Unterschied gemacht, er war ja schon tot.« Zwischendurch mit dem Zusatz: »Oder so gut wie.« Sie konnte schließlich nicht hundertprozentig sicher sein, in welchem Zustand er sich befunden hatte, als sie ihren Entschluss gefasst hatte. Ihren eigennützigen Entschluss, wohlgemerkt. Als sie entschieden hatte, ihn unten in der Schlucht zurückzulassen, in der Hoffnung, dass für sie nun eine neue Zeit anbrechen würde. Bestimmt würde jetzt alles besser werden.
Als sie nach Hause kam, gab sie vor, es wäre nichts passiert, was leichter gesagt war als getan mit einem Riss im Mantelstoff und matschigen Curling-Stiefeln. Doch ihr Mann hinterfragte ihre vage Erklärung, das Wetter sei umgeschlagen und die Bürgersteige seien rutschig gewesen, nicht, und sie plapperte ungebremst von der Badezimmerrenovierung, hauptsächlich deswegen, weil es in ihrer letzten normalen und alltäglichen Unterhaltung vor dem Unfall um die verdammten Fliesen gegangen war.
Vielleicht kam sie ihm außergewöhnlich aufgekratzt vor, mit einer unerwartet positiven Einstellung zu der Renovierung, für die sie sich bislang nicht sonderlich engagiert hatte. Aber er stellte keine Fragen, beteiligte sich am Gespräch und wirkte so ausgeglichen und mit sich im Reinen wie bereits seit Langem nicht mehr.
Seine Begeisterung beruhigte sie für den Moment, verscheuchte jedoch nicht ihre Gedanken, wenn es still wurde. Sie drehte und wendete das Geschehnis in dem kläglichen Versuch, ihre Schuldgefühle zu vertreiben. In ihrem Kopf entspann sich ein ständiger Dialog zwischen ihr selbst und einer Art moralischem Über-Ich:
Warum sollte mich ein toter Mann hinhängen?
Weil er vielleicht gar nicht tot ist.
Nach dem Aufprall und mit den Verletzungen muss er auf der Stelle tot gewesen sein, das Eintreffen des Krankenwagens hätte er auf keinen Fall noch erlebt.
Was weißt du schon davon? Hast du eine medizinische Ausbildung?
Jeder hätte erkennen können, dass er tot war, oder zumindest fast. Er hätte ohnehin kein lebenswertes Leben mehr gehabt, selbst wenn er gerettet worden wäre.
Wer bist du, dass du darüber urteilst, wer ein lebenswertes Leben hat und wer nicht?
Stimmt.
Selbst wenn er gerettet worden wäre, sagst du? Dann bestand also die minimale Chance, dass er hätte gerettet werden können?
Nein. Nein, so war das nicht. Nicht mal bei einer Chance von eins zu einer Million.
Trotzdem – ihn da einfach sitzen lassen? Bis er verblutet. Ohnmächtig. Ist das menschlich?
Da kann man nichts machen. Ein toter Mann durfte einfach keine Schande über mich bringen.
Du bist nicht die Erste, die eine Affäre hatte.
Und nicht die Letzte, die deswegen als Schlampe abgestempelt wird. Ich habe das Leben noch vor mir, er war tot oder lag bereits im Sterben. Was spielt das für eine Rolle?
Es spielt eine Rolle, für seine Frau, Kinder, Eltern und Geschwister, die ihn vermissen. Die ein Recht darauf haben, zu erfahren, was passiert ist.
Ich habe so reagiert, wie es am besten für mich war. Das meiste von dem, was ich tue, dient den anderen zum Vorteil, aber nun habe ich an mich selbst und meine Zukunft gedacht. Mein Verhalten war nachvollziehbar in der Situation.
Jeanette kämpfte mit ihren inneren Dämonen, rang darum, sich davon zu überzeugen, dass sie nur vernünftig gewesen war und ihr Handeln auf lange Sicht positive Auswirkungen haben würde. Aber das schlechte Gewissen nagte an ihr, fraß sich in ihre Gedanken und Träume.
Sie musste etwas unternehmen, damit ihre Schuldgefühle sie nicht erdrückten.
7
Sandra
»Du bist ja nur noch Haut und Knochen, Mädchen«, sagte ihr Vater und legte ihr eine Hand auf die Schulter.
Sandra fuhr zusammen, was sie mittlerweile bei jeder plötzlichen Berührung tat. Es war nicht das erste Mal, dass ihre Eltern – bei denen sie oft aß, sich ihnen ob der gegenwärtigen Lage allerdings nicht anvertraute – der Ansicht waren, sie habe abgenommen. Dass sie überhaupt keinen Appetit mehr hatte, war ein willkommener Nebeneffekt des schrecklichen Geschehnisses, das sie am liebsten vergessen wollte, jedoch nicht konnte.
»Oh, du hast mich aber erschreckt«, sagte Sandra und lachte auf, um ihre Reaktion herunterzuspielen.
Ihren Vater schien das nicht zu überzeugen. »Das wollte ich nicht«, sagte er mit einer Sorgenfalte zwischen den Brauen, »bitte entschuldige.«
Er und auch ihre Mutter merkten, dass irgendetwas nicht stimmte, doch sie hielten sich zurück und drängten sie nicht dazu, mit der Sprache herauszurücken. Unerwartete Geräusche mochte sie gar nicht. Leicht neurotisch warf sie immer wieder Blicke über die Schulter, um sicherzugehen, dass niemand sie aus der Ferne beobachtete. Abends konnte sie bloß mit Mühe und Not einschlafen, und es fiel ihr tagsüber schwer, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Sie war zwar intellektuell nicht besonders anspruchsvoll, aber sie musste den Erwartungen der Kunden nachkommen, ihnen ihre Wünsche von den Lippen ablesen, wenn sie zwischen den Waren herumirrten, und ihnen das Regal zeigen, das sie suchten. Und das Fernstudium, dem sie sich sonst abends widmete, lag zurzeit auf Eis. Sie war mit ihren Gedanken woanders.
Ihr Auto war fahrbereit, doch sie fand selbst, sie sei nicht fahrtüchtig. Sie hatte Angst vor der Kälte, vor eventueller Glätte, unvorhersehbaren Manövern der anderen Verkehrsteilnehmer und davor, bei Dunkelheit zu fahren. Sie war überspannt und niedergeschlagen – Welten entfernt von ihrem gewöhnlichen sonnigen Gemüt.
Der Gedanke, zur Polizei zu gehen, ließ sie nicht mehr los, und Sandra grübelte, ob sie sich dann besser fühlen oder die gegenteilige Wirkung erzielen würde, wenn sie Anzeige erstattete. Natürlich müsste sie ihrer Pflicht nachkommen wie jeder verantwortungsvolle Mitbürger. Dazu beitragen, dass dieser Mann gestoppt und bestraft wurde, damit nicht noch mehr Menschen Leid zugefügt wurde. Allerdings müsste sie – sollte die Polizei ihn wider Erwarten aufgrund ihrer vagen Beschreibung fassen – ihm von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Das war eher abschreckend als verlockend, obwohl es genau umgekehrt sein sollte. Sie würde vor Gericht gegen ihn aussagen müssen, wenn die Ermittlungen nicht eingestellt werden würden, was wahrscheinlicher war. Denn sie wusste weder, wie er hieß, noch was für ein Auto er fuhr, wo er arbeitete oder wo er wohnte. Und es war fraglich, ob sie ihn bei einer Gegenüberstellung überhaupt wiedererkennen würde.
Wozu die Ressourcen der Polizei und das Geld der Steuerzahler verprassen, wenn der Fall sowieso zu den Akten gelegt werden würde?
Deshalb warf Sandra ihre Überlegungen allmählich über Bord und konzentrierte sich darauf, so gut es ging ihr normales Leben weiterzuführen. Und die Tage verstrichen.
8
Jeanette
Erst gute zwei Wochen später wurde der vermisste Mann namentlich samt Foto in der Lokalpresse erwähnt. Jeanette konnte ihren Augen nicht trauen, sie las den Artikel immer wieder, bevor sie die Zeitung aus der Hand legte und die Hände über dem Kopf zusammenschlug.
Verschwunden? Was sollte das heißen?
Dem Text zufolge hatten die Ermittlungen bislang nichts ergeben, es gab nicht mal eine Spur.
Das war einerseits gut, andererseits nicht.
»Kopfschmerzen?«, fragte ihr Mann von der anderen Seite des Frühstückstisches.
Derart durcheinander von dieser überraschenden Meldung hatte sie ganz vergessen, dass sie nicht allein in der Küche war. Sie antwortete mit Ja, entschuldigte sich und ging ins Bad, wo der Medizinschrank hing. Hastig spülte sie zwei Schmerztabletten runter, das Zweifache der im Beipackzettel vorgeschriebenen Dosis. Dann setzte sie sich auf den Toilettendeckel, stützte das Kinn in die Hand und versuchte ihre Gedanken zu ordnen.
Mit einem Schlag war ihr turbulentes Dasein auf den Kopf gestellt worden. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hilfe, Familie und Freunde wussten nichts. Niemand wusste etwas.
Ausgenommen sie selbst. Jeanette kannte die Antworten auf alle Fragen, kannte die Lösung, damit sich das Rätsel auflöste und die trauernden Angehörigen Gewissheit hatten.
Doch zu welchem Preis?
Zu einem viel zu hohen Preis zweifelsohne. Sie hatte sich strafbar gemacht, das war ihr bewusst, obwohl sie keine Vorstellung davon hatte, wie schwer ihre Tat geahndet werden würde. Jeanette war nicht bereit, ihr Wohlergehen einer Handvoll fremder Menschen zu opfern. Sie war ihnen nichts schuldig, Punkt. Und selbst wenn ihre mentale Verfassung zurzeit zu wünschen übrig ließ, hatte sie dort unten in der Schlucht ihre Entscheidung getroffen, daran gab es nichts zu rütteln. Es war zu spät, das jetzt noch in Ordnung zu bringen. Sie wollte dafür nicht ins Gefängnis wandern, das würde sie nicht aushalten.
Keinem würde es besser gehen, wenn herauskäme, dass sie mit dem verschwundenen Mann ein Verhältnis gehabt hatte. Das würde nur Salz in die Wunde streuen. Außerdem war die Affäre jetzt vorbei, also brauchte niemand davon zu erfahren.
*
Jeanette schlief nachts fast gar nicht mehr. Obwohl alles in ihr förmlich nach Ruhe schrie, weigerte sich ihr Gehirn abzuschalten. Stattdessen malte ihre Fantasie Schreckensbilder, die für Herzrasen und Schweißausbrüche sorgten, welche die Laken durchnässten.
In fiebrigem Halbschlaf sah sie den Mann in dem Blechwrack tief unten in der Schlucht. Sein Gesicht war durch Blutergüsse und Schrammen bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Glasscherbe steckte wie eine Harpune in seinem Hals, die aufgerissenen Augen flehten um Hilfe, die aber nicht kam. Der Brustkorb hob sich für einen einzigen rasselnden Atemzug, Blut rann aus der Platzwunde an der Stirn.
Fantasie und Wirklichkeit gingen ineinander über, sie wälzte sich Nacht für Nacht hin und her, ohne ihr schlechtes Gewissen zu besänftigen.
Nur tagsüber herrschte eine gewisse Vernunft, und ihre rationale innere Stimme fand Gehör. Doch die ruhelosen Nächte forderten ihren Tribut, und der Schlafmangel führte zu einem Zustand, der langsam, aber sicher einer Depression glich.
Die Tage verstrichen.
CHARLOTTE WRETBERG
* 7. März 2003 † 16. September 2009
Wir vermissen Dich!
In unendlicher Liebe und Trauer
Mama und Papa
Oma, Omi und Opi
Angehörige und Freunde
Deine Wange kann ich
nicht mehr liebkosen,
Deine Hände nicht mehr drücken,
in einem anderen Land bist Du,
Dir kann nichts mehr geschehen.
Der Aussegnungsgottesdienst findet in der Västerhejdekirche am Freitag, den 2. Oktober um 11 Uhr statt.
Nach dem Abschied in der Kirche ist die Trauerfeier beendet.
Statt Blumen bitten wir um eine Spende an die Kinderkrebsgesellschaft: Postgiro 902090-0, Bankgiro 902-0900
2018
Mai
9
Sandra
Es war ein frischer, aber angenehmer Frühlingsabend, und Amseln und Laubsänger zwitscherten im elterlichen Garten um die Wette. Seit einer ganzen Weile schon hatte es nicht mehr geregnet, sodass Erik und sein Großvater den Garten bewässerten. Sandra hörte, wie ihr Vater seinem Enkel ausführlich erklärte, warum es so wichtig war, am Abend zu gießen. Erik hörte mit großem Interesse allem zu, was sein Opa sagte. Er vergötterte seine Großeltern, und diese Liebe beruhte fraglos auf Gegenseitigkeit. Erik war mindestens genauso verwöhnt, wie sie selbst in ihrer Kindheit es gewesen war. Doch man konnte schließlich gar nicht genug geliebt werden, sagte sie sich.
Sie hatten gemeinsam gegessen, und nun half Sandra ihrer Mutter beim Abräumen. Eigentlich wollte sie ihre Hilfe nicht, aber Sandra fand, dass sie ihre Eltern bereits oft genug in Anspruch nahm, und wollte wenigstens einen kleinen Teil wieder zurückgeben. Mehrmals in der Woche zum Abendessen herzukommen kam ihr irgendwie unreif vor, doch die übrigen Beteiligten wollten es so haben. Und sie wollte ihnen diese Freude nicht verderben, auch wenn es nicht gerade dazu beitrug, endlich erwachsen zu werden.
»Machst du heute Abend wieder diese Freiwilligenarbeit?«, fragte ihre Mutter.
»Klar, wenn ich nichts Besseres vorhabe, mache ich das.«
»Ist das nicht zu anstrengend? Leidet denn dein richtiger Job nicht darunter? Du musst dich auch mal erholen, so wie alle anderen.«
»So anstrengend ist das gar nicht«, versicherte Sandra ihr. »Ich kann etwas bewirken, und das ist mir wichtig. Fast schon eine Beschäftigungstherapie.«
»Wenn du eine Therapie brauchst, kannst du immer zu mir kommen, meine Kleine.«
»Ich weiß, Mama, und ihr gebt mir allen Halt, den ich brauche. Aber es ist schön, anderen zu helfen. Sie zu trösten und zu unterstützen.«
»Rufen da nicht lauter Widerlinge an?«
»Widerlinge?« Sandra lachte und stellte die Bratpfanne in die Spüle. »Nein, wirklich nicht. Meistens rufen traurige Menschen an. Einsame und vielleicht ängstliche Menschen, die denken, dass sie niemanden haben, dem sie ihren Kummer und ihre Sorgen anvertrauen können.«
»Das muss doch absolut kraftraubend sein, den Seelenklempner zu spielen.«
»Im Gegenteil, Mama, im Gegenteil. Die eigenen Probleme kommen einem oft nichtig vor, wenn man von den Schwierigkeiten der anderen erfährt.«
»Probleme?«, sagte ihre Mutter mit einem Stirnrunzeln. »Macht dir das alles sehr zu schaffen?«
»Schon«, sagte Sandra wahrheitsgemäß, »aber es wird von Tag zu Tag besser. Ich habe doch euch, und ich habe auch mal Erik. Ich habe einen interessanten Job und dazu Kollegen, mit denen ich gut auskomme. Mehr kann man sich doch nicht wünschen, oder?«
»Ja, wenn du meinst«, seufzte ihre Mutter und klang dabei nicht sehr überzeugt.
Bald würde die Frage kommen, ob Erik bei den Großeltern übernachten könnte. Sandra stellte das restliche Geschirr in die Spülmaschine und wischte die Arbeitsfläche sauber.
»Du weißt schon, dass wir Erik liebend gerne über Nacht hierbehalten? Dann hättest du mal ein bisschen Zeit für dich.«
Sandra hatte eine vage Vorstellung davon, dass »Zeit für sich« etwas mit Kerlen und über kurz oder lang auch etwas mit einer Heirat zu tun hatte. Auf die Dauer begann diese Art von Druck etwas zu nerven, doch das war nichts, was sie nicht aushalten konnte.
»Ich weiß, Mama«, gab sie zurück. »Aber ich liebe es auch, Zeit mit Erik zu verbringen. Ich bade ihn, putze ihm die Zähne und lese ihm eine Gutenachtgeschichte vor. Ich will ihn in seinem Zimmer schlafen hören, wenn ich Erwachsenensachen erledige. Danke, aber heute Abend nicht.«
Den Auftakt des Abends am Sorgentelefon machte ein älterer Mann, dessen Hund überfahren worden war. Es fiel ihm leicht, darüber zu sprechen, und es machte ihm nichts aus, seine Gefühle zu offenbaren. Er brauchte nur jemanden, der ihm zuhörte, und genau das tat Sandra. Gelegentlich warf sie eine kurze, aufmunternde Bemerkung ein, und nach etwa zwanzig Minuten hatte er sich seinen Kummer von der Seele geredet.
Danach rief eine junge Frau namens Ellen an, die sich fast jeden Abend meldete, wenn Sandra Dienst hatte. Sie war geistig beeinträchtigt und wirkte unbekümmert, wollte bloß jemandem mitteilen, wie ihr Tag gewesen war. Sandra stellte interessiert Fragen und bekam unterhaltsame Antworten. Auf diese Weise die Vertraute eines anderen Menschen zu sein und den Alltag mit diesem zu teilen, von dem sie andernfalls nichts erfahren würde, war eine Anerkennung.
Anschließend führte sie ein recht kurzes Telefonat mit einer unglücklichen Mutter, die mit ihrem Kind Probleme hatte, das in schlechte Kreise geraten war.
Dann rief niemand mehr an, und Sandra machte sich für die Nacht fertig. Doch gerade als sie das Telefon auf Flugmodus stellen wollte, weil um Mitternacht ihr Dienst sowieso zu Ende war, klingelte es wieder.
Das Gespräch begann sehr zögerlich.
»Kerstin«, entgegnete die Frau nach einer Weile auf Sandras Frage. »Ich heiße Kerstin.«
Ihre Stimme war ziemlich rau, vielleicht hatte das Leben ihr mitunter übel mitgespielt. Aber es konnte genauso gut sein, dass sie mehr rauchte, als für ihre Stimme gut war, oder dass sie noch eine Erkältung auskurierte.
»Ich bin froh, dass Sie sich an das Sorgentelefon wenden, Kerstin. Bevor wir anfangen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich gezwungen bin, die Polizei zu verständigen, wenn Sie etwas sagen, was den Verdacht erweckt, dass Sie oder eine andere Person eine Straftat begangen haben oder begehen wollen. Ist das für Sie in Ordnung?«
»Natürlich.«
»Darüber hinaus können Sie ganz beruhigt sein: Alles, was gesagt wird, bleibt unter uns. Klingt das gut, was meinen Sie?«
»Ja, tut es.«
»Wunderbar. Möchten Sie mir irgendwas Bestimmtes erzählen?«
»Was Bestimmtes? Nein, ich weiß nicht …«
»Wir können über alles reden. Ich höre Ihnen zu, und Sie bestimmen, in welche Richtung das Gespräch geht.«
»Ich bin eigentlich auch eher eine gute Zuhörerin«, sagte Kerstin.
Dann verstummte sie, und Sandra konnte nur mit Mühe und Not die Unterhaltung in Gang halten. Es war ungewöhnlich, dass ein Anrufer kein konkretes Gesprächsthema hatte.
»Sie sind quasi die stumme Beobachterin? Oder kommen die Menschen mit ihren Problemen zu Ihnen?«
»Beides«, gab Kerstin zurück, ohne genauer zu werden.
»Fällt Ihnen das schwer?«, fragte Sandra nach.
»Nein, nein, gar nicht.«
»Es ist sicher auch manchmal eine Belastung, diejenige zu sein, bei der sich alle ausweinen wollen.«
»Für Sie offenbar nicht.«
»Sie und ich, wir bleiben anonym«, sagte Sandra. »Das ist der Unterschied. Ich kann Ihnen bloß helfen, indem ich Ihnen zuhöre und versuche, Ihnen gute Ratschläge zu geben. Wenn man der Person direkt gegenübersitzt, ist das was ganz anderes. Ich will damit nur sagen, dass es auch anstrengend sein kann, die Vertrauensperson zu sein, wenn es den Menschen im eigenen Umfeld schlecht geht.«
»Nein, nein, das ist wirklich nicht schlimm«, sagte Kerstin wieder.
Sandra wusste nicht so recht, wie sie das Gespräch am Laufen halten sollte. »Dann sind Sie also eine gute Zuhörerin. Heißt das auch, Sie sind nicht so redselig?«
»Genau.«
»Woher, meinen Sie, kommt das? Sind Sie vielleicht eher schüchtern?«
»Nein, das würde ich nicht sagen. Es gibt einfach nichts, worüber ich reden könnte.«
Die Unterhaltung verlief schleppend, ohne dass wirklich irgendetwas gesagt wurde. Lange Strecken blieb es still in der Leitung. Aber irgendwie weckte diese Frau Sandras Interesse mehr als die anderen Anrufer. Es war dieser traurige, zurückhaltende Ton in ihrer Stimme. Ihr Widerwille zu sprechen und die Überwindung, die es gekostet haben muss, es dennoch zu tun.
»Ich spüre, dass es Ihnen schwerfällt, über sich selbst zu sprechen«, meinte Sandra. »Es ist wirklich sehr mutig, dass Sie das trotzdem machen.«
»Ich habe ja kaum was gesagt«, erwiderte Kerstin mit einem kurzen Lacher.
»Das wird schon«, sagte Sandra aufmunternd. »Wir lernen uns schließlich gerade erst kennen. Bauen Vertrauen zueinander auf. Das braucht eben seine Zeit. Wenn Sie das nächste Mal anrufen, ist es bestimmt leichter.«
»Sie denken, ich sollte wieder anrufen?«
»Das finde ich auf jeden Fall. Manchmal muss man einfach im Mittelpunkt stehen. Vor allem wenn es um das eigene Leben geht. Wenn Sie lieber mit jemand anderem reden wollen, können Sie das gerne sagen, das ist kein Problem.«
»Schon in Ordnung, ich rufe vielleicht wieder an.«
»Tun Sie das. Alles Gute bis dahin.«
»Danke für das Gespräch.«
Damit war das Telefonat beendet. Es war nicht einfach gewesen, weil Sandra nicht sonderlich erfinderisch war, wenn es darum ging, ein Gesprächsthema zu finden. Meistens musste sie das aber auch gar nicht. Genau genommen hatten sie über rein gar nichts geredet, und dennoch wünschte sich Sandra merkwürdigerweise, es würde ein nächstes Mal geben. Sie vermutete, dass hinter der Niedergeschlagenheit in Kerstins Stimme eine Trauer lag, etwas, das sie belastete und nach und nach an die Oberfläche dringen würde. Das machte Sandra neugierig, und sie hoffte, dann dabei zu sein.
10
Jeanette
Es war ein turbulenter Nachmittag am Österport, dem östlichen Tor der alten Ringmauer. Ein paar von den Burschen waren laut geworden, und die Polizei war mehrmals angerückt, um ihnen ins Gewissen zu reden. Sie nahm selten jemanden mit, denn die Clique, die auf und vor den Bänken herumlungerte, war eigentlich harmlos. Aber manchmal kippte die Stimmung, und dies war jetzt der Fall.
Jeanette hatte einen ihrer schlechteren Tage. Ihr lag die Angst wie ein Krebsgeschwür im Magen, gedankenlos hatte sie Beruhigungsmittel mit Alkohol gemischt, das war ihr durchaus klar. Nun war ihr schwindelig und übel, sie saß schwankend auf der Bank und hielt sich die Ohren zu. Hoffte, dass der Lärm aufhörte, damit sie alle die Ruhe in der Frühlingssonne genießen konnten.
Die beiden anderen, die sich in den Haaren lagen – wie fast immer ging es um einen überschaubaren Geldbetrag –, hatten hingegen die Fäuste geballt, bereit, jeden Moment zuzuschlagen. Die restlichen – zwei Frauen und eine Handvoll Männer – versuchten, sie zu beruhigen und auseinanderzubringen. Jeanette hielt sich da raus, sie hatte keine Kraft sich einzumischen und fand, sie gehöre da auch gar nicht richtig dazu.
Dennoch war sie hier gelandet, und hier verbrachte sie einen großen Teil ihrer langen, sinnleeren Tage. Sie war tief gesunken, und das war schnell gegangen. Nach einem geordneten, finanziell abgesicherten Leben hatte sie von einem auf den anderen Tag alles hingeworfen und sich verschiedenen Formen von chemischen Substanzen zugewandt. So hatte eins zum anderen geführt, bis ihr die Bänke der randständigen Alkoholiker an der Österport ein besserer Ort zu sein schienen, als ihr Leben an die Einsamkeit ihrer Zweizimmerwohnung in Gråbo zu verschwenden.
Jetzt hing die Schlägerei in der Luft, es hagelte Flüche. Alle waren irgendwie beteiligt, ausgenommen Jeanette. Passanten blieben neugierig stehen, um zu erfahren, was passieren würde, doch die Polizei glänzte durch Abwesenheit, wo sie am allermeisten gebraucht wurde. Der Lärm türmte sich unerbittlich auf, und Jeanette beschloss zu gehen. Nicht weit weg, nur rüber zur Sparbössa und zum Dalmansporten, wo sie sich auf den Rasen legen konnte, bis sich die Situation wieder beruhigt hatte. Gerade als sie sich erheben wollte, wurde sie von einem Ellenbogen umgestoßen, der ihr zufällig in den Weg geriet. Als sie wieder zu sich kam, lag sie rücklings auf dem Asphalt, mit blutender Nase. Die Wogen hatten sich inzwischen geglättet, und alle richteten ihre Aufmerksamkeit auf Jeanette.
Die beiden Rabauken zeigten sich reumütig und halfen ihr auf, damit sie halbwegs auf der Bank sitzen konnte. Einer von ihnen, Lubbe, setzte sich neben sie, legte ihr den Arm um den Nacken und neigte ihren Kopf zurück.
»Muttern holt Eis beim Inder um die Ecke«, sagte er. »Entschuldige. Das wollte ich wirklich nicht.«
»Ich weiß«, entgegnete Jeanette. »Aber es war total unnötig, so über die Stränge zu schlagen.«
»Willst du einen kleinen Schluck?«, fragte Lubbe in dem plumpen Versuch abzulenken.
»Stehen hier nicht lauter Leute rum und gaffen?«
»Wen stört das? Aber die sind jetzt weg. Der Krankenwagen ist unterwegs.«
»Machst du Witze?«
»Ich mache Witze«, grölte Lubbe. »Hier.«
Dann hielt er ihr vorsichtig den Kopf und ließ sie aus der Wodkaflasche trinken. Das war vielleicht nicht gerade das, was sie brauchte, aber sie lehnte nicht ab. Es war schön, so umsorgt zu werden und ein einziges Mal im Mittelpunkt zu stehen. Sie lehnte sich wieder zurück, um den Blutfluss zu stoppen.
»Hier kommt sie, unsere Barbamama«, sagte Lubbe.
Muttern setzte sich ans andere Ende der Bank. Sie hatte einen Plastikbeutel mit Eis auftreiben können, den sie Jeanette nun auf die Nase drückte.
»Wie ist es?«, fragte sie. »Tut’s weh?«
»Geht schon«, gab Jeanette zurück.
»Danke, dass du die Streithähne auseinandergebracht hast.«
»Hab ich das?«
»Das weißt du doch«, sagte Muttern mit einem Seitenblick auf Lubbe. »Im Augenblick sind sie ja die reinsten Unschuldslämmer.«
Wieder setzte dröhnendes Gelächter von Lubbe ein. Jeanette musste auch lachen und setzte sich gerade hin.
»Ich glaube, es blutet nicht mehr«, meinte sie und legte den Eisbeutel auf die Erde.
Sie sah sich um. Alles war wieder normal. Auf den anderen Bänken wurde verstohlen getrunken und schwadroniert. Die Frühlingsblumen in den Beeten zwischen den Bänken leuchteten im Sonnenlicht. Die Vögel zwitscherten, und die Luft war warm. Die perfekten Voraussetzungen für ihren jetzigen Lifestyle.
Passanten spazierten mit zielgerichteten Schritten und wichtigen Mienen vorbei. Vor wenigen Jahren war sie noch eine von ihnen gewesen, eine, die jeden Morgen zur Arbeit ging und abends mit einer Tüte Lebensmittel nach Hause kam. Eine, die ins Fitnessstudio und zum Yoga ging, der ihre Gesundheit wichtig war, ihr Aussehen und Äußerlichkeiten wie Schminke und Accessoires. Und Badezimmerfliesen.
Die Panik, die zwischenzeitlich bedingt durch den Schlag auf die Nase von ihr abgefallen war, war wieder da. Es gab kein Heilmittel, aber zwei Arten der Linderung: Tabletten und Alkohol. Beides war auf lange Sicht verheerend. Alles drehte sich vor ihren Augen, ihr Magen rebellierte. Mehr vertrug sie im Moment nicht, sie musste die Schmerzen irgendwie aushalten.
»Wie geht’s dir, Kleine?«, wollte Lubbe wissen und legte ihr eine Hand aufs Knie. »Du bist kreideweiß.«
»Geht schon«, log Jeanette.
»Hätten wir nicht besser den Notarzt rufen sollen? Vielleicht hast du eine Gehirnerschütterung.«
»Nein, bestimmt nicht. Ich habe einfach bloß einen richtig beschissenen Tag heute. Hier drinnen«, fügte sie mit einer Geste Richtung Kopf hinzu.
Und nun konnte sie die Tränen nicht länger zurückhalten. Sie kam sich lächerlich vor, weil sie vor den anderen weinte, für die das auch nicht komisch war. Aber der Kloß in ihrem Hals wurde immer größer. Sie weinte ohne große Gebärden; keine Schluchzer, nur ein stiller Strom Tränen rann ihr über die Wangen.
Lubbe bemerkte das, er legte den Arm um Jeanette und zog sie an sich. »Was bedrückt dich denn so sehr?«, fragte er feierlich, um den Ernst der Situation herunterzuspielen.
»Ich will wieder nach Hause«, sagte Jeanette. »Zurück zu allem, was ich früher hatte, bevor ich so geworden bin wie jetzt.«
»So wie jetzt?«, wiederholte Lubbe. »Du bist ein feines Mädel, Nettan. Da gibt es nichts, was du ändern musst.«
»Ich habe Sehnsucht nach meiner Tochter und meinem Mann und unserem Haus mit all unseren Sachen. Nach meinem Job allerdings eher weniger …«
»Tochter?« Sie wurde von Muttern unterbrochen. »Du hast eine Tochter?«
»Das hast du uns nie erzählt«, pflichtete Lubbe ihr bei.
»Hatte«, entgegnete Jeanette bedrückt. »Sie ist gestorben.«
»Verdammt«, sagte Muttern und griff nach Jeanettes Hand.
»Mein Beileid«, murmelte Lubbe. Er schwieg eine Weile, ehe er den Faden wieder aufnahm. »Ich will ja alte Wunden nicht wieder aufreißen, aber wenn du reden willst, dann habe ich immer ein offenes Ohr für dich.«
Jeanette wollte darüber sprechen, doch sie hatte ihre Gefühle so lange verdrängt und wusste nicht recht, wie sie anfangen sollte.
»Sie hieß Charlotte«, begann sie dann.
»Schöner Name«, sagte Muttern.
»Wie alt – ist sie geworden?«, wollte Lubbe wissen.
»Sie war vier, als wir die Diagnose erhalten haben«, sagte Jeanette und wischte sich mit dem Ärmel die Nase ab. »Akute myeloische Leukämie.«
»Leukämie«, wiederholte Lubbe. »Verflucht.«
»Sie hatte Schmerzen, hatte Blutergüsse am ganzen Körper, hat Infektionen bekommen, die nicht mehr kuriert werden konnten, und sie war andauernd müde. Sie war beinahe zwei Jahre lang in Behandlung. Lauter Chemotherapien. Und dann hat sie eine Knochenmarktransplantation bekommen. Nichts hat geholfen, die Nieren haben nicht mehr mitgemacht, und am Ende hatte sie keine Kraft mehr. Sie war sechs, als sie aufgegeben hat. Das ist fast neun Jahre her. Dieses Jahr wäre sie fünfzehn geworden.«
Keiner sagte etwas. Lubbe drückte sie fest an sich, und Muttern hielt ihre Hand. Jetzt, wo jemand Anteil nahm, fühlte sie sich ein bisschen besser. Es änderte nichts an dem, was gewesen war, aber für den Moment spürte sie eine Warmherzigkeit, die von diesen Menschen kam, die nur noch selten anzutreffen war.
»Sie hat sich in den letzten Jahren sehr gequält«, erklärte Jeanette, als sie sich wieder gefasst hatte. »Und wir haben mitgelitten, mein Mann und ich. Es war schrecklich, tatenlos zusehen zu müssen und Charlotte nicht helfen zu können. Und dann von seinem eigenen Kind Abschied nehmen und es beerdigen zu müssen … Das war unbeschreiblich.«
»Wie hat er das aufgenommen?«, fragte Muttern. »Dein Mann?«
»Als Charlotte noch am Leben war, da waren wir drei gemeinsam stark. Unfassbar stark, wenn ich so darüber nachdenke. Einer von uns oder wir beide waren ständig bei ihr. Wir haben zusammengehalten gegen gleichgültiges Pflegepersonal, verständnislose Behörden, ja, gegen den Rest der Welt. Aber als Charlotte nicht mehr da war, verschwand all das, was uns zusammengeschweißt hatte.«
»Habt ihr euch scheiden lassen?«, fragte Lubbe.
»Nicht sofort. Fünf Jahre lang haben wir uns noch was vorgemacht. Er hat gekämpft und sich eingeredet, alles wäre wie immer. Ich stumpfte immer mehr ab, und unser leeres Leben und all die uninteressanten Gespräche langweilten mich. Danach sehne ich mich jetzt zurück. Doch wir teilten immerhin die Trauer um Charlotte miteinander. Wir hätten darüber reden können. Ich wollte das, aber er hat alles abgeblockt, was anstrengend war. Er wollte wieder leben, nach vorne schauen. Das hat er gesagt, und er hatte sicher recht. Ich bin ein schwacher Mensch.« Sie weinte bitterlich, schluchzte dann und trocknete die Tränen mit ihrem Jackenärmel.
Lubbe und Muttern schwiegen und warteten, dass Jeanette fortfuhr.
»Ich habe einen Mann kennengelernt. Über meine Arbeit«, fuhr Jeanette fort. »Er war verheiratet und hatte zwei Kinder, und wir haben eine Affäre miteinander angefangen. Wir sind nachmittags heimlich mit seinem Auto weggefahren. Für ein Schäferstündchen. Das kam mir schmutzig und unmoralisch vor, aber irgendwo muss man ja anfangen. Man kann die alte Beziehung schließlich nicht Hals über Kopf beenden, ehe man wenigstens die neue etwas ausgetestet hat.«
Lubbe machte ein Dosenbier auf und reichte es Jeanette. Sie sollte zwar besser nicht trinken, nahm aber trotzdem einen Schluck. Danach hielt sie Muttern die Dose entgegen, die jedoch ablehnte. Also gab sie Lubbe das Bier zurück und erzählte weiter.
»Wir haben über eine gemeinsame Zukunft gesprochen. Ich war bis über beide Ohren verliebt in ihn und bereit, alles aufzugeben, was ich noch hatte. Das war nicht viel, habe ich gedacht, aber wenn ich jetzt daran zurückdenke … Das mit dem anderen Mann ist nichts geworden. Ging total nach hinten los. Ich bekam Depressionen und Panikattacken. Habe mich krankschreiben und mir Beruhigungstabletten verschreiben lassen. Wein aus dem Tetrapack getrunken. Ich bin nicht mehr zum Sport gegangen, habe mich nicht mehr mit meinen Freunden getroffen und nicht mehr mit meinem Mann geredet. Von meiner Untreue wusste er nichts, aber ein halbes Jahr später hatte er genug von mir und meiner jämmerlichen Verfassung. Das war nur verständlich, doch mir war das egal. Zuerst. Bis die Wirklichkeit mich einholte und ich dieser fertigen, abgemagerten Trinkerin im Badezimmerspiegel ins Gesicht sah. Das machte es auch nicht einfacher, wieder an meinen Arbeitsplatz zurückzukehren und ein geregeltes Leben zu führen.«
Muttern und Lubbe schlugen die Augen nieder, vermutlich weil sie an ihre eigenen jämmerlichen Gestalten denken mussten und nicht an Jeanettes. Keiner von ihnen widersprach ihr, was ihr indirekte Bestätigung einbrachte.
»Und, was habe ich getan? Habe ich mich zusammengerissen und bin wieder abstinent geworden? Nein, ich habe mich noch mehr gehen lassen. Ich bin eine Versagerin, und mein Leben ist ein einziges Fiasko«, stellte Jeanette fest.
Damit war die Unterhaltung beendet. Die anderen kamen dazu, und die Stimmung war gebrochen. Vielleicht weil Jeanettes letzte Bemerkung auf jeden von ihnen zutreffen konnte. Lubbe und Muttern konnten vor ihrem eigenen Schiffbruch die Augen verschließen, warum also schleuderte Jeanette ihnen die Wahrheit ins Gesicht? Glaubte sie insgeheim, dass sie etwas Besseres war als die beiden?
Sie beschloss, sich in Zukunft anders auszudrücken. Keine Verunglimpfungen mehr von sich zu erzählen, die im Grunde auf die ganze armselige Bagage am Österport zutrafen.
11
Sandra
»Mama, warum willst du nicht, dass ich mich prügele?«
Sandra saß im Kinderzimmersessel und versuchte zu lesen, bis Erik eingeschlafen war. Nicht weil er Gesellschaft brauchte, weil er Angst vor der Dunkelheit hatte oder davor, allein zu sein, sondern um ihrer selbst willen. Bisweilen brauchte er eine Weile, um abzuschalten, und dann redeten sie. Über das Buch, das sie eben gelesen hatten, oder über etwas, was am Tag passiert war. Manchmal über große Fragen über das Weltall, die Weltmeere oder die Armut, oft über alltägliche, aber dennoch faszinierende Dinge wie Busse, Vogelscheuchen oder Elektrizität. Diesmal über Verbrechen und Strafe.
»Weil es verboten ist, anderen Menschen wehzutun«, antwortete Sandra. »Das ist eine Straftat, für die man ins Gefängnis kommt.«
»Igor ist aber nicht im Gefängnis«, wandte Erik ein.
»In Schweden kommen Kinder auch nicht ins Gefängnis.«
Es entstand eine Pause, dann ergriff Erik wieder das Wort.
»Ich würde es nicht traurig finden, im Gefängnis zu sitzen.«
»Nicht?«
»Ich würde Däumchen drehen und Schattenspiele machen.«
Sandra musste sich das Grinsen verkneifen. Däumchen drehen – woher hatte er das denn?
»Am besten, du vermeidest es einfach, im Gefängnis zu landen«, sagte sie lachend und kniff ihn liebevoll in die Wange. »Schlaf jetzt schön, mein Kleiner.«
Erik ging alles Mögliche durch den Kopf, und es fiel ihm nicht schwer, sich auszudrücken. Er war in mehrerlei Hinsicht seiner Entwicklung voraus: Schon mit neun Monaten konnte er laufen, und mit dreizehn Monaten hatte er angefangen zu sprechen. Er redete viel und gern, plapperte mit Begeisterung drauflos, um seinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
Was für ein Glück, dass ich so einen Sohn habe, dachte Sandra oft. Besonnen und einfühlsam, offen und mitteilsam. Ziemlich weit von ihrem Charakter entfernt, zum Glück. Sie selbst war verschlossen und feige und machte nicht viel her: dick und ungeschickt, mit mattbraunem Haar und Überbiss. Die Jungs standen damals nicht gerade Schlange, was ihre Eltern nicht wahrhaben wollten, sie aber trotzdem enttäuschte.
Sie hatte nur ein paar Seiten zu lesen geschafft, denn die Gedanken wollten in der wirklichen Welt mit ihren vielen Schattenseiten, allerdings auch manchen Lichtblicken verweilen. Erik war der stärkste von ihnen allen, und ohne ihn wäre das Leben nicht lebenswert. Sie schlug das Buch zu und musterte ihn im Licht der Leselampe. Was hatte sie ihm gegeben? Außer Liebe und Geborgenheit? Äußerlich sah er ihr nicht ähnlich, und seine aufgeschlossene Art hatte er ebenso wenig von ihr. Aber er ist ein braver Junge, dachte sie, lässt alles auf sich zukommen. Und er will gut sein zu den Menschen.
Als Erik eingeschlafen war, löschte Sandra das Licht und ging aus dem Zimmer. Sie legte in der Diele und im Wohnzimmer ein paar Sachen an ihren Platz und räumte die Küche auf. Dann setzte sie sich mit einer Tasse Tee und der Zeitung an den Küchentisch und wartete darauf, dass ihr Handy klingelte.
Am Telefon war sie anders. Da konnte sie so tun, als wäre sie eine Person, die sie tatsächlich gar nicht war. Vor allen Dingen traute sie sich, laut zu denken und zu reden. Sie war zwar nicht besonders gut darin, die Unterhaltung in Gang zu halten, aber Gesprächspausen waren ja durchaus erlaubt. Fast allen bedeutete es am meisten, dass sie eine gute Zuhörerin war, geduldig war und einsilbige Kommentare gab. Keiner wusste, wer sie war oder wie sie aussah, sie versteckte sich hinter einer Stimme, die einfühlsam und erfahren zugleich klang. Oder es war genau anders herum, dass sie sich hinter ihrer Stimme gar nicht zu verstecken brauchte, weil es ihre eigene war.
Darüber dachte sie oft nach. Wenn sie sich anstrengte, könnte sie sich ihr Aussehen wegdenken und ihre Angst draußen unter Leuten überwinden und stattdessen die Rolle der Frau ausleben, die sich nicht unterkriegen ließ. Die tröstete und aufbaute, die Menschen, die das seelische Gleichgewicht verloren hatten, mit vorsichtigem Rat justierte.
Aber nein – niemand konnte seine Ängste und eingestandenen Schwächen bewusst verdrängen.
Nun vibrierte ihr Handy. Ellen war die Erste. Wunderbare, gut gelaunte Ellen, die das Leben meist positiv sah, so wie heute. Und das war ansteckend. Ein ausführlicher Bericht über einen Schwimmbadbesuch, gefolgt von der Bitte, Sandra möge von ihrem Tag erzählen. Das tat sie – stets auf ihre Integrität bedacht und darauf, keine Einzelheiten über ihre Arbeitsstätte und ihre Wohnadresse preiszugeben. Von Ellen brauchte sie nichts zu befürchten, doch früher oder später würde sie einen Verrückten am Telefon haben.
Dann zwei Anrufe von derselben Person im Abstand von einer guten Stunde. Aber derjenige stellte sich mit zwei verschiedenen Namen vor und schilderte zwei unterschiedliche Probleme. Sandra ließ sich nichts anmerken und ging auf jedes Anliegen einzeln ein. Bei dem ersten ging es um eine Lebenskrise infolge einer Krebsdiagnose, bei dem zweiten handelte es sich um Angst wegen etwas, das er rein rechtlich als Misshandlung der Ehefrau bezeichnete, was tatsächlich allerdings nur eine unsanfte körperliche Berührung gewesen war.
Sandra fand, sie ging die ganze Sache recht gut an, besonders das zweite Telefonat, bei dem sie sich Mühe gab, nicht zu urteilen, sondern wollte, dass sich der Mann über seine Gefühle klar werden konnte. Gestärkt in ihrem Glauben an ihre objektiven therapeutischen Fähigkeiten, nahm sie kurz vor Mitternacht den zweiten Anruf von Kerstin entgegen.
»Ich bin froh, dass Sie sich wieder melden«, sagte Sandra. Das meinte sie wirklich so, sie hatte seit dem ersten Gespräch auf ein zweites gehofft.
Kerstin schwieg.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte Sandra.
»Geht so«, entgegnete Kerstin zögerlich.
»Wissen Sie, warum?«
»Wie, warum?«
»Warum geht es Ihnen nicht so gut?«
»Ich habe Halsweh«, sagte Kerstin.
»Das klingt ziemlich übel. Aber das geht wieder vorüber.« Sandra glaubte nicht, dass Kerstin anrief, um über kleinere Wehwehchen zu diskutieren.





























