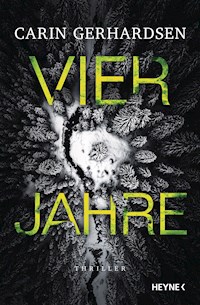12,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Thriller und Krimis von beTHRILLED als XXL-Sammelbände für extra viel Spannung
- Sprache: Deutsch
Hammarby, mitten in Stockholm: Hier ermittelt Kommissar Conny Sjöberg mit seinem Team. Dabei ist der Familienmensch Sjöberg immer wieder mit menschlichen Abgründen konfrontiert ...
Spannende Fälle, raffinierte Clous, typisch schwedisch: die Thriller von Carin Gerhardsen sind internationale Bestseller - in über 25 Sprachen übersetzt, jedes Buch erreichte Platz 1 der schwedischen Bestseller-Charts.
Dieser Sammelband enthält die ersten drei Fälle von Kommissar Sjöberg:
Das Haus der Schmerzen
Als Ingrid Olsson aus dem Krankenhaus zurück in ihre Stockholmer Wohnung kommt, entdeckt sie einen Mann in ihrer Küche. Sie hat den Eindringling noch nie gesehen. Doch er ist keine Bedrohung - er ist tot. Kriminalkommissar Conny Sjöberg und sein Team identifizieren den Toten: ein Familienvater mittleren Alters. Aber warum war er dort? Und wer hat ihn erschlagen? Die Polizei findet weder einen Verdächtigen noch ein Motiv, bis sie eine Verbindung zu einem anderen rätselhaften Mord entdeckt. Und Sjöberg ahnt, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben ...
Dieser Roman erschien auf Deutsch auch unter dem Titel "Pfefferkuchenhaus".
Du bist ganz allein
Als die dreijährige Hanna aufwacht, befindet sie sich ganz allein in einer abgeschlossenen Wohnung. Sie weiß, dass ihr Vater in Japan ist - aber wo sind ihre Mutter und ihr kleiner Bruder? Warum kommen sie nicht wieder? Der kleinen Hanna gelingt es, jemanden anzurufen, aber sie kann nicht erklären, wo sie wohnt. Eine verzweifelte Suche nach dem eingesperrten Kind nimmt ihren Anfang ... Doch noch ein anderer Fall beschäftigt Kommissar Conny Sjöberg: Seine Kollegin stößt in einem Gebüsch vor der Polizeiwache auf einen fast erfrorenen Säugling. Kurz darauf wird in der Nähe des Fundortes eine tote Frau entdeckt ...
Dieser Roman erschien auf Deutsch auch unter dem Titel "Nur der Mann im Mond schaut zu".
Und raus bist du
Eine Wohnung im teuren Szeneviertel Södermalm, Stockholm: Zwei Kinder liegen neben ihrer Mutter im Bett, alle drei mit durchgeschnittener Kehle. Wer ist zu so etwas fähig? Zunächst verdächtigt Kommissar Sjöberg den Vater der Kinder. Dann verschwindet ein Kollege des Kommissars spurlos - und das Ermittlerteam stößt an die Grenzen der Belastbarkeit. Ist der Vater wirklich der Mörder? Und was hat der verschollene Polizist mit dem Fall zu tun? Ein atemloser Kampf gegen die Dämonen der Vergangenheit beginnt ...
Weitere Schwedenkrimis um Conny Sjöberg:
Band 4: Falsch gespielt
Band 5: Vergessen wirst du nie
Band 6: In deinen eiskalten Augen
Band 7: Blutsbande
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber diese ThrillerTitelDas Haus der SchmerzenMottoKapitel 1: KATRINEHOLM, OKTOBER 1968Kapitel 2: STOCKHOLM, NOVEMBER 2006, MONTAGABENDKapitel 3: DIENSTAGABENDKapitel 4: TAGEBUCH, NOVEMBER 2006, DIENSTAGKapitel 5: MITTWOCHVORMITTAGKapitel 6: MITTWOCHNACHMITTAGKapitel 7: DONNERSTAGABENDKapitel 8: FREITAGABENDKapitel 9: TAGEBUCH, NOVEMBER 2006, SAMSTAGKapitel 10: SAMSTAGMORGENKapitel 11: SAMSTAGABENDKapitel 12: MONTAGVORMITTAGKapitel 13: TAGEBUCH, NOVEMBER 2006, MONTAGKapitel 14: DIENSTAGKapitel 15: MITTWOCHABENDKapitel 16: DONNERSTAGVORMITTAGKapitel 17: DONNERSTAGABENDKapitel 18: FREITAGVORMITTAGKapitel 19: FREITAGNACHMITTAGKapitel 20: TAGEBUCH, NOVEMBER 2006, FREITAGKapitel 21: FREITAGABENDKapitel 22: SAMSTAGVORMITTAGKapitel 23: SAMSTAGNACHMITTAGKapitel 24: SAMSTAGABENDKapitel 25: SONNTAGVORMITTAGKapitel 26: SONNTAGNACHMITTAGKapitel 27: MONTAGVORMITTAGKapitel 28: MONTAGNACHMITTAGKapitel 29: MONTAGABENDKapitel 30: STOCKHOLM, NOVEMBER 2006Du bist ganz alleinZitat1964September 2007, FreitagabendDie Nacht von Freitag auf SamstagSamstagmorgenSamstagnachmittagSamstagabendDie Nacht von Samstag auf SonntagSonntagmorgenSonntagvormittagSonntagnachmittagSonntagabendMontagvormittagMontagnachmittagMontagabendDienstagmorgenDienstagvormittagDienstagmittagDienstagnachmittagDienstagabendUnd raus bist duEpigraphMärz 2008, in der Nacht von Samstag auf SonntagDienstagvormittagDienstagnachmittagDienstagabendMittwochvormittagMittwochnachmittagMittwochabendDonnerstagvormittagDonnerstagnachmittagDonnerstagabendDie Nacht von Donnerstag auf FreitagFreitagvormittagFreitagnachmittagFreitagabendÜber die AutorinWeitere Titel der AutorinImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über diese Thriller
Das Haus der Schmerzen
Als Ingrid Olsson aus dem Krankenhaus zurück in ihre Stockholmer Wohnung kommt, entdeckt sie einen Mann in ihrer Küche. Sie hat den Eindringling noch nie gesehen. Doch er ist keine Bedrohung – er ist tot. Kriminalkommissar Conny Sjöberg und sein Team identifizieren den Toten: ein Familienvater mittleren Alters. Aber warum war er dort? Und wer hat ihn erschlagen? Die Polizei findet weder einen Verdächtigen noch ein Motiv, bis sie eine Verbindung zu einem anderen rätselhaften Mord entdeckt. Und Sjöberg ahnt, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben …
Dieser Roman erschien auf Deutsch bereits unter dem Titel »Pfefferkuchenhaus«.
Du bist ganz allein
Als die dreijährige Hanna aufwacht, befindet sie sich ganz allein in einer abgeschlossenen Wohnung. Sie weiß, dass ihr Vater in Japan ist – aber wo sind ihre Mutter und ihr kleiner Bruder? Warum kommen sie nicht wieder? Der kleinen Hanna gelingt es, jemanden anzurufen, aber sie kann nicht erklären, wo sie wohnt. Eine verzweifelte Suche nach dem eingesperrten Kind nimmt ihren Anfang … Doch noch ein anderer Fall beschäftigt Kommissar Conny Sjöberg: Seine Kollegin stößt in einem Gebüsch vor der Polizeiwache auf einen fast erfrorenen Säugling. Kurz darauf wird in der Nähe des Fundortes eine tote Frau entdeckt …
Dieser Roman erschien auf Deutsch bereits unter dem Titel »Nur der Mann im Mond schaut zu«.
Und raus bist du
Eine Wohnung im teuren Szeneviertel Södermalm, Stockholm: Zwei Kinder liegen neben ihrer Mutter im Bett, alle drei mit durchgeschnittener Kehle. Wer ist zu so etwas fähig? Zunächst verdächtigt Kommissar Sjöberg den Vater der Kinder. Dann verschwindet ein Kollege des Kommissars spurlos – und das Ermittlerteam stößt an die Grenzen der Belastbarkeit. Ist der Vater wirklich der Mörder? Und was hat der verschollene Polizist mit dem Fall zu tun? Ein atemloser Kampf gegen die Dämonen der Vergangenheit beginnt …
C A R I N G E R H A R D S E N
DAS HAUS DER SCHMERZEN
DU BIST GANZ ALLEIN
UND RAUS BIST DU
Drei packende Schweden-Thriller in einem eBook
Aus dem Schwedischen vonThorsten Alms
C A R I N G E R H A R D S E N
DAS HAUS DER SCHMERZEN
ACHTLANGEJAHRESEHNICHMICHNACHHAUS,
IMSCHLAFESELBSTVERSPÜREICHDIESSEHNEN.
ICHSEHNEMICH, WOIMMERICHAUCHFAHRE,
– NICHTNACHDENMENSCHEN! NACHDERERDE,
NACHDENSTEINEN, WOALSKINDICHSPIELTE.
VERNERVONHEIDENSTAM
KATRINEHOLM, OKTOBER 1968
Oben auf dem Hügel zwischen hochgewachsenen Kiefern thront das alte braune Haus. Im Sommer spenden die Kiefern den Kindern Schatten, wenn sie um das Haus herum spielen, das die Vorschule des Ortes beherbergt. Jetzt im Herbst wirken sie bedrohlich, wie Wachsoldaten, die den Auftrag haben, das Haus gegen die Winterkälte und andere ungebetene Gäste zu verteidigen. Der erste, nasse Schnee hat sich wie ein Lappen über die Landschaft gelegt. Das einzige Geräusch, das die fast vollkommene Stille an diesem Ort von Zeit zu Zeit durchbricht, ist das weit entfernte Bellen eines Hundes.
Bis die Tür des Hauses sich plötzlich öffnet. Kinder stürmen ins Freie. Lärmende Kinder in neuen, tadellosen Kleidern oder in alten, zerschlissenen. Manche Kinder groß, andere klein, dünne und dicke, blonde und dunkelhaarige. Kinder mit Zöpfen, Sommersprossen, Brillen oder Mützen. Manche schlendern langsam aus dem Gebäude, andere sind schon vorausgerannt, einige von ihnen sind in aufgeregte Gespräche verwickelt, während wieder andere still und in sich gekehrt wirken.
Die Tür fällt hinter den Kindern ins Schloss, um gleich darauf noch einmal geöffnet zu werden. Ein kleines Mädchen mit weißer Pelzmütze und rot karierter Steppjacke verlässt die Schule, gefolgt von einem Jungen. Dunkelblaue Steppjacke, Halstuch und die obligatorische KSK-Mütze in den Vereinsfarben Rot-Weiß-Schwarz. Jeder in diesem Teil der Stadt ist KSK-Fan. Die beiden sprechen nicht miteinander. Das Mädchen, Katarina, beeilt sich, den Hang hinunterzukommen, um an das große schmiedeeiserne Tor zu gelangen. Es kostet sie Kraft, das Tor weit genug zu öffnen, um durch den Spalt hinausschlüpfen zu können, bevor es krachend wieder ins Schloss fällt. Thomas, der Junge, erreicht das Tor kurz darauf, öffnet es ebenso umständlich und zwängt sich hindurch.
Einen Augenblick bleibt er stehen und holt tief Luft, denn dort drüben auf dem Bürgersteig bestätigen sich seine schlimmsten Befürchtungen. Sämtliche Kinder haben sich an der gegenüberliegenden Straßenecke zusammengerottet. Ruhig beobachtet er, wie Katarina ohne wahrnehmbares Zögern die Straße überquert. Thomas braucht nicht lange, um zu entscheiden, dass er ihr nicht folgen, sondern den Umweg linksherum nehmen wird. Er hat sich erst ein paar Schritte entfernt, als sie sich bereits auf das Mädchen geworfen haben. Ann-Kristin mit ihrem ewigen Grinsen und dem gemeinen Glitzern in den Augen reißt Katarina die Mütze vom Kopf und wirft sie unter dem Johlen und Lachen der anderen Kinder zu Hans hinüber, zu König Hans.
Thomas hält inne und überlegt, ob er Katarina nicht helfen sollte. Noch bevor er den Gedanken zu Ende gedacht hat, haben sie ihn entdeckt. Auf ein Signal von Hans hin jagen die Eifrigsten über die Straße und stürzen sich auf Thomas. Die übrigen Kinder folgen ihnen wie blutrünstige Hunde. Auf der anderen Straßenseite bleibt eine verwunderte und sichtbar erleichterte Katarina zurück. Dieses Mal wird es nicht sie treffen. Sie bückt sich, um ihre nicht mehr ganz so weiße Pelzmütze aufzuheben und aufzusetzen. Dann überquert auch sie die Straße, um das Schauspiel aus nächster Nähe zu beobachten.
Woher stammt nur dieser Erfindungsreichtum? Und dieses enge Band zwischen einundzwanzig, vielleicht zweiundzwanzig dieser dreiundzwanzig Kinder? Wie gelangt ein Junge zu solcher Autorität, dass er zum wortlos anerkannten Anführer wird, der die eine Hälfte dieser Kinder dazu bringt, sich wie ein Mann urplötzlich und voller Enthusiasmus der Aufgabe zu widmen, einen verängstigten kleinen Jungen mit Springseilen und Halstüchern an einen Laternenpfahl zu fesseln, während die andere Hälfte Steine sammelt, um ihn damit zu bewerfen?
Vollkommen hilflos ist Thomas, wie er da auf dem nassen, kalten Asphalt sitzt, unfähig, sich zu wehren oder auch nur zu schreien. Stumm schaut er seine Klassenkameraden an. Die Steine treffen ihn am Kopf, im Gesicht, überall am Körper. Ein Junge steht neben ihm und schlägt seinen Kopf wieder und wieder gegen den Laternenpfahl. Ein anderer benutzt ein übrig gebliebenes Springseil als Peitsche.
Einige Kinder stehen nur herum und lachen, andere unterhalten sich flüsternd mit einem herablassenden Ausdruck in ihren kleinen Gesichtern. Manche schauen völlig unbewegt zu. Auch Katarina steht dort. Jetzt gehört sie dazu – zu den anderen.
Irgendwann im Laufe der Misshandlung kommt auch die Lehrerin vorbei. Sie wirft einen flüchtigen Blick auf den gefesselten Jungen und seine Spielkameraden. Dann hebt sie die Hand, um einigen der Mädchen, die ihr am nächsten stehen, zum Abschied zu winken.
So schnell, wie alles begonnen hat, ist es vorbei. Kaum eine halbe Minute dauert es, bis sich die Kinder in alle Richtungen zerstreut haben und wieder ganz normale Kinder sind, auf dem Heimweg von der Vorschule. Alle gehen ihres Weges, allein, zu zweit oder in kleinen Gruppen. Auf dem Bürgersteig lassen sie einen sechsjährigen Jungen zurück, mit schmerzendem Körper und unendlich traurig.
STOCKHOLM, NOVEMBER 2006, MONTAGABEND
Es war erst vier Uhr nachmittags, aber schon dunkel. Der Schnee fiel in großen, nassen Fetzen vom Himmel, die schmolzen, sobald sie den Boden berührten. Vorbeifahrende Autos blendeten ihn, und er musste ständig aufpassen, dass er nicht nass gespritzt wurde. Warum fuhren diese Autos so schnell, dass das schmutzige Wasser bis zu ihm hinaufspritzte? Man muss auf Fußgänger achten, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, das lernt man schon in der Fahrschule. Vielleicht sahen die Fahrer ihn gar nicht, klein und unansehnlich, wie er war. Vielleicht war er in seiner dunklen Kleidung in der Dämmerung sogar unsichtbar. Seine gebeugte Haltung trug wahrscheinlich noch dazu bei. Er sah wohl auch ein wenig lächerlich aus, denn seine Füße zeigten nicht nach vorn, sondern standen nach außen, wie bei einem Clown. Dabei war er das ganz sicher nicht.
Eher war er ein stiller Mensch, der nie in einen Konflikt verwickelt war – vielleicht weil er anderen nicht widersprach. Wie sollte er auch, wenn er keine Kontakte hatte. Außer auf der Arbeit natürlich, draußen in Järfälla, wo er in der Poststelle eines großen Elektronikkonzerns arbeitete. Er verteilte die Post an die Ingenieure, Sekretärinnen und deren Chefs und all die anderen, die bei der Firma beschäftigt waren. Das war seine einzige Aufgabe. Er wurde nie damit beauftragt, die Post zu sortieren. Da gab es andere, qualifiziertere Leute, die solche Aufgaben bewältigen und wichtige Entscheidungen fällen konnten. Etwa dann, wenn die Post nicht richtig adressiert war.
Es fiel ihm sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Wenn er genau darüber nachdachte, stellte er fest, dass er eigentlich nie eine eigene Meinung zu irgendetwas gehabt hatte. Wenn er ausnahmsweise einmal mit anderen Kindern gespielt hatte und ganz unerwartet gefragt wurde, was er von der einen oder anderen Sache hielt, dann hatte er eigentlich nie irgendeine Meinung dazu gehabt. Denn im Grunde hatte er nur einen Wunsch: mit den anderen Kindern zusammen zu sein und zu tun, was sie ihm sagten – ihnen zu Willen zu sein. Er wollte wirklich nur eine einzige Sache – von den Menschen in seiner Umgebung angenommen werden. Jetzt war er vierundvierzig Jahre alt, und dieser Wunsch war immer noch nicht in Erfüllung gegangen.
Oft fragte er sich, was geschehen würde, wenn sein Wunsch eines Tages in Erfüllung ginge. Würde er dann plötzlich neue, komplexere Bedürfnisse entwickeln und eigene Ansichten zu allen möglichen Dingen haben? Passierte das automatisch, wenn man eine allseits anerkannte Persönlichkeit war?
Er schaute zu den Fenstern auf der anderen Seite der Fleminggata hinauf. Sie waren einladend beleuchtet und erhellten die herbstliche Dunkelheit, indem sie Topfpflanzen, Gardinen, Lampen mit hübschen Schirmen, südostasiatischen Fächern und anderem Zierrat zur Schau stellten. In einigen Fenstern prangten bereits Adventsleuchter, als sollte das Glück der Familie, des Paars oder des Menschen, der dahinter wohnte, noch betont werden. Welchen Sinn sollten dieses freundliche Licht und die gepflegte Einrichtung sonst auch haben?
Sein eigenes Wohnzimmerfenster blickte ihn stattdessen dunkel und leer an, wenn man von einem vernachlässigten Ficus und der herunterbaumelnden Schnur eines Rollos absah. Auch das Küchenfenster war vollkommen leer bis auf ein einsames, altes Transistorradio.
Hin und wieder blätterte er mit echtem Interesse in einem Einrichtungsmagazin. Nicht weil er nach Anregungen für sein eigenes Zuhause suchte, denn schließlich gab es keinen Grund, große Mühe auf eine Wohnung zu verwenden, in der nur er sich aufhielt. Nur er – eine einzelne, unbedeutende Person, so viel wie gar keine. Nein, er las in den Einrichtungszeitschriften aus demselben Grund, aus dem er den Leuten in die Fenster schaute. In seiner Fantasie begab er sich in eine andere Welt, eine Welt voller freundlicher Menschen mit einem warmen Lächeln und großen weichen, farbenfrohen Kissen auf ihren Sofas.
Heute war er auf der Arbeit tatsächlich fast zu einem Stück Torte eingeladen worden. So etwas kam selten vor, denn in der Poststelle gab es eigentlich nie einen Anlass zum Feiern. Er hielt sich ja schließlich auch immer nur ein paar Minuten dort auf. Wenn er die neue, sortierte Post abholte, die in andere Abteilungen gebracht werden sollte.
Als er die Poststelle an diesem Tag um elf Uhr betrat, saßen alle zusammen und aßen Torte. Den Anlass dafür kannte er nicht. Er war nicht besonders glücklich darüber, dass er die Post ausgerechnet um elf abliefern sollte, denn um diese Zeit saßen sie immer da und machten ihre Kaffeepause. Dann konnten sie ihn beobachten, wenn er in seiner Poststellenuniform hereinkam. Uniform war eigentlich ein zu großes Wort für eine blaue Hose mit blauer Jacke. Er war der Einzige hier, der diese Kleidung trug, die er selbst lächerlich fand. Es war niemals gut aufzufallen.
Und er fiel ihnen sofort auf, genauer gesagt, einer von ihnen bemerkte ihn. Ein Spaßvogel, der ständig Scherze machte und zu allem eine Meinung hatte. Die anderen lachten über seine Scherze und schienen seine Ansichten zu teilen, denn niemand widersprach ihm. »Hallo, Postbote!«, hatte er ihm vom Kaffeetisch aus zugerufen, mit vor der Brust verschränkten Armen und unter dem Tisch ausgestreckten Beinen. »Möchtest du ein Stück Torte?« Ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr er fort: »Dann schwing dich auf dein Laufrad und hol endlich diesen TX-Schaltplan. Hatte ich den nicht schon gestern oder vorgestern angefordert? Seid ihr auf der Poststelle alle so zurückgeblieben, oder nur du?« Alle anderen am Tisch lachten. Und sei es auch nur aus alter Gewohnheit. Also hatte er auch kein Stück Torte bekommen. Aber schließlich war er einfach nicht befugt, für irgendwelche Leute Botengänge zu erledigen. Sein Auftrag war es, die Post auszutragen, die ihm zugeteilt wurde.
Zurückgeblieben war er nicht. Er hatte zwar keine Ausbildung, aber er las eine ganze Menge, Zeitschriften und Literatur. Man konnte ihn wohl kaum als normal begabt bezeichnen, aber zurückgeblieben war er nicht. In den ersten Schuljahren war er sogar ein guter Schüler gewesen, aber nur zu Anfang. In Katrineholm war man kein guter Schüler, das war absolut verboten. Genau genommen durfte man in dieser Schule überhaupt nicht gut sein, außer beim Fußball oder Bandy. Da gab es ungeschriebene Gesetze, die regelten, in welchen Fächern man gut (Sport) oder schlecht (Musik, Sprachen, textiles Gestalten, Betragen) oder eben mittelmäßig (alle anderen Fächer) zu sein hatte. Sie regelten auch, welche Kleidung man tragen sollte (gekaufte Kleidung der richtigen Marken) und welche nicht (Mütze, Brille, Selbstgenähtes), wo man wohnen durfte (Mietshaus), welcher politischen Einstellung man anzuhängen hatte (sozialdemokratisch, auf gar keinen Fall kommunistisch) und welche Bandymannschaft es anzufeuern galt (KSK, nicht Värmbol). Vor allen Dingen aber durfte man in keinerlei Weise herausragen oder irgendwie anders sein.
Hier, in Stockholm, für einen erwachsenen Mann, galten natürlich andere Gesetze. Hier wurde selbstständiges Denken geschätzt, und ein auffallendes Äußeres war oft sogar von Vorteil. Vor allen Dingen brauchte man eine Ausbildung und ein starkes Selbstvertrauen.
Diesen Ansprüchen konnte er kaum gerecht werden. Seine Mutter war gestorben, als er noch sehr klein war, und sein Vater hatte in einer Druckerei im Schichtdienst gearbeitet, und so war für seinen Sohn nicht besonders viel Zeit übrig geblieben. Doch, er war ein liebevoller Vater gewesen, hatte aber keine Ahnung gehabt, wie man einen Haushalt führt oder ein Kind großzieht. Nach jahrzehntelangem Kettenrauchen war auch er einem allzu frühen Tod entgegengegangen.
Er selbst war schon immer anders gewesen, ohne sich je darüber klar geworden zu sein in welcher Weise. Gut, er hatte von Beginn an den falschen Dialekt gesprochen, weil er seine ersten Lebensjahre unten in Huskvarna verbracht hatte, und eine Mütze musste er nun einmal tragen, aber trotzdem – der entscheidende Unterschied musste woanders gelegen haben. Ganz bestimmt war damals schon irgendetwas an seiner Persönlichkeit sonderbar gewesen. Als ganz kleiner Junge war er noch offen und fröhlich gewesen. Er war gerne unter Menschen gewesen, hatte aber früh gelernt, dass die Menschen ihn nicht in der gleichen Weise schätzten. Und bald hatten sie ihm seine gute Laune und seine Ecken und Kanten ausgetrieben. Damals, in der Vorschule, hatte er wohl begonnen, sich zu dem Menschen zu entwickeln, der er heute war. Die ständigen körperlichen Misshandlungen, verbunden mit Spott und Abweisung, hatten ihn nicht nur in einen stummen Schatten verwandelt, sondern ihm auch jegliches Selbstvertrauen genommen.
Trotzdem war er dann als Siebenjähriger nicht ohne Begeisterung zur Schule gegangen, neugierig und interessiert. Aber aufzuzeigen, um Fragen zu beantworten, erwies sich von Anfang an als völlig unmögliches Unterfangen. Wusste er doch, dass man niemals glauben durfte, etwas Besseres zu sein. Wenn ihm trotzdem eine Frage gestellt wurde und es ihm tatsächlich gelang, sie richtig zu beantworten, gab es Getuschel und vielsagende Blicke unter den anderen Kindern. Wenn er falsch antwortete, erntete er allgemeines Gelächter. Einige der Plagegeister aus der Vorschule gingen in seine Klasse, und die Kinder, die ihn noch nicht kannten, hatten schnell begriffen, wie sie mit ihm umgehen mussten. In den Pausen verprügelten sie ihn, sangen Spottverse, und oft stand er einsam da und schaute den anderen Kindern beim Spielen zu. Schon in der Grundschule kam es vor, dass er an einzelnen Tagen den Unterricht versäumte, weil er zu Hause krank im Bett lag – Kopfschmerzen und Bauchweh – oder eine Krankheit simulierte. Seine schulischen Leistungen begannen, darunter zu leiden, und in der neunten Klasse ging er ab. Er bekam einen Praktikumsplatz in einer Kurzwarenhandlung zugeteilt, wo er das tat, was ihm aufgetragen wurde.
Was seine Person betraf, war die Zeit seiner Ausbildung ein verschenktes Jahrzehnt gewesen, aber vielleicht war es für die Kinder, die heute heranwuchsen, besser geworden. Neulich hatte man in den Nachrichten einen Bericht über das vorbildliche »Projekt Katrineholm« gezeigt. So nannte es jedenfalls der Nachrichtensprecher, während es der aufgeblasene Landrat Göran Meijer in einem Interview als »Projekt Skogskullen« bezeichnet hatte, nach der Grundschule, die als erste ein erfolgreiches Konzept gegen Mobbing an Schulen eingeführt hatte. Er fragte sich, ob diese neuen Methoden, die mit so großen Worten beschrieben wurden wie »Respekt für das Individuum«, »Körperkontakt«, »Erwachsenenaufsicht« und »Patentätigkeit«, auch dem Dialekt von Huskvarna und Värmbol-Mützen Rechnung trugen.
Als er sein Praktikum in der Kurzwarenhandlung beendet hatte, zog er nach Stockholm, wo er bei einem Großonkel einquartiert wurde, der allein in einer Einzimmerwohnung auf Kungsholmen wohnte. Nachdem er auf dem zweiten Bildungsweg seinen Schulabschluss nachgeholt hatte, gelang es ihm gegen alle Wahrscheinlichkeit und ohne weitere Qualifikationen, den Job zu ergattern, den er immer noch hatte. Onkel Gunnar war mittlerweile gestorben, und die Wohnung gehörte jetzt ihm allein.
Plötzlich wurde er in seinen Gedanken unterbrochen und erstarrte. Er blieb auf dem Zebrastreifen stehen, mitten auf der Straße vor dem Haus, in dem sich seine Wohnung befand. Irgendetwas an dem Mann, dem er gerade begegnet war, kam ihm sehr vertraut vor, und ohne dass er eine Ahnung hatte warum, drehte er sich um und folgte ihm. Die hellblauen Augen und das blonde, lockige Haar, der zielbewusste Gesichtsausdruck, eine Narbe an der linken Augenbraue, seine Art zu gehen – alles stimmte. Aber war es wirklich möglich, einen Menschen wiederzuerkennen, den man mit sechs oder sieben Jahren zum letzten Mal gesehen hatte? Wahrscheinlich ließen ihn die Gedanken, die er sich unlängst über das viel gepriesene Projekt Katrineholm gemacht hatte, plötzlich Gespenster sehen.
Seine Zweifel gründeten auf Vernunft, aber seine Gefühle sagten ihm etwas anderes. Er hatte ihn fast täglich in seiner Erinnerung heraufbeschworen. Es konnte keinen Zweifel daran geben, dass er es wirklich war.
Der Mann stieg die Treppe zur U-Bahn hinunter und ging mit raschen Schritten auf die Schranke zu, zog mit geübter Hand seine Dauerkarte durch den Leseschlitz und schob sich durch das Drehkreuz. Nicht einmal auf der langen Rolltreppe, die in die Unterwelt hinabführte, hörte er auf zu gehen. Auf dem Bahnsteig angelangt, zog er eine Abendzeitung aus der Jackentasche und blätterte ein bisschen darin herum, während er auf die Bahn wartete.
Die ganze Zeit hatte er zehn, zwölf Meter Abstand gehalten, schließlich setzte er sich hinter ihm auf eine Bank, während der andere mit der Zeitung in der Hand dastand. In seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Er hatte keine vernünftige Erklärung für sein Handeln. In den vergangenen zwanzig Jahren hatte er nie etwas Ungewöhnliches getan: Er fuhr zur Arbeit und wieder zurück, war ins Kino oder gelegentlich spazieren gegangen, hatte gelesen oder ferngesehen. Und jetzt befand er sich plötzlich in einer U-Bahn-Station, weil er einen Mann verfolgte, den er seit fast vierzig Jahren nicht mehr gesehen hatte. Erstaunlicherweise fühlte er sich gut dabei. Es geschah etwas in seinem Leben, er hatte sich in ein Abenteuer gestürzt und genoss es.
*
Der Mann genoss es, sich auf dem Nachhauseweg mit einer Abendzeitung in der Hand auf einen der Sitze in der U-Bahn sinken zu lassen. Er begann mit seiner Arbeit im Maklerbüro schon um sieben Uhr in der Frühe, damit er rechtzeitig am Abend zu Hause war und die Kinder noch eine Weile sehen konnte, bevor sie ins Bett gingen. Er stand also schon um halb sechs auf, und vor halb zwölf kam er selten ins Bett, weshalb er unter chronischem Schlafmangel litt. Aber er hatte gelernt, damit zu leben, und schon in ein paar Jahren würden die Kinder viel selbstständiger sein. Dann würden Pia und er an den Wochenenden ausschlafen können.
Drei Kinder hatten sie bekommen, drei wunderbare Kinder, die trotz ihrer Quengeleien, ihrer Trotzigkeit und ihrer schier unerschöpflichen Energie dafür verantwortlich waren, dass er so glücklich war. Genauso ging es auch Pia, die er bereits an der Universität kennengelernt hatte, mit der er aber erst acht Jahre später zusammengekommen war, als sie sich auf einer Party wieder getroffen hatten. Sie hatte eine Teilzeitstelle als Zahnpflegerin in dem Vorort, in dem sie wohnten, und ihre Beziehung funktionierte auch nach fünfzehn Jahren noch hervorragend. Sie waren wie beste Freunde und konnten über fast alles miteinander reden.
Mit seiner Arbeit war er im Großen und Ganzen auch zufrieden, auch wenn er selbst an den Wochenenden immer wieder Besichtigungstermine wahrnehmen musste. Das Geschäft lief gut, und das war die Hauptsache. Die Arbeit als Immobilienmakler war abwechslungsreich, er arbeitete selbstbestimmt, und er und sein Partner konnten sich jeden Monat ein ordentliches Gehalt auszahlen.
So wie sein Leben begonnen hatte, war es keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass er ein glücklicher Mensch geworden war. Er war als einziges Kind einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen, die ihr Geld als Friseurin verdient hatte – wenn sie denn arbeitete – und deren einziges Interesse Männern in allen Ausführungen gegolten hatte. Sie waren oft umgezogen und nirgendwo wirklich heimisch geworden. Etliche mehr oder weniger seriöse Stiefväter waren im Laufe der Jahre gekommen und auch wieder gegangen. Als kleiner Junge galt er als unartig und streitlustig, und seine Kindheit war geprägt von Prügeleien und ständigem Nachsitzen. Wahrscheinlich war er eine echte Landplage gewesen. Seine Noten hatten natürlich darunter gelitten, aber aus irgendeinem Grund hatte er sich trotzdem entschieden, im Gymnasium eine theoretische Fachrichtung einzuschlagen.
Dort hatte sich alles geändert. Seine Mutter war schon bald, nachdem er am Gymnasium begonnen hatte, wieder umgezogen, aber er hatte beschlossen, sie nicht zu begleiten. Also lebte er von da an in einer Einzimmerwohnung und war ganz auf sich allein gestellt. An den Wochenenden hatte er an einer Tankstelle gearbeitet, abends gelernt, Fußball gespielt und die Hausarbeit erledigt. In jener Zeit war er erwachsen geworden, und es war ihm tatsächlich gelungen, das Gymnasium mit einem guten Zeugnis zu verlassen. Gut genug, um zu einem Wirtschaftsstudium an der Universität zugelassen zu werden.
Und jetzt saß er hier, auf dem Rückweg von seiner gut bezahlten Arbeit in der Firma, die er zusammen mit seinem Partner selbst aufgebaut hatte, auf dem Heimweg zu seiner geliebten Frau und seinen geliebten Kindern in ihrem gepflegten Reihenhaus. Er gönnte sich diesen Gedanken, und sein Wohlgefühl wurde noch verstärkt, als er all die grauen Mitreisenden betrachtete, die um ihn herum Platz genommen und ihre Nasen tief in eine dieser Gratiszeitungen gesteckt hatten oder mit leerem Blick aus dem Fenster starrten. Sein Blick fiel auf das Spiegelbild einer dieser gescheiterten Existenzen. Der Mann saß einfach nur da und starrte ihn an, als könnte man ihm sein Glück ansehen. Störte den Mann das vielleicht? Nun gut, damit konnte er im Zweifelsfall leben.
*
Thomas hatte sich in einiger Entfernung einen Platz gesucht. Jetzt war er sich sicher, dass es König Hans war. Thomas saß mit dem Rücken in Fahrtrichtung, damit er ihn studieren konnte. Nicht von Angesicht zu Angesicht natürlich – er hatte sich so platziert, dass einige Leute zwischen ihm und dem Objekt seines Interesses saßen. So konnte er das Spiegelbild von König Hans in der Fensterscheibe vor sich hervorragend sehen.
Entspannt und selbstbewusst wirkte er, eine große, schlanke Erscheinung. In Gedanken versunken hatte er die Zeitung im Schoß zusammengefaltet und schaute nachdenklich aus dem Fenster. Es sah fast so aus, als würde hin und wieder ein kleines Lächeln über sein Gesicht huschen. Thomas starrte fasziniert hinüber und fragte sich, worüber er sich freute. Hatte er jemanden, der auf ihn wartete? Jemanden, der sich freute, wenn er nach Hause kam? Hatte er Gardinen vor dem Fenster und Kissen auf dem Sofa?
Der Mann ließ seinen Blick über die anderen Menschen im Waggon schweifen, und für einen Moment begegneten sich ihre Blicke im spiegelnden Fenster. War es Verachtung, was Thomas in diesen blauen Augen sah? Angesichts seiner eigenen, unterwürfigen Haltung, seiner ungepflegten Frisur und seines ängstlichen Blickes wäre das auch wenig verwunderlich gewesen. Schließlich war er ein armer Wicht, der andere Menschen nur unterwürfig anblickte, wenn er sie überhaupt anzuschauen wagte.
Plötzlich begann die Beleuchtung zu flackern, und für einige Sekunden wurde es dunkel. Als das Licht wieder anging, war der Mann in die Beobachtung der Wassertropfen versunken, die sich ihren Weg über die Fensterscheibe suchten. Thomas konnte ungestört fortfahren, diese Erscheinung aus seiner Kindheit genau zu betrachten.
Er dachte an all die Mützen, die auf dem Heimweg von der Vorschule auf den Dächern und Ladeflächen vorbeifahrender LKW gelandet waren. Er dachte an seine Zeichnungen, die er am Ende des Jahres mit nach Hause nehmen und dort vorzeigen sollte, die stattdessen aber zur großen Belustigung aller Kinder Stück für Stück in einem Gully verschwunden waren. Er dachte an zerrissene Hosen, verdreckte Jacken und zerschrammte Knie, und er dachte an Carina Ahonen, die beim gemeinsamen Singen immer auf den Knien der Vorschullehrerin sitzen und vorsingen durfte, was die anderen Kinder nachsingen sollten. Sie durfte darüber bestimmen, was gemalt werden sollte, und wenn sie »Pferde« sagte, dann malten alle Kinder Pferde, Pferde und nochmals Pferde, nichts anderes war erlaubt. Seine Pferde waren so misslungen, dass sie zur allgemeinen Belustigung zur Schau gestellt wurden.
Er dachte an das große grüne Auto draußen auf dem Hof, in das nur sechs Kinder passten. Zwei mussten es anschieben, und er und Katarina schoben es an, tagein, tagaus, in der naiven Hoffnung, dass auch sie eines Tages in diesem Auto sitzen durften. Die Vorschullehrerin nahm es sehr genau damit, dass jeder einmal fahren durfte, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund schien sie Thomas und Katarina ständig zu vergessen. Hin und wieder war es vorgekommen, dass Thomas als Erster im Auto war, aber sie hatten ihn wieder hinausgeschickt, und er musste anschieben, denn das schien die natürliche Ordnung der Dinge zu sein. Die Vorschullehrerin lächelte dazu jedenfalls nur ihr übliches nettes Lehrerinnenlächeln.
Einmal, so erinnerte er sich, hatten ihm Hans und Ann-Kristin die Mütze weggenommen und sie einander immer wieder zugeworfen, hin und her, über seinen Kopf hinweg. Thomas war es nicht gelungen, sie zu fangen, aber eine plötzliche Eingebung hatte ihm den Mut geschenkt, Hans die Mütze vom Kopf zu reißen und damit davonzulaufen. Natürlich hatten sie ihn eingeholt, ihn grün und blau geschlagen und ihm die Mütze wieder abgenommen. Als er am selben Tag nach Hause gekommen war, hatte die Mutter von Hans bereits seinen Vater angerufen und sich darüber beschwert, dass Thomas die Mütze ihres Sohnes ruiniert hätte. Also wurde Thomas mit zehn Kronen in der Hand zu Hans nach Hause geschickt, um sich zu entschuldigen. Über seine Mütze, die verschwunden war, hatte aus welchem Grund auch immer niemand gesprochen.
Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als der Zug hielt und der Mann, den er beobachtete, aussteigen wollte. Also stand auch Thomas auf, um dem Schatten seiner Vergangenheit weiter zu folgen.
*
Das Reihenhaus lag nur ein paar Gehminuten von der U-Bahn-Station Enskede Gård entfernt. Er lief über die Straße, hielt sich am Hantverks-Gymnasium links und verschwand zwischen den Häusern des Trädskolan-Viertels. Nach einer Weile erreichte er den Park mit seinen ungewöhnlichen Bäumen und Büschen, diese letzte Erinnerung an die alte Baumschule, die Ende der achtziger Jahre einem Neubaugebiet weichen musste. Der Weg führte an einem Gebüsch vorbei zum Spielplatz der Reihenhaussiedlung. Im Sandkasten saßen zwei schlammbedeckte Kinder in Matschhosen, das dritte – ein anderthalbjähriges Mädchen – hatte die Leiter zur Rutsche bis zur obersten Sprosse erklommen.
»Moa, mein Engel, halt dich gut fest, damit du nicht runterfällst und dir wehtust«, rief er, lange bevor er die Rutsche erreichte.
Das Gesicht des kleinen Mädchens leuchtete auf, sie begann sofort hinunterzuklettern. Auch die beiden größeren Kinder stürmten auf ihren Vater zu. So gut wie möglich versuchte er, sie zu umarmen und gleichzeitig auf Abstand zu halten.
»Hallo, ihr drei!«, sagte er. »Passt auf, ich habe noch meinen Anzug an. Kommt, lasst uns zu Mama nach Hause gehen!«
Kaum hatte er zu Ende gesprochen, warf sich Moa von der Leiter hinunter in seinen Arm. Er musste sein sauberes Jackett opfern, doch dafür gab es einen feuchten Kuss auf sein Kinn. In einem verzweifelten Versuch, das Jackett noch zu retten, trug er sie mit entschlossenen Schritten und ausgestreckten Armen vor sich her, die beiden anderen Kinder folgten ihm auf dem Fuße. Auf den Stufen zu seiner Haustür stellte er Moa wieder auf ihre Füße.
»Hallo!«, rief er, noch während er die Tür öffnete. »Ich habe drei Dreckspatzen dabei, du musst mir helfen!«
»Zieht euch die Stiefel aus, bevor ihr reingeht«, sagte er zu den beiden größeren Kindern, während er in die Hocke ging und begann, die Kleine auszuziehen.
Mit einem Lächeln erschien Pia in der Türöffnung. Sie trug Jeans, ein in der Taille zusammengeknotetes Hemd und hatte ihr dickes schwarzes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
»Hallo, mein Schatz«, sagte sie, beugte sich hinunter und küsste ihn in den Nacken. »Wie war dein Tag?«
»Gut, aber ich muss gleich noch mal los und mir ein Haus angucken. Es ist hier in der Nähe, also wird es wohl kaum mehr als eine Stunde dauern. Wollen wir den Kleinen gleich was zu futtern geben? Dann können wir essen, wenn sie im Bett sind.«
»Okay, wann musst du los?«
»Wir bringen die Kinder zusammen ins Bett, und ich mache mich dann in einer Stunde auf den Weg.«
Als es ihm endlich gelungen war, dem Mädchen die dreckige Hose auszuziehen, schoss sie mit fröhlichem Geheul wie der Blitz durch die Haustür hinein. Die beiden anderen hatten ihre Kleider selbst ausgezogen, die jetzt auf der ganzen Treppe verstreut lagen. Er richtete sich auf und unternahm einen halbherzigen Versuch, die Schlammflecken mit der Hand von seinem Jackett zu wischen. Pia sammelte Stiefel und Kleidung der Kinder ein und ging ins Haus. Hans zog die Tür mit einem Knall hinter sich zu, sodass der Türklopfer laut auf das Holz schlug.
Keiner von ihnen hatte den Mann bemerkt, der sie aufmerksam durch die nackten Zweige des Holunderbusches auf der anderen Seite des Spielplatzes beobachtet hatte.
*
Thomas wusste nicht, wie lange er hier draußen im Dunkeln gestanden und spioniert hatte, in seiner Fantasie befand er sich längst in der warmen, gemütlichen Küche. Es roch nach gebräunter Butter und gebratenem Fleisch. Eine Zeit lang liefen alle von einem Zimmer zum anderen und machten alle möglichen Sachen, doch nach einer Weile wurde es ruhiger, und einer nach dem anderen setzte sich an den Esstisch.
Thomas konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal gemeinsam mit anderen Menschen gegessen hatte. Wenn er arbeitete, aß er zwar in der großen Kantine, umgeben von vielen anderen Menschen, aber dennoch für sich allein. Seine Eltern lebten nicht mehr, Geschwister hatte er nicht, auch sonst keine Verwandten, mit denen er sich traf, und keine Freunde. Wie wundervoll, jemanden zu haben, der zu Hause auf einen wartete! Wie wundervoll es doch wäre, einen Freund zu haben, einen Menschen, mit dem man über alles Wichtige und Unwichtige reden, mit dem man einfach mal essen könnte. Wie schön könnte es sein, Essen zu kochen, wenn man es nicht nur für sich allein tat.
Das Abendessen war zu Ende, die Betriebsamkeit in der Küche war genauso plötzlich vorbei, wie sie vorhin begonnen hatte. Die Haustür öffnete sich, ein geliebter Familienvater trat aus seinem Haus ins Freie und zog zum allerletzten Mal die Tür sorgfältig hinter sich ins Schloss.
*
Die Hände hatte er tief in den Jackentaschen vergraben, den Kragen als Schutz gegen den Herbstwind hochgekrempelt. Eiligen Schrittes ging er so durch die Eigenheimsiedlung. Verwelktes Laub wirbelte durch das Licht unter den Straßenlaternen. Jedes Mal, wenn er den rechten Fuß hob, erklang ein schmatzendes Geräusch. Der Schuh war undicht, und er spürte, wie der Strumpf allmählich feucht wurde. Er hätte seine Winterschuhe anziehen sollen, aber jetzt hatte er keine Zeit mehr umzukehren. Schließlich würde er nicht mehr als eine Viertelstunde zu dem Haus benötigen, das er besichtigen wollte. Für den Heimweg würde er sich bei diesem Wetter dann vielleicht ein Taxi nehmen.
Er überquerte eine etwas breitere Straße und bog in den Weg ein, an dem das Haus lag. Die Häuser in diesem Viertel waren schon älter. Sie stammten meist aus den zwanziger oder dreißiger Jahren und besaßen große Gärten mit Obstbäumen und Pavillons. Das hier musste es sein. Ein rosa gestrichenes altes Holzhaus mit hübschen Erkern. Das Grundstück, das um einiges größer war als die Grundstücke der umliegenden Häuser, fiel vom Haus zur Straße hin ab und war von einer gepflegten, allerdings viel zu hohen Hecke umgeben. In der Hecke versteckte sich ein schmiedeeisernes Gittertor, das nicht so recht zum Haus passte. Ein Kiesweg führte dahinter zum Haus hinauf. Er warf einen Blick auf den Briefkasten und stellte fest, dass es das richtige Haus war, Åkerbärsvägen 31. Er hatte Mühe, das widerspenstige Tor weit genug zu öffnen, um durch die Öffnung hineinschlüpfen zu können. Das Tor fiel mit einem dumpfen Krachen schwer hinter ihm ins Schloss.
Er eilte den Weg hinauf, ohne den kräftigen Geruch des faulenden Fallobstes im Gras wahrzunehmen. Ebenso wenig bemerkte er den Schatten, der, ohne einen Laut zu erzeugen, hinter ihm geschmeidig über das große Tor kletterte und auf den nassen Rasen neben dem Kiesweg sprang. Er stieg die Treppe zur Haustür hinauf und drückte auf die Klingel. Ein hallendes Ding-Dong war hinter der Tür zu hören, mehr aber auch nicht. Er ließ eine Minute vergehen, bevor er noch einmal klingelte. Auch jetzt blieb es still in dem Haus. Nach einem Blick auf seine Armbanduhr, die bestätigte, dass er nur wenige Minuten zu spät war, trat er auf den Rasen zurück, um eine Runde um das alte Haus zu drehen. Es zeigte sich, dass abgesehen von der Außenbeleuchtung nur in einem Raum Licht brannte. Es war die Küche, deren Fenster nach hinten hinaus gingen und auf den Teil der Hecke blickten, der die Grenze zum Grundstück dahinter bildete. Bis zum Küchenfenster konnte er nicht hinaufreichen, also bückte er sich und hob einen dünnen Stock auf, den er gegen das Fenster warf. Doch nichts geschah. Also ging er zurück, um nachzusehen, ob die Haustür vielleicht offen war. Er hatte richtig vermutet. Vorsichtig drückte er die Klinke herunter. Die Person, die hier wohnte, war vielleicht alt und hörte nicht mehr so gut?
»Hallo, ist jemand zu Hause?«, rief er mit lauter Stimme, ohne eine Antwort zu bekommen. »Hallo!«, versuchte er es noch einmal lauter.
Dann traf er eine Entscheidung. Er betrat das Haus, säuberte sich gründlich die Schuhe auf der Fußmatte in der Diele und schloss die Tür hinter sich.
DIENSTAGABEND
Nach vielen Wochen im Krankenhaus durfte sie schließlich nach Hause. Endlich, denn sie sehnte sich danach, in ihrem eigenen Bett zu schlafen, allein vor ihrem Fernseher zu sitzen und selbst zu bestimmen, welches Programm sie sich anschaute, mit einem selbst gekochten, dampfenden Kaffee auf dem Couchtisch. Wie hatte sie den Geruch ihres Hauses vermisst. Den Duft ihrer Seife und ihres Putzmittels und auch den vertrauten Geruch von Marmelade, die hier vor unendlich langer Zeit eingekocht worden war und der sich in den Wänden festgesetzt hatte.
Trotz allem war ihr die Entscheidung, das Krankenhaus zu verlassen, nicht leichtgefallen. Das Gehen fiel ihr nach dem Oberschenkelhalsbruch immer noch schwer. Es würde mühsam werden, wieder ganz allein zurechtzukommen. Ihr Appetit hatte nachgelassen, mittlerweile schmeckte ihr fast nichts mehr. Und da war es praktisch, dass man etwas serviert bekam und sich weder um den Einkauf noch um das Kochen oder den Abwasch kümmern musste.
Der Mann vom Fahrdienst stellte ihren kleinen Koffer vor der Haustür ab und wartete geduldig, bis sie den Schlüsselbund aus der Handtasche gezogen hatte. Vorsichtig steckte sie den Schlüssel ins Schloss, das mit einem Klicken nachgab, worauf sich die Tür wie von selbst öffnete.
»Soll ich Ihnen ins Haus helfen?«, fragte der Mann freundlich.
»Nein, nicht nötig. Jetzt komme ich allein zurecht. Haben Sie vielen Dank«, sagte sie und hob die Hand zu einem Abschiedsgruß.
»Passen Sie gut auf sich auf, und erholen Sie sich gut!«, sagte der Fahrer und winkte zurück, während er rückwärts die Treppe hinunterging, um sicherzugehen, dass sie es wirklich allein ins Haus schaffte.
Nachdem sie die Deckenlampe eingeschaltet hatte, trat sich Ingrid die Schuhe auf der Fußmatte ab, stellte die Krücke in die Ecke hinter der Tür und ging zur Garderobe hinüber. Während sie sich mühsam den Mantel auszog, balancierte sie auf dem gesunden Bein. Ihre Hand griff nach einem der roten, samtbezogenen Kleiderbügel mit goldenen Fransen, auf den sie ihren Mantel hängte. Dann ging sie ein paar Schritte zu dem kleinen Hocker, um sich darauf niederzulassen. Hier zog sie die gefütterten Stiefel aus und stellte sie exakt unter dem Kleiderbügel ab. In ihrem Koffer befanden sich die orthopädischen Hausschuhe, die sie herausholte und anzog. Indem sie sich an der Wand abstützte, gelang es ihr, wieder aufzustehen.
Auf die Krücke gestützt, humpelte sie durch die Diele, warf einen kurzen, unzufriedenen Blick auf sich selbst im Garderobenspiegel und setzte ihren Weg zur Küche fort. Vor der Schwelle hielt sie inne und beugte sich vor, um den Lichtschalter auf der anderen Seite des Türrahmens erreichen zu können.
Sie hielt mitten in der Bewegung inne, weil sie fand, dass es fremdartig roch. Die alten, gewohnten Gerüche gab es zwar immer noch, aber durch all dieses Altvertraute drängte etwas Unbekanntes in ihre Nasenlöcher. Es roch nach Leder. Leder und … Exkrementen? Sie schaltete das Licht an.
Zuerst stockte ihr der Atem. Wie versteinert stand sie da, ohne zu verstehen, was sie dort vor sich sah. Nach einigen Sekunden gelang es ihrem Gehirn, das Bild des toten Mannes auf ihrem Küchenboden zu verarbeiten. Sofort begann sie zu hyperventilieren, stolperte zu einem der Stühle am Esstisch und ließ sich darauffallen. Sie konnte ihre Augen nicht von der blutigen Masse losreißen, die einmal ein Gesicht gewesen war. Und so blieb sie eine lange Zeit sitzen, ohne an etwas anderes zu denken als daran, einzuatmen, auszuatmen, einzuatmen, auszuatmen, ruhig und regelmäßig. Es dauerte einige Minuten, bis ihre Atmung sich normalisiert hatte. Dann bemerkte sie erleichtert, dass ansonsten alles noch seine Ordnung hatte. Auf der Arbeitsplatte war nichts angerührt worden, und alle sechs Küchenstühle standen ordentlich um den runden Esstisch herum. Keine Spur eines Handgemenges oder sonstiger dramatischer Szenen, einfach nur ein zerschmetterter Mensch auf dem Fußboden. Ein toter Mann. Großer Gott, wer könnte das bloß sein? Und warum um alles in der Welt lag er hier auf ihrem Küchenboden?
Mühsam erhob sie sich und schleppte sich zu ihrem Telefon, das in der Diele an der Wand befestigt war. Sie nahm den Hörer ab und dachte einen Augenblick nach, bevor sie die Nummer der Taxizentrale wählte. Nachdem sie einen Wagen bestellt hatte, der nach Aussage der Zentrale in zehn bis zwölf Minuten eintreffen würde, machte sie alles wieder rückgängig, was sie zuvor getan hatte: Hausschuhe ausziehen und zurück in den Koffer, Reißverschluss zu, Stiefel an, aufgestanden und rein in den Mantel, Licht aus und raus und abgeschlossen. Anschließend ging sie mit der Handtasche über der Schulter, dem Koffer in der einen und der Krücke in der anderen Hand den Weg wieder hinunter und stellte sich am Straßenrand in Position, um auf das Taxi zu warten.
»Um Gottes willen, Ingrid!«, rief Schwester Margit überrascht. »Ich dachte, du hast dich darauf gefreut, endlich wieder nach Hause zu kommen!«
Margit Olofsson war eine Frau im besten Alter, stattlich gebaut und mit einem großen, dunkelroten Haarschopf. Sie gehörte zu der Sorte Mensch, die Mütterlichkeit und Fürsorglichkeit ausstrahlten.
»Schwester Margit, es ist etwas Schreckliches …«
»Aber, Ingrid, meine Liebe, setz dich doch, du siehst ja ganz mitgenommen aus! Ist etwas passiert? Geht es dir nicht gut?«
Margit Olofsson nahm die ältere Frau am Arm und führte sie zu einem der Sessel in der Aufnahmestation. Unter ihrem weißen Kittel schauten ein paar ausgewaschene Jeanshosen hervor.
»Ich wusste nicht, was ich tun sollte«, sagte Ingrid kleinlaut. »Ich bin wohl ziemlich durcheinander, aber mir ist außer dir niemand eingefallen, an den ich mich wenden könnte … Lach mich bitte nicht aus, aber … es liegt ein Toter in meiner Küche.«
»Großer Gott! Wer denn?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Es waren keine Diebe oder so etwas, sie haben nichts angerührt. Er liegt einfach nur da und ist tot.«
»Das klingt ja unglaublich. Bist du sicher, dass er tot ist?«
»Absolut. Das spürt man. Irgendwie ist dann alles … ganz ruhig und still.«
»Du musst ja furchtbare Angst gehabt haben!«
»Deswegen bin ich ja hierher zurückgekommen.«
»Ja, natürlich. Du Ärmste«, tröstete sie Schwester Margit und legte einen Arm um ihre Schultern. »Du hast doch bestimmt die Polizei gerufen, oder?«
»Ich … Nein«, gestand Ingrid. »Es kam mir alles so … unwirklich vor. Ich konnte nicht …«
Schwester Margits erster Gedanke war, die Polizei anzurufen, aber plötzlich beschlich sie der Verdacht, dass Ingrid Johansson möglicherweise nicht ganz klar im Kopf war. Ein paar Sekunden lang musterte sie sie nachdenklich und schaute schließlich auf ihre Armbanduhr.
»Wir machen es so. In zweieinhalb Stunden habe ich Feierabend. Dann fahren wir gemeinsam zu dir nach Hause und machen uns dort darüber Gedanken, was wir unternehmen können. Okay?«
»Das wäre schön.«
»Macht es dir nichts aus, so lange zu warten?«
»Nein, nein. Das macht nichts.«
»Ich besorge dir Kaffee und Kuchen. Und eine Zeitschrift.«
Dann eilte sie hastig davon, wobei ihre Holzpantoffeln auf dem Fliesenboden klapperten. Ebenso schnell war sie wieder zurück, mit einem Kaffee, einer Rosinenschnecke, ein paar Keksen und einem Stapel Frauenzeitschriften.
»Brauchst du noch etwas?«
»Nein danke. Du bist so lieb zu mir, Schwester Margit.«
»Dann sehen wir uns gleich. Bis dann!«
Und so blieb sie allein zurück, ohne sich allerdings besonders einsam zu fühlen, denn sie war davon überzeugt, dass Schwester Margit dafür sorgen würde, dass alles aufs Beste geregelt werden würde.
Als Schwester Margit schließlich zurückkam, hatte sie den weißen Krankenhauskittel gegen eine schwarze Baumwolltunika getauscht, eine blaue, offen stehende Daunenjacke flatterte hinter ihr her, als sie auf Ingrid zueilte. Die weißen Holzpantoffeln waren zwei schwarzen Curlingschuhen gewichen. Das Klappern hatte sich in nahezu lautlose Schritte verwandelt.
»Mein Auto steht draußen auf dem Parkplatz«, sagte Schwester Margit und schenkte Ingrid ein warmes Lächeln. Gleichzeitig bot sie ihr einen Arm zur Unterstützung an, damit Ingrid sich aus dem Sessel erheben konnte. »Ist dir langweilig geworden?«
»Nein, gar nicht. Ich habe die ganze Zeit gelesen.«
Seite an Seite verließen sie das Krankenhaus und gingen im Schneckentempo einen kurzen Hang hinunter, bis sie einen gepflasterten Weg erreichten. Er führte zwischen ein paar Berberitzensträuchern hindurch auf den riesigen Parkplatz. Nachdem sie einige Reihen von Autos hinter sich gelassen hatten, blieben sie neben einem weißen Ford Mondeo stehen. Schwester Margit schloss den Wagen mit einem Druck auf die Fernbedienung auf und half Ingrid auf den Beifahrersitz.
»Jetzt hast du auch ein bisschen Bewegung gehabt, Ingrid. Es ist gut, wenn du das Gehen übst. Du kannst es als Krankengymnastik betrachten.«
Ingrid lächelte die freundliche Krankenschwester an, als sie sich neben ihr in den Fahrersitz sinken ließ. Sie konnte selbst kaum noch glauben, dass bei ihr zu Hause wirklich eine Leiche in der Küche lag. Hatte sie sich alles vielleicht nur eingebildet? Vielleicht hatten die Schmerztabletten Halluzinationen verursacht? Es kam ihr doch sehr unwahrscheinlich vor, dass gerade ihr Haus zum Schauplatz für einen Mord geworden sein sollte.
Je näher sie dem Haus kamen, desto mehr knarrte es im Gebälk der Frauenzeitschriften-Idylle, die sie in der Aufnahmestation eingelullt hatte. Zu Hause in ihrer Küche lag eine Leiche. Punkt, aus. Was würde das für ihr zukünftiges Leben bedeuten? Ihr Haus würde vermutlich von Polizisten und Technikern heimgesucht werden, die es nach Fingerabdrücken und Spuren durchkämmen würden. Wer würde hinter ihnen sauber machen? Rund um das Haus Absperrbänder und gaffende Nachbarn. Vielleicht auch Journalisten. Polizeiverhöre.
Nein, es würde eine Weile dauern, bis das Leben wieder einigermaßen normal verlaufen würde. Wenn überhaupt. Würde sie sich jemals wieder sicher fühlen in einem Haus, in dem ein unbekannter Mörder einen fremden Mann umgebracht hatte? Na ja, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas ein zweites Mal passieren würde, war sicherlich nicht besonders groß. Sie würde wohl versuchen müssen, einfach weiterzumachen, als ob nichts geschehen wäre. Schließlich war sie ja nicht im Geringsten in die Sache verwickelt, sie hatte nur Pech gehabt. Jeden Tag werden Menschen ermordet, in Schweden und vor allem in anderen Ländern. Darüber sollte man sich nicht zu viele Gedanken machen, und an diesem Todesfall gab es eigentlich nichts Besonderes außer der Tatsache, dass er in ihrem eigenen Zuhause stattgefunden hatte. Also Zähne zusammenbeißen, vergessen und weitermachen.
Es war ein gruseliges Gefühl, Arm in Arm durch die dichte Novemberdunkelheit den Kiesweg wieder hinaufzugehen. Der Kies knirschte unter den Sohlen. Die einzigen Lichtquellen waren eine Laterne am Wegesrand und die Außenbeleuchtung an der Eingangstür, die ein mattes gelbes Licht verbreitete. Die Temperatur hatte null Grad erreicht, und die herbstlichen Nordwinde ließen die nackten Kronen der Obstbäume ächzen und die beiden Frauen bibbern.
Sobald sie die Tür geöffnet und die Nase in die warme Stube gesteckt hatte, bemerkte Schwester Margit den ekelerregenden Geruch. Auch Ingrid nahm ihn jetzt sofort wahr. Seltsam, dass er ihr vorhin nicht aufgefallen war. Ingrid schaltete das Licht an und blieb in der Türöffnung stehen, während Schwester Margit schnell aus ihren ungeschnürten Curlingschuhen schlüpfte und mit resoluten Schritten zur Küche hinüberging. Nachdem sie das Licht angeschaltet hatte, sah sie sich ein paar Sekunden um, bevor ihre Augen entdeckten, wonach sie gesucht hatten. Ohne zu zögern, eilte sie zu dem leblosen Körper auf dem Küchenboden. Routiniert suchten ihre Finger unter dem Hemdkragen nach der Halsschlagader, und sie konnte schnell konstatieren, was sie bereits gewusst hatte: Der Mann war tot. Sie stand auf und ging zum Telefon.
*
Hauptkommissar Conny Sjöberg lag auf dem Sofa und schaute das Kinderprogramm. Auf ihm saß ein überdrehter Einjähriger, der rauf und runter, rauf und runter hüpfte. Dabei versuchte er trotz ständiger mehr oder weniger strenger Ermahnungen, Papas Brille an sich zu reißen, deren Gläser mittlerweile aber ohnehin so verschmiert waren, dass man kaum noch durch sie hindurchschauen konnte. Ein weiterer einjähriger Marodeur stand am Zeitschriftenhalter und warf eine Illustrierte nach der anderen auf den Boden. Sjöberg stellte fest – zum wievielten Mal, wusste er selbst nicht –, dass sie dringend Zeitschriftenordner brauchten, und nahm sich vor, morgen ein paar zu kaufen. Auf dem Fußboden vor dem Fernseher kniete eine junge Dame von vier Jahren, vollständig gefangen genommen von dem Blödsinn, den ein Zebra, eine Giraffe, ein Affe und zwei kleine Teddys beim Aufräumen eines Kinderzimmers machten. Als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, blieb sie von dem kleinen Weltkrieg, den die Zwillinge verursachten, völlig unberührt. Ihr einziges Interesse galt dem Fernsehprogramm, das allein für sie gemacht zu sein schien.
Conny Sjöbergs Frau Åsa stand in der Küche und beseitigte die Spuren des Abendessens. Dabei wurde sie von ihrer ununterbrochen plappernden sechsjährigen Tochter unterstützt, die für ihr Leben gern spülte. Conny konnte ihre helle Stimme durch den Lärm des Fernsehers und das aufgekratzte Geschrei der wilden Kleinen hindurch hören. Hätte Simon, der älteste Sohn, acht Jahre, nach der Schule nicht einen Klassenkameraden aus der Nachbarschaft nach Hause begleitet, wäre die Familie vollzählig gewesen.
Die Wohnung der Familie Sjöberg war ein Wunder an Ordentlichkeit, insbesondere wenn man bedachte, wie viele Menschen dort lebten. Das war die unbedingte Voraussetzung für das Wohlbefinden des Familienvaters, und er selbst sorgte dafür, dass es so blieb. Wenn alle Kinder am Nachmittag zu Hause eingetroffen waren, gespielt, gebadet und zu Abend gegessen hatten, konnte die Wohnung für das uneingeweihte Auge chaotisch wirken. Aber um neun Uhr, wenn alle Kinder im Bett waren, gab es in derselben Wohnung keinerlei Anzeichen mehr dafür, dass dort irgendeine Art von Aktivität stattgefunden hatte.
Morgens verhielt es sich ebenso. Obwohl dort sieben Personen ein paar Stunden lang wie aufgescheuchte Hühner herumgesprungen waren, waren keinerlei Spuren mehr zu sehen, wenn der Letzte die Haustür hinter sich geschlossen hatte. Sjöberg redete sich ein, dass es gut für die Kinder sei, wenn sie jedes Mal von einer ordentlichen Basis ausgehen konnten, wenn sie neues Chaos erschufen. Eigentlich ging es aber darum, dass er selbst keinen klaren Gedanken fassen konnte, wenn nicht alles an seinem gewohnten Platz lag. Als Kriminalkommissar in der Abteilung für Gewaltverbrechen war es für ihn wichtig, seine Gedanken in Muster, Listen und Tabellen fassen zu können, und das ging schlicht und ergreifend nicht, wenn in seinem Blickfeld irgendetwas Störendes auftauchte.
Die Wohnung in der Skånegatan, nicht weit vom Nytorget, war groß, eine Fünfzimmerwohnung mit einer geräumigen Küche, und trotzdem war sie zu klein. Die Zwillinge teilten sich ein Zimmer, ebenso die beiden Mädchen. Simon besaß sein eigenes kleines Reich, aber auch die Mädchen würden in nicht allzu ferner Zukunft das Bedürfnis haben, einander auch einmal aus dem Weg gehen zu können. Ein zweites Badezimmer würden sie auch brauchen. Es war schwer zu ertragen, sich jeden Morgen hinten anstellen zu müssen, um seine hygienischen Grundbedürfnisse befriedigen zu können. Um dem zu entgehen und noch eine Weile in Ruhe mit seiner Zeitung am Frühstückstisch sitzen zu können, stand Sjöberg immer als Erster auf. Schon um halb sechs kroch er aus den Federn, duschte und rasierte sich, setzte den Kaffee auf, machte sich zwei Butterbrote mit Käse und holte die Zeitung. Manchmal durfte er zwanzig Minuten lang in Ruhe dasitzen, bevor sich seine Umwelt bemerkbar machte. Dann aber musste sehr viel in sehr kurzer Zeit passieren. Haferschleim musste gekocht und Windeln mussten gewechselt werden, Butterbrote mussten geschmiert, Kleider herausgesucht und Kinder angezogen werden, Zöpfe mussten geflochten und Zähne geputzt werden. Und im Hintergrund ein ständiges Stimmengewirr, das Hüpfen und Patschen kleiner Füße, Möbel, die umhergeschoben wurden, und dieses verdammte Rutschauto, das für die Nachbarn unten vermutlich wie heftiger Donner klang. Vielleicht keine beneidenswerte Situation, aber Sjöberg liebte dieses Leben mit den Kindern, und Åsa und er hatten es niemals bereut, diese große und lautstarke Familie gegründet zu haben.
Wie auch immer – sie mussten sich etwas Größeres suchen. Aber eine größere Wohnung in der Innenstadt würde schwer zu finden sein, und mit Sicherheit wäre sie viel zu teuer. Ein Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus in irgendeiner Vorstadt kam ihnen nicht besonders verlockend vor. Schließlich fühlten sie sich wohl hier und hatten tiefe Wurzeln geschlagen. Sie waren zufrieden mit der Schule und dem Kindergarten, die Kinder hatten hier ihre Freunde, und sowohl für Åsa als auch für ihn war es nicht weit bis zur Arbeit, so wie auch alles andere in der Nähe war, Geschäfte, Restaurants und viele ihrer Freunde. Nein, es würde schwer werden, etwas Besseres zu finden.
Aus der Küche hörte er seine älteste Tochter Sara rufen: »Fischpudding, Fischpudding, Fischpudding, geh mir weg mit Fischpudding, Fischpudding, Fischpudding …«, und er wunderte sich, warum sie so etwas sang, wo sie Lachspudding doch so liebte. Im selben Augenblick klingelte das Telefon, und aus der Küche erklang ein Rumsen, als Sara vom Küchenstuhl vor der Spüle sprang, um als Erste am Telefon zu sein.
»Hallo, hier ist Sara!«, zwitscherte sie.
»…«
»Gut, und wie geht es dir?«
»…«
»Nein, er schaut Kinderfernsehen.«
»…«
»Okay, ich werde ihn fragen. Tschüs!«
»Wer war das?«, fragte Åsa.
»Es ist Sandén!«, rief Sara, während sie ins Wohnzimmer galoppierte. »Papa. Sandén ist am Telefon. Er möchte mit dir sprechen!«
»Dann musst du auf die Kleinen aufpassen, Sara«, sagte Sjöberg und stellte Christoffer, der auf seinem Bauch gelegen hatte, auf den Boden, bevor er sich widerstrebend vom Sofa erhob.
»Na, dann«, seufzte er schicksalsergeben, nachdem das Gespräch beendet war.
Er sah die kummervolle Stirnfalte zwischen den Augen seiner Frau schon vor sich, und er verstand sie nur allzu gut. Es war nicht gerade das, was man sich wünschte, allein mit fünf Kindern, die ins Bett gehen sollten.
»Was ist passiert?«, fragte sie.
»Eine alte Dame ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, und als sie nach Hause kam, fand sie eine Leiche auf dem Küchenboden. Ich muss hin.«
»Wer war es denn?«
Auch wenn Åsa diese Situationen gar nicht liebte, konnte sie nicht leugnen, dass die Arbeit ihres Mannes sie faszinierte. Bei ihr konnte er alles loswerden, so abscheulich die Verbrechen, an denen er arbeitete, oft auch waren. Sie versuchte, ihn zu unterstützen, so gut sie konnte. Nicht selten eröffnete Sjöberg seine Theorien zu einem Fall zuerst seiner Frau; oft hatte sie gute Einfälle und war ihm Inspiration bei seinen komplizierten Ermittlungen.
»Genau das ist das Merkwürdige«, antwortete Sjöberg. »Sie hatte keine Ahnung, wer es war. Er lag tot in ihrem Haus, aber sie hat ihn noch nie zuvor gesehen.«
»Das ist schrecklich.«
Åsa schauderte, als vor ihrem inneren Auge das Bild eines Leichnams auf ihrem eigenen Küchenboden erstand.
»Wahrscheinlich hat sie ihn irgendwo doch schon einmal getroffen«, fuhr sie gedankenverloren fort. »Vielleicht ohne es zu wissen …«
»Wir werden sehen«, sagte Sjöberg und küsste sie schnell auf den Mund. »Es dauert vielleicht die ganze Nacht, ich weiß es nicht. Mach’s gut.«
»Du auch, und viel Glück«, sagte sie und streichelte ihm kurz über die Wange, bevor er sie mit einem müden Seufzen verließ.
*
Die alte Dame wirkte jünger, als er sie sich vorgestellt hatte. Sie mochte um die siebzig sein und hatte sich in ein dunkelbraun genopptes Zweiersofa im Stil der siebziger Jahre zurückgelehnt. Neben ihrem Bein lehnte eine Krücke. Sie saß regungslos da und starrte geradeaus, mit einem Blick, der nichts darüber verriet, was sich in ihrem Kopf abspielte. Sie sah weder verängstigt noch traurig aus, und sie schien auch nicht besonders neugierig darauf zu sein, was um sie herum vor sich ging. In der Diele stand Sandén und unterhielt sich mit einer Frau mittleren Alters. Die ältere Dame gab keinen Anlass zu der Vermutung, dass sie diesem Gespräch lauschen würde. Hinter der goldgerahmten Brille versteckten sich graue Augen, das graue Haar trug sie kurz geschnitten. Ihre dünnen Beine steckten in einer hellbraunen Hose und endeten in einem Paar schwarzer Halbschuhe. Oben war sie mit einem grauen Lammwollpulli bekleidet.
Sjöberg trat auf sie zu, um sich ihr vorzustellen. Sie wandte sich ihm zu, ihr Gesichtsausdruck war nicht unhöflich, eher desinteressiert. Als er seine Hand ausstreckte, antwortete sie mit einem schwachen Händedruck und einem Nicken.
»Können Sie hier noch einen Augenblick warten? Dann komme ich gleich zu Ihnen und unterhalte mich mit Ihnen?«, fragte Sjöberg freundlich.
»Ich sitze, wo ich sitze«, antwortete sie ausdruckslos und setzte die Beobachtung des Luftraums vor ihrer Nase fort.
Sjöberg kehrte in die Diele zu Sandén zurück, der ihm einen kurzen Blick zuwarf und zur Küche hinübernickte, während er sein Gespräch mit der jüngeren Frau fortsetzte. Sjöberg warf einen flüchtigen Blick auf die große, rundliche Gestalt, die zwischen fünfundvierzig und fünfundfünfzig Jahre alt sein mochte. Trotz der Sorgenfalte auf ihrer Stirn und der ernsten Stimme meinte er, ein fröhliches Funkeln in ihren grünen Augen entdecken zu können. Ihre beeindruckende rotbraune Haarpracht geriet in Wallung, als sie sich ihm zuwandte und seinem Blick begegnete. Aus irgendeinem Grund fühlte er sich ertappt und schaute sofort in eine andere Richtung. Plötzlich hatte er Durst und fühlte sich unwohl.
Er ging zur Küche hinüber, stellte sich in die Türöffnung und betrachtete eine Zeit lang den toten Körper. Dann schaute er sich in der Küche um, ohne sie zu betreten. Dies hier war seine Chance, sich ein Bild vom Fundort zu machen, bevor es von Fotografen, Technikern und Polizisten nur so wimmelte. Der erste Eindruck von einem Tatort konnte sehr wichtig sein, und er nahm sich ausreichend Zeit, bevor er über die Schwelle trat.
In der Küche gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass hier eine gewaltsame Auseinandersetzung stattgefunden hatte. Alles schien seine Ordnung zu haben, alle Möbel standen an ihrem Platz. Die Anrichte und die Spüle waren sauber, und mitten auf dem runden Tisch lag eine weiße Spitzendecke, auf der eine leere Obstschale und ein Messingleuchter standen. Auf dem Fußboden vor dem Kühlschrank lag der tote Mann, der eine dunkelblaue Segeljacke trug, deren Reißverschluss zur Hälfte geöffnet war, dazu beige Hosen und braune Lederschuhe. Sein Gesicht war böse zugerichtet, ein wenig Blut war aus der Nase bis hinunter zum Boden geflossen. Im Übrigen machte er einen eher friedvollen Eindruck, wie er da so in typischer Ruhehaltung mit dem Rücken auf den Kieferdielen lag.
Sjöberg verließ die Küche und drängte sich an Sandén und der Frau vorbei in die Diele. Der angenehme Duft eines nicht allzu aufdringlichen Parfums stieg ihm in die Nase. Er trat auf die Eingangstreppe hinaus und rief seine Leute zusammen. Der Fotograf und die Techniker wussten bereits, was sie zu tun hatten, den Schutzpolizisten gab er die Anweisung, Absperrbänder aufzuspannen und sich im Garten umzusehen. Er selbst würde die Besitzerin des Hauses befragen, bevor er sie bitten würde, sich eine Zeit lang eine andere Bleibe zu suchen.
»Sie heißen Ingrid Johansson?«, fragte Sjöberg.
»Ja«, antwortete Ingrid knapp.
»Ich muss Sie leider bitten, das Haus für eine Weile zu verlassen. Sie können hier nicht bleiben, solange wir den Tatort untersuchen.«
Statt zu antworten, schaute sie ihn nur ausdruckslos an.
»Können Sie heute Nacht irgendwo bleiben?«
»Ich werde mit Schwester Margit reden.«
»Schwester Margit?«, wunderte sich Sjöberg.
»Ja, ich war doch gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden, als ich nach Hause kam und den Toten fand. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, also habe ich Schwester Margit gefragt, ob sie mir nicht helfen könnte. Sie arbeitet in der Abteilung, in der ich gelegen habe.«
»Verstehe. Können Sie mir bitte alles noch einmal von Anfang an schildern?«