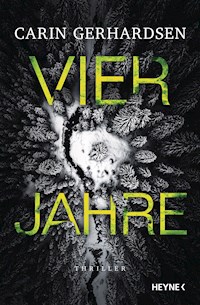4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Sjöberg
- Sprache: Deutsch
Als die dreijährige Hanna aufwacht, befindet sie sich ganz allein in einer abgeschlossenen Wohnung. Sie weiß, dass ihr Vater in Japan ist - aber wo sind ihre Mutter und ihr kleiner Bruder? Warum kommen sie nicht wieder? Der kleinen Hanna gelingt es, jemanden anzurufen, aber sie kann nicht erklären, wo sie wohnt. Eine verzweifelte Suche nach dem eingesperrten Kind nimmt ihren Anfang ... Doch noch ein anderer Fall beschäftigt Kommissar Conny Sjöberg: Seine Kollegin stößt in einem Gebüsch vor der Polizeiwache auf einen fast erfrorenen Säugling. Kurz darauf wird in der Nähe des Fundortes eine tote Frau entdeckt ...
Dieser Krimi erschien auf Deutsch bereits unter dem Titel "Nur der Mann im Mond schaut zu".
Über diese Serie
Hammarby, mitten in Stockholm: Hier ermittelt Kommissar Conny Sjöberg mit seinem Team. Dabei ist der sympathische Familienmensch Sjöberg immer wieder mit menschlichen Abgründen konfrontiert ...
Mit dieser Serie erlangte die Schwedin Carin Gerhardsen ihren internationalen Durchbruch: Die Schweden-Krimis wurde in über 25 Sprachen übersetzt, jedes Buch erreichte Platz 1 der schwedischen Bestseller-Charts.
Alle Schwedenkrimis um Conny Sjöberg:
1: Das Haus der Schmerzen
2: Du bist ganz allein
3: Und raus bist du
4: Falsch gespielt
5: Vergessen wirst du nie
6: In deinen eiskalten Augen
7: Blutsbande
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverWeitere Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumZitat1964September 2007, FreitagabendDie Nacht von Freitag auf SamstagSamstagmorgenSamstagnachmittagSamstagabendDie Nacht von Samstag auf SonntagSonntagmorgenSonntagvormittagSonntagnachmittagSonntagabendMontagvormittagMontagnachmittagMontagabendDienstagmorgenDienstagvormittagDienstagmittagDienstagnachmittagDienstagabendWeitere Titel der Autorin
Das Haus der Schmerzen
Und raus bist du
Falsch gespielt
Vergessen wirst du nie
In deinen eiskalten Augen
Blutsbande
Über dieses Buch
Als die dreijährige Hanna aufwacht, befindet sie sich ganz allein in einer abgeschlossenen Wohnung. Sie weiß, dass ihr Vater in Japan ist – aber wo sind ihre Mutter und ihr kleiner Bruder? Warum kommen sie nicht wieder? Der kleinen Hanna gelingt es, jemanden anzurufen, aber sie kann nicht erklären, wo sie wohnt. Eine verzweifelte Suche nach dem eingesperrten Kind nimmt ihren Anfang … Doch noch ein anderer Fall beschäftigt Kommissar Conny Sjöberg: Seine Kollegin stößt in einem Gebüsch vor der Polizeiwache auf einen fast erfrorenen Säugling. Kurz darauf wird in der Nähe des Fundortes eine tote Frau entdeckt …
Über die Autorin
Carin Gerhardsen, geb. 1962, ist in Katrineholm aufgewachsen und lebt nun in Stockholm. Vor dem internationalen Durchbruch als Autorin arbeitete die Mathematikerin mit großem Erfolg in der IT-Branche. Mit der Serie um Kommissar Conny Sjöberg erlangte die Schwedin Carin Gerhardsen ihren internationalen Durchbruch: Die Schweden-Krimis wurde in über 25 Sprachen übersetzt, jedes Buch erreichte Platz 1 der schwedischen Bestseller-Charts.
C A R I N G E R H A R D S E N
DU BISTGANZALLEIN
Aus dem Schwedischen vonThorsten Alms
S C H W E D E N - K R I M I
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Carin Gerhardsen
Titel der schwedischen Originalausgabe: »Mamma, pappa, barn«
Originalverlag: Ordfront, Stockholm
Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Nur der Mann im Mond schaut zu«
Lektorat/Projektmanagement: Lukas Weidenbach
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.deunter Verwendung von Motiven von © Florian95/shutterstock; © wavebreakmedia/shutterstock; © Wilqkuku/shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0765-7
be-ebooks.de
lesejury.de
Ich sah das Dunkle im Dunkeln.
Es lebt und lechzt und leidet
unter gräsernem Geflecht,
es krabbelt und wimmelt und kriecht
und fängt und tötet und frisst
und zeugt und vergeht, um wiedergeboren
zu leben in kommenden Zeiten …
Dan Andersson
1964
Schlaf jetzt, schlaf, beeil dich. Schließ die Augen, lass den Mund ein wenig geöffnet, dann sieht es echt aus. Der Atem sollte langsam und gleichmäßig fließen, auch wenn das Herz wie wild in der Brust hämmert. Aber wenn man muss, dann geht es auch. Er hört die Schritte auf der Treppe, angenehme Schritte mittlerweile, nicht mehr die harten, bösen, wie eben noch, jetzt sind sie versöhnlich und einschmeichelnd. Er hört, wie die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird – verdammt, es ist einer dieser Tage. Seine Atemzüge sind langgezogen, säuselnd, perfekt. Der Kopf liegt ein wenig schräg auf dem Kissen, Speichel rinnt aus dem Mundwinkel und läuft die Wange hinab. Er muss einen vollkommen entspannten Eindruck hinterlassen, obwohl jeder einzelne Muskel seines Körpers so angespannt ist, dass es schmerzt, aber das kann niemand sehen.
»Schläfst du, kleiner Mann?«, flüstert die verhasste Stimme in ihrem sanften, zuckersüßen Tonfall. »Ich dachte, wir könnten als Freunde einschlafen, das ist doch immer so schön, nicht wahr?«
Es scheitert immer an den Augen, man kann die Lider nicht entspannt geschlossen halten.
»Ich sehe doch, dass du wach bist, deine Augenlider zucken. Mach mir nichts vor, bist du etwa nachtragend? Ich will doch nur dein Bestes, das weißt du doch. Wollen wir uns nicht vertragen?«
Jetzt kann er die Augen nicht länger geschlossen halten, und er muss den Speichel wegwischen, der ihm mittlerweile ins Ohr gelaufen ist. Und da ist sie, die kalte, knochige Hand mit den langen, schmutzigen Fingernägeln, die unter die Pyjamajacke gleitet. Sein Körper erstarrt, und voller Angst und Ekel starrt er den Mann an, aber dieses verdammte Schwein merkt es nicht. Ein leichtes Zucken im Augenlid entgeht ihm nicht, aber einen ganzen Körper in Aufruhr nimmt er nicht wahr.
Jetzt klingt Lärm aus der Küche herüber und durch das ganze Haus. Klirrendes Porzellan wird in Schränke geräumt und rasselndes Besteck in Schubladen sortiert. Er zuckt zusammen, als ein Stück der empfindlichen Haut in seinem Nabel für einen Moment hinter einem langen Zeigefingernagel eingeklemmt wird. Der Finger kreiselt eine Weile in seinem Nabel herum – der auf eine unangenehme, fast schmerzhafte Weise in direkter Verbindung mit seinem Unterleib zu stehen scheint –, bevor er sich weiter in seine Schlafanzughose hinunterarbeitet.
Spätestens an diesem Punkt zieht er es vor, sich von jenem Ort zu verabschieden und sich auf den Fußballplatz oder hinunter zum Badeplatz zu begeben, wo er Kaulquappen fängt. Heute steht er allerdings an den Gleisen und betrachtet die Menschen hinter den Fenstern des vorbeifahrenden Zuges, und aus welchen Gründen auch immer brennt sich ausgerechnet dieses Bild in sein Gedächtnis ein. Es ist weder angenehm noch unangenehm, aber irgendwie wird er es nicht mehr los. Von jetzt an wird er immer neben diesem Zug stehen, wenn er sich in sich selbst zurückzieht, von sich selbst zurückzieht. Aber das ahnt er in diesem Augenblick noch nicht. Die Schienen schreien unter dem heranbrausenden Zug.
September 2007, Freitagabend
Sie lässt ihn auf dem Teppich vor dem Bett liegen, während sie das Laken wechselt. Er schreit mit einer Stimme, die mittlerweile kaum noch wiederzuerkennen ist, und sein rundes Gesicht ist vor Anstrengung rot angelaufen. Es ist halb elf. Seit vier Stunden versucht sie ihn zum Einschlafen zu bringen. Aber der Hals tut ihm so weh, dass er den Schnuller nicht im Mund behalten mag, und ohne Schnuller ist es aussichtslos. Auch das Paracetamol hilft nicht mehr. Das Schlucken bereitet ihm so starke Schmerzen, dass er kaum mehr isst, und der leere Magen behält das Penizillin nicht bei sich. Sie selbst ist nach drei Tagen so erledigt, dass diese totale Erschöpfung zum Normalzustand geworden ist. Aber nicht ein einziges Mal ist sie laut geworden, kein einziges böses Wort ist ihr über die Lippen gekommen. Es fühlt sich an wie ein Sieg.
In ihrem Hinterkopf läuft ununterbrochen der Countdown. Sie zählt die Tage, Stunden und Minuten, bis Mats endlich wieder nach Hause kommt. In diesem Augenblick sind es noch genau vier Tage, zehn Stunden und dreißig Minuten. Er ist in Japan auf einem technischen Seminar, und dort gibt es kein GSM, sie kann ihn nicht einmal anrufen, um sich ein wenig aufmuntern zu lassen. Aber vielleicht ist es auch besser so, es würde ihn nur ablenken, wenn er wüsste, wie es um sie steht, und sie selbst würde wahrscheinlich anfangen zu weinen und ihre kämpferische Entschlossenheit in Selbstmitleid zerfließen lassen.
Sie läuft mit einem Berg vollgespuckter Laken ins Badezimmer und stopft das Bündel in die Waschmaschine. Instinktiv fischt sie ein paar Stück Wäsche in ähnlichen Farben aus dem Wäschekorb und drückt sie mit hinein in die Trommel, bevor sie Waschpulver dazugibt und das Sechzig-Grad-Programm der wahrscheinlich überladenen Maschine einschaltet.
Das Kind hört plötzlich auf zu schreien, und in der aufziehenden Stille hört sie ihren eigenen Magen nach Nahrung rufen. Sie selbst verspürt keinen Hunger, macht aber einen Umweg über die Küche, um sich die letzte braun gefleckte Banane aus der Schale neben der Spüle zu nehmen. Im selben Augenblick beginnt erneut das Geschrei im Schlafzimmer. Sie eilt zurück und nimmt den Jungen auf den Arm, setzt sich auf das Fußende des ungemachten Betts, legt das Kind mit dem Bauch auf ihre Knie und streichelt seinen Rücken. Im Fernseher vor ihr läuft ein amerikanischer Film, dem sie mit ausgeschaltetem Ton zu folgen versucht, während sie die Banane herunterwürgt und monoton das untröstliche Baby streichelt.
Nur wenige Minuten später ist der Film vorbei, und der Abspann rollt über den Bildschirm. Sie schaltet den Fernseher aus, erhebt sich mühsam mit dem schluchzenden Kind auf dem Arm und tritt ans Fenster. Zwei Männer mittleren Alters gehen auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig vorbei. Etwas weiter entfernt ist ein junges Paar zu erkennen. Ihre Körperhaltung deutet an, dass es inzwischen nicht mehr regnet, keiner der beiden hat einen Schirm. Der ausdauernde Regen scheint endlich vorbei zu sein.
Sie versucht, den Jungen vor sich auf die Fensterbank zu stellen und an den Händen festzuhalten, aber das will er nicht. Zornig strampelt er mit den Beinen, statt sich auf seine Füße zu stellen. Sie hebt ihn wieder hoch, legt seinen Kopf an ihre Schulter und riecht an seinem Haar. Es ist schweißnass, und sein Geschrei sticht wie Nadeln in ihren Ohren. Ihre Augen brennen, denn sie hat zu wenig geschlafen. Es bereitet ihr Schwierigkeiten, sie offenzuhalten, obwohl sie sich eigentlich alles andere als schläfrig fühlt. Widerwillig gesteht sie sich ein, dass sie in dieser Situation mehr Mitleid mit sich selbst empfindet als mit dem kleinen Menschen, den sie über alles liebt und der in ihren Armen so leidet. Wut steigt in ihr auf. Wahnsinnige Wut über dieses namenlose, ungreifbare, abstrakte Etwas, das ihren Sohn so quält und das sie nicht besiegen kann. Mit einem Seufzer steht sie auf und geht mit dem kleinen Jungen im Arm in die Diele hinaus.
Bevor sie den Schlüssel in das Schloss steckt, zögert sie einen Augenblick, überlegt, ob man sich an so einem Freitagabend eher vor Einbrechern oder vor einem Feuer fürchten soll. Dann schließt sie die Wohnungstür sorgfältig von außen ab.
*
Lachen und fröhliche Stimmen klangen durch die ganze Wohnung. An diesem Abend schienen alle guter Laune zu sein, niemand zickte oder quatschte dumm herum. Die meisten saßen in der Küche, weil Solan mit ihrem neuen Typen im Wohnzimmer hockte. Dass sie auf Gesellschaft keinen großen Wert legten, hatten sie deutlich gemacht, indem sie die Tür zur Küche und die zum Flur geschlossen hatten. Am Küchentisch drängten sich nicht weniger als neun Leute, und auf dem Fußboden saß Elise, die sich an den Kühlschrank lehnte und ihren Drink neben sich abgestellt hatte. Ihr gegenüber saß Jennifer, die ebenfalls an einer Mischung aus selbstgebranntem Schnaps und Cola nippte.
Bei ihnen zu Hause gingen ständig Menschen ein und aus. Schon am Vormittag kamen Leute hereingeschneit, und falls jemand auf dem Weg eingekauft hatte, gab es Kaffee und Butterbrote. Die Mutter hielt die Tür stets offen für alle Freunde und Bekannte, aber für die Verpflegung mussten sie selber sorgen. Früher hatte sie sich schwergetan, ihnen nichts zu essen anzubieten, aber schließlich hatte sie sich dazu durchgerungen, als sie wieder einmal im Kühlschrank und in den Schränken herumstöberten, seitdem respektierten alle die Entscheidung. Sie legte Wert darauf, dass die Mädchen jeden Tag ihr Frühstück bekamen und sich rechtzeitig auf den Weg machten. Sie schickte immer eine von ihnen zum Einkaufen in den ICA-Markt in Ringen, nicht aus Faulheit – Elise wusste, dass sie es eigentlich lieber selbst gemacht hätte –, sondern weil sie sich schämte rauszugehen. Elise und ihre Schwester aßen selten zu Hause Mittag, meistens kauften sie sich etwas auf die Hand, wenn sie Hunger bekamen, und manchmal aßen sie bei Freundinnen. Aber sie bekamen Geld für Kleider, Mittagessen und Körperpflege. Es fehlte ihnen nichts. Ihrer Mutter gelang es, die Familie über die Runden zu bringen, auch wenn ihr Leben ein bisschen anders aussah als das der anderen.
In der Regel wurden schon am frühen Nachmittag die ersten Flaschen auf dem Wohnzimmertisch in der Dreizimmerwohnung im Wohnkomplex Ringen entkorkt. Danach herrschte bis weit in den Abend hinein ein ständiges Kommen und Gehen, und erst gegen Mitternacht wurde es ein bisschen ruhiger. Und nicht selten schlief einer der Saufkumpane ihrer Mutter ein und blieb über Nacht.
Die Mädchen gingen tagsüber in die Schule und zogen danach durch die Stadt oder waren bei Freundinnen. Sie teilten sich ein eigenes Zimmer, aber sie hielten es kaum zu Hause aus, solange dort gefeiert wurde, also versuchten sie sich so lange wie möglich von dort fernzuhalten. Die Gelage bei ihrer Mutter endeten nur selten in Handgreiflichkeiten, aber die Gespräche verliefen lautstark, und man musste aufpassen, dass man niemanden provozierte, der ohnehin schon nicht besonders gut gelaunt war. Elise und Jennifer blieben am liebsten weg und versuchten möglichst unsichtbar zu bleiben, wenn sie zu später Stunde in die Wohnung schlichen und sich schlafen legten.
Doch jetzt war Freitagabend, das Wochenende stand vor der Tür, also keine Schule oder andere Verpflichtungen. Außerdem hatte ihre Mutter gerade Geld bekommen. Am Küchentisch, auf dem sich Flaschen, Gläser und volle Aschenbecher drängten, herrschte Hochstimmung. Elise und Jennifer hatten sich von der ausgelassenen Atmosphäre anstecken lassen und die Gelegenheit ergriffen, Schnaps und Zigaretten zu schnorren. Normalerweise schlichen sie auf dem Weg zu ihrem Zimmer vorbei, ohne dass sich jemand um sie kümmerte, aber diesmal waren sie hereingerufen worden. Einige der großmäuligen Typen am Küchentisch machten ihnen das eine oder andere Angebot.
Elise fühlte sich schon nach dem ersten Schluck angenehm entspannt. Sie zog an der Zigarette und schloss die Augen. Diese hier wollte sie für sich alleine, denn sie wusste, dass sie nicht noch mehr bekommen konnte. Das Geld, das sie bekam, reichte selten für Zigaretten, und wenn man bei Freundinnen schnorrte, musste man sich mit ihren fast aufgerauchten Kippen begnügen. Sie nahm einen ordentlichen Schluck aus dem Glas und schaute zu ihrer großen Schwester hinüber. Alle sagten, sie sähen sich ähnlich, aber sie konnte nicht viele Übereinstimmungen entdecken. Jennifer war zwei Jahre älter, cool und selbstbewusst und nie um eine Antwort verlegen. Sie selbst war eine blasse Kopie ihrer Schwester mit wenig Selbstvertrauen, schlechter Haltung und kleinen, lächerlichen Brüsten, die kein Vergleich zu Jennifers waren. Sogar die Typen in ihrer Küche erkannten den Unterschied. An einem Abend wie diesem sollte Jennifer bei einem von ihnen auf dem Schoß sitzen, sie war der Hauptgewinn. Aber sie ließ die Männer auf ihre souveräne Art fast immer abblitzen. Da konnten sie noch so viele Krokodilstränen vergießen und bitten und betteln, sie schüttelte nur den Kopf und rollte entnervt mit den Augen. Erst dann wandten sie sich an Elise, aber auch sie sagte meistens nein, genau wie Jennifer. Manchmal allerdings setzte sie sich auf Dagges oder Gordons oder Peos Schoß, weil sie einfach nicht mehr nein sagen konnte oder einfach für einen Augenblick das Gefühl haben wollte, geliebt zu werden.
»Was hast du heute Abend vor?«
Um den Lärm in der Küche zu übertönen, musste Elise schreien.
»Weiß nicht. Mit Jocke losziehen, aber vielleicht scheiß ich auch drauf«, brüllte Jennifer zurück.
Jennifer hatte einen Freund. Na ja, Freunde hatte sie selbst auch hin und wieder schon gehabt, aber Jennifer hatte einen richtigen Freund. Einen Mann. Jocke war vierundzwanzig und hatte einen Bart. Die Jungen, mit denen sich Elise traf, hatten bestenfalls schon den Stimmbruch hinter sich. Von Bartwuchs konnte bei ihnen kaum die Rede sein, und sie waren kindisch und albern. Jennifer hatte einen richtigen Mann und war sich nicht sicher, ob sie Lust hatte, ihn zu treffen! Er war nett und aufmerksam, Elise konnte sich nicht erinnern, selbst je so einem Mann begegnet zu sein. Sie hatte die beiden einmal von Weitem beobachtet, Jocke hatte seinen Arm um Jennifer gelegt, als wäre sie sein Eigentum. So als wollte er allen zeigen: »Das ist mein Mädchen, und darauf bin ich stolz.« Und dann hatte er ihr tief in die Augen geschaut und ihr so sanft und vorsichtig die Wange gestreichelt, als könnte sie bei der geringsten Berührung zerbrechen. Elise wünschte, sie hätte auch einen solchen Freund. Ihn.
»Was heißt, ich scheiß drauf?«
Jennifer leerte ihr Glas in einem Zug, und Elise ertappte sich dabei, dass sie es ihr nachmachte.
»Ach, ich weiß nicht.«
»Seid ihr nicht mehr zusammen?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Doch, aber er ist so verdammt … ach, scheißegal. Willst du noch einen?«
»Ja. Und besorg mir auch ne Fluppe.«
Jennifer stand auf und arbeitete sich zwischen Stühlen, Beinen und schwankenden Oberkörpern hindurch zum Tisch vor. Dagge streckte beide Arme aus, packte sie fest an den Hüften und zog sie neckisch auf seinen Schoß, doch sie schnellte sofort wieder hoch, schnappte sich eine Flasche und eine Packung Zigaretten, um sich schließlich wieder zurück zu ihrem Platz am Küchenschrank zu malen.
»Na hör mal, junges Frollein, was ist denn das für eine Art?«, rief Dagge ihr mit lauter, heiserer Stimme hinterher. »Du stibitzt meinen Wein, und ich werde dafür nicht mal ein bisschen gedrückt?«
Dagge war ein blonder, rotwangiger Typ mit kleinen, blutunterlaufenen Augen und großen Ohren, aus denen Haare herauswucherten. Bemerkenswerterweise trug er ein ziemlich modisches, kariertes Hemd, doch seine Jeans waren voller Farbflecken und rochen bis zu Elises Sitzplatz hinüber nach altem, erstarrtem Dreck.
»Vielleicht lässt sich da was machen, wenn du ein bisschen nett bist«, antwortete Jennifer kühl, während sie ihr Glas und das ihrer Schwester mit lauem Weißwein füllte.
Elise ließ allein schon der Gedanke schaudern, diese Jeans berühren zu müssen.
»Wenn überhaupt, müsstet ihr ein bisschen nett zu mir sein. Das ist nämlich mein Wein«, krakeelte ihre Mutter.
Oberpeinlich wie immer. Sie war leichter zu ertragen, wenn sie in ihrer schweigsamen, deprimierten Stimmung war. Heute Abend war sie aufgedreht und redselig. Verlangte Respekt und Aufmerksamkeit. Elise mochte sie weder sehen noch hören und versuchte, sie auszublenden.
»Ja, ja, aber du schuldest mir auch noch was«, fuhr Dagge unbeirrt fort. Das Gespräch wandte sich den Themen Schulden und anderen Ungerechtigkeiten zu, und plötzlich wusste jeder am Tisch etwas dazu beizutragen.
Jennifer bot Elise eine Zigarette an, nahm sich selbst eine und steckte sich die Zigarettenschachtel, die bislang noch niemand vermisste, in den Ausschnitt. Elise zündete sich die neue Zigarette an der alten an, die sie dann an Jennifer weiterreichte.
»Gehst du etwa noch aus?«, fragte Jennifer.
Elise trank ein halbes Glas des schalen Weißweins in einem Zug und verzog angeekelt das Gesicht.
»Ja, auf jeden Fall«, antwortete sie. »Ich bin mit Nina verabredet. Kannst du mir vielleicht Geld leihen?«
»Wo zum Teufel soll ich denn Geld herhaben? Frag doch einfach die Typen da. Heute scheinen sie ja flüssig zu sein.«
Sie wedelte mit einer Hand zum Tisch hinüber, schüttete den Rest des sauren Weins in sich hinein und machte Anstalten aufzubrechen. Elise spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Der Alkohol verbesserte ihre Laune. Machte sie mutig.
»Warte mal, Jennifer!«
»Ja?«
»Du, kann ich mir vielleicht deine Jacke ausleihen?«
»Welche verdammte Jacke?«
»Die Lederjacke. Von Gina Tricot.«
»Und was soll ich dann anziehen?«, nölte Jennifer.
»Du hast doch genug andere Sachen. Bitte. Nur für heute Abend.«
Vielleicht hatte sich Jennifer von der guten Stimmung anstecken lassen. Jedenfalls gab sie nach.
»Okay. Aber morgen brauch ich sie zurück.«
»Versprochen. Supernett von dir.«
»Sie hängt in der Diele. Ich mach mich jetzt vom Acker«, sagte Jennifer.
Elise blieb noch eine Weile auf dem Fußboden sitzen und rauchte weiter, bis sie sich an der Glut die Fingerspitzen verbrannte. Dann trank sie ihr Glas aus, ließ die Kippe hineinfallen und hörte, wie es zischte. Sie ging zum Tisch und spürte, wie sie leicht schwankte.
»Kann mir einer von euch ein paar Hunderter leihen?«, fragte sie forsch, aber niemand ging darauf ein.
»Was heißt schon leihen? Das Geld sieht man doch nie wieder«, jammerte ihre Mutter.
»Verdammt, so dick hab ich’s nun auch wieder nicht«, brummelte Gordon.
»Genau, und wenn ich so viel hätte, würde ich es bestimmt nicht dir geben!«, krakeelte Peo.
Monkan schüttelte lediglich den Kopf, und sie redeten weiter, als wäre nichts gewesen.
Elise zog sich in die Diele zurück und durchsuchte die Taschen aller Jacken, die dort aufgehängt waren, ohne etwas zu finden. Sie nahm die Lederjacke vom Haken und zog sie sich über. Nachdem sie sich flüchtig im Spiegel betrachtet hatte, trat sie ins Treppenhaus hinaus und schlug die Tür hinter sich zu. Es war halb elf.
*
»Was für ein verdammtes Mädchen?«
»Ein Mädchen eben.«
»Ein Mädchen? Sie wird doch wohl einen Namen haben, oder?«
»Sie heißt Jennifer. Das hab ich dir doch schon gesagt.«
»Genau der passende Name für eine richtige Schlampe.«
»Sie ist keine Schlampe. Sie ist ein hübsches Mädchen.«
»Hübsch! Dass ich nicht lache! So ein hässlicher Vogel wie du bekommt doch im Leben kein hübsches Mädchen ab. Sie nutzt dich aus, kapierst du das nicht?«
Vielleicht hatte sein Vater ja recht. Jocke sah nicht besonders gut aus, und Jennifer war süß wie ein Püppchen. Er hatte noch nie eine Freundin gehabt, aber jetzt hatte er eine, seine erste. Sie war zwar acht Jahre jünger als er, aber sie war ganz allein seine. Das war sie doch, oder? Anders konnte es gar nicht sein, denn schließlich hatten sie miteinander geschlafen, und sie hatte ihn gebeten, sie morgen auf einer Rundfahrt mit der Finnlandfähre zu begleiten. Und jetzt hatte sie angerufen und ihn gefragt, ob sie gleich zusammen ausgehen wollten.
»Und wenn schon. Man sollte sich einfach freuen, dass man jemanden hat. Ich gehe jetzt.«
»Nein, nein, junger Mann. Das wirst du nicht tun. Du wirst schön hierbleiben und dich um deine Mutter kümmern.«
Ein schadenfrohes Lachen zerschnitt das Gesicht seines Vaters in zwei groteske Hälften, und Jocke spürte, wie ihm langsam schlecht wurde.
»Mama kommt schon klar. Sie geht doch sowieso gleich schlafen«, bettelte er.
»Du bleibst zu Hause«, erwiderte der Vater knapp und zog an seiner Zigarette, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.
Er machte sich gar nicht die Mühe, den Rauch wieder auszublasen, er verschwand einfach in seinem Körper. Jocke spürte, wie sich seine Kehle zuschnürte und ihm Tränen in die Augen stiegen. Er wollte Jennifer treffen, musste sie treffen. Wenn sie sehen könnte, wie erbärmlich er hier vor seinem Vater flennte. Ein erwachsener Mann ohne eigenes Leben, der immer tat, was sein Vater ihm sagte. Ihr gegenüber spielte er den harten und abgeklärten Typen, soweit er dazu in der Lage war. Immerhin war er groß und bärtig und kaute und rauchte seinen Tabak. Das hatte ihm sein Vater zwar verboten, aber er bemerkte es nicht, da er selber Raucher war. Irgendwie hatte Jocke allerdings das Gefühl, dass er ihr etwas vormachte. Er war vierundzwanzig und sie sechzehn. Er versteckte sich hinter seinem Bart und einer Sonnenbrille, und sie hielt ihn für einen großen, starken Kerl, obwohl jeder auf den ersten Blick sehen konnte, was für eine Memme er war.
»Papa, bitte, du musst mich gehen lassen«, flehte er. »Ich habe mich schon den ganzen Tag um sie gekümmert. Heute ist doch Freitag, und …«
»Du tust, was ich sage. Geh zu Mama, ich will dich nicht mehr sehen.«
Jockes Unruhe ging langsam in Verzweiflung über. Er durfte so schnell nicht aufgeben – nicht dieses Mal.
»Das werde ich nicht tun«, krächzte er mit einer Stimme, die unter zurückgehaltenen Tränen zu brechen drohte. »Ganz bestimmt nicht. Ich werde ausgehen! Du kannst mir keine Vorschriften machen. Ich tue, was ich will! Ich bin erwachsen!«
»Ach, bist du plötzlich erwachsen geworden?«, fauchte sein Vater mit zusammengebissenen Zähnen, und erst in diesem Augenblick suchten sich die ersten dünnen Rauchfäden ihren Weg aus seinen Nasenlöchern. »Davon habe ich ja gar nichts bemerkt.«
Sein Vater hatte recht. Er war ein Versager. Nach ein paar sinnlosen Jahren hatte er die Schule mit katastrophalen Noten verlassen. Man hatte festgestellt, dass er große Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hatte, allerdings auch keinerlei praktische Begabung besaß. Die wenigen Jobs, die es gab, waren nicht für Leute wie ihn geschaffen, und an Schule war überhaupt nicht zu denken.
Aber sein Vater hatte einen Ausweg gefunden. Als es mit seiner Mutter so schlimm wurde, dass sie nicht mehr arbeiten konnte, hatte er Jocke als ihren persönlichen Pfleger angeheuert. Dafür bekam er Essen, ein Dach über dem Kopf und ein minimales Taschengeld. Deshalb trug er morgens zusätzlich noch Zeitungen aus. Von dem mühsam zusammengekratzten Geld wollte er sich irgendwann eine eigene Wohnung mieten. Er wollte ein eigenes Leben.
»Ich werde jetzt jedenfalls gehen, scheißegal, was du sagst«, schniefte Jocke und begann sich in Richtung Haustür zurückzuziehen. »Und morgen Abend fahre ich mit Jennifer nach Åbo«, fügte er hinzu und bereute sofort, das gesagt zu haben.
»Einen Scheiß wirst du tun!«, brüllte sein Vater, schnellte aus dem Sessel empor und kam mit riesigen Schritten und der Zigarette im Mundwinkel auf ihn zu.
Jocke lief durch die Diele und warf sich gegen die Wohnungstür, aber die Türkette war eingehakt, und während er verzweifelt versuchte, sie aus ihrer Schiene zu lösen, spürte er, wie sich der Arm seines Vaters von hinten um seinen Hals schloss. Er schraubte sich so fest um seine Kehle, dass er meinte, er müsse ersticken. Er versuchte den Ellenbogen in den Bauch seines Vaters zu rammen, aber dessen Griff wurde immer fester. Ohne dass er Widerstand hätte leisten können, drehte sein Vater ihn zu sich herum, was von einem unangenehmen Geräusch, einem Knacken in seinem Nacken, begleitet wurde. Während er noch nach Luft rang, rammte sein Vater ihm die Faust in den Bauch, und er brach auf der Fußmatte zusammen. Nach einem weiteren Tritt in den Bauch und einem gegen Mund und Nase beruhigte sich die Lage, und er blieb halb bewusstlos auf dem Fußboden der dunklen Diele liegen. Er nahm kaum wahr, wie sein Vater zu seinem Sessel ins Wohnzimmer zurückschlurfte und ungerührt in der Abendzeitung zu blättern begann.
Er stellte sich Jennifer und ihre runden Formen in der engen Jeans vor, ihre weichen, glänzenden Lippen und ihre fröhlichen, graublauen Augen, die jederzeit und ganz unerwartet einen in sich gekehrten, fast scheuen Ausdruck annehmen konnten. Morgen würde er mit ihr im Ballsaal der Finnlandfähre tanzen und sie zu farbenfrohen Drinks an der Bar einladen. Sie würden miteinander schlafen, und er würde die weiche Haut mit dem blonden Flaum spüren, die zwischen Hosenbund und Hemdchen hervorschaute, und er würde die warmen, schimmernden Lippen küssen dürfen.
Er musste eingeschlafen sein, denn als er die Augen wieder aufschlug, war das Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet. Vorsichtig bewegte er Arme und Beine, und nachdem er festgestellt hatte, dass nichts gebrochen war, stemmte er sich hoch und richtete sich, gegen die Wohnungstür gestützt, auf. Sein Zwerchfell schmerzte, und er vermied es, seine pochende Nase zu betasten, während er sich so leise wie möglich zum Badezimmer schleppte. Er schloss die Tür hinter sich ab, bevor er den Lichtschalter betätigte und sich im Spiegel betrachtete. Das halbe Gesicht war von geronnenem Blut bedeckt, die Oberlippe geschwollen und aufgeplatzt. Als er vorsichtig die Nase abtastete, gab sie in der Gegend der Nasenwurzel ein unschönes Knirschen von sich. Er feuchtete ein Stückchen Toilettenpapier mit kaltem Wasser an und tupfte die Nase und die geplatzte Lippe ab. Anschließend wusch er sich vorsichtig die unverletzten Teile des Gesichts und putzte sich die Zähne.
Zahnbürste und Zahnpasta steckte er in seine Sporttasche, die er aus der Garderobe herauskramte. Er stopfte seine Sportklamotten in eine der Rollkisten in der Garderobe und ersetzte sie durch eine Handvoll saubere Unterhosen, einen Pullover und eine Jeans. Anschließend schlich er sich in die Diele hinaus und zog sich im Dunkeln die Turnschuhe an.
Schließlich tat er etwas, was er bis dahin niemals gewagt hatte. Er steckte seine Hand tief in die Innentasche des Mantels seines Vaters, zog die Brieftasche heraus und zählte das Geld. Dreitausend Kronen. Er nahm sich eintausendfünfhundert, steckte die Brieftasche zurück, legte seine Jacke über den Arm, hängte die Tasche über die Schulter und schlich ins Treppenhaus hinaus. Er warf einen Blick auf die Uhr und stellte fest, dass es gerade erst halb elf war.
*
Conny Sjöberg putzte, und Åsa packte. Die Familie – fünf Kinder zwischen zwei und neun Jahren, Åsa und er selbst – hatte den Freitagabend bei seiner Mutter verbracht. Sie wohnte eine halbe Stunde südlich der Stadt in Bollmora. Sie waren viel zu spät wieder nach Hause gekommen, und nachdem sie endlich alle Kinder ins Bett gebracht hatten, musste Åsa noch saubere Kleidung und Spielzeug für den kommenden Tag zusammensuchen. Sie wollte mit den Kindern den Zug nach Linköping nehmen und für ein paar Tage ihre Eltern besuchen. Simon und Sara hatten am Montag schulfrei, und Åsa musste nicht unterrichten, sodass sie bis Montagabend bleiben konnten.
Sjöberg öffnete die Spülmaschine, zog die Körbe heraus und drehte die Becher um, damit das Wasser ablaufen konnte, das sich beim morgendlichen Spülgang auf ihrer Unterseite angesammelt hatte. Anschließend ging er durch alle Räume ihrer Fünfzimmerwohnung und überprüfte mit seinem beinahe pedantischen Blick, dass alles auf seinem Platz lag. Erst wenn alles seine Ordnung hatte, konnte er entspannen und das Zuhausesein genießen.
Auf der Arbeit war es genauso. Er konnte sich unmöglich auf seine Aufgaben konzentrieren, wenn Papiere und Ordner auf seinem Schreibtisch lagen. Die Ordner gehörten fein säuberlich aufgestellt in die Regale hinter dem Schreibtisch, die Papiere auf ordentliche Stapel, und das Büromaterial – Stifteköcher, Locher und dergleichen – musste in ausreichendem Abstand von der Arbeitsfläche in Reih und Glied aufgestellt sein. So entstand eine harmonische Arbeitsumgebung ohne unnötige Irritationsmomente.
Als er fertig war, setzte er Wasser auf und bereitete ein paar Butterbrote mit den übrig gebliebenen Frikadellen vom gestrigen Abendessen zu. Er zündete die Kerzen auf dem Küchentisch an, goss das kochende Wasser über die Teeblätter und stellte die Teekanne auf den Tisch.
»Puuh, sie ist aber auch unzufrieden und miesepetrig«, sagte Åsa, als sie hereinkam und sich setzte.
»Ja, da hast du wohl recht«, seufzte Sjöberg.
»Und trotzdem so aufmerksam und nett gegenüber den Kindern. Und auch uns gegenüber. Warum ist sie bloß so verdammt negativ?«
»Da steckt wohl Unsicherheit dahinter. Sie ist einfach schüchtern. Zu wenig Selbstvertrauen. Weiß nicht so recht, wie sie sich verhalten soll, und hat das Gefühl, immer alles verkehrt zu machen. Ein Herkunfts- und Bildungskomplex.«
»Das Essen war nicht gelungen, der Pullover, den sie gestrickt hat, hässlich geraten, und der Kaffee war zu stark. Die ganze Zeit kritisiert sie nur sich selbst – niemals uns, was an und für sich ja okay wäre – aber das Essen schmeckt irgendwann wirklich nicht mehr, wenn sie einen ständig darauf hinweist, was damit nicht stimmt, während man davorsitzt und isst. Nein, es kann einem wirklich leidtun, dass sie niemals richtig zufrieden mit etwas ist.«
Sjöberg servierte den Tee und schüttete einen gehäuften Teelöffel Zucker in seine Tasse.
»Immerhin ist sie glücklich, wenn Schweden gewinnt«, bemerkte er mit einem schiefen Lächeln.
»Ach, das ist doch keine wirkliche Freude. Es geht ja nur um Sport. Woher stammt denn dieses Sportinteresse? Ältere Damen haben sich nicht für Sport zu begeistern, ihre größte Sorge ist es doch, nicht dem Mainstream hinterherzulaufen.«
»Papa war anscheinend sehr sportbegeistert, es stammt wohl noch aus dieser Zeit. Sie liest ja auch keine Bücher. Da ist es doch ganz gut, wenn sie sich für irgendetwas interessiert.«
»Nein, so habe ich es ja auch nicht gemeint«, sagte Åsa und biss in ihr Butterbrot. »Ist doch toll, dass sie sich für Eishockey und Fußball und Leichtathletik und Skifahren und all so was interessiert. Aber du wirst doch zugeben, dass es ein bisschen seltsam ist. Es passt irgendwie nicht ins Bild … Wie war sie denn, als dein Vater noch gelebt hat?«
»Daran kann ich mich nicht erinnern.«
Sjöberg spülte den Rest seines Butterbrots mit ein paar Schlucken heißen Tees hinunter.
»Ich weiß nur noch, dass sie sehr ernst war, während mein Vater im Krankenhaus lag. Es wurde nicht viel darüber geredet, und ich durfte ihn nie besuchen. Ich war ja noch schrecklich jung. Drei vielleicht.«
»Das ist auch so eine merkwürdige Sache in deiner Familie. Du glaubst, dass er Krebs hatte. Wie kann es denn sein, dass du es nicht weißt?«
»Aber Åsa, du weißt doch, wie sie ist! Sie erinnert sich an nichts, oder zumindest möchte sie nicht darüber reden.«
»Oder einfach mal zu erfahren, wie du als Kind so warst. Warst du ein Lausejunge, hast du nachts gut geschlafen, hattest du einen Schnuller, oder hast du am Daumen gelutscht, wann hast du laufen gelernt und solche Dinge. Es ist unmöglich, ihr so etwas aus der Nase zu ziehen. Und du scheinst dich ja auch an so gut wie gar nichts zu erinnern«, fügte sie mit einem neckischen Lächeln hinzu.
»Ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen und du in einer Akademikerfamilie«, antwortete Sjöberg. »Alles, was ich kann, habe ich mir selbst beigebracht. Mein erstes Buch habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Du hast einfach nur den Mund aufgerissen, und sie haben dir Bildung und Wissen eingeflößt.«
»Ach, du armes, kleines Mauerblümchen«, entgegnete Åsa mit gespieltem Mitgefühl und streichelte ihm über die Wange. »Jedenfalls liebe ich dich über alles in der Welt.«
Sjöberg ergriff die Hand seiner Frau und küsste sie. Ein kurzes Jammern ertönte aus dem Schlafzimmer der Zwillinge und ließ beide für einen Augenblick erstarren. Als die Gefahr beinahe gebannt schien, begann das Geschrei, und Åsa lief auf Zehenspitzen hinüber, um nicht noch mehr Lärm zu machen.
In diesem Moment klingelte das Telefon.
»Wer hat angerufen?«, fragte Åsa, als sie nach einer Weile in die Küche zurückkam. »Musst du arbeiten?«
»Nein, es war Mama«, seufzte Sjöberg. »Sie ist von einem Hocker gefallen und hat sich vermutlich ein paar Rippen gebrochen. Ich muss hinfahren und sehen, wie es ihr geht. Wenn sie sich wirklich etwas gebrochen hat, werde ich sie wohl in die Notaufnahme bringen müssen.«
»Irgendwas ist immer. Aber es wird hoffentlich nichts Schlimmes sein, oder?«
»Nein, abgesehen davon geht es ihr gut. Sie war schon ins Bett gegangen, aber offensichtlich hatte sie immer noch Schmerzen. Tut mir leid, dass ich noch mal los muss.«
»A man’s got to do what a man’s got to do. Ich werde jedenfalls ins Bett gehen«, sagte Åsa. »Küss mich, wenn du wiederkommst.«
»Jetzt ist es schon halb elf. Es wird bestimmt spät werden.«
»Macht nichts, hoffentlich sehen wir uns morgen früh noch ein Weilchen.«
»Ich werde auf jeden Fall mit euch aufstehen«, sagte Sjöberg. »Ich kann ja tagsüber noch ein Stündchen schlafen, wenn es nötig ist.«
Er küsste sie auf die Stirn, schnappte sich seine Jacke und die Autoschlüssel und verschwand im dunklen Treppenhaus.
*
Der Pelikan war jeden Freitag rappelvoll und laut, aber an diesem Abend war die traditionsreiche Schankwirtschaft in der Blekingegatan noch voller als sonst – falls das überhaupt möglich war. Schwer zu sagen, ob es daran lag, dass der Monat zu Ende ging, oder ob der hartnäckige Regen vor dem riesigen, bunten Bleiglasfenster die Leute in die behagliche Wärme getrieben hatte. Die Gäste drängten sich um die Eichentische und vor der Theke. Jetzt war es halb zehn, und der Lautstärkepegel, den die Anwesenden erzeugten, war noch gestiegen. Die hohe Decke und der Fliesenboden warfen den Lärm zurück, sodass man manchmal besser verstehen konnte, was in einer ganz anderen Ecke des Lokals gesagt wurde, als die Worte des eigenen Tischnachbarn. Westman und Jamal Hamad brüllten sich über den Tisch und ihre leeren Biergläser hinweg an. Glücklicherweise hatten sie ein paar Stunden zuvor einen Tisch ergattern können, als ein älteres Paar nicht länger darauf warten wollte, endlich bedient zu werden. Petra und Jamal hatten es nicht eilig und ertrugen geduldig, wie das überforderte Personal an ihnen vorbeirannte, weil sie halb versteckt hinter einer großen Säule saßen, die mitten im Lokal emporragte.
Einer der Kellner tauchte dann doch vor ihrem Tisch auf, ein großer, hübscher Kerl um die fünfunddreißig, der seine dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Das Namensschild an seiner Brust verriet, dass er Firas hieß. Er brachte ihnen zwei große Bier, die sie ein paar Minuten zuvor bei einer Kellnerin bestellt hatten.
»Shukran«, sagte Jamal.
»Ahlan«, antwortete der Kellner und musterte ihn, wobei seine blaugrünen Augen neugierig funkelten. »Men wen hadrtak?«
»Lebnen. O anta?«
»Suria.«
»Anjar?«, fragte Jamal mit einem schiefen Lächeln.
Der Kellner schien einen Augenblick zu zögern, bevor er sich zu ihm hinunterbeugte und ihm ins Ohr zischelte:
»Ana rabian honek …«
Schließlich schmetterte er Jamal seine flache Hand auf den Rücken, was Petra als freundschaftliche Geste deutete, und eilte zur Theke zurück. Jamal schaute dem Kellner mit einem herzhaften Lachen hinterher, der sich noch einmal umdrehte und ihm zuzwinkerte, bevor er im Menschengewimmel verschwand. Petra betrachtete ihren Kollegen voller Verwunderung.
»Jetzt prickelt es im ganzen Körper«, sagte sie lachend und hob ihr Glas.
»Liegt das an mir oder an Firas?«, erwiderte Jamal mit einem Lächeln und stieß mit ihr an.
»An euch beiden. Oder vielmehr an der Sprache.«
»Soll das eine kleine A fish called Wanda-Warnung sein?«
»Genau. Du machst hier gerade ein bisschen den John Cleese. Worüber habt ihr euch unterhalten?«
»Über unsere Herkunft, könnte man vielleicht sagen.«
»Und dabei hattet ihr so viel Spaß?«
»Ganz offensichtlich. Und jetzt wechseln wir das Thema«, sagte Jamal und stieß erneut mit ihr an.
»Feminin«, grummelte Petra eine Weile später und schüttelte den Kopf. »Wie kommt er denn auf so was? Stöckel ich etwa auf hohen Absätzen herum, oder was?«
»Ja, tust du das etwa nicht?«
Jamal zwinkerte ihr zu und grinste zufrieden.
»Was ist denn daran so verkehrt, feminin zu sein? Wärst du glücklicher gewesen, wenn er gesagt hätte, dass du maskulin rüberkommst? Wie so ein o-beiniger Fußballer? Nein, ich glaube, es macht ihn an, wie du dein Fahrgestell schwingst, Petra. Dein Hinterteil«, präzisierte er, wobei er das I mit übertrieben gedehnten Lippen aussprach, um zu betonen, wie lächerlich er diesen Ausdruck fand.
Petra konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. Sie trank einen großen Schluck aus ihrem Glas und wischte sich mit dem Zeigefinger den Schaum von den Lippen.
»Ist es etwa besser, wenn man wie du seinen Schwerpunkt zwischen den Schultern trägt?«, schnaubte sie. »Ich kann das nur dahingehend deuten, dass du balzt. Dass du dich aufplusterst wie ein Pfau, um die Weibchen anzulocken.«
»Und es funktioniert, wie du siehst! Hier sitze ich nun mit Stockholms hübschester Polizistin …«
Jamal legte die Hände hinter den Kopf und betrachtete sie mit einem neckischen Blick. Petra gefiel, was er gesagt hatte. Das Problem war nur, dass sie nicht wusste, ob er es ernst meinte oder ob er sie aufziehen wollte. Obwohl sie ihn schon so lange kannte, konnte sie ihn nicht genau einschätzen.
Seine Anspielungen bezogen sich auf das Seminar, an dem sie und zwanzig weitere Polizisten von der Wache in Hammarby heute teilgenommen hatten. Es war eine Veranstaltung zum Thema »Körpersprache« und beschäftigte sich damit, wie man seine Wirkung auf andere verändern kann, wenn man an seiner Körperhaltung arbeitet. Dabei war es nicht das Ziel, ein anderer Mensch zu werden, sondern an den eigenen Möglichkeiten zu arbeiten.
Unter anderem sollte jeder von ihnen eine Runde unter den kritischen und amüsierten Blicken der anderen Teilnehmer gehen, woraufhin die Position des jeweiligen Körperschwerpunkts ausgiebig analysiert wurde. Wenn man – wie beispielsweise bei der Festnahme eines Straftäters – Autorität ausstrahlen wollte, musste der Schwerpunkt an der richtigen Stelle sitzen, nicht in der Wampe (Jens Sandén) oder in den Füßen, wie es in Petras Augen bei Einar Eriksson der Fall war. Das Seminar hatte im Großen und Ganzen eine unterhaltsame Unterbrechung des alltäglichen Einerleis dargestellt, und vermutlich hatten sie den einen oder anderen brauchbaren Tipp mitnehmen können.
»Im Übrigen plustern Vögel sich auf, wenn sie frieren, und nicht aus irgendeinem anderen Grund«, fuhr Jamal fort.
Seine braunen Augen glitzerten im Licht der Kerze, die zwischen ihnen auf dem Tisch stand. Als er sie anlächelte, strahlten seine Zähne blendend weiß im Kontrast zu der sommerlichen Bräune, die sich bis jetzt in seinem Gesicht gehalten hatte.
»Ach, mein Kleiner, komm, lass dich von mir wärmen.«
Petra streckte ihm mit gespielt mitleidiger Miene die Hände über dem Tisch entgegen und ergriff seine Hand. Sie war weich und warm.
»Ich wusste gar nicht, dass du so viel Ahnung von Vögeln hast«, fuhr sie fort.
»Tja, ich bin eben immer für eine Überraschung gut.«
»Dann kannst du mir vielleicht erzählen, zu welcher Art Vogel unser Polizeidirektor gehört? Er kann sich so gekonnt spreizen.«
»Brandt? Ich dachte, du findest ihn sexy«, antwortete Jamal mit einem spöttischen Lächeln.
Petra ließ seine Hand auf die Tischplatte fallen.
»Hör auf«, sagte sie entnervt. »Die Worte wurden mir in den Mund gelegt. Von seinem Stellvertreter – wie hieß er doch gleich – Malmberg. Der hat mich da reingeritten. Was sollte ich denn sagen? Ich hatte nicht das geringste Interesse daran, den Gang des Polizeidirektors zu kommentieren. Malmberg hat ›sexy‹ vorgeschlagen, und ich habe gelächelt und genickt. Geniert.«
»›Vielleicht‹, hast du gesagt«, erwiderte Jamal lachend.
»Ja, vielleicht. Was zum Teufel sollte ich denn sagen? ›Nein, überhaupt nicht, eher unsexy‹?«
»Du hast gesagt, dass der Polizeidirektor sexy sei.«
»Malmberg hat das gesagt.«
»Ich glaube eher, dass es Holgersson war.«
»Ja, vielleicht. Der ist ja auch ein seltsamer Typ.«
»Wirklich? Ich finde ihn witzig«, grinste Jamal. »Anscheinend liest er in dir wie in einem offenen Buch. Er konnte deine Gefühle für den Polizeidirektor förmlich riechen.«
Petra seufzte hörbar und leerte ihr Glas.
»Was, glaubst du, könnte Brandt denn mit ›feminin‹ gemeint haben?«, fragte sie dann mit einer angedeuteten Sorgenfalte zwischen den Augenbrauen.
»Ich glaube, er meinte …«
Jamal schaute sie mit ernster Miene an, bevor er fortfuhr.
»… sexy«, beendete er den Satz und brach in lautes Lachen aus.
Petra hob resigniert die Arme und schüttelte den Kopf.
»Ich gebe noch eine Runde aus«, sagte Jamal und stand auf.
Petra schaute ihm nach, während er sich mit den beiden leeren Biergläsern einen Weg zur Theke bahnte. Er machte über alles Witze, während sie Schwierigkeiten hatte, irgendetwas Komisches an dieser Situation zu erkennen.
Nachdem sie ansehnliche Mengen Bier konsumiert hatten, verabschiedeten sie sich eine gute Stunde später vor dem Eingang zur U-Bahn-Station Allhelgonagatan voneinander. Petra schlug vor, noch ein wenig weiterzuziehen, aber Jamal meinte, dass er am nächsten Morgen früh aufstehen müsse und deswegen gerne zu Fuß nach Hause gehen wolle, um ein wenig nüchterner zu werden. Als sie nach seinen Plänen für den kommenden Tag fragte, sagte er, dass er nach Nacka zum Golfspielen wolle.
»Golf?«, fragte Petra. »Kannst du etwa Golf spielen?«
Aber in ihrem Kopf schwirrte eine ganz andere Frage herum: Nacka? Dann hast du wohl doch eine Sache mit Bella Hansson laufen?
»Tja, das weiß ich noch nicht«, sagte Jamal lächelnd. »Ich habe es noch nie versucht.«
Nach einer kurzen Umarmung und einem Kuss auf die Wange eilte Petra die Treppe hinunter. Ihr Schwerpunkt schien dabei irgendwo im Unterleib zu liegen.
*
Trotz der späten Stunde waren immer noch viele Autos unterwegs und machten Lärm, bespritzten Fußgänger und Radfahrer mit schmutzigem Wasser und sättigten die kühle Luft mit stinkenden Abgasen. Nina stand schon vor dem Zeitungskiosk am Einkaufszentrum Ringen an der Götgatan, als Elise auftauchte.
»Mensch, siehst du schick aus!«, sagte Nina.
Das bunte Licht der Neonreklame spiegelte sich in der Sonnenbrille, die sie in die Haare gesteckt hatte.
»Wo hast du die Jacke gekauft?«
»Ach, das ist gar nicht meine«, antwortete Elise. »Ich habe sie von meiner Schwester geliehen.«
»Bist du besoffen?«
Elise musste lachen.
»Mama hat mir was abgegeben. Und du?«
»Noch nicht«, antwortete Nina. »Aber wir gehen doch rüber ins Krokodil, oder?«
»Ich hab kein Geld. Kannst du mir was leihen?«
»Du, guck mal, der Typ dahinten.«
Nina flüsterte, obwohl der Mann, den sie durch das Fenster des Zeitungsladens hindurch beobachteten, sie unmöglich hören konnte.
»Verdammt, sieht der hässlich aus! Das ist so ein Pädophiler, ein richtiger Schweinigel«, fuhr Nina fort.
Der Mann blätterte in einer Zeitschrift und hatte ihnen den Rücken zugewandt, sodass Elise sein Gesicht nicht sehen konnte. Aber zumindest trug er keinen verdächtigen Hut oder hatte sich den Mantelkragen hochgeklappt, um sich vor ihren Blicken zu schützen.
»Woher willst du das wissen?«, fragte Elise. »War er etwa hinter dir her …?«
»Nein, wo denkst du hin!? Ich hab es von anderen gehört. Er ist scharf auf kleine Mädchen und kann seine Finger einfach nicht von ihnen lassen. Gehen wir?«
»Aber ich hab kein Geld. Du wirst mir doch wenigstens einen Hunni leihen können, oder?«, bettelte Elise.
»Was ich habe, reicht ja kaum für mich selbst. Sofia und Magda sind schon im Krokodil, und ich geh jetzt auch hin. Du kannst ja nach Hause gehen und Geld besorgen, dann treffen wir uns dort wieder.«
Vollkommen unbeschwert machte sich Nina auf den Weg und ließ eine ratlose Elise zurück. Nach einer Weile drehte Nina sich um, winkte und rief mit einem fröhlichen Lächeln:
»Beeil dich!«
Elise schaute erneut durch das Fenster des Zeitschriftenladens, und ihre Augen blieben an dem Typen hängen, den Nina als Pädophilen bezeichnet hatte. Er stand immer noch an derselben Stelle und las seelenruhig in den Zeitschriften, aber es waren ziemlich viele Leute in dem Laden, und der Verkäufer hatte wahrscheinlich keine Zeit, ihn zurechtzuweisen.
Elise musste an eine Fernsehsendung denken, die sie vor einer Weile gesehen hatte. Eine Reportage über ein paar Mädchen in Malmö, die aus den verschiedensten Gründen auf den Strich gingen. Ihre Gesichter waren unkenntlich gemacht und ihre Stimmen verzerrt worden. Elise dachte, dass ihre Freundinnen sie trotzdem wiedererkennen würden. Eine von ihnen erzählte, dass sie auf ein eigenes Pferd sparte. Sie war dreizehn Jahre alt.
Nachdem sie eine Weile überlegt hatte, ging Elise in den Laden. Sie musterte das Angebot an Süßigkeiten und Eis, Sandwiches und Limonade. Dann nahm sie allen Mut zusammen und schlich sich von hinten an die Seite des Mannes, um zu sehen, was er las. Tatsächlich, er schaute sich nackte Mädchen an. Hastig schaute sie sich um. Keiner der anderen Kunden befand sich in Hörweite, wenn sie leise genug sprach.
»Willst du so was in echt sehen?«, fragte sie, ohne den Mann neben sich anzusehen.
Er drehte sich um und stellte fest, dass sie tatsächlich mit ihm gesprochen hatte, dann wandte er sich wieder der Zeitschrift zu.
»Was genau?«, fragte er bedächtig, ohne von der Zeitschrift aufzuschauen.
»Ein nacktes Mädchen.«
»Und was willst du dafür haben?«, fragte er ungerührt.
Er hatte es also vorher schon gemacht. Nina hatte recht.
»Hundert für die Möpse. Dreihundert die Muschi«, antwortete Elise mit gespielter Routine.
»Und wenn ich mehr will …?«
»Mehr gibt’s nicht«, sagte Elise.
Er legte die Zeitschrift zurück in die Auslage, schaute ihr aber immer noch nicht ins Gesicht.
»Du kriegst zweihundert«, sagte er und ging zum Ausgang.
Sie folgte ihm mit hämmerndem Herzen. Es war spannend und ein bisschen eklig. Wie der Anfang von etwas ganz Neuem und Gefährlichem.
Die Nacht von Freitag auf Samstag
Seine Mutter lag auf dem Bett, als er kam. Sie beklagte sich nicht über die Schmerzen, sondern begnügte sich mit der sachlichen Feststellung, dass sie sich vermutlich eine Rippe gebrochen habe, da sie ein ungutes Gefühl in der Brust habe. Sjöberg fragte sie, ob er einen Krankenwagen rufen solle, aber sie wollte kein großes Theater machen, zumal die Rettungssanitäter bestimmt Wichtigeres zu tun hätten, und überhaupt, was sollten die Nachbarn denken? Er half ihr vorsichtig auf die Beine, legte ihr den Mantel über die Schultern und führte sie zum Auto hinaus. Anschließend kehrte er noch einmal in die Wohnung zurück und packte eine Tasche mit Unterwäsche und Toilettenartikeln. Im letzten Augenblick fiel ihm auch noch ein, ihre Handtasche mitzunehmen, bevor er das Licht ausschaltete und die Tür hinter sich abschloss.
Auf der Fahrt zum Krankenhaus erzählte seine Mutter, dass sie auf einen Hocker geklettert sei, um ein Tablett in den Wandschrank zurückzustellen, nachdem er und Åsa sie am Abend verlassen hatten. Sie habe das Gleichgewicht verloren und sei auf dem Fußboden gelandet.
»Und jetzt falle ich euch zur Last. Du kommst nicht zu deinem Schlaf, und die arme Åsa muss sich ganz allein um die Kinder kümmern.«
Sie schüttelte den Kopf und schaute aus dem Seitenfenster.
»Mama, die Kinder schlafen und Åsa auch«, versuchte Sjöberg sie aufzumuntern. »Und mir macht es auch nichts aus, weil ich morgen frei habe. Aber um dich mache ich mir Sorgen. Du hättest doch mich darum bitten können, dieses Tablett in den Schrank zurückzulegen. In deinem Alter solltest du solche Sachen nicht mehr machen, Mama.«
»Ich weiß. Man merkt gar nicht, wie die Jahre vergehen.«
»Wie geht es dir? Sitzt du bequem?«
»Wenn ich mich nicht bewege, ist es gar nicht so schlimm.«
Sie schwiegen eine Weile, und Sjöberg dachte an das, was Åsa vorhin gesagt hatte. Seine Mutter war eine ziemlich seltsame Natur, dem konnte er nur zustimmen. Er merkte es nur nicht mehr. Mittlerweile war sie vierundsiebzig Jahre alt und er selbst neunundvierzig. Sie war mehr als die Hälfte ihres Lebens Witwe gewesen. Wie ist sie eigentlich damit klargekommen? Wie hatte sie sich gefühlt, als sie allein mit ihm zurückblieb? Über Gefühle hatten sie zu Hause nie gesprochen. Man lebte sein Leben und fand es weder gut noch schlecht. Es kam eben, wie es kam.
»Wie ist Papa gestorben?«, musste er plötzlich fragen.
Seine Mutter zögerte einen Augenblick.
»Er ist krank geworden«, antwortete sie schließlich.
»Aber was war es für eine Krankheit?«
Als sie nicht unmittelbar darauf antwortete, hakte er nach:
»Hatte er Krebs, oder …?«
»Ich habe nie so genau nachgefragt«, antwortete sie mit einer gewissen Schärfe in der Stimme. »Man versteht ja sowieso nie, was diese Ärzte eigentlich sagen.«
Sjöberg seufzte. So verliefen ihre Gespräche. Schon immer. Die Welt ist so groß und unbegreiflich. Man selbst ist so klein und unwichtig, und was hat es schon für einen Sinn, sich zu engagieren, sich hervorzutun, zu nehmen, was einem zusteht, und einen Platz für sich einzufordern? Am besten ist es, möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, seine Stärken und Schwächen zu verbergen und sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern.
Sie mussten einige Stunden im Wartezimmer der Notaufnahme verbringen. Sjöberg hatte sich lediglich für ein paar Minuten entfernt und zwei Tassen dünnen Kaffee aus einem Automaten gezogen, ansonsten saßen sie da und blätterten in alten Zeitschriften. Sie wechselten nur wenige Worte, denn man unterhielt sich nicht, wenn man unter Leuten war, aber jedes Mal, wenn ein neuer Patient auftauchte, schauten sie beide neugierig für ein paar Sekunden auf. Seine Mutter lehnte es kategorisch ab, sich im Wartezimmer hinzulegen, und blieb geduldig auf ihrem Stuhl sitzen, bis sie gegen halb zwei aufgerufen wurde.
Die Ärztin bestätigte, dass wirklich ein paar Rippen gebrochen waren, und seine Mutter wurde im Rollstuhl zu einer Station gefahren, in der sie, zumindest über Nacht, zum Röntgen und zur Beobachtung bleiben sollte. Sjöberg deckte sie gut zu und versprach, sich am nächsten Tag bei ihr zu melden. Als er sie am Samstagmorgen gegen halb drei schließlich verließ, war sie bereits eingeschlafen.
Sjöberg musste ausgiebig gähnen, als er in den Krankenhausflur hinaustrat. Er schaute sich nach irgendwelchen Hinweisen um, die ihm verraten würden, in welche Richtung er gehen musste, um das riesige Krankenhaus zu verlassen. Weiter hinten im Flur konnte er ein paar Hinweistafeln ausmachen, und er lenkte seine Schritte dorthin. Zwei Krankenschwestern kamen ihm entgegen, die er nach dem Weg fragen wollte. Aber dann brachte er vor lauter Überraschung kein Wort mehr heraus.
Eine der Krankenschwestern war ihm nur allzu gut bekannt, ihr roter Haarschopf und ihre lebendigen, grünen Augen. Sie war die Frau im Fenster, die Frau, die ihn seit vielen Monaten jede Nacht plagte. In seinen Träumen waren ihre Gesichtszüge allmählich immer verschwommener geworden, weil es mittlerweile fast ein Jahr her war, dass er sie zuletzt gesehen hatte – Margit Olofsson. Aber ihre Haare waren immer dieselben geblieben, und jetzt stand er hier und stotterte und wusste nicht, wohin mit sich. Das ist doch einfach nur lächerlich, konnte er gerade noch denken, die Frau wusste schließlich nichts von seinen absurden Träumen. Im vergangenen Jahr waren sie einander zwei, drei Mal im Laufe einer Mordermittlung begegnet und hatten nicht viele Worte miteinander gewechselt. Was war bloß mit ihm los? Ihre neutrale Miene machte einem Ausdruck des Wiedererkennens Platz, und sie lächelte bereits breit, als er endlich einen unbeholfenen Gruß über die Lippen brachte.
»Hallo«, murmelte er schließlich unsicher. »Margit Olofsson …«
»Der Kommissar! Sich nach so langer Zeit noch an meinen Namen erinnern zu können, Hut ab! Da muss ich ja eine der Hauptverdächtigen gewesen sein!«, scherzte sie.
Die andere Krankenschwester ging weiter den Flur hinunter und ließ die beiden allein. Sjöberg wusste nichts zu erwidern, doch Margit Olofsson sagte:
»Was machst du hier? Dem nächsten Mörder auf der Spur?«
»Nein, meine Mutter hat sich ein paar Rippen gebrochen, und ich musste sie hierherbringen. Wir sitzen seit elf Uhr in der Notaufnahme, und jetzt bleibt sie über Nacht zur Beobachtung hier. Arbeitest du nachts?«
»Ja, manchmal. Aber heute Nacht war es zum Glück ziemlich ruhig.«
Sjöberg wusste nicht, was ihn auf die Idee gebracht hatte, aber ehe er noch darüber nachdenken konnte, hörte er sich selbst sagen:
»Darf ich dich zu einem Kaffee einladen?«
Um dieser – seinem Empfinden zufolge – sozialen Tölpelei, die für Margit Olofsson vermutlich nicht die geringste Bedeutung hatte, ein wenig die Spitze zu nehmen, fügte er hinzu:
»Also, ich habe das Gefühl, dass ich gerade dringend einen Kaffee brauche, damit ich nicht hinter dem Steuer einschlafe.«
»Warum nicht?«, antwortete Margit Olofsson. »Ich muss nur kurz Bescheid sagen, dass ich eine Pause mache. Warte hier auf mich, dann werde ich dich durch das Labyrinth von Huddinge lotsen.«
»Und wie geht es ihr jetzt?«, fragte Margit Olofsson, als sie sich mit zwei Tassen Kaffee in der Krankenhauscafeteria gegenübersaßen.
»Eigentlich ganz gut. Sie wollen sie noch röntgen, um sicherzugehen, dass ihre Lunge nicht punktiert ist oder so etwas. Vielleicht kann sie morgen schon wieder nach Hause.«
»Ich werde sie für dich im Auge behalten. Wie heißt sie denn? Sjöberg?«
»Ja, Eivor. Und wie geht es dir? Und – wie hieß sie noch gleich – Ingrid?«
»Zu Ingrid Olsson habe ich keinen Kontakt mehr, eigentlich nie gehabt. Es waren ja nur die paar Wochen, die sich zufällig so ergeben haben.«
»Die barmherzige Samariterin …«, sagte Sjöberg.
»Ja, ja«, erwiderte Margit Olofsson abwehrend. »Mir geht es jedenfalls gut. Zwei mittlerweile glücklich ausgeflogene Kinder. Ein Mann in der Malerbranche und ich selbst …«
»Ist er denn nicht glücklich?«, unterbrach Sjöberg sie.
»… schufte hier jetzt schon in meinem dreißigsten Jahr.«
Sie hatte den Satz ganz automatisch beendet, aber jetzt betrachtete sie Sjöberg fragend. Er spürte, wie er rot wurde, und hoffte, dass es nicht zu sehen war. Warum stellte er solche Fragen? Was war bloß in ihn gefahren? Saß er hier etwa und flirtete mit Margit Olofsson, einer vollkommen unbedeutenden Person? Offensichtlich war es höchste Zeit, nach Hause zu fahren.
»Tja, auf seine Weise ist er wohl glücklich. So wie ich auf meine«, antwortete sie kryptisch und mit einem leichten, fast unmerklichen Lächeln. »Und du?«
Während der Sekunden, die Sjöberg brauchte, um sich eine Antwort zu überlegen, wurde er von einer fast unwiderstehlichen Sehnsucht gepackt, ihr von seinem seltsamen Traum zu erzählen. Sie weckte wundersame Gefühle in ihm, die er nicht in Worte zu fassen wusste. Es war keine Liebe, jedenfalls nicht die Art von Liebe, wie er sie für Åsa oder die Kinder empfand. Auch nicht Seelenverwandtschaft, denn was hatten sie schon für Gemeinsamkeiten? Gar keine vermutlich, jedenfalls keine, die er hinter der Fassade dieses Menschen, wie er ihn bislang erlebt hatte, meinte erahnen zu können. War es Begierde? Absolut nicht. Margit Olofsson – die weiß Gott nicht schlecht aussah und auch ihren Charme hatte – besaß nicht viel von dem, was er normalerweise an Frauen als attraktiv empfand.
Und trotzdem wurde er von ihr angezogen. Irgendetwas an dieser Frau brachte ihn dazu, dass er am liebsten auf ihren Schoß kriechen und sich bei ihr ausweinen wollte. Dass er ihr sein Herz ausschütten und seine intimsten Gedanken anvertrauen wollte. War es vielleicht dieselbe mütterliche Ausstrahlung, die Ingrid Olsson seinerzeit dazu gebracht hatte, sie um Hilfe zu bitten? Er hielt es nicht für wahrscheinlich. Er hatte bereits mehr Liebe, Fürsorge und Freundschaft, als er brauchte. Margit Olofsson brachte seine Gefühle auf eine Weise in Aufruhr, wie er es in seinem Leben, das jetzt immerhin fast schon ein halbes Jahrhundert umfasste, noch nie erlebt hatte. Er musste sich davon befreien, sich besinnen.
»Tja, man kann nicht klagen«, antwortete er und merkte sofort, dass diese Worte nach seiner Mutter klangen.
Er wollte es nicht, und dennoch saßen sie eine halbe Stunde an diesem Ort und sprachen über sich selbst und die großen und kleinen Probleme ihres Lebens, bis Margit Olofssons Pause zu Ende war. Als sich Sjöberg schließlich in sein Auto setzte, glaubte er nicht, dass er allzu viel von sich preisgegeben hatte. Den Traum hatte er nicht erwähnt.
Samstagmorgen
Hanna lag lange, lange im Bett und wartete auf die vertrauten Geräusche. Obwohl die Rollos heruntergelassen waren, wurde es langsam hell im Zimmer. Sie fühlte sich überhaupt nicht müde, hatte aber trotzdem versucht, wieder einzuschlafen. Mama hatte gesagt, dass sie liegen bleiben und versuchen sollte, wieder einzuschlafen, wenn sie aufwachen würde und sonst noch niemand aufgestanden war. Jetzt hatte sie es so lange wie möglich versucht, aber länger schaffte sie es nicht. Sie beschloss, trotzdem aufzustehen und ein bisschen zu spielen, ohne die Tür aufzumachen. Sie krabbelte aus dem Bett und holte ein Puzzle aus dem Regal. Sie hatte sich die grüne Kiste mit dem Teddybärpuzzle ausgesucht und schüttete die Teile auf ihren kleinen Tisch. Der Tisch war rot mit grünen Stühlen. Papa und Hanna hatten die Möbel gemeinsam angestrichen, die blauen Blüten auf den Sitzflächen hatte Mama mit einem viel kleineren Pinsel gemalt.
Nachdem sie das Teddybärenpuzzle zusammengesetzt hatte, kochte sie ein bisschen Spielessen in ihrer Spielzeugküche. Im Ofen fand sie den batteriebetriebenen Mixer und schlug ein bisschen Sahne für Magdalena, die braunäugige Puppe mit den langen, dunklen, glatten Haaren und dem rosa Kleid. Der Mixer brummte gewaltig, und plötzlich fiel ihr ein, dass sie die anderen mit dem Lärm wecken könnte. Sofort schaltete sie ihn aus und lauschte aufmerksam an der Tür. Aber in der Wohnung war es immer noch genauso still wie vorher.
Die Windel war schwer nach der langen Nacht und hing unbequem unter ihrem rot-weiß gestreiften Nachthemd. In ihrem Bauch begann es zu knurren, obwohl sie das Frühstück eigentlich gar nicht so sehr mochte. Wie konnte sie Mama wecken, ohne dafür ausgeschimpft zu werden? Sie könnte vielleicht schreien, als ob sie einen schrecklichen Alptraum gehabt hätte …
»Mama! Mama!«, rief sie. »Mama, komm! Hilfe!«