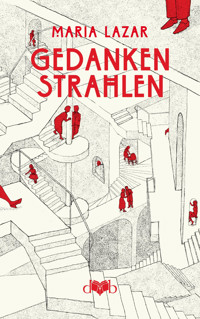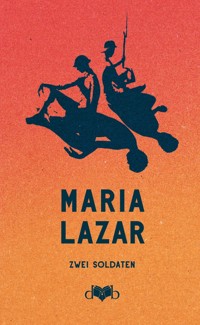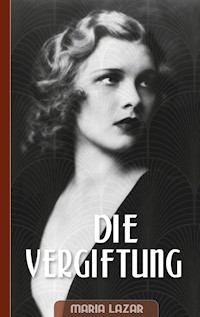13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVB Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Viermal ICH" dreht sich um vier Freundinnen, die so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht, und deren Schicksale dennoch von der Schulzeit bis ins Erwachsenenalter untrennbar miteinander verwoben bleiben. Es geht ums gemeinsame Aufwachsen und die erste Liebe in den gar nicht so goldenen Zwanziger Jahren, aber auch um die dunklen Seiten der Freundschaft, um Selbstbetrug, Verrat und Täuschung – und, davon unberührt, um weibliche Emanzipation, Identitätsfindung und die Suche nach dem großen Glück. Maria Lazars Ende der 1920er Jahre in Wien verfasster Roman galt lange als verschollen und wurde noch nie veröffentlicht. Nun wird er zum 75. Todestag der gefeierten Exilautorin erstmals aus dem Nachlass herausgegeben. „Mascha Kaleko gleich […] brilliert Lazar mit Erzählkunst, Detailkenntnis und weiblichem Sarkasmus“ – Andrea Seibel, DIE LITERARISCHE WELT „Maria Lazar kann wirklich erzählen!“ – Denis Scheck, SWR LESENSWERT QUARTETT „Ihr Werk harrt weitgehend noch der Entdeckung…“ – Margarete Affenzeller, DER STANDARD
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Maria Lazar
Viermal ICH
Ein Roman
Erstmals aus dem Nachlass herausgegebenund mit einem Nachwort versehenvon Albert C. Eibl
Der in den späten 1920er Jahren entstandene Roman Viermal ICH ist noch nie veröffentlicht worden und wird hier erstmals aus dem Nachlass herausgegeben — auf Grundlage des in der Österreichischen Exilbibliothek im Literaturhaus Wien aufbewahrten Originaltyposkripts.
1. Auflage 2023
Das vergessene Buch | www.dvb-verlag.at
Copyright © by DVB Verlag GmbH, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lukas Spreitzer, Wien
Satz: Kevin Mitrega, Schriftloesung
ISBN 978-3-903244-27-6
Viermal ICH
Das erste Mal geschah es, als ich noch klein war. Zwölf
Jahre. Wir hatten ein Küchenmädchen, das hieß Julie. Julie Horky. Da aber die Köchin auch Julie hieß, wurde sie Horky gerufen. Einfach Horky.
Es war Sommer und dunstig und staubig und wir sollten aufs Land fahren. In irgend ein großes Hotel im Hochgebirge, wo es sicher regnete. Die Horky stand abschiedsbereit im Hausflur, hatte eine frische, papiersteife weiße Bluse an. Ihre Haut glänzte, als hätte sie sie eben mit flüssigem Kerzenwachs eingerieben, und die strohigen Haare hatte sie straff nach hinten gespannt. Die Horky war gut, viereckig und fest wie eine Kiste. Und da stand sie nun und wartete, dass ich ihr einen Kuss geben sollte.
Ich gab ihr nämlich alle Tage einen Kuss im Hausflur, wenn ich in die Schule ging. Sie steckte mir dabei das Frühstücksbrot zu. Dieser Kuss schmeckte nach Schmierseife und grobem Mehl. Ich glaube, ich küsste sie eigentlich gern.
Aber heute standen zwei riesige Lederkoffer zwischen mir und ihr und Mama gab noch Aufträge und Papa hielt seine Brieftasche in der Hand und meine Schwester Bea winkte schon aus dem Auto, das vor dem Tor stand. Vor allem aber sah Onkel Max auf mich herab, dunkel und furchtbar groß, mit dem gewissen Lächeln um die Lippen, und da konnte ich die Horky doch nicht küssen, wenn es auch für zwei Monate fort ging, ich konnte nicht, sondern sprang an ihr vorbei auf die Straße hinaus.
Ich sah dann noch, als wir um die nächste Ecke bogen, wie sie vor dem Haus stand und winkte. Ihr Arm war rund und ungeformt wie ein dicker Ast. Ich wusste, dass ihre fahlen Augen rot in Tränen schwammen. Ich wusste es, obwohl ich es nicht sehen konnte.
Damals geschah es zum ersten Mal.
Es war ein lauer Sommertag, der Himmel hing herab in erstickten Wolken und unser Zug lief zwischen farblosen Feldern. Meine Schwester Bea aß ein Brot mit gelbem Käse. Ich fühlte mit den Fingerspitzen den Samt der Sitze und hatte einen seltsamen Klotz im Magen, eine Faust, die sich zusammenkrampft. Die Horky — ach die Horky war jetzt sicher traurig, furchtbar traurig, weil ich sie verraten hatte. Sie sah herab auf ihre papiersteife Bluse und ich sah herab auf plötzlich angeschwollene schwere Brüste, roch das Abwaschwasser, spürte das grobe ausgeflickte Hemd — eine Katze saß auf der Ofenbank, eine alte Frau stöhnte in einem Bauernbett, rohe Männerstimmen, endloser Regen über gelbem Getreide, eine riesige Kuh, und meine Brüste zogen mich herab, immer tiefer herab in ein schwüles Dunkel bis der Zug mit einem grässlichen Ruck halt machte.
Ein wilder roter Schnitt, tropfendes Blut, und ich stand auf und wunderte mich, dass ich so mager war. Mein Blick fiel in den kleinen Spiegel des Abteils dicht neben dem blonden Kopf meiner Schwester Bea, jemand rief zum Fenster herein: — Bier bitte! Und ich sah ein fremdes blasses Gesicht mit tiefen Augen, zusammengewachsenen Brauen, Kinderwangen und einem entsetzlich alten Mund. Ich wandte mich um. Nein, hinter mir stand niemand. Plötzlich streckte ich die Zunge heraus. Die andere, die im Spiegel streckte auch die Zunge heraus. Und Julie Horky packte jetzt eben ihre mehl- und seifenduftenden groben Hemden in ein Holzköfferchen, um in ihr tschechisches Heimatsdorf zu reisen.
Ich aber fuhr mit Mama und Papa und Bea in ein Hotel im Hochgebirge, wo es sicher regnete. Warum? Wieso? Warum nicht an ein südliches kochend blaues Meer? Oder in ein Dorf mit rotem Kirchturm?
Das war das erste Mal.
Am Abend erkannte ich in dem Spiegel des Speisesaals meine dürftige Schulmädchengestalt zwischen vielen bunten Menschen. Mama sagte: — Halt’ dich gerade. Und erst viel, viel später erfuhr ich, dass die Horky damals ungefähr im dritten Monat einer Schwangerschaft gewesen sein musste.
Ich wusste natürlich gar nicht, was geschehen war, ahnte es nicht einmal. Ich spielte den Sommer lang mit russischen und französischen Kindern, las im Geheimen einen Roman, den Bea für gewöhnlich in ihrer Handtasche versperrt hielt und in dem sehr viel von der Liebe stand. An die Horky dachte ich gar nicht mehr, denn ich bin nicht gut und edel, ganz gewiss nicht, auch nicht schlecht —
Eigentlich gar nichts. Und das ist es eben. Eben deshalb schreibe ich diese Notizen, vielleicht wird es auch ein Buch, ein Bekenntnis, weiß Gott was. Das ist übrigens gleichgültig.
Tatsache ist, dass ich hier etwas niederschreibe, ich, nicht wahr, ich, daran kann doch kein Zweifel sein, und wenn ich es lese, und ich werde es oft lesen, vielleicht sogar jeden Abend, wie ein Gebetbuch, eine Bibel — denn warum zum Teufel soll man immer nur von anderen lesen? Die Horky kann sich ihr Leben ja schließlich selber aufschreiben, wenn sie will, aber die denkt nicht daran, sitzt bei sich zuhause in einem Fabriksnest, rote Ziegelbaracken und Ruß, sechs Kinder hat sie oder sieben, die Haut unter ihren Nägeln ist ganz zerrissen, das Älteste hat einen Wasserkopf, und sie hat eine graue Bluse, vergilbtes Haar, riecht nach Schnaps aus dem Mund —
Aber Herrgott, was geht mich die Horky an!
Ich muss mich zusammennehmen, muss von mir schreiben, von mir allein. So eine Art Lebensgeschichte. Das wird zwar nicht sehr interessant. Braucht es auch nicht zu sein. Und gar nicht bunt. Wenn ich von Grete schreiben könnte, das wäre so weich, so süß, so hell. Schaukelnde Abende unter verhängten Lampen. Oder von Anette. Donnerwetter, wäre das lustig, spitz und zackig und etwas schmerzhaft und nicht immer appetitlich, mit Geldfetzen dazwischen. Gar nicht zu reden von Ulla, die wie ein Salzfelsen ist, kristallklar und beißend gescheit. Aber was soll das alles. Ich will das doch gar nicht. Ich will von mir schreiben. Von mir allein.
Denn es muss etwas geschehen. Besonders seit der Sache von gestern. Das war ja ein Verbrechen, eine Sünde. Aber war ich denn schuld daran? Stand denn, als ich nachhause kam, nicht die Andere im Spiegel, die Fremde, die Gehasste? Und war ich denn, als ich in seinen Armen lag — nein, still, nicht daran denken!
Aber es muss etwas geschehen. Denn wenn es einmal so weit geht, dass ich nicht nur denke und fühle wie die anderen, sondern auch handle — das wird entsetzlich, das wird gefährlich.
Wenn die Spiegel versagen, die Schaufenster und die Glaskugeln, die geschliffenen Tintengläser und die polierten Tische, vielleicht hilft dann das Wort, das geschriebene Wort. Wie heißt es doch: UNDDASWORTIST FLEISCHGEWORDEN.....
Jeder Bleistift, mit dem ich schreibe, soll eine Waffe sein. Eine Waffe gegen Grete, gegen Ulla, gegen Anette, und nicht zuletzt auch gegen die Fremde. Und wer hier schreibt bin ich. Jawohl ich! Ich allein!
Am besten ist wohl, wenn ich beginne mit meiner, wie man es so nennt, Lebensgeschichte. Obwohl es da eigentlich gar keine Geschichte gibt. Aber das macht nichts.
Das Wichtigste ist Onkel Max. Dass ich ein blitzblank poliertes Kinderzimmer hatte, ist nebensächlich. Alle Weihnachten gab es Puppen und zu jedem Geburtstag die gewisse Torte. Mama und Papa bekamen regelmäßig ihren Gutenachtkuss. Es wundert mich eigentlich, dass sie Vater und Mutter von mir waren. Jedenfalls habe ich sie nie so genannt. Sie waren da wie das Feuer im Ofen und die Suppe auf dem Tisch.
Mit Onkel Max war das ganz anders. Er kam plötzlich und verschwand plötzlich wieder. Man wusste nie, wie lange er bleiben würde, drei Tage, eine Woche, sechs Monate oder eine halbe Stunde. Manchmal verschwand er auf unendlich lange. Aber dann zitterte doch immer die Aufregung im ganzen Haus: kommt er, kommt er heute Abend oder morgen oder übermorgen oder überhaupt nicht mehr. Alles um ihn herum war so unsicher, so unzuverlässig, so ganz und gar nicht selbstverständlich.
Es ist natürlich ein Unsinn, wenn ich behaupte, dass ich es weiß, aber ich weiß ganz genau, dass er sich einmal, als ich noch ein winziges starrendes Baby war, über mein Bettchen geneigt haben muss. Spät in der Nacht. Und dann sagte er etwas, es muss nichts Besonderes gewesen sein, aber sicher etwas, was niemand erwarten konnte. Wahrscheinlich fand er mich auch sehr hässlich.
Er war ein Sammler von wunderbaren alten Holländern, sollte übrigens selbst einmal gemalt haben. Davon sprach er nicht gerne und das war übrigens noch ehe ich zur Welt kam.
Bea aber muss damals schon ein ziemlich großes Kind gewesen sein. Und er malte sie auch mit einer rosa Gasrüsche um den Hals. Ich habe das Bild allerdings nie zu sehen bekommen.
Bea war sehr schön und sie war eigentlich, wie man das so nennt, die Tochter des Hauses. Ihr Zimmer lag neben dem meinen. Sie besaß eine Schmuckkassette, einen winzigen Schreibtisch mit verbogenen Beinen, und in ihrem Schrank zwischen den Spitzenhöschen steckten immer Briefe und Photographien. Das wusste ich, obwohl ich nie hineingesehen hatte. Sie trug den Schlüssel ständig bei sich. Ich wusste auch, dass ein Mann in Uniform dazu gehörte, ein Mann mit breiten Backenknochen und vorspringender Unterlippe. Ich weiß genau, wie er ausgesehen hat. So einer, der seine Kinder prügelt, wenn der Vorgesetzte ihn ärgert. Aber ich habe das Bild nie gesehen. Wirklich nicht. Kann sein, dass eines der Mädchen mir davon erzählte. Übrigens hatte er rechts drei goldene Zähne.
Was die Mädchen betrifft, so verhielt es sich mit ihnen ein bisschen wie mit Onkel Max, wenn sie auch nicht so schön und so groß und so furchtbar waren. Aber sie hatten in meinem Leben nie die selbstverständliche Sicherheit wie Papa und Mama und die große Stehuhr im Speisezimmer, wie die Fensterkreuze und wie Bea. Man konnte nie wissen, ob es nicht eines Tages heißen würde: — Die Person muss fort! Und dann packte eben so ein Mädchen seine Sachen zusammen und war kurz darauf fort, wirklich fort, für immer. Manchesmal vergaß ich sogar die Namen.
Ich aber blieb. Hatte mein Gitterbett, meine Zahnbürste, meinen kleinen Tisch. Ich weiß nicht, weshalb, aber wenn ich so zurückdenke, ist mir, als hätte ich mit offenen Augen die ganzen ersten Jahre meines Lebens verschlafen. Wäre nur manchesmal aufgewacht, mit jenem Ruck, der plötzlich die Erde unter den Füßen verschwinden, den schwerelosen Leib in nichts zerschweben lässt. Und mir war, als hätte man mich vergessen, in einem zufälligen Haus, einer zufälligen Straße, bei zufälligen Eltern. Oft weinte ich über einem Butterbrot.
Dann kam der erste Schultag.
Von der Schule wusste ich im Voraus nur, dass man täglich zeitig aufstehen muss und dann mit Kindern zusammen ist. Kinder kannte ich bisher so gut wie gar keine. Man hatte mich wirklich immer ein bisschen vergessen gehabt. Mama musste ja fortwährend an Bea denken und Papa an Poker und seine Bank. Ich sollte also in der Schule das erste Mal mit Kindern zusammen sein. Das war aufregend. Gefährlich. Voll Abenteuer.
Ich weiß noch, dass wir am Abend vor dem ersten Schultag kalten Hasenbraten zum Abendessen hatten, und irgend eine dunkelrote Sauce war auch dabei. Und fünf Minuten vor neun, also fünf Minuten, ehe ich schlafen geschickt wurde, kam plötzlich Onkel Max. Er setzte sich auf den Stuhl neben Bea, der immer für ihn bereit stand, und sah mich mit seinen langen schiefen Augen traurig an, als er hörte, ich sollte von nun an zur Schule. — Na, sagte er, ärgere dich nur nicht zu viel.
Da bekam ich Angst.
Am nächsten Morgen aber schien die Sonne grell und kalt und die Weiber auf dem Markt verkauften Astern. Papa brachte mich selbst zur Schule, weil das auf dem Weg zur Bank lag. Meine neue Schultasche roch nach hartem Leder und ein langes Fräulein mit blutlosen Lippen nahm mich in Empfang.
Die Kinder — ich sah sie nicht. Ich wusste nur, dass vor mir eine Tafel stand, drohend und schwarz, und dass man Namen aufschrieb. Aber das wusste ich bloß wie von ferne, denn neben mir in der blankpolierten Bank saß — ja, da saß Grete.
Grete war so rosa, so hell, so blondgelockt, wie es sonst nur Puppen oder Engelchen auf Ansichtskarten sind. Sie lächelte mit breiten weißen Zähnen. Sie lächelte eigentlich immer, wenn sie einen ansah. Aber sie sah mich nicht oft an.
Sie saß in einer Wolke von warmem Dunst, einem Dunst aus Milch und Mandelseife. In diese Wolke steckte ich meine braunen mageren Finger hinein. Sie selbst zu berühren wagte ich nicht.
Neben ihr das Fenster schnitt ein Stück kalten grellen blauen Himmels aus. Ich wusste auf einmal, dass wir in unserer Wohnung zuhause zu viele und zu dunkle Vorhänge hatten. Und als die Lehrerin mich beim Namen rief, hörte ich es nicht. Sie wiederholte meinen Namen. War das wirklich mein Name? Grete, Grete, Grete......
Da lachten alle Kinder und Grete puffte mich mit ihrer kleinen gestreichelt glatten Faust. Der Stoß durchzuckte mich wie ein elektrischer Schlag.
Es kam öfters vor, dass ich meinen Namen vergaß. Und später, viel später, als wir schon groß genug waren, um selber Zahlen an die Tafel zu schreiben, stand ich einmal auf, als Grete gerufen wurde und löste an ihrer Stelle eine Rechnung vor der ganzen Klasse. Die Kinder kicherten, die Lehrerin sah mich erstaunt an, ich jedoch sprach ganz laut und klar, mit einer sanften etwas heiseren Stimme, und dachte dabei an eine Mutter in weißem Kleid und mit strahlenden Augen. Aber sonderbar, ich sah von dieser Mutter nur Kopf und Brust, einen gütigen breiten Busen, an den Füßen fehlte etwas, die Beine waren nicht da —
Hier unterbrach mich die Lehrerin und schickte mich in meine Bank zurück. Grete sah mich böse an, lächelte nicht. Sie hatte lange braune Augen mit rötlichem Licht um die Pupillen herum.
Erst später einmal lernte ich Gretes Mutter wirklich kennen. Sie war an beiden Beinen gelähmt, lächelnd saß sie in ihrem Lehnstuhl, dirigierte das ganze Haus und wenn sie Grete sagte, sang ihre Stimme. Und sie nähte Gretes Hemden selbst, stickte jeden Hohlsaum leise summend und mit unendlicher Mühe, während Grete mit ihrem Vater Reisen machte und ins Theater ging. Er war ein berühmter Professor. Astronom. Helles Licht flutete hinter schützendem Milchglas, durchwärmte das Esszimmer. Die Stores vor den Fenstern sahen immer aus wie frisch geplättet.
Ich aber, ich liebte Grete, ohne je etwas anderes für sie tun zu können, als ihr zarte rötliche Radiergummi (Radifix hießen sie) in die Schultasche zu schmuggeln. Sie hatte die Gewohnheit, mit ihren breiten durchscheinenden Zähnen daran zu kauen.
In mein Leben war also, seit ich in die Schule ging, etwas Wichtiges getreten. Etwas, das beinahe so wichtig war wie Onkel Max und beinahe eben so unwahrscheinlich. Nur dass es da war, immer, jeden Morgen ab acht Uhr, falls Grete nicht Schnupfen hatte oder Halsentzündung. Die ersten Jahre, die ich mit Grete zur Schule ging, war Onkel Max übrigens kaum bei uns zu sehen. Er war zwischendurch auch viele Monate in Ägypten. Einmal schickte er mir eine Karte mit einer komischen Sphinx darauf. Ich trug diese Karte so lange mit einem Wäscheband auf das Herz oder vielmehr auf den Magen gebunden, bis sie ganz zerknittert und unleserlich geworden war.
Einmal durfte ich kurz vor den Sommerferien — es waren jene Ferien, zu deren Beginn sich die Geschichte mit der Horky abspielte — eine große Kindergesellschaft zu Ehren meines Geburtstages geben. Ich lud der Einfachheit halber zwei ganze Bänke ein, Grete war nämlich dabei und auch Ulla und Anette, von denen ich später viel zu erzählen haben werde. Ich war riesig aufgeregt, denn Grete hatte schon mehrmals abgesagt, wenn sie zu mir kommen sollte, und ich konnte mir ihre lichte und selbstverständliche Schönheit in unseren dunklen samtenen Zimmern eigentlich gar nicht vorstellen.
Es war ein lauer Juninachmittag. Die drückende Hitze einer ganzen Woche hatte sich nach kurzem Morgengewitter in sanftem Regen gelöst, im Park tropften die Akazien und auf meinem Geburtstagstisch stand ein riesiger Strauß Schneeballen. Schneeballen sind dumme Blumen, wenn man sie anrührt, fallen sie ab. Aber Akazien bekommt man nicht zu kaufen.
Grete kam erst furchtbar spät. Sie war die Letzte, oder beinahe die Letzte. Sie trug ein weißes flaumiges Kleid und weiße Schuhe trotz des Regens. Ihre Haut war zarter als die Blätter der Akazienblüten und an ihrer Schläfe zuckte eine feine blaue Ader. Die Tafel Schokolade, die sie mir brachte, steckte in blauem Glanzpapier.
Ich war so erschöpft vom langen Warten, dass ich mit kaltem Schweiß bedeckt in einem Lehnstuhl versank, während sie sich mit den andern vergnügte. Sie spielten ein großes Kreisspiel. Da klingelte es noch einmal.
Wer konnte das sein? Noch ein Kind? Ich wandte kaum den Kopf zur Tür und herein kam — Onkel Max.
Er trat auf Grete zu — wahrscheinlich begrüßte er erst auch die andern — aber er trat auf Grete zu und strich ihr über das helle Haar, das in zart goldenem Streifen tief in den Nacken verlief. Er sagte zu jemandem — Was ist das für ein wunderschönes Mädchen, und beim nächsten Kreisspiel nahm er sie an der Hand und spielte mit.
Ich saß immer noch in meinem Lehnstuhl, vor mir hing ein Spiegel, ich sah hinein, etwas tat mir weh, zerreißend weh, da sah ich im Spiegel Grete vorüberschweben, an seiner Hand, ganz leicht und hell vorüberschweben, hoch hinaus über das dunkle Fensterkreuz, während Onkel Maxens Hand doch etwas behaart war, nach Fell roch, braunen Pferden und brühendem Stall. Ich hasste Onkel Max, wollte schon aufstehen, Grete von ihm reißen, etwas tun, etwas Furchtbares, Aufsehenerregendes tun — da hatte der Kreis sich aufgelöst, die Kinder wünschten Blindekuh zu spielen, man suchte nach mir und verband mir die Augen.
Ich glaube, in keinem Sommer hat es so viel geregnet, wie in jenem Sommer nach dem aufregenden Geburtstag und der Abschiedszene mit der Horky. Wir waren in einem großen Berghotel und ich spielte mit russischen und französischen Kindern im Lesezimmer und in der Hall. Wir rannten fortwährend den Erwachsenen zwischen die Beine, verschleppten die illustrierten Zeitungen und hatten Zank mit Kellnern und Liftboys. Eines Morgens wachte ich spät auf, wandte mich um, und Beas Bett war voll Blut.
Ich wagte kaum zu atmen. Vor dem Fenster hingen die Wolken wie schmutzige Leinenfetzen. Nun, ich hatte ja schon in der Schule davon gehört. Aber trotzdem — es war entsetzlich.
Da kam Bea herein. Sie drehte die Stehlampe auf dem Nachtkästchen auf, dass das Licht mir schneidend in die Augen fiel, sagte: — Möchtest du nicht gefälligst aufstehen, und warf eine Ansichtskarte auf mein Bett. Eine Karte mit heißem trunkenen Himmel, blendenden Palästen und einem Schiff. Grete schrieb: — Wie geht es dir? Mir geht es gut.
Nachher streute ich mir ein wenig von Beas gelbem Sonnenbrandpuder, das noch unbenützt im Koffer lag, über die Hand. Es war Sand, gelber, hitzeduftender Sand.
Eine warme ferne Freude überrieselte mich.
Der erste Schultag in dem darauffolgenden Herbst aber brachte eine große Enttäuschung. Und mit dieser Enttäuschung ereignete »das« sich zum zweiten Mal, um dann wieder zu geschehen, immer wieder — gestern erst — aber nein, davon später. Ich schreibe ja dieses Buch, ich oder die Fremde, die im Spiegel steht und immer so erstaunt tut, jawohl tut, denn eigentlich weiß sie alles sehr genau, weiß, dass ich gestern erst unter der süßlich blauen geblümten Lampe ihm jenes breite Lächeln entgegen — ach Gott, wo bin ich schon wieder. Ich muss mich, wie heißt es doch, disziplinieren. Übrigens ein grässliches Wort. Ich habe mich wohl nie genug zu disziplinieren verstanden.
Ich wollte also von jenem Schultag sprechen, an dem Grete zum ersten Mal in all den Jahren nicht neben mir saß. Wir waren ja die ganze Zeit hindurch nie so sonderlich befreundet gewesen, aber neben mir gesessen hatte sie immer, so wie sie immer aus meinen Heften abschrieb, mir von ihrem Vater erzählte und mich anlächelte mit breiten Zähnen. Ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, ob sie mich je lieb gehabt hat. Aber ich sah und hörte sie und das schien ihr genug. Außerdem hatten wir den gleichen Schulweg.
Heute aber, am ersten Schultag, es war kalt und winterneblig und die neuen Bleistifte rochen nach hartem Holz, heute saß sie plötzlich vor mir, gerade, dass ich das zartgoldene Flaumenhaar ihres Nackens vor Augen hatte, und neben ihr hockte frech und zottelig Anette, Anette mit den ewig nassen Lippen und den chinesischen Augen. Und Anette saß nicht nur neben ihr, sondern stieß sie auch ununterbrochen mit dem Ellbogen an und kicherte. Nur mit Mühe verbiss ich mir das Weinen. Onkel Max war gestern Abend auch nicht gekommen, obwohl er sich telefonisch angesagt hatte. Und neben mir saß Ulla, die Klügste und Hässlichste der ganzen Klasse, die beste Turnerin.
Warum hatte Grete mir das angetan? Wusste sie überhaupt, was sie tat? Ich hob den Kopf, eine große weiche Hand — war das die Hand von Onkel Max? — fuhr sanft, beinahe zärtlich unter meinen Sitz, hob mich ein wenig und schob mich um eine Reihe weiter nach vorne. Ich hielt den Kopf schief zur Seite geneigt und lächelte, ja ich lächelte mit breiten Zähnen. In meinen Augen funkelte rotes Licht, die Brauen verlängerten sich, ich dachte an einen Abend, blendend hell, mit tausendfältigen Kronleuchtern, Orchesterstimmen und warmem Parfüm. Ich fühlte, dass hinter mir etwas Dumpfes saß, etwas Wehes, Blutaufgerissenes, aber ich hüllte mich in den lauen Dampf eines Badezimmers mit Milchglaslampe und ich hörte wie Anette flüsterte: — Ich möchte auch so gern mal in die Oper.
Da knatterte eine Gewehrsalve, eine Kugel schoss mir in die Rippen — die Kinder lachten und Ulla hatte mir einen Stoß versetzt. Natürlich hatte ich wieder nicht gehört, dass man mich aufrief. Ich fuhr in die Höhe und in dem Glaskasten mit den naturhistorischen Präparaten links an der Wand stand bleich und mit entsetzten Augen die Fremde.
— Setzen, sagte der Lehrer.
In diesem Winter sprach ich mehr mit meinen Kameradinnen als je vorher. Nur an Grete ging ich stumm vorüber. Und sie wandte den Kopf ab, als hätte sie ein schlechtes Gewissen. Stunde für Stunde aber flimmerte vor mir der goldene Flaum des Nackens, leuchtend über dem selbstverständlich sitzenden Kleid aus bestem englischen Stoff.
Anette war das schwatzhafteste Ding der ganzen Klasse. Immer hatte sie Grete etwas zuzuflüstern, und ich sah Gretes gemeißelt zartes Profil sich ihr zuneigen, erstaunt, entsetzt und — oh ja, es war derselbe Ausdruck, mit dem sie in dem lilienweißen Brautkleid an seinem Arm in die Kirche schritt, mit dem ich gestern unter der süßlich blauen geblümten Lampe lächeln musste, als ich auf Gretes Sofa saß und er die Tür aufriss, jener Ausdruck, der ein Gesicht verzehrend weiß machen kann, wie ein mit unsichtbarer Schrift durchsetztes nacktes Papier, jener Ausdruck, der von nichts weiß und alles verrät — ach, warum sage ich es denn nicht gleich: lüstern lächelte sie, wenn Anette ihr ihre Geschichten erzählte. Lüstern, obwohl sie als Kostbarkeit in der Schulbank saß, von ihrer Mutter geliebt wurde wie das Leben selbst und unter reinlichen Milchglaslampen aufwuchs.
Bei Anette gab es hingegen nur bauchige rosa Lampenschirme, Maiskolben und Engelsbilder an der Wand, Seidentapeten und blutige Wäsche in der Blechbadewanne. Anettes Mutter hatte im Haus unten einen Frisiersalon, wo wasserstoffsuperoxydblonde Mädchen schwammigen Herren die Finger manikürten. Anette hatte nicht Geld genug für Butterbrote — Grete aß in der Pause immer weißes Kalbfleisch in ganz dünnen Scheiben auf ganz dünnen Brötchen — Anette besaß ein goldenes Puderdöschen, das zuunterst in der Schultasche steckte. Ihre Röcke waren etwas zu kurz, ihre Beine wie neugierige Stäbe, und wenn sie mit ihren chinesischen Augen lachte, sah man alle Zähne in dem riesigen Mund. Ihre Mutter gab viel auf gute Erziehung und alle Nachmittage ging Anette mit einer dürren Engländerin spazieren.
Ich weiß nicht, wie es kam, denn eigentlich gefiel Anette mir überhaupt nicht, aber eines Tages sagte ich ihr geschickt eine lateinische Verbalform ein und mittags ging ich dann in sie eingehängt nachhause. Neben uns ging Grete in einer weißen Pelzmütze, unberührbar und gleichgültig. Und da musste ich Anette mit einem Mal ein »Geheimnis« sagen. Ein Geheimnis! Wo nimmt man es her, wenn es Mittag ist, die Straßenbahnen klirren und die Luft ist grau von Staub. Aber ein Geheimnis musste ich sagen. Ich klammerte mich krampfhaft an Anette an, steckte meine Nase in ihren violetten Samtmantel, der nach Haarwasser und Puder roch, und flüsterte plötzlich: — Du, ich habe es auch schon gemacht.
Anette zwinkerte mich an mit ihren verschmitzten Chinesenaugen, ihr Mund war ein einziges rotes klaffendes Loch. Was sie sich unter meinen Worten vorstellte, weiß ich bis heute nicht, möglich, dass sie sich so wenig dabei dachte wie ich selbst. Jedenfalls presste sie heftig meinen Arm an sich und ich setzte halblaut und heiser noch rasch hinzu: — Du sagst es aber keiner Menschenseele, auch — und mit einer Kopfbewegung gegen Grete — ihr nicht.
Beim Mittagessen sagte Mama: — Was machst du heute für verzwickte Augen? Und Bea rief mir zu: — Reiß den Mund nicht so weit auf! Ich wurde rot. Das war das Geheimnis. Ich wusste ja nicht, worin es bestand, aber Anette wusste es. Und Anette warf den Kopf auf der Straße schief zurück, wenn sie mit ihrer Engländerin spazieren ging, dass Herren und Laufjungen ihr nachblickten. Und als ich mit meiner Bonne nachmittags spazieren ging, warf auch ich den Kopf schief zurück, neugierig und gleichgültig auf einmal, spürte ein paar plötzlich lebendige runde kleine Brüste und sah einen Mann an — ich weiß nicht, wie er aussah, vielleicht hatte er ein rotes Gesicht, aber es war ein Mann, der erste Mann in meinem Leben, obwohl ich doch Onkel Max so glühend liebte.
Und in der Nacht darauf wurde das wohlbehütete Leinen meines Elternhauses grau und struppig unter mir, die Kinderdecke zu heiß, das Zimmer voll erstickendem Atem. Und meine Finger wurden zu Polypen, roten gemeinen Polypen, mir fremd und schlüpfrig, neugierige Finger — Anettes Finger.
Am nächsten Tag aber nahm Grete in der Pause mich unter dem Arm, und in einer geöffneten Fensterscheibe, hinter der drohend und dunkel die Schultafel stand, beobachtete mich verzweifelt und furchtbar fremd, fremder denn je, die Fremde.
Ulla hatte eine sonderbare Schrift. Nicht zu rund, nicht zu eckig, nicht zu dünn und nicht zu dick, klar und selbstbewusst, gestreckt und in sich gehalten. Die großen Lettern schrieb sie in Blockschrift. Solange ich neben Grete gesessen hatte, zeigten auch meine Schreibhefte kindisch spitze, unregelmäßige Buchstaben. Bei Grete saßen die I-Punkte nie auf den Is und zwei-, dreimal in der Woche machte sie den Versuch, steil nach hinten gelegt zu schreiben, so wie Damen mit parfümiertem Briefpapier.
Eines Tages gab der Lehrer Ulla mit allen Zeichen der Missbilligung das Heft mit den deutschen Aufsätzen zurück. — Sowas hätte ich nicht von Ihnen erwartet!
Ulla warf einen Blick hinein. Ihr schmaler Mund mit den ineinander stolpernden schneeigen Zähnen zuckte kaum merklich. Als aber auch ich mein Heft zurück erhielt, nahm sie es schweigend an sich und schob mir dafür das andere zu.