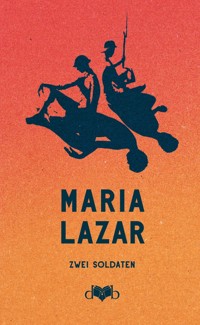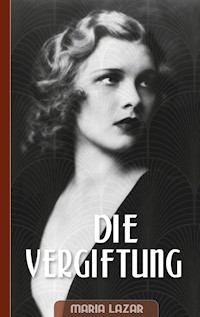Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pallas Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Maria Lazar: Die Vergiftung Für die eBook-Ausgabe neu lektoriert. Voll verlinkt, mit eBook-Inhaltsverzeichnis und Fußnoten |Ruth, eine junge Frau Anfang 20, rebelliert gegen das verstaubte Spießertum der großbürgerlichen Gesellschaft in Wien kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der Zorn äußert sich im expressionistisch drängenden Staccato des mitreißenden Textes von Maria Lazar, die ihn im Alter von nur 20 Jahren zu Papier brachte. Die fiktive Ruth, die reale Maria, sie schreien ihre Wut heraus. Gegen die tyrannische Mutter, die verkommene Verwandtschaft, den ignoranten älteren Liebhaber, der, wie sie herausfindet, vor langen Jahren eine Affäre mit ihrer Mutter hatte und ihr Vater sein könnte. Alle haben sie, saturiert und träge, ohne Ansporn, ihr Leben vergeudet so sieht es Ruth. Sie ist Rebellin, ein Punk aus gutem Hause. »Und unter dem Bett lag, staubdick geschichtet, wehrlose Wut.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
— INHALT —
Innentitel
Über dieses Buch
DIE VERGIFTUNG
Die Tür
Der Kleiderkasten
Die Mutter
Onkel Gustav
Mittagessen
Geld
Gott
Gute Familie
Brand
Eine Mutter
Der Tod
Vision
Abrechnung
Über Maria Lazar
Impressum
Fußnoten
Über dieses Buch
Ruth, eine junge Frau Anfang 20, rebelliert. Sie führt einen Kampf gegen das verstaubte Spießertum der großbürgerlichen Gesellschaft in Wien kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der Zorn äußert sich im expressionistisch drängenden Staccato des mitreißenden Textes von Maria Lazar, einer lange vergessenen Autorin, die ihn im Alter von nur 20 Jahren zu Papier brachte.
Die fiktive Ruth, die reale Maria, sie schreien ihre Wut heraus. Gegen die dominante, tyrannische Mutter, die verkommene Verwandtschaft, den ignoranten älteren Liebhaber, der im Roman ohne Namen bleibt, und gleichwohl – da er vor langen Jahren eine Affäre mit Ruths Mutter hatte – ihr Vater sein könnte. Alle haben sie, saturiert und träge, ohne echten Ansporn, ihr Leben vergeudet – so sieht es die Protagonistin. Sie ist Rebellin, ein Punk aus gutem Hause, wie man heute sagen könnte. »Und unter dem Bett lag, staubdick geschichtet, wehrlose Wut.«
Der Rezensent Arthur Lichtenfels bringt es auf den Punkt: »Ein starker Roman über den Kampf einer jungen Frau gegen verkrustete Wertordnungen, ... eine gekonnt inszenierte Tour de Force der Selbstbehauptung gegenüber der eigenen Familie ... das alles in einem expressionistischen Swing geschrieben, der die Sprache zum Knistern bringt und einen atemlos bis zur letzten Seite fliegen lässt ... Schade, dass es keine Fortsetzung gibt!«
Dieser Roman ist die Wiederentdeckung der letzten zehn Jahre, in einer berauschenden, radikalen Sprache von heute. Kaum kann man es glauben, dass dieses Werk einer Zwanzigjährigen vor rund einhundert Jahren erschienen ist.
Lesen Sie mehr über die Autorin am Anhang
DIE VERGIFTUNG
Die Tür
Eine braune Holztür, glatt, mit vielen dunklen Flecken. Eine Tür wie sie überall ist, überall ist. Eine Tür –
Nein, eine dunkle Macht, feindlich, glatt, mit vielen dunklen Flecken. Das schlägt ins Gesicht, dem ganzen Körper entgegen. Eine Schicht, eine dünne, harte Wand.
Und da verloren sich die schmiegsamen Formen ihres Leibes. Das Immerweitertasten ihrer Hände blieb stecken. Sie wurde platt zusammengedrückt zu einer Fläche, einem Ding, aus dem nur der ungeheure Schrecken herausgestiegen war und draußen stehen blieb, verwundert.
Als sie über die Treppe des Alltagshauses ging, trat sie in die Abdrücke der hundert geschäftigen Füße, die täglich hier vorüberliefen.
Wieso war sie überhaupt dahergekommen? Immer daher gekommen und nur da her, dass alles Übrige draußen liegen blieb?
Heute drang das Licht blendend durch Steine und die erstarrte Haut ihres Leibes. Von den Blättern troff es, grell und heiß, und duftete nach dem Blut aller, die auf der Straße gingen. Das Blau war zu tief, zusammengedichtet aus trotzigen Kräften.
Ach, die furchtbare Helle. Und in sie hineingelegt die Tür, mit den dunkelbraunen Flecken. Die sich niemals, aber auch niemals einschlagen lässt.
Diese Tür war schon damals gewesen, als sie so klein war, dass sie den Kopf ganz nach hinten legen musste, um die ersten Stockfenster zu sehen. War es die Tür aus dem Kinderzimmer heraus oder von der Küche in den dunklen Gang, an die sie sich nicht zu hämmern traute, als man sie einmal dort eingesperrt hatte? Die Tür, die sich nie und nie zertrümmern lässt.
Wie viel Mal schon hatte sie diese Türe geöffnet, mit Händen, die dem eigenen Sieg nicht glauben wollen. Nur ein leichter Druck auf die Klinke – und hatte doch immer den Mut gehabt, zu wissen, dass diese Tür einmal verschlossen sein muss. Jedes Mal hatte sie den einen grässlichen Moment erlebt, der heute Wahrheit geworden war – verschlossen.
Heute, es ist ja gar nicht heute. Das war schon immer, das hat sie ja schon hunderttausendmal erlebt. Tritt man nicht aus der Zeit heraus, wenn dann eine Stunde kommt, die sich einbildet, die erste zu sein. Ein Heute, das ewig ist – ein Schritt aus dem warmen Leben – vielleicht ist ihr deshalb so entsetzlich kalt. Und sie muss die Augen schließen, während das Sonnenlicht des Tages die Wimpern versengt.
Verschlossen – undurchdringlich.
Sie geht durch Straßen, wo die Nachmittagsröte die Mauern frisst. Und weiß: Der breiten Kastanie vor seinem Fenster ist heute ein Ast abgehauen worden. Blendend weiß bietet sich die Wunde der gierigen Sommersonne dar.
Sie kann nie mehr weiter tasten. Steht fest, undurchdringlich – verschlossen.
– Ich muss denken, sagte Ruth. Sie nahm den Brief, der in seine Tür geklemmt war und dachte: Ein zu kleines Kuvert. Und warum macht er dem ›R‹ bei Ruth so einen Schnörkel? Eine wütende Lust überkam sie, den Brief von sich zu werfen, irgendwohin, vielleicht in den Straßengraben. Und dann nie mehr ... Aber sie hielt ihn fest und ging so lange, bis die erste Dämmerung sich mit dem Staub der Großstadt mischte, der in die Höhe stieg, langsam, leise und unerbittlich.
Es schlug neun Uhr vom Kirchturm. Sie dachte: Mutter ist böse, wenn ich zu spät zum Abendessen komme. Und Richard macht seine verwunderten Augen. Ich will sie nicht ärgern. Aber ich bin nur so elend, wie sie gar nicht wissen, dass man sein kann.
Sie spürte den Essensgeruch der aus der Küche quoll, als die Köchin öffnete. Und war gespannt was es gäbe, während ihr die Tränen in die Augen traten, dass sie jetzt daran denken könne.
Sie sah nicht auf Mutter und Bruder, während sie schweigend würgte. Sie hörte nicht die Nörgeleien der Schwester. Sie schluckte eilig große, trockene Bissen hinunter und fragte sich nur: Was habe ich? Sie wusste es nicht mehr.
Aber als sie in ihr Zimmer trat, schrie der Spiegel seinen Namen. Und sie sah ihr Bild darin, wie sie sich den Schleier vorgebunden hatte, bevor sie weggegangen war, heute. Die Bücher auf dem Tisch, die vernachlässigt und zusammengeworfen waren, und die zerrissene Mappe atmeten seinen Duft aus. Und von dem seidengelben Lampenschirm herab träufelten in weichen Farben ihre nächtlichen Gedanken.
Sie öffnete den Brief. Und las verächtlich seine großen Lügen.
Der Spiegel schrie seinen Namen. Sie sah sich drinnen, wie sie sich den Schleier vorgebunden hatte. Wird sie so nie mehr zu ihm gehen.
Aber ja, morgen geht sie zu ihm, ganz so wie sonst. Was hat sie nur heute. Der Brief ist ja so einfach zu verstehen. Warum soll er denn nicht einmal verhindert sein, geschäftlich.
Ruth las den Brief noch einmal. Die lächerliche Schlinge des ›R‹ und die kriecherische Windung des ›L‹ in Liebe.
Er lügt. Aber das macht ja nichts, das wusste sie schon immer. Und doch – sie kann nicht mehr.
O Gott, was ist nur geschehen? Was ist mit ihr? Durch das Fenster strahlt die warme Sommernacht, wie eine Fülle leuchtender Versprechungen. Die Welt ist hell. Sie war bis jetzt nur in einer dunklen Stube. Dunkle Stühle, dunkle Flecken an der dunklen Tür. Die Welt ist hell. Ihre Glieder, ihr armer vergessener Körper schreien nach Licht. Sie kniet am Boden. Ihre Zähne beißen in die Tischkante, oh, dass sie nicht aufschluchzt.
Sie will denken. Sie weiß, dass seine Augen durch alle Mauern auf sie sehen. Aber ihre Hand sagt ›nein‹, ihr Knie schlägt in trotzigen Stößen auf die Diele.
Ihr Hirn schmerzt vor Sehnsucht nach ihm, ihre Zähne beißen in die Tischkante.
Solange sie denkt, gehört sie ihm. Aber da ist noch etwas an ihr, das nicht denkt. Das treibt, das schlägt, das stößt, das treibt sie zu ...
Er stand vor dem Spiegel mit dem zu dicken Rahmen, der alles verdüsterte und doch so hervorstach, als wolle er es nicht zugeben, dass eine eigentümliche Frechheit von dem bespritzten Glas ausging.
* * *
Er stand vor dem Spiegel und sah aufmerksam auf seine schlecht rasierten hageren Backen. Auf die etwas zigeunerhafte Locke, die über die Stirn hing. Sie war nur zu licht, um wild zu sein.
Er stand vor dem Spiegel und versuchte die Regelmäßigkeit seiner schmalen Züge zu genießen, durch die die zu weit nach hinten liegende Stirn durchfuhr, wie ein querer Strich in einer regelmäßigen Zeichnung. Seine Schultern standen zu weit nach hinten, künstlich steif. Sie wollten offen und frei erscheinen. Aber die Augen lagen tief versteckt. Die Pupillen waren nicht in sich abgeschlossen, sie liefen über, ausstrahlend und doch wie verirrt in das Weiße des Auges.
Er stand vor dem Spiegel und der zusammengepresste Mund, mit den dunklen, schmalen Zähnen erkannte alle Schwächen der kraftlos weichen Hände, die sich auf den Rücken legten, während die Schultern sich nach hinten streckten, gewaltsam, künstlich.
Als Ruth zur Tür hereinkam, saß er vor dem Pianino und spielte eine Beethoven-Sonate. Er trat ihr entgegen mit beiden ausgestreckten Händen. - Du kommst spät, sagte er liebenswürdig spöttisch. Aber seine Augen blickten böse in eine Ecke des Zimmers.
Ruth erschrak. Wie immer legte sich der süßlich-herbe Geruch der Räume, den sie nie wo anders getroffen hatte, betäubend um ihre Stirn. Sie lachte dann: Ja, denk nur, wieso, ich bin einen verkehrten Weg gegangen.
– Du hast nicht kommen wollen, sagte er langsam und schwer.
Alles stand still. Das Zimmer stand still, jeder Stuhl, selbst die Uhr, die sonst immer zu laut schnarrte. Etwas lebte nicht mehr, es war etwas gestorben, jetzt, in dieser Minute, etwas Furchtbares war ausgesprochen worden.
Ruth dachte: Weinen können. Sie sah die hochmütigen Globen auf dem Wandregal, die alle staubig waren. Und die sattgelben Minerale auf dem unordentlichen Schreibtisch.
Er rückte ihr den Stuhl zurecht, wie immer. Immer denselben Stuhl.
– Aber was sagst du denn da? lachte Ruth. Es war ihr schlankes frohes Kinderlachen, das so seltsam hinaufkletterte über die grau verschossenen Wände, die zu hoch waren.
– Mein Kind, sagte er, mit überschlagenen Beinen und fremden Augen, ich habe dich seit drei Wochen nicht gesehen und heute kommst du zu spät.
– Du musst mir erzählen, stöhnte Ruth, alles was da war, alles was du erlebt hast, was du gearbeitet hast.
– Ruth, sagte er. Und sie hasste ihn. Spürte den Schnörkel in der Schlinge des ›R‹.
Sie sah seine weißen, kraftlosen Hände. Wusste, dass sie diese Hände niemals vermissen könne. Seine Krawatte war zerschlissen.
Eine heiße Welle stieg in ihr empor, würgte die Kehle. Aber sie war so müde. Hilf mir, sagte sie.
Vor ihr war eine große, schwere Waage. Eine Schale war voll eiserner Gewichte, schwer und kalt. Die andere leer, ganz leer und hoch oben, mutterseelenallein.
Die ganze Welt war aus dem Gleichgewicht durch diese Waage. Und durch die Disharmonie seiner Bewegungen. So wie er jetzt die Zigarre zum Munde führte.
– Du kannst mich eben nicht mehr aushalten, sagte er langsam. Nein, er wusste nichts, er konnte ihr nicht helfen.
Er erzählte ihr von seinem neuesten chemischen Experiment. Und sah sie an, als wäre sie eine schillernde Phiole.
Ihr Gehirn wollte mitarbeiten, aber wieder wehrten sich ihre Hände, ihre Knie, ihr Blut dagegen.
Die Nacht war hereingebrochen.
Du, sagte Ruth plötzlich, als er ihr seine letzten Tage schilderte, wie er sich elend in Gasthäusern herumgetrieben. Hör’ auf. Ihre Stimme klang hart und hell. Sie sprang auf und nahm seine Hand. Und ein grenzenloses Mitleid, ein Schmerz, der sich selber zerbrach, lähmten ihren Atem. – Jetzt geh ich und komme nicht mehr. Deine Tür war verschlossen, letztes Mal. Sie war immer verschlossen. Lüg nicht! Vielleicht weißt du es nicht. Ach, diese Kälte herinnen. Und ich liebe dich. Hörst du mich nicht. Das ganze Zimmer hört mich ja. Die Bäume draußen hören mich. So hör mich.
– Ich höre, mein Kind, sagte er und sie stampfte mit dem Fuß, weil er mein Kind sagte.
– Du weißt, dass ich seit zwei Jahren für dich gelebt habe, fuhr sie fort und ihre Stimme überschlug sich. Aber ich sage dir, ich spüre eine Erschöpfung, eine Gefahr, ich bin zu voll von dir, ich kann dich nicht mehr ertragen. O, was tust du mit mir.
– Wohin willst du, sagte er und nahm einen Zug aus seiner Zigarre.
– Fort, schrie Ruth. Was bin ich dir? Eine Phiole mehr für deine Experimente.
– Törichtes Kind, sprach er und seine Stimme war schwarz in der lauen Nacht. Fort – du kannst nicht mehr fort. Du warst die Phiole für mein kostbarstes Experiment. In dir habe ich mich selber experimentiert.
In diesem Augenblick sah Ruth vor sich auf dem Schreibtisch ein schmales, scharf geschliffenes Messer liegen.
– Wohin willst du, fragte er und vertrat ihr den Weg zur Tür. Du Kleine, die du die ganze Last eines verbrauchten Lebens in dir trägst.
Ruth roch Blut. Oder waren das seine Chemikalien.
– Nein, sagte sie. Und ging hinaus ohne ihm die Hand zu geben.
Im Stiegenhaus brannte grellrot elektrisches Licht. Und die Straße lärmte.
Der Kleiderkasten
Ruth erwachte. Durch das Fenster stieß peinigend laut Licht. Es kam von drüben, von der fahlgelben Hofmauer, zerbrochen und unverschämt schrill. Es saugte die Menschen aus ihren Betten, aus ihren Häusern, ihren Gewohnheiten. Und weil heute Sonntag war, liefen sie alle hinaus. In eine Freiheit, die zu hell war. Dass die großen grünen Blätter schon verdeckt lagen von Staub und zu viel erlebt haben. Wie das schmerzt. Und alle schreien. Irgendwo wird Bier ausgeschenkt.
Dasselbe Licht kroch über die Gegenstände ihres Zimmers, die sonst dunkel waren. Sie traten heraus aus sich selbst, aus ihrem farblosen Dasein und jede Kontur wurde scharf und kam weit hervor.
Es war nicht zum Aushalten. Ruth sprang auf. Sie ließ die Jalousie herunter und war erleichtert, als die Eisenstangen auf dem Fensterbrett aufschlugen. Dann legte sie sich wieder in das zerwühlte Bett, obendrauf, den Kopf weit nach hinten.
Vor ihr stand der Kirschholzkasten. Der liebe, lichte, gerade Kirschholzkasten.
Tisch und Stühle und vor allem das dunkle Bücherbrett trugen noch sein Gepräge. Sie waren immer nur dagewesen, um zu warten, dass sie zu ihm gehe. Und wenn sie wieder kam, waren sie voll Warten für das nächste Mal. Und nur voll Warten.
Aber der lichte Kirschholzkasten war schon früher dagewesen. Sie sah starr auf ihn mit halbgeschlossenen Lidern. Um die anderen nicht zu sehen.
Der Kasten hatte etwas vom lieben Gott. Ganz bestimmt. Von dem lieben Gott, vor dem man die Hände faltet, um zu ihm zu beten. Der einen weißen Bart hat. Und man braucht nur brav zu sein und es kann einem gar nichts geschehen. Er schmeckt nach Zuckerlämmchen, die zu Ostern verkauft werden. Und auch ein bisschen verstaubt.
Dieser liebe, breitlinige Kasten war einmal groß, so groß, dass man nicht bis zum Schlüssel reichen konnte. Und alles war darin, was man nur brauchte.
Ruth bäumte sich auf. Der liebe Gott war tot. In dem lichten Kirschholzkasten hing eine Menge dunkler Stoffe. Die rochen alle ein wenig nach fremden Chemikalien, süßlich herb. Stundenlang war sie gesessen, den Kopf in diesen Kleidern vergraben, um den geheimnisvollen Duft einzusaugen. Nein, sie wird den Kasten nie mehr aufsperren können.
Sie betrachtete misstrauisch ihre braunen Kinderhände. Mit den kurzen Fingern, die noch niemals etwas sein wollten und noch niemals etwas festgehalten hatten, immer nur alles fragend betastet. Rochen sie nicht in ihrem Innern, ganz drinnen in der Handfläche, aus den Poren heraus nach ihm? Sie dachte an das Versinken in seinen großen, zu weißen Händen und ihr wurde übel. Ihre widerspenstig flockigen Haare rochen ja auch nach dort – ist sie denn ganz von ihm durchzogen, vergiftet –
Sie wird ein Bad nehmen. Und sich die Haare waschen mit sehr viel Seife. Das wird nützen. Und die Möbel heute gut abstauben, mit einem neuen Staubtuch.
O Gott, wenn sie nicht auf den Kasten sieht, sieht sie überall ihn, nein, nicht ihn und auch nicht seine Augen, nur seinen Blick. Der dunkel ist und wie ein Band sich um ihre Glieder legt. Den sie nicht versteht und nie verstanden hat, weil er aus einem Land kommt, das sie nicht kennt. Dessen Unkörperlichkeit sie verzweifeln ließ und dem sie nun entflieht, von heute an.
Es ist merkwürdig, dachte Ruth, dass ich die ganze Nacht geschlafen habe. Es ist überhaupt merkwürdig, dass man bei einem großen Unglück doch ganz bleibt, wie sonst. Nur alles andere wird anders.
Und wieder sieht sie auf den hellen freundlichen Kasten. Und vergleicht ihn mit dem lieben Gott. Sie möchte die Hände falten, ganz wie damals. Und kann es nicht mehr. Und fürchtet sich, ganz wie damals.
Denn da ist sie wieder, die alte Kinderangst, über die sie schon hinweggegangen zu sein glaubte mit hochmütig erwachsenem Schritt. Die Angst, die die Nacht fürchtet und die blasse Frühlingsdämmerung. Die sich krümmt unter der Eintönigkeit des Mittags. Die Angst, die auf der Schulbank hockt neben dem patzenschwarzen Tintenfass, den strengen Scheitel der Lehrerin streift, die nach zerkauten Federstielen schmeckt und liniertem Papier, die Angst, die aufschreit in einsamen Nächten und keinen Ausweg findet durch den fest verschlossenen Mund. Die von Leichenzügen träumt und alle Pest und Hungersnot der Jugendbüchereien durchlebt hat.
Wer ist sie heute? Was war sie seit der Zeit, als sie in kurzen Röcken über die Gassen lief und das Zopfband verlor? Ist sie bestohlen, beraubt?
Nein, Ruth wusste es, sie war misshandelt worden. Eine zarte Hülle blieb übrig, die leben wollte. Und was war in ihr? Was roch wie die lebendig gewordene Wissenschaft? Was klebte an ihren Händen, in ihren Haaren, in ihren Kleidern? Was füllte den lieben, alten Kasten?
Da wird sie sich einer furchtbaren Gefahr bewusst: Leer werden. Leer – was heißt das, was ist das? Leer – das sind die Augen in Totenschädeln.
Sie will nach der goldenen Fülle greifen. Und das Licht kann nicht herein und dahinter steht das Nichts, das Leere.
Leer – das heißt ihn verlieren, ihn verloren haben. Und die Wucht seiner Schmerzen, die Qualen seiner Einsamkeit.
Hoch aufgerichtet steht sie vor dem Bett. Sie sieht an sich herunter. Bis zu den schlanken, braunen Knöcheln. Und hasst sich.
Leer – das ist das Stück vom Fenster hinab bis zu dem harten Pflaster. Worauf die Menschen ihren grünen Schleim spucken und das die Hunde beschmutzen.
Frei sein und leer sein und weniger als elend sein –
– Fräulein Ruth sollen zum Frühstück kommen. – Ruth sah das große überkräftige Stubenmädchen mit der hohen vergnügten Stimme. Und wusste: heute Abend geht sie aus, da wartet einer unten auf sie, vielleicht der vom letzten Mal oder auch ein anderer.
– Ruth, rief die Mutter aus dem Nebenzimmer. – Ich komme, antwortete sie mit einer Stimme, die voll Musik und Jubel war.
Mutter stand in der Sonne. Und Mutter war lebendigstes Gewesensein.
* * *
Mutter ging alle Morgen nachsehen, ob das Mädchen gut aufgeräumt habe. Sie ließ keinen Stuhl so stehen, wie diese ihn gestellt hatte. Mutter wollte ein eigenes Haus haben, wie sie sagte. Ob dieses Haus besser war, als alle anderen, ist nicht bestimmt. Aber dass es anders war als alle anderen, dass es ihr eigen war und nur durchtränkt von der kindhaften Unruhe ihrer zu langen Finger, die niemals jung gewesen sein konnten, dass ihr Haus fremd und versperrt war allen, die nicht ihres Blutes waren, das hatte sie erreicht. Und Ruth empfand es mit einem Stolz, der sich selbst nicht anerkennen will.
Mutter küsste Ruth, wie man ein Stück Eigentum küsst oder ein Stück von sich selbst. Und Ruth fühlte die Schmerzen der vergangenen Nacht ganz klein werden und wollte weinen.
Mutter frühstückte nicht mit. Sie war nie imstande eine Mahlzeit durch sitzen zu bleiben. Sie musste immer rasch noch etwas anderes tun.
Mutter war groß. Aber nicht groß genug für das, was sie der Welt zeigen wollte. Deshalb schien sie fast klein.
Und auch ihre Wohnung war groß. Aber zu klein, um sich vor allen zurückziehen zu können. Denn das wollte sie. Deshalb waren die hohen Räume eng und drückend.
Als Ruth mit dem schmalen, silbernen Brotmesser das Brot schnitt, empfand sie einen seltsamen Besitzerstolz und dachte: zuhause sein.
Sie hatte keinen anderen Wunsch, als Mutters Kleid zwischen beide Hände fassen zu können, ganz, ganz fest. Wie gut war es, dass Mutter immer so alte Kleider trug. Und schon wollte sie aufspringen und Mutter alles sagen –
Da kam Richard herein. Nein, sie konnte nicht. Richard war zu klug. Und Richard war Mutters Sohn. Von so etwas konnte sie nie zu Mutter sprechen.
Und Martha war Mutters Tochter. Martha war hässlich und verbittert. Wenn sie die Tür aufmachte, war das Zimmer voll Lärm. Da konnte Ruth von so etwas doch nie zu Mutter sprechen.
Ruth wusste nicht, dass Mutters Leben nur Enttäuschung war, die nicht eingestanden werden durfte. Und dass Mutter so grenzenlos arm war, weil sie nie den Mut gehabt hatte, das zu erkennen.
Mutter war so klug, dass sie die Dinge nicht wirklich sah, sondern in Karikatur auf dem Hintergrund ihrer Wünsche und Vorurteile. Aber sie sah sie alle bis auf eines: Das war sie selbst. Sie wusste so wenig von ihrer eigenen Existenz wie ein ganz kleines Kind. Und ahnte nicht, dass sie selber auch etwas beigetragen habe in der Symphonie der Ereignisse, die ihr enges, tiefes Dasein bildeten.
In ihrer Jugend hatte sie nur eines gekannt: Die Pose. Die Verwandten und Freunde, ja selbst der Kutscher ihres väterlichen Hauses sprachen mit Handbewegungen, wie Schauspieler in ihren Rollen. Das hatten sie von ihrem Vater gelernt. Dessen ganzes Leben ein großer Faltenwurf war. Hinter dem steckte nichts als Jagd und Rausch und etwas Verwesung. Aber ihre Mutter war träge.
Sie hatte nie den Mann gefunden, den sie lieben konnte. Das wäre auch nicht so nötig gewesen, nur hätte sie sich Zeit nehmen sollen, ihn zu suchen. Denn nur dann hätte sie sich entwickeln können.