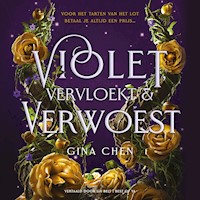Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Violet ist Prophetin und Lügnerin, die den königlichen Hof mit ihren raffiniert formulierten – und nicht immer zutreffenden – Weissagungen beeinflusst. Ehrlichkeit ist für Verlierer, wie den gar nicht so märchenhaften Prinzen Cyrus, der Violet ihres offiziellen Postens berauben will, sobald er am Ende des Sommers den Thron besteigt – außer Violet unternimmt etwas dagegen. Doch als der König sie bittet, für einen bevorstehenden Ball Prophezeiungen bezüglich Cyrus' Liebesleben zu fälschen, erweckt Violet einen gefürchteten Fluch zum Leben, der das Königreich entweder verdammen oder erlösen wird – je nachdem, für welche Braut sich der Prinz entscheidet. Auch Violet steht vor einer Wahl: entweder die Gelegenheit nutzen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, egal was es kostet, oder der wachsenden Anziehung zwischen ihr und Cyrus nachgeben. Violets scharfer Verstand mag sie bisher am intriganten Hof geschützt haben, doch auch er kann ihr Schicksal nicht ändern. Und während die Grenze zwischen Hass und Liebe bei Cyrus und ihr immer weiter verschwimmt, muss Violet ein teuflisches Netz der Täuschung entwirren, um sich selbst und das Königreich zu retten – oder für immer zu verdammen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANMERKUNG der AUTORIN
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieses Buch ist ein Märchen für alle, die es stets vorziehen, auf ihren Kopf anstatt auf ihr Herz zu hören. Es ist eine Geschichte über Geschichten und darüber, wie sie unsere Geschichte und unsere Auffassung von Göttlichkeit formen. Es geht um Liebe und darüber, wie sie uns rettet – oder eben auch nicht.
Doch vor allem geht es um Violet.
Ich habe Violet für all diejenigen unter euch geschrieben, die sich immer mit den Figuren identifizieren, die eigentlich nicht dafür gedacht sind. Figuren, die zu kaltherzig sind, zu stolz und gleichzeitig zu viel und doch nicht genug. Sie ist weder eine mutige Heldin noch eine glamouröse Bösewichtin, sondern einfach ein eigener Charakter voller Widersprüche: ein kratzbürstiges Mädchen, das sich seinen Platz in einer Welt, an die es selbst nicht glaubt, erkämpft – mit beiden Füßen auf dem Boden und dem Blick gen Himmel gerichtet.
Ich glätte Violets scharfe Kanten nicht. Ich richte das hellste Scheinwerferlicht auf sie. Häufig sprechen wir ausschließlich positiv von Repräsentation, von Figuren, die Vorbilder sind und stets versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber menschlich zu sein bedeutet auch, voller wunderbarer, schrecklicher Fehler zu sein. Diese Wahrheit in unseren Erzählungen zu verbergen, vermittelt die Botschaft, dass wir vor diesen abstoßenden Seiten unseres Selbst davonrennen sollten, statt ihnen ins Gesicht zu sehen.
Violets Reise ist nicht immer nur schön, sondern stets auch irgendwie chaotisch, und trotz alledem voller Hoffnung. Sie ist aber auch amüsant, so wie es das Schicksal nun einmal ist. Ich hoffe, du lachst und staunst und verliebst dich, wenn du es am wenigsten erwartest. Die Zukunft ist immer besser, wenn sie ein paar Überraschungen bereithält.
Viel Freude beim Lesen,
Gina
Für die Leserinnen und Leser,die an mich geglaubt haben,bevor ich es tat.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Die BRAUT des DORNENKÖNIGS
DANKSAGUNGEN
1
Prinz Cyrus wird heute in die Hauptstadt zurückkehren und wehe, er bringt keine Braut mit.
Vom Turm der Sehenden aus, dem höchsten Punkt der Sonnenstadt, kann ich inmitten der Felder vor der Stadt eine Reihe violetter Banner flattern sehen: die königliche Kolonne, die sich den steilen Weg zum südlichen Tor hinaufbahnt. Menschen, die hinter Absperrungen darauf warten, den Prinzen willkommen zu heißen, füllen die Straßen der Stadt. Sechs Monate sind vergangen, seit Cyrus losgezogen ist, um den Kontinent zu bereisen. Seit er sich mit der Absicht auf den Weg gemacht hat, »vom Land und den großzügigen Leuten, die es bewohnen, all die Weisheiten zu erlernen, die ich im Palast nicht erlernen kann«.
Oder so was in der Art. Ich habe ihm nicht mehr zugehört, seit er so ungefähr bei der Hälfte seiner Rede angelangt war.
Vor allem aber ging er auf Reisen, um eine Braut zu finden – eine Lösung für seinen Fluch. Das hat Cyrus in seiner Rede nicht erwähnt. Was ich weiß, weil König Emilius, sein Vater, ihn anschließend für diese Auslassung angeherrscht hat und ich es dann in meiner Rede ein paar Tage später erwähnen musste, als ich bekannt gab, dass ich eine neue Prophezeiung geträumt hatte.
Das Beste am Seherinnendasein ist nicht der Turm oder die Annehmlichkeiten oder der Kontakt zum König, sondern wie einfach dir alle glauben, was du sagst.
»Ohne Seine Hoheit war die Stadt nicht annähernd so lebhaft wie sonst. Mir fehlen all die wild gewordenen Mädchen, die sich nur darum reißen, ihn zu retten«, sagt die Frau mit dem Pfirsichgesicht am Lesungstisch. »Das ist nun wohl endgültig vorbei. Er wird doch inzwischen unsere nächste Königin auserwählt haben, oder etwa nicht?«
Wenn Cyrus auf mich gehört haben sollte, dann hat er gewählt. »Kann man nur hoffen«, murmele ich und wende mich vom Fenster ab.
»Bitte?«
»Ich sagte, er hat sie getroffen.« Ich werfe meiner einzigen Besucherin an diesem Tag ein mysteriöses Lächeln zu. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mich heute, da die königliche Karawane zurückkehrt, überhaupt jemand im Turm aufsucht. Doch die vom Wetter gezeichnete Frau erscheint mir – mit ihrem breitkrempigen Hut und schwieligen, offen auf dem Marmortisch liegenden Händen – zu praktisch veranlagt, als dass sie Schlange stehen würde, nur um einen Blick auf ein königliches Gesicht zu erhaschen. »Wenn Ihr von der Prophezeiung sprecht, die ich vor der Abreise Seiner Hoheit empfangen habe … In meinen Träumen hieß es: ›Noch bevor seine Reise endet, wird Prinz Cyrus seiner Braut begegnen.‹ Nicht mehr und nicht weniger.«
Sie nickt. »Ich konnte mich nicht mehr an Euren genauen Wortlaut erinnern …«
»Der genaue Wortlaut ist wichtig.« Vier Nächte lang bin ich durch diesen Raum getigert, um diese Worte auszuwählen. Da werde ich nicht dulden, dass sie jetzt, da es endlich von Bedeutung ist, falsch wiedergegeben werden. Ich hebe meine Robe, setze mich ihr gegenüber hin und streife dabei meinen schweren geflochtenen Zopf über die Schulter. Je eher diese Lesung vorüber ist, desto eher nimmt diese belanglose Unterhaltung ein Ende und ich kann zum Palast gehen und den Prinzen begrüßen. »Was soll ich für Euch hellsehen?«
Die Frau zieht eine Augenbraue hoch. Dass ich so kurz angebunden bin, verärgert sie, doch sie sagt es nicht. »Ich sorge mich lediglich um die Ernte, Sehende Meisterin Violet. Um die Zukunft meines Hofs. Mag uns das Schicksal gnädig sein.«
Sie macht mir keinen Spaß, diese Handleserei. Doch der König besteht darauf, dass ich mich regelmäßig mit dem gemeinen Volk abgebe, damit es dem Mädchen vertraut, das die Zukunft des Königreichs vorhersagt. Ob das oder die Ehevermittlung, aber beim Anblick liebeskranker Tölpel dreht sich mir der Magen um.
Ich lege meine Hand über ihre und die Berührung lässt etwas in meinem Geist aufleuchten, das so gleißend ist wie die Sonne. Ich schließe meine Augen und konzentriere mich auf die Linien ihrer Handfläche, die Furchen und Narben, das Blut, das darunter pulsiert – jegliche Zeichen ihrer Vergangenheit, an die ich meine Magie knüpfen kann. Mit meiner Gabe finde ich die Fäden in meinem Geist, die ihre Seele mit dem Lauf der Welt verbinden:
Ein am Hang gelegener Bauernhof, umringt von goldenen Feenglöckchen.
Ausflüge zur Sonnenstadt, Teil ihres monatlichen Rhythmus.
Ein weiterer Hof in den Grenzgebieten. Familie? Ein Geliebter? Der Feenwald zeichnet sich dunkel am Horizont ab.
Lange Tage auf dem Feld dehnen sich bis in die Nacht …
Und so weiter.
Am deutlichsten sind die Fäden, die bereits gesponnen wurden: ihre Erinnerungen. Die Fäden der Zukunft sehen dagegen verschwommen aus und können sogar widersprüchlich sein. Hinter dem Schicksal stecken launische Götter und die Zukunft ändert sich ständig. Wenn ich die Schicksale nicht eindeutig erkennen kann, kann ich stattdessen manchmal ihre Absicht spüren. Unheilvolles fühlt sich an wie eine regnerische Böe vor dem Sturm, eine Gelegenheit wie das Eintauchen in warmen Honig. Meistens jedoch lassen sich die Schicksale nicht gern in die Karten sehen.
Zumindest nicht, ohne es zu wollen.
Wer meinen Rat sucht, muss sich mit den wenigen Bruchstücken begnügen, die ich sehe. Ich bin die einzige Seherin in Auveny, die einzige Wahl meiner Kunden. Das ist kein Zufall. Es gibt neun Sehende auf der Welt. Wir sind allesamt an einem der fürstlichen Höfe beschäftigt. Wir sind zu nützlich, um uns uns selbst zu überlassen. Ich habe gehört, dass die Seherin in Yue neben ihren Prophezeiungen von den Wellen eines Teichs auch Stürme ablesen kann und dass die in Verdant den Zeitpunkt einer jeden Geburt kennt.
Ich bin die jüngste der Sehenden und wurde vor sieben Jahren auf den Straßen Auvenys aufgelesen. Alles, was ich kann, ist träumen, Fäden lesen und … lügen.
»Ihr braucht Euch nicht zu sorgen«, murmele ich, während ich meinen geistigen Blick auf ihre diffuse Zukunft richte. Ich schmücke die vage Vision mit Details aus ihrer Erinnerung aus. »Eure Feenglöckchen sollten dieses Jahr prächtig wachsen. Doch seid weiterhin fleißig, schweift nicht so viel umher und bleibt in der Nähe Eures Hofs.«
Als ich meine Augen wieder öffne, zieht die Frau ihre Hände zurück. »Das Schicksal ist gnädig. Es tut gut, das zu hören«, sagt sie. »Sonst noch etwas?«
Ich schwafele vor mich hin, bis sie endlich zufrieden ist. Dankend wirft sie ein paar Silberstücke in das leere Brunnenbecken, das als Gabengefäß fungiert, und verlässt den Turm.
Ich schiele über den gewellten Rand des Brunnens und seufze. Zwar bin ich nicht auf die Münzen angewiesen, denn der Palast stellt alles bereit, was ich brauche. Doch der Brunnen meiner Vorgängerin war immer randvoll mit Gaben gefüllt. Seit ich dagegen im Amt bin, nun ja … setzt er nur noch Staub an.
Und nun, da Cyrus zurück ist, wird es mit meinem Ruf wohl nur noch bergab gehen.
Draußen in der Stadt branden die Jubelrufe auf und wieder ab. Ich muss kaum aus dem Fenster blicken, um zu wissen, dass die königliche Kolonne in der Stadt eingetroffen ist. Der Hof hat schon Intrigen um Cyrus’ Rückkehr gesponnen, als er gerade erst abgereist war. König Emilius ist immer kränklicher geworden und man erwartet, dass Cyrus noch vor Ende des Jahres den Thron besteigt. Es ist an der Zeit, um seine Gunst zu buhlen.
Ich knirsche mit den Zähnen. Das gilt auch für mich.
Vor sieben Jahren verlautete die Sehende Meisterin Felicita – mögen die Sterne ihre Seele geleiten – ihre letzte Prophezeiung:
»Das Land wird rot erblühen – mit Blut und Rosen und Krieg. Das Herz des Prinzen wird entscheiden, uns verdammen oder erlösen. Seine Wahl vermag es, uns alle zu retten. Alles liegt an ihr, seiner Braut! Ein Fluch, ein Fluch, verfluchter Fluch. Bei den Göttern, seid wachsam …«
Und das war alles, bevor sie starb. Ein Dienstmädchen, das sie an ihrem Krankenbett gepflegt hatte, behauptete, der Mund der Seherin sei weit aufgerissen erstarrt, die Faust an ihre Kehle geklammert gewesen. So als hätte sie gegen jemanden angekämpft, um sprechen zu können. Selbst als sie tot war, gelang es nicht, ihren verkrümmten Körper aus der Starre zu lösen.
Das Königreich versank in Paranoia. Hatte Felicita das Ende von Auveny verkündet? Das Ende der Welt? Warum spielte der Prinz dabei eine Rolle? Nach ihrem Tod wurde ich zur neuen Seherin ernannt, obwohl ich damals erst ein Kind war. Ein Straßenkind, das in Seide gehüllt Theater spielte. So durcheinander wie alle anderen. Ich träumte nie von dem, was Felicita beschrieben hatte.
Und da ich keine Antworten parat hatte, war ich bei den Leuten nicht besonders beliebt.
Wir baten die Sehenden der Nachbarländer um Hilfe und warnten sie im Gegenzug, doch auch sie konnten keine bösen Vorzeichen spüren. Die großmütterliche Seherin von Balica merkte an, dass das, was Felicita gesehen hatte – sofern es nicht nur ein Fiebertraum gewesen war –, womöglich noch in weiter Zukunft lag. Wir hatten Zeit, uns vorzubereiten.
Und so hielt das Königreich in der Hoffnung, dass Cyrus sich verlieben würde, mit jedem Wechsel der Jahreszeit, jeder Gala und jedem Besuch bei Hofe die Luft an. In diesem Punkt war Felicitas Prophezeiung schließlich deutlich genug gewesen: Die Zukunft hing vom Herzen des Prinzen ab, von seiner Wahl und seiner Braut.
Sieben Jahre vergingen, ohne dass Cyrus jemanden auserkoren hat. Eine unheilvolle Bestimmung lastet auf seinen Schultern und er beschließt, pingelig zu sein.
Aber auch er kann nicht ewig Zeit schinden.
Ich mache mich auf den Weg zum Palast, um das Resultat seiner Reise selbst in Augenschein zu nehmen. Es ist nicht weit. Der Eingang zum Turm ist über eine Brücke mit dem nördlichen Ende des Palastgeländes verbunden – ohne die ich bis zum Fuß des Turms am Flussufer des Julep erst einmal zweihundert Stufen hinabmarschieren müsste. Der Turm der Sehenden ist ein knorriges Relikt des Feenwalds, der sich einst über den gesamten Kontinent erstreckte – gewachsen, nicht erbaut, und deshalb auch nie zweckmäßig gestaltet.
Märchen zufolge ließ eine der ersten Sehenden die Wände aus dem Boden wachsen und so hoch emporsteigen, dass sie inmitten der Sterne leben konnte. Zu jener Zeit, als der Feenwald noch ungebändigt war, noch wenige Nationen existierten und das Land voller Magie schien, waren derartige Kunststücke angeblich üblich. Ich würde es selbst nicht glauben, wenn ich nicht manchmal von Fäden längst vergangener Zeiten träumte – Zeiten, in denen die von Feen erleuchteten Baumkronen selbst Berge überragten und in denen die klügsten Wesen, die durch die Wälder streiften, noch keine Menschen waren.
Heute scheint der Turm der Sehenden einfach fehl am Platz. Gleich einem Stamm versteinerter Ranken, der vom Flussufer emporwächst und vor den Bauten der Stadt einen grünen Kontrast bildet, ragt er nur mehr wie ein Reißzahn in den Himmel. Meine Robe flattert im Wind, als ich die Brücke überquere und mich vom Turm entferne. Hinter den Marmorwänden des Palasts und den goldverzierten Turmspitzen verschwindet die Sonnenstadt aus meinem Blick. Ich passiere ein paar Tore und erreiche die Gartenanlagen: ein Flickenmuster aus akkuraten Blumenbeeten, verzierten Brunnen und dekorativen Bäumen.
Unterwegs werde ich ein paarmal gegrüßt – eine kurze Verbeugung oder ein Knicks, begleitet von einem gemurmelten »Sehende Meisterin«. Andere wissen, dass ich nichts von Formalitäten halte. Auf Zehenspitzen biege ich zwischen dem Heckenlabyrinth und einer Reihe frisch beschnittener Begonien auf einen schmalen Pfad für Bedienstete und gelange mit nur leicht erdigen Schuhen zu einem der Hintereingänge des Palasts.
Im Inneren des Palasts dringen aus allen Räumen und Fluren Unterhaltungen an mein Ohr. Ich runzle tief meine Stirn. Das, was ich da höre, verstört mich – oder vielmehr das, was ich nicht höre.
Ich gehe die Stufen zu den königlichen Gemächern hinauf und die Gespräche verklingen. Als ich näher komme, werfen mir die Wachen vor Cyrus’ Gemächern beunruhigte Blicke zu, halten mich aber nicht auf.
Weit reiße ich die Flügeltüren zu seinem Schlafzimmer auf.
»Lasst sie nicht herein … Violet, verschwinde.«
Mein Blick fällt auf Cyrus, der – zumindest größtenteils – bekleidet vor seiner Garderobe steht und … hui … sogar noch besser aussieht als zuvor.
Cyrus Lidine von Auveny könnte auch direkt einem Märchenbuch entsprungen sein: elegant, belesen, geistreich, wenn er sich dazu herablässt, mit einem zu reden, und selbst ohne Feenzauber wunderschön. An ihm würde selbst ein grober Leinensack stylish aussehen und sein Lächeln verursacht mehr Ohnmachtsanfälle als die Sommersonne.
Jetzt, am Ende seines neunzehnten Lebensjahrs, ist er ausgewachsen, Muskeln glätten seine zuvor noch jugendlichen Kanten. Seit er aufgehört hat zu wachsen, wirken auch seine Kleider nicht länger zu klein. Farbe ist in seine Wangen zurückgekehrt, die nach einer Erkrankung in Jugendjahren früher blass wie Porzellan waren, und der neue Schnitt seines Kupferhaars hat ihm das jungenhafte Aussehen genommen.
Doch manche Dinge ändern sich nie. Einschließlich dem herablassenden Blick, den er mir zuwirft, weil ich anders als angeordnet nicht verschwinde. Die Monate, die wir uns nicht gesehen haben, haben den Hass zwischen uns nicht gemindert.
Nicht einmal ein ganzes Leben würde da reichen.
»Du kannst hier nicht so einfach reinplatzen …«, setzt Cyrus an.
»Und doch habe ich das soeben getan«, sage ich leise und lasse den Blick durchs Zimmer schweifen. Ich bin die Einzige hier, was ein Problem ist. Auch das Bett ist ordentlich gemacht und das Bad anscheinend leer. Unten ist mir keine Gefolgschaft begegnet, keine Hofdamen, die sich um den letzten Neuzugang der sonnenstädtischen Gesellschaft scharen. Es stellt sich also die Frage: »Wo ist sie?«
Cyrus wendet sich dem Spiegel zu und fährt fort, seine Weste zuzuknöpfen. »Wen meinst du?«
»Ihre zukünftige Majestät. Das Mädchen, das du heiraten wirst.«
»Geht dich gar nichts an.«
Schwingenden Zopfes stapfe ich zu ihm hinüber. »Das geht mich«, sage ich und zwänge mich zwischen ihn und den Spiegel, woraufhin er einen schweren Seufzer ausstößt, »sehr wohl etwas an.« Hätte ich in meiner frühen Kindheit mehr zu essen bekommen, wäre ich vielleicht so groß, ihm direkt in die Augen zu blicken. Doch so überragt er mich um eine ganze Handbreit und ich muss mein Kinn in die Höhe strecken, um ihn wütend anzustarren. »Ich habe vorhergesagt, dass du eine Braut finden wirst, und nun bist du hier, ganz ohne Begleitung. Mach mich nicht zur Lügnerin.«
»Dann hättest du nicht lügen dürfen.«
Meine Augen verengen sich. Cyrus ignoriert mich und schlüpft in ein mit Vogelmuster verziertes Wams.
Es war nur eine kleine Lüge, etwas, um das Gerede zu ersticken. Vergangenen Herbst erreichten uns Berichte, dass sich der Feenwald in der Nähe der Grenzgebiete schwarz färbte und des Nachts blutrote Rosenblätter durch Dörfer wehten. Die Menschen wurden unruhig. Also bat König Emilius mich, in der Zukunft nach irgendwelchen Hinweisen oder Einzelheiten zu Felicitas Prophezeiung zu suchen.
Doch die Nächte blieben erfolglos, meine Träume enttäuschend leer.
Als Cyrus dann seine Reise ankündigte, sog ich mir einfach etwas aus den Fingern, um den Hofstaat zu beruhigen.
Noch vor dem Ende seiner Reise wird Prinz Cyrus seiner Braut begegnen.
Eine kleine Lüge geht runter wie verwässerter Wein. Du bemerkst sie kaum und wenn doch, reicht es nicht, um dich darüber zu beschweren. Schließlich muss Cyrus so oder so irgendwann eine Braut finden. Ich habe ihm nur ein Zeitlimit gesetzt.
»Also gut«, sage ich mit vor der Brust verschränkten Armen. »Ich habe nicht wirklich geträumt, dass du eine Braut findest. Allerdings hätte das auch gar nicht nötig sein sollen. Du hättest dich schon längst entschieden haben sollen.« Ganze Wege könnte man mit den Verehrerinnen pflastern, die für ihn auf den Straßen für ihn schwärmen. Wie schwer kann das denn schon sein? »Solange du Felicitas Prophezeiung im Nacken hast, werden die Menschen Angst haben und sich auch vor deiner Herrschaft fürchten. Sie sagen, du seist verflucht – natürlich nur hinter deinem Rücken. Ich habe dir Zeit verschafft, Prinzchen. Zeit und Zuversicht.«
Prüfend rückt Cyrus die Manschettenknöpfe in Form zweier kleiner Löwenköpfe zurecht und fährt gelangweilt fort: »Wie ich sehe, bist du mal wieder mehr um den Anschein als die Prophezeiung selbst besorgt.«
Ich fletsche meine Zähne. »Ich kann mich durchaus um zwei Dinge gleichzeitig sorgen.«
»Selbstverständlich. Um deinen prekären Ruf und die Meinung meines Vaters über dich.«
»Die neuesten Berichte der Grenzpatrouillen sind letzte Woche eingetroffen. Sie haben im Feenwald verrottende Bäume gefunden.«
»Das ist mir bekannt. Ich habe sie gesehen.« Er hört endlich auf, seine Kleidung zurechtzurücken, und schaut zu mir hinab. Ein beunruhigter Ausdruck umspielt das Grün seiner Augen. Doch ich sehe es nur kurz, denn er wendet seinen Blick schon wieder ab. »Mein Vater müsste schon Truppen losgeschickt haben, um die faulenden Stellen zu verbrennen.«
»Aber die Wurzel des Problems …«
»… ist womöglich Felicitas letzte Prophezeiung, ja. Dagegen kann ich aber nichts tun. Ich kann mir nicht aussuchen, wann oder in wen ich mich verliebe.«
In der Prophezeiung wird nur von einer Braut gesprochen, von Liebe war nie die Rede. Doch Cyrus ist ein Romantiker, glaubt, es sei wichtig. Anderenfalls würde er schon längst seinen dritten Hochzeitstag mit einer für ihn arrangierten Prinzessin aus Verdant feiern. »Du versuchst es ja nicht einmal«, entgegne ich schroff.
Cyrus schüttelt nur den Kopf. »Ich mache den Menschen nur keine falsche Hoffnung, dass die Prophezeiung gebrochen wird. Das ist alles.«
Er dreht sich zur Schlafzimmertür und ich folge ihm aus seinen Gemächern hinaus auf den Korridor, wo es von ziellos umherlaufenden Höflingen nur so wimmelt. Mit leuchtenden Augen und lauter Fragen wenden sie sich dem Prinzen zu. Cyrus lächelt entwaffnend, dann versteinert seine Miene abrupt, er ignoriert sie allesamt und saust die Treppe hinunter. Zwei Wachen stellen sich schützend hinter ihn, doch ich schlüpfe an ihnen vorbei.
Ich senke meine Stimme. »Hast du wenigstens einen Plan, was du tun wirst, wenn du die Menschen damit in Panik versetzt?«
»Das werde ich gewiss nicht mit dir besprechen«, brummt er mir zu.
»Mit mir?«, spotte ich in demselben Tonfall und presse die Hand gegen meine Brust.
»Du, die mich seit Jahren bei jeder denkbaren Gelegenheit hintergeht.«
»Jahre, die du nicht gehabt hättest, wenn ich nicht dein Leben gerettet hätte.«
Cyrus wirft mir einen wütenden Blick zu. Er hasst es, wenn ich ihn an unser erstes Treffen erinnere. Ich dagegen erwähne es liebend gern.
Als er das Ende der Treppe erreicht, schlägt er unverzüglich eine andere Richtung ein, um die Menschenmenge zu umgehen, die uns im Atrium entgegenströmt. Der Teppich dämpft die schnellen Schritte, mit denen er mich und alle anderen abzuhängen gedenkt. Doch ich lasse mich nicht abhängen. Die blaue Seide meiner Robe flattert hinter mir her.
»Es geht hier nicht nur um die Prophezeiung«, rufe ich ihm hinterher. Einige der Herzöge sind über seinen bevorstehenden Amtsantritt alles andere als erfreut. Cyrus ist ihnen zu ehrlich. »Der Rat wird diese Angst gegen dich verwenden. Seine Mitglieder sagen, du seist nicht für den Thron gemacht. Welchen Teil von ›Du bist verflucht‹ verstehst du nicht?«
Er kneift seinen Mund zu einer schmalen Linie zusammen. Er weiß, dass ich recht habe. »Die Ratsmitglieder sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten sorgen, nicht um die fiebrigen letzten Worte einer Prophetin, denen es an Einzelheiten oder Zeitangaben mangelt. Schon morgen könnte ein Erdbeben, eine Flut oder ein herabfallender Stern uns alle auslöschen und das kümmert auch niemanden.«
»Das mag ja alles sehr logisch sein. Nur reagieren die Menschen genauso allergisch auf Logik wie ich auf Feenstaub, Prinzchen …«
Ohne jede Vorwarnung dreht er sich zu mir um und ich laufe beinah in ihn hinein. Der Saum seines Umhangs streift meine Füße. »Du willst doch nicht einmal, dass ich König werde. Warum sollte ich auf dich hören?«
Ich schlucke einen bitteren Klumpen in meiner Kehle hinunter. Weil er König sein wird. Ungeachtet dessen, ob es eine Panik gibt. Ungeachtet dessen, was der Rat denkt. Cyrus bekommt am Ende immer das, was er will. »Wir können unsere Energie entweder damit verschwenden, uns zu streiten, oder aber lernen zusammenzuarbeiten. Wir müssen uns nicht mögen, um die Lage in den Griff zu bekommen.«
»Was aber, wenn ich nicht mit dir zusammenarbeiten will?«
»Das musst du aber, eines Tages. Ich bin deine Seherin.«
»Das könnte ich ändern.«
Aus Gewohnheit lache ich, doch hinter seinen gesenkten Lidern blitzt es kalt hervor. Wir haben schon immer so gestritten wie jetzt und doch … Nein. Cyrus könnte mich gar nicht wegschicken. Er würde es nicht wagen, ein solches Exempel zu statuieren und eine Seherin ihres Amtes zu entheben. Nicht, wenn es nur so wenige von uns auf der Welt gibt.
Ich fahre mir mit der Zunge über die Lippen. »Du brauchst mich mehr, als du mich hasst.« Vielleicht eine etwas arrogante Aussage, aber der einzige Weg, ihn auf die Probe zu stellen.
Er zieht die Mundwinkel leicht nach oben. Das einzige Anzeichen, dass er diese Unterhaltung zumindest zum Teil genossen hat. »Ist das so?«
Er wendet sich wieder von mir ab. Ich beobachte ihn, wie er den Korridor entlang in Richtung Ratssaal geht. Ein Bediensteter verbeugt sich und öffnet die vergoldeten Türen, Cyrus betritt den Raum und verschwindet.
Die meisten der vierzehn Herzöge, aus denen sich der Rat zusammensetzt, oder aber ihre Stellvertreter sind bereits vor einer Woche zu der halbjährlich stattfindenden Ratssitzung eingetroffen. Mit jeder Menge Prunk und nur wenig Fortschritt streiten sie sich über Steuern und die Aufteilung der Drachengarde auf ihre jeweiligen Gebiete. Auveny ist die größte und wohlhabendste der drei Nationen des Sonnenkontinents – es ist der Republik Balica im Süden und dem Königreich Verdant jenseits des Feenwalds und den östlichen Gebirgen weit voraus. Unter den Amtsträgern des Landes befördert dieser Status eine Mischung aus Ehrgeiz und Bequemlichkeit. Zusätzlich rühmen wir uns damit, mit fairen Gesetzen und selbst Chancen für die ärmsten Untertanen ein vorbildliches Königreich zu sein.
Somit herrscht hier auch eine gehörige Menge Selbstgefälligkeit.
Zu viel heiße Luft, als dass es sich lohnen würde, sie zu belauschen, wie ich finde. Und wenn es doch etwas Interessantes geben sollte, spricht es sich ohnehin bald herum. Geheimnisse springen in der Sonnenstadt wie Flöhe durch die Gegend. Bei Angelegenheiten, die eine Seherin erfordern, ruft König Emilius ohnehin bald mich persönlich hinzu.
Nachdem Cyrus im Ratssaal verschwunden ist, warte ich in der oberen Bibliothek die Ergebnisse ab. Ich habe schon viele Nachmittage zwischen den sorgfältig ausgewählten Buchbänden verbracht. Ihre Inhalte mögen zwar unglaublich trocken sein, bieten mir aber zumindest eine Möglichkeit, die unbekannten Dinge, die ich in meinen Träumen sehe, zu benennen. Ich war selbst noch nie weit von den mit Flüssen durchzogenen Hügeln der Hauptstadt entfernt. Meine Pflichten halten mich hier und ich bemühe mich, stets anwesend zu sein, falls nach mir verlangt wird. Ich werde so schon genug kritisiert, ohne zur Liste meiner Unzulänglichkeiten noch faul hinzuzufügen.
Gerade blättere ich in einem Reisebericht eines berühmten yueanischen Entdeckers vom Mondkontinent, als ich mit einem Knall Türen auffliegen höre und daraufhin ein lautes Stimmengewirr vernehme. Es ist noch nicht einmal eine Stunde vergangen. Ich lege das Buch beiseite und folge dem Lärm und der immer größer werdenden Menschenmenge zum zentralen Empfangshof des Palasts, wo Lord Rasmuth der Siebte und Lord Ignacio der Dreizehnte miteinander streiten.
Letzterer stampft so heftig mit einem Fuß auf den Boden, dass ein paar Vögel aufgeschreckt davonfliegen. »Ich pfeife auf Effizienz«, brüllt Ignacio ihn an. »Auf dem Prinzen liegt noch immer ein Fluch! Ich werde ihn als König nicht befürworten, bis er eine Königin findet … und ich wage zu behaupten, selbst dann!«
Mit meinem langen schwarzen Zopf und dem schimmernden, fließenden Gewand steche ich trotz meines kleinen Wuchses aus der Menge hervor. In meiner Nähe richten immer mehr Leute ihre fragenden Blicke auf mich. Genau das wollte ich vermeiden.
Ich seufze laut, als sich die in einen Schal gehüllte Dame an meiner Seite zum dritten Mal zu mir wendet, als müsse sie noch den Mut aufbringen, mich anzusprechen. Nach dem vierten Seitenblick verbeugt sie sich kurz und wendet sich endlich an mich: »Sehende Meisterin, wird es nicht schon bald eine Hochzeit geben? Ihr habt doch gesagt …«
»Dass Seine Hoheit seiner Braut begegnen wird, bevor seine Reise endet«, fahre ich ihr über den Mund. »Doch nicht bevor sein Reiseabschnitt endet. Seine Reise ist wohl eindeutig noch nicht zu Ende.« Genau deshalb ist der genaue Wortlaut so wichtig.
Ich täusche Kopfschmerzen vor und ziehe mich zurück. Während ich mir einen Weg zurück in den Palast bahne, erkenne ich an den schockierten Mienen und dem Geflüster, wie die Wirkung meiner Antwort durch die Menschenmasse schwappt. Noch bevor es dunkel wird, werden die Neuigkeiten durch die ganze Stadt gesickert sein.
Cyrus’ Schritte hallen lauter als die der anderen in meiner Nähe wider. Sie geben jedermann zu verstehen, dass Seine Hoheit für den Moment keine Fragen beantworten wird. Seine Rockschöße flattern an mir vorbei, als er in Richtung des Palastflügels, in dem sich das Arbeitszimmer seines Vaters befindet, davonfliegt.
Ich kann nicht widerstehen, ihm hinterherzurufen: »Ich sage es ja nur ungern, Prinzchen … Ach, Blödsinn, ich sage es sogar sehr gerne. Ich habe dich gewarnt!«
Er hält nicht einmal inne, um mir einen finsteren Blick zuzuwerfen.
Cyrus’ rebellisches Verhalten bereitet uns beiden Unannehmlichkeiten. Ihm allerdings noch mehr als mir. König Emilius kennt die Launen seines Sohnes. In der Öffentlichkeit setzen die zwei zwar ein Lächeln auf, doch abgesehen davon streiten sie vielleicht sogar noch mehr als Cyrus und ich – wobei Cyrus nie gewinnt. Das weiß ich, weil ich noch nie erlebt habe, dass der König auch nur in irgendeinem Belang seine Meinung geändert hat.
Mich hat der König dagegen schon immer sehr geschätzt und genau deshalb kann Cyrus mich nicht ausstehen. Den Respekt seines Vaters muss man sich hart erkämpfen, was so selten passiert, wie einen Schatz aus den Tiefen einer Drachenhöhle zu rauben. Dieser Respekt wird mich sogar dann schützen, wenn Cyrus den Thron bestiegen hat. König Emilius wird selbst nach seiner Abdankung zumindest noch eine Hand in Auvenys Puppentheater mit im Spiel haben. Die Herzöge des Rates sind alle von ihm ernannt worden und Emilius somit treu ergeben. Dort liegt seine eigentliche Macht.
Schon bald nach der Rückkehr in meinen Turm legt sich der Abend einem Vorhang gleich über den Himmel. Ich genieße diese Stunden, in denen es schon zu spät ist, als dass jemand vorbeikommen und nach meinen Diensten fragen würde. Oben in meinem Schlafzimmer entfache ich ein Kaminfeuer und lasse mir ein kaltes Bad ein. Ich streife die Robe von meinen Schultern, knöpfe den Rock auf, ziehe mir die Bluse und das Unterkleid über den Kopf.
Ich wappne mich gegen die Kälte, tauche in die Wanne und wasche mich im Kerzenschein. Auf meiner durch die Seife inzwischen geschmeidigen Haut sind die alten Narben kaum noch zu erkennen. Vom parfümierten Wasser wird mein Haar schwer und legt sich wie eine dunkle Lache aus Tinte um mich.
Wer mich heute so sähe, würde niemals vermuten, dass ich als dürres Unkraut in einer ärmlichen Ecke des Mondviertels geboren wurde. Jetzt habe ich einen Turm für mich allein, mit einer Badewanne aus Porzellan und einem Bett aus Seide. Ich kann lesen und schreiben, esse so gut wie die Königsfamilie selbst und die Menschen verbeugen sich vor mir.
Und doch können weder Turm noch Titel den Menschen die Angst vor Dingen nehmen, die sie nicht verstehen. Wenn etwas so Fremdes wie Magie jemandem innewohnt, der ihnen so fremd ist wie ein Mädchen mit ausländischen Zügen, hatte ich nie eine Chance. Daran sollte ich wohl das nächste Mal denken, wenn ich dem Prinzen arrogante Sprüche zuwerfe. Auch wenn ich recht habe.
Als ich mich abgetrocknet habe, ziehe ich mein Nachthemd an und falle erschöpft ins Bett.
Als ich meine Augen schließe, klackert etwas im Stockwerk unter mir.
Dann noch einmal und immer wieder: Klack, klack, klack.
Knarzende Möbel? Ich runzle die Stirn.
Klack, klack, klack, klack.
Gekicher.
Mein Herzschlag dröhnt mir in den Ohren. Es gibt keinen Grund, warum ich nicht allein sein sollte. Ich schlüpfe aus dem Bett und greife nach dem erstbesten stumpfen Gegenstand, den ich im Dunkeln finden kann. Nach einem langstieligen Besen neben der Badewanne. Mit angehaltenem Atem tapse ich die Treppe hinunter. Vorsichtig, damit die Stufen nicht knarzen.
In der stockfinsteren Nacht laufe ich den Raum kreisförmig ab, taste mich an den Einbuchtungen der Wände entlang. Doch das einzige Geräusch kommt von meinen Füßen, die über den Boden schlurfen.
Niemand ist hier. Um mich zu beruhigen, frage ich trotzdem in die Dunkelheit hinein: »Wer ist da?«
Ich höre ein Zischen, wie wenn eine Zunge auf heißen Stahl trifft. Ich schwinge den Besen in einem weiten Bogen und treffe etwas Festes, das daraufhin scheppernd über den Boden schlittert.
Eine hölzerne Schale auf einem Tablett. Ich atme erleichtert aus.
Ein gurgelndes Lachen. Ha ha ha.
Vi…o…let.
Wieder wirbele ich den Stiel herum. Stolpere. Das Echo meines Namens hallt in meinem Kopf wider, direkt neben mir und nirgendwo zugleich.
Was für einen passenden
Namen
du hast,
Vi…o…let.
Die Worte überlagern sich – viele Stimmen, die ineinanderfließen. Mein Herz pocht wild. Dieser Klang ist nicht von dieser Welt.
Widerliche
Vi…o…let.
Violet vom Mond.
Ich kenne die Stimmen, obwohl ich sie noch nie zuvor gehört habe. So vertraut wie ein Instinkt, so intim wie ein Teil meiner Seele. »Wer seid ihr?«, frage ich, obwohl ich die Antwort kenne.
Zwei fahle Lichter flackern ein Stück entfernt in der Dunkelheit auf. Ich bekomme keine Luft. Nichts in diesem Raum gibt solch ein Licht von sich.
Wir sind es, die dir deine Macht verleihen, Miststück.
Schützend halte ich den Besen vor mich und nähere mich mit zittrigen Schritten den Lichtern, wobei ich darauf achte, nicht auf das umgeworfene Tablett zu treten. Ich erkenne nun, was vor mir steht: der Gabenbrunnen, in den meine Besucher zum Dank ihre Mitbringsel und Münzen werfen. Und auf dessen Spitze thront eine Statue ohne Gesicht, zu der sie manchmal beten.
Ehemals ohne Gesicht.
Seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe, ist ihre kupferblaue Oberfläche so abgenutzt und glatt, dass die Figur kaum noch als solche erkennbar ist. Geschweige denn als eines der Schicksale. Ihr einziger Wert liegt in ihrem Alter, denn angeblich ist sie uralt, beinah so alt wie die erste Seherin.
Doch als ich näher komme, formt sich die Statue zu einer Frau, voll kühler Gelassenheit und in ein Gewand gehüllt, das wie ein Wasserfall an ihr herabfließt. Blaue Flammen flackern in ihren Augen. Aus ihrem Mund ergießt sich ein Chor aus Worten:
Sieben Jahre gewonnen,
ein Leben hast du uns genommen.
Den gekrönten Jungen gerettet,
der sonst uns gehört hätte.
Dich dem Tod widersetzt,
um in deinem Turm zu leben.
Die Zeit ist gekommen,
die Schuld zu begleichen.
In mir steigen Erinnerungen hoch. Der Prinz, wie er über den Marktplatz des Mondviertels rennt. Ich, wie ich ihn von der heranrollenden Kutsche wegziehe. Wir waren noch Kinder. Damals. Felicita lebte noch. So lange ist es her. »Ich verstehe nicht.« Jede Ader in meinem Körper pulsiert, ist sich einer Gefahr bewusst, die ich nicht einordnen kann. »Ist das eine Drohung?«
Dem Schicksal zu trotzen hat seinen Preis.
Ein Leben hast du uns genommen.
Der Junge muss sterben,
bevor der Sommer endet.
Oder du wirst brennen.
»Aber warum? Ich habe doch nichts …« Mein Griff um den hölzernen Besenstiel bebt, der einzige Halt, den ich noch habe. Meine Füße sind taub geworden.
Der Junge muss sterben.
Jede Geschichte muss ENDEN.
Ein Windstoß fegt durch den Raum oder habe ich mir das Ganze nur eingebildet? Ist Felicita so verrückt geworden? Ich kann doch nicht ernsthaft mit den Göttern sprechen. Das ist unmöglich.
Die Stimmen schwellen so ohrenbetäubend an, dass sie den ganzen Raum einnehmen:
DIE ZEIT IST GEKOMMEN.
ENDLICH. ENDLICH.
BLUT UND ROSEN UND KRIEG.
Ich ramme die Spitze des Besenstiels in die Statue. Ihr Oberkörper fällt klirrend zu Boden. Schwarze Ranken schießen aus dem Marmor empor und legen sich wie Spinnennetze über das Innere des Brunnens. Ein Kichern hallt von den Wänden wider. Ich fasse mir an den Kopf und wimmere gequält.
Ich werde verrückt. Das ist völlig verrückt. Auf der Suche nach einem Weg, um das Gelächter zu stoppen, krabbele ich über den Boden und schneide mir an einem Marmorsplitter eine Hand auf. Bei dem stechenden Schmerz schreie ich auf. Ein Blitzschlag erhellt den Raum und dabei erbebt dieser wie von Gotteshand getroffen.
DU BIST JEWEDER LIEBE NICHT WERT, DIE DICH RETTEN KANN.
Rauch dringt in meine Lungen.
Der Turm geht in Flammen auf.
Nach Luft ringend wache ich auf und habe noch den Geruch von frischer Asche in der Nase. Meine Hände sind um meinen Hals geschlungen, meine Beine haben sich in den Laken verheddert. Eine kurze, weiß glühende Sekunde lang versengt das Feuer weiter meine Haut. Noch ein Wimpernschlag, dann ist die Nacht wieder dunkel und kalt. Die Edelsteine, die über mir in die Zimmerdecke eingelassen sind, zwinkern mir zu, unverändert, als wüssten sie, was ich gesehen habe.
Langsam lockere ich den Griff um meine Kehle.
War es eine Prophezeiung oder …? Was soll es sonst gewesen sein, Einbildung? Es wirkte so real.
Es hat sich anders angefühlt als alle Prophezeiungen, die ich sonst je hatte. Noch nie haben sie direkt zu mir gesprochen.
Noch nie haben sie mich bedroht.
Ich trete die Bettdecke mit den Füßen davon, klettere aus dem Bett und streife mit zitternden Händen meine Robe über. Ein kühler Luftzug strömt meine Knie hinauf, als ich die Balkontür aufstoße und mich gegen die Brüstung lehne. Die Dämmerung bricht an. Unter mir schimmern die schuppigen Dächer der Sonnenstadt den ganzen Weg bis hin zur Stadtmauer hinab. Dahinter fällt die Landschaft zu schattigen Tälern ab.
»Was wollt ihr von mir?«, rufe ich dem Himmel zu.
Nichts und niemand antwortet. Womöglich, weil ich nicht an den Einfluss der Schicksale glaube, nicht wirklich. Und was tun Gottheiten schon den lieben langen Tag, außer die belanglosesten Gründe zu finden, beleidigt zu sein?
Nebel kräuselt von meinem Atem empor wie Rauch. Die Erinnerung an Felicitas Prophezeiung beunruhigt mich am meisten: Blut und Rosen und Krieg. Wenn die Prophezeiung wahr ist … Wenn sie unmittelbar bevorsteht …
Warum sollte es damit zusammenhängen, dass ich Cyrus vor sieben Jahren gerettet habe?
Warum wollten die Schicksale, dass er stirbt?
Die Menschen glauben, weil ich die Gabe des Sehens besitze, bin ich automatisch eine Botin der Götter. Als würde ich diese Kräfte verstehen oder wissen, wie die Magie funktioniert. In meinen Träumen habe ich Zeitalter durchquert und jetzt höre ich Stimmen …
Doch ich weiß nie warum.
Wenn die Schicksale unsere Zukunft wirklich in den Händen halten, dann verstehe ich nicht zu welchem Zweck. Hier in Auveny glauben die Menschen, dass sie über uns richten. Dass sie, wenn wir großzügig, ehrlich, nachsichtig, versöhnlich und nicht zu geschwätzig sind, unsere Zukunftsfäden so flechten, dass wir Liebe finden und für die Güte unseres Herzens entlohnt werden. Alle kennen die Geschichten von der gutherzigen Müllerstochter, die reich heiratet, der Magd, die aus der Bestie den Mann herauslockt, von dem treu ergebenen Fräulein, das in den Turm gesperrt auf seinen Retter wartet.
Doch ich glaube an nichts, das annimmt, mich besser zu kennen als ich mich selbst.
Ich kann besser lügen als prophezeien und ich glaube weder, dass das, wofür wir bestimmt sind, irgendeinen Grund hat, noch glaube ich an eine gerechte Welt. Ich glaube an Wölfe, an Hochstapler und an Männer mit Kronen, die sich ihrer Boshaftigkeit rühmen, als sei es eine Begabung. Die einfach das verschlingen, was ihnen gehört, ohne ein Urteil abzuwarten. Sie wissen, dass die Zukunft nichts anderes ist als eine Wette mit gezinkten Würfeln, aber dann können sie die Würfel auch gleich selbst zinken.
Die Zukunft wird schon lange von den Königen und deren Herzögen geschrieben, indem sie lügen und lächeln. Das ist eine Macht, die ich verstehe. Und zwar besser als jede körperlose Stimme in der Dunkelheit.
Ich schließe meine Augen und rufe mir die Worte erneut ins Gedächtnis: Der Junge muss sterben, bevor der Sommer endet. Oder du wirst brennen.
Oder. Wenn es keine Drohung ist, dann ist es eine Wahl.
Vorausgesetzt er stirbt, kann ich mich also retten.
Ich umklammere das Geländer, meine Knöchel werden weiß. Noch sind es nur Worte, noch war es nur ein Albtraum.
Niemand muss davon erfahren.
Ich werfe einen letzten Blick in den stillschweigenden Himmel, wende mich wieder dem Turm zu und schließe die Balkontüren hinter mir.
2
Als ich wieder aufwache, finde ich Blutspuren auf meinem Laken. Meine Regel hat früher eingesetzt als erwartet. Eine unangenehme Überraschung an einem ohnehin schon fürchterlichen Morgen. Ich ziehe die Bettwäsche ab und lege sie zusammengerollt in einen Korb, wo das Zimmermädchen sie abholen wird.
Ein Stockwerk tiefer steht die Statue wieder unversehrt und gesichtslos auf dem Gabenbrunnen. Sie fühlt sich stumpf an. Dann muss ich letzte Nacht wohl doch geträumt haben, was mich allerdings nur noch mehr beunruhigt.
Meine Träume werden immer wahr.
Ich verhülle die Statue mit einem Tuch.
Mein Blick schweift durch den Raum, in dem ich meine Lesungen abhalte. Er sieht genauso aus wie gestern, enthält also nicht viel, lediglich einen Tisch und Stühle für meine Lesungen, eine kleine Sitzecke mit Teppich und einen Kamin. Vor Jahren habe mich bemüht, Ordnung in das Chaos zu bringen. Die Sehenden, die hier gewohnt haben, haben über die Jahrhunderte jede Menge Krempel angehäuft und die Menschen fürchten sich zu sehr davor, versehentlich Gotteslästerung zu betreiben, um irgendetwas wegzuwerfen. Ich tat das Nächstbeste und stopfte alles, was ich selbst nicht gebrauchen konnte, in die Schränke, um es nie wieder hervorzuholen.
Draußen läutet eine Glocke. Ich blinzele. Ein Gedanke will an die Oberfläche dringen. Irgendetwas vergesse ich.
Der nächste Glockenschlag. Klong.
Oh, oh. Mein wöchentliches Treffen mit dem König …
Klong.
Verdammt. Ich strecke den Kopf aus dem Fenster. Ein weiterer Schlag ertönt vom Glockenturm und weitere acht werden der Position der Sonne nach zu urteilen noch folgen.
Ich habe verschlafen. Ich komme zu spät.
Verdammter Albtraum, verdammte … was auch immer das war. Ich stimme dem Prinzen nur ungern zu, aber ich habe wirklich Dringenderes zu tun, als mich um kryptische Warnungen zu sorgen, die bei Tageslicht tatsächlich etwas lächerlich erscheinen. König Emilius wird mir vielleicht nicht mit Flammen drohen, aber sein Blick kann jede Rose seines Gartens verwelken lassen, wenn er enttäuscht ist.
Und ich enttäusche ihn nie.
Schnell kämme ich mir das Haar und stecke es nach hinten. Ich habe keine Zeit, es zu flechten. Ich streife mir ein sauberes Kleid und meine Robe über, die momentan in einem hellen, wolkenlosen Blauton schimmert. Die Robe der Sehenden, ein auvenisches Erbstück, wurde der Legende nach aus einem Stück Himmel gewebt und die Farben des Stoffes spiegeln die des Firmaments über der Stadt wider.
Noch dazu hat sie sehr weite Ärmel. Ich schnappe mir zwei kalte Brötchen vom Herd, schiebe mir eins in den Mund und das andere in einen der besagten Ärmel. So die Sterne es wollen werde ich hoffentlich nicht auf die Füße Seiner Majestät krümeln, was aber allemal besser wäre, als einen knurrenden Magen zu haben.
Ich eile zum Palast hinüber. Erst als ich die Gärten zur Hälfte hinter mir habe, bemerke ich, dass mir zu viele unbekannte Gesichter auf den gepflasterten Wegen begegnen. Es sind auch mehr Wachen unterwegs als sonst, die allerdings eher gemächlich dahinschlendern, ganz so, als drohte keine unmittelbare Gefahr.
Entgeht mir sonst noch etwas?
Ich folge dem Fluss der Passanten zur Vorderseite des Palasts, wo eine gut gekleidete, lärmende Menschentraube den Eingang blockiert.
Aus der noch größeren Ansammlung vor dem äußeren Tor lassen die Wachen ein paar wenige Leute passieren.
Mein Blick fällt auf ein unruhig herumzappelndes Mädchen am Fuße der Eingangstreppe, das mir jung genug erscheint, um sich einschüchtern zu lassen. Räuspernd neige ich mich zu ihr. »Worauf warten all diese Leute?«
»O… oh! Sehende Meisterin!« Das Mädchen macht hektisch einen Knicks. Ihr Kleid ist schlicht, aber von guter Qualität. Sie ist keine Adelstochter, zumindest keine, die mir bekannt ist. Wenn die Wachen Bürgerliche hereinlassen, muss eine öffentliche Audienz bevorstehen. »Der Prinz hat etwas zu verkünden, das den Ball betrifft.«
»Den was?«
»Den Ball. Habt Ihr die Flugblätter nicht gesehen? Sie machen überall in der Stadt die Runde.«
Sie hält ein Stück Papier hoch und ich rupfe es ihr aus der Hand. Darauf stehen nur ein paar wenige Informationen:
ALLE SIND ZU DER
Maskierten Menagerie
GELADEN
Am 11. Tag von Annesolöffnet der Palast um 19 Uhr seine Türen,um ein Spektakel zu enthüllen.
Junge Damen sind herzlichst erwünscht.Feinste Abendgarderobe erbeten, Maske vorgeschrieben.Auch unser Prinz wird anwesend sein.
Das also ist gestern Abend bei Cyrus’ Unterredung mit seinem Vater herausgekommen: ein Notfallball.
»Danke.« Ich unterdrücke ein breites Grinsen und gebe dem Mädchen das Flugblatt zurück. Damit wäre wenigstens eines meiner Probleme gelöst.
In den Palast muss ich trotzdem noch. Also bahne ich mir einen Weg durchs Gedränge. Köpfe drehen sich und Füße treten beiseite, als die Menschen sehen, wer ich bin, und mich durchlassen.
Zwischen den Zuschauern im Audienzsaal ist weniger Platz als für den Mörtel zwischen Mauersteinen und es ist so heiß, dass einem die Haut kribbelt. Es herrscht ein verschwitztes Dickicht aus Federhüten und den pastellfarbenen Rüschen der neuesten Mode. Alle wollen mit ihrer übertrieben opulenten Aufmachung Eindruck schinden. Manche haben sogar ihre Feen mitgebracht, die die Hitze gar nicht gut vertragen. Ohnmächtig liegen sie auf den Hutkrempen ihrer Besitzer und schimmern nur blass statt golden.
Einst haben die Feen bloß gutherzige Bettler, denen es an Glück mangelte, gesegnet und wurden jenseits des Feenwalds nur selten gesichtet. Magische Wesen lieben es, allerlei Dinge zu horten, und Feen lieben es, die besten Menschen zu horten. Auch wenn man böse Blicke erntet, es derart zu formulieren. Heute folgen die Feen jedem, der buchstäblich auf einem Haufen Ambrosia sitzt, dem flüssigen Goldnektar der Feenglöckchen, mit dem Feen sich gern betrinken. Einst wuchsen Feenglöckchen nur im Feenwald, doch König Emilius erkannte den Bedarf an Zaubern und ermutigte die Bauern von Auveny, ungeachtet ihres Ursprungs den Anbau der Pflanze zu erlernen. Seither ist sie das größte Handelsgut unserer Wirtschaft.
In den oberen Vierteln der Sonnenstadt kann man keinen einzigen Schritt machen, ohne einem der winzigen Wesen zu begegnen, die fiepsend umhersausen und Feenstaub herabrieseln lassen. Ein menschliches Herz kann so verdorben sein wie ein modriger Kürbis. Doch mit ein paar Tropfen Ambrosia wirkt eine Fee immer nur zu gern einen Zauber für dich, damit jedes Härchen sitzt, dein Lachen wie Musik klingt und dein Kleid so grandios ist, dass es nicht einmal durch die Türen des Ballsaals passt. Nur die Reichsten können es sich leisten, täglich eine Fee auf Abruf zu haben. Ich kann sehen, auf welchen Anwesenden solch ein Zauber liegt, weil ihnen die Schminke nicht vom Gesicht läuft.
Wer braucht schon ein gutes Herz? Das ist etwas für hässliche, arme Leute.
König Emilius sitzt am Rande der Bühne, hält die Hand auf seinen Gehstock gestützt und ist augenscheinlich in gesünderer Verfassung, als ich ihn seit Wochen gesehen habe. Meine Schultern entspannen sich vor Erleichterung, als er den Kopf neigt und mir zulächelt. Er hat nicht auf mich gewartet. Ich tue es ihm gleich und stoße beinah mit den weit ausgestellten Ärmeln einer Zuschauerin zusammen.
Prinzessin Camilla ist von ihren Zofen umringt ebenfalls anwesend. Sie ist kaum zu übersehen: Ihr Aussehen zieht einen genauso in den Bann wie Cyrus’, denn immerhin sind sie Zwillinge, doch durch ihre blassgold gefärbten Locken wirkt sie noch strahlender. Sie ist einen Fingerhut größer als er und wären da nicht ihre Muskeln, die sie sich in Schwertkämpfen und auf Jagdausflügen antrainiert hat, würde man sie als grazile Schönheit bezeichnen.
Als sie sieht, wie ich mich aus dem Gedränge befreie, lächelt sie, nimmt meine behandschuhten Arme und hakt sich bei mir unter, sodass wir dicht genug nebeneinander stehen, um so etwas wie eine private Unterhaltung zu führen. »Eine Brautsuche für meinen kleinen Bruder. Er ist fürwahr erwachsen geworden.« Sie ist gerade mal eine halbe Stunde älter. »Die Zeit vergeht so schnell.«
Ich suche den Raum nach dem einzigen anderen freundlichen Gesicht ab, das noch anwesend sein könnte. »Dante ist nicht hier?« Er sollte noch einfacher zu entdecken sein als Camilla, schließlich gibt es nur wenige Balicaner am Hof, aber ich entdecke weder seine schlaksige Figur noch seine chaotische schwarze Lockenmähne.
»Ich dachte, ihr würdet zusammen kommen.«
Ich dachte, er würde Cyrus nicht von der Seite weichen. Nun, da Cyrus zurück ist, wird Dante wieder sein Freund sein, nicht meiner. Ein weiterer Grund, mir zu wünschen, der Prinz wäre von einem Drachen verschlungen worden, anstatt zurückzukehren. Dante ist der Einzige, dem ich vielleicht von letzter Nacht erzählen würde.
Die Menge verstummt. Ich wende meine Aufmerksamkeit wieder der Bühne zu.
Cyrus hat das Podium betreten. Er trägt einen eleganten violetten Mantel, dessen Revers ein Muster aus Sonnenstrahlen ziert, und scheint kein bisschen zu schwitzen. »Willkommen«, beginnt er und setzt ein charmantes Lächeln auf, als spiegele es seine Natur.
All die jungen Damen, die Flugblätter an sich pressen, drängen nach vorn und gegen die Samtkordeln, die sie abgrenzen. Ringsum zieht sich die Luft im Saal zu einem einstimmigen, schmachtenden Seufzer zusammen.
Bei den Göttern, ich verabscheue es, wie leicht ihm das fällt.
Cyrus beginnt seine Rede ganz harmlos und schildert seine Rundreise durch den Kontinent. Er lobt die Entwicklung der Grenzgebiete, berichtet von der herzlichen Begrüßung am Hof von Balica und Verdant und erzählt lachend von der Begegnung mit ein paar verirrten Feen auf dem Weg in die Stadt.
»Kommen wir jetzt zum Ball …«
»Eure Hoheit«, unterbricht ihn eine raue Stimme vom Balkon aus. »Sosehr wir uns über die Feierlichkeiten freuen, haben wir doch alle eine Hochzeit erwartet, keinen Ball. Was ist geschehen?«
Ich blicke nach oben und runzele meine Stirn. Ich habe ihren Namen vergessen, weiß aber, dass eben Lord Ignacios neueste Ehefrau gesprochen hat. Will sie etwa in seinem Namen Unruhe stiften?
König Emilius winkt das Gesagte mit einer faltigen Hand ab und bedeutet Cyrus fortzufahren. Doch der Prinz lächelt nur noch breiter und einnehmender. »Nichts ist geschehen. Ich bin vielen reizenden Damen begegnet, jedoch keiner Königin. Die Menschen haben auf etwas gehofft, das nicht gewiss war. Vielleicht solltet Ihr nicht alles glauben, was die Seherin sagt.«
Er durchbohrt mich vom anderen Ende des Raums mit seinem Blick: eine Drohung. Verunsichertes Gemurmel geht wie eine Welle durchs Publikum, einschließlich eines »Oh, Cyrus, nicht doch« der Prinzessin.
Hitze steigt mir ins Gesicht. So eine hohle Knallkröte. »Seine Hohei…«, beginne ich.
Doch nur wenige halten daraufhin mit ihrem Geschwätz inne und meine Worte gehen unter.
Knurrend löse ich mich von Camilla und dränge mich nach vorn, bis ich direkt unter dem Podium und dem spöttisch dreinblickenden Prinzen stehe. Es fiel schon immer schwer, mir wie und wann ich es wollte Gehör zu verschaffen oder gesehen zu werden. Seit ich aus den Armenvierteln in den Turm der Sehenden gezogen bin, hat niemand am Hof je aufgehört, von mir zu erwarten, einfach still und bescheiden dazustehen, als dulde man meine Anwesenheit hier nur aus reiner Barmherzigkeit, als wäre dies nicht mein wahrer Platz. Dabei gehöre ich weitaus mehr hierher als sie.
Unverfroren zu sein, ist das Einzige, was ich kann. Ich weigere mich, mir auf irgendeine andere Weise Respekt zu verdienen. »Seine Hoheit …«, hebe ich also erneut an, diesmal lauter, und die Stimmen verstummen, »wird seiner wahren Liebe begegnen, noch bevor seine Reise endet, wie ich es vorhergesagt habe. Er möchte mich nur für seine Trödelei verantwortlich machen. Vielleicht würde seine Reise ja schneller enden, wenn er meine Weisheit nicht ständig hinterfragen würde.«
»Vielleicht würde ich sie nicht hinterfragen, wenn das, was Ihr vorherseht, präziser wäre«, erwidert Cyrus, noch bevor das Gelächter verebbt. Unsere öffentlichen Auseinandersetzungen kennen die Menschen nur zu gut. »Wisst Ihr überhaupt, wo meine sogenannte Reise endet?«
»Nicht in Eurem Hinterteil. Also solltet Ihr Euren Kopf vielleicht wieder daraus entfernen.«
Gelächter schwappt durch das Publikum. Camilla prustet förmlich los. Währenddessen bilden sich auf Cyrus’ Gesicht rote Flecken.
»Hexen und Prinzen, wie Hund und Katze«, kichert jemand.
König Emilius ist keine Spur zornig und trommelt nur mit einem Finger auf der Armlehne herum. »Ich nehme an, damit wollen mein Sohn und meine Seherin sagen, dass die Liebe nicht für jeden von uns einfach zu finden ist. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich sie mit meiner liebsten Merchella erlebt habe, solange sie unter uns weilte. Mögen die Sterne ihre Seele geleiten. Die wahre Liebe wird uns vor der Dunkelheit bewahren. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren.« König Emilius schließt den Mund zu einer ehrfürchtigen Linie.
Der Saal ist gebändigt. Der Prinz und ich blicken in unterschiedliche Richtungen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Cyrus noch vor Ende des Jahres den Platz seines Vaters einnehmen will. Sein Charme mag ihm ja zu den Ohren herausgucken, aber den Untertanen flößt er nur ein Quäntchen der Ehrfurcht ein, die sein Vater ihnen gebietet.
Als die Stille zu einem Abgrund zu werden droht, schnaubt Camilla verärgert und geht auf das Podium zu. »Zeit, den liebreizenden Prinzen zu retten«, raunt sie. Mit einer wedelnden Handbewegung scheucht sie Cyrus fort. Camilla Lidines Auftreten ist nicht mit dem ihres Bruders zu vergleichen. Sie versteht und begrüßt die Reaktion auf ihr Erscheinen.
Als sie Cyrus nun so an die Seite rangiert hat, breitet sie ihre Arme aus, um das Wort an ihr Publikum zu richten. »Lasst uns zum vergnüglichen Teil kommen, mein liebes Volk von Auveny: zum Ball. Zur Maskierten Menagerie.«
Zustimmendes Brummen erfüllt den Raum. »Vorzüglicher Name, nicht wahr? Meine Idee, versteht sich. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, welch wundersame Wesen in dieser Menagerie zur Schau gestellt werden.« Sie rollt ihre Schultern und ein paar Flügel scheinen sich hinter ihrem Rücken zu entfalten: ein Umhang mit dem Abbild eines Schwans. »Wir natürlich!«
Ahs und Ohs erklingen.
»Tragt eure schönsten, gewagtesten Kleider, die prächtigsten Masken, die ihr herbeizaubern könnt. Füllen wir den Palast mit den Kreaturen unbekannter Länder. Beeindruckt mich. Aber noch viel wichtiger, beeindruckt meinen Bruder. Wenn ihr ihm ins Auge fallt, wer weiß …« Die Menge buht. »Ein Kuss auf die Hand? Auf die Wange? Könnt ihr ihm mit eurem Charme sogar einen Ring abluchsen?« Euphorisches Kreischen. Für einen Sekundenbruchteil vergisst Cyrus seine übliche Rolle zu spielen und stöhnt hörbar auf. »Wie aufregend, meint ihr nicht? Noch Fragen?«
Alle Hände schnellen in die Höhe. Die Aufmerksamkeit treibt Camilla an. Sie wird diesen Zirkus so lange wie nur möglich hinauszögern. Cyrus scheint sich seinem derzeitigen Schicksal ergeben zu haben, denn seine Augen wirken beinah vollkommen leer und sein Lächeln zu Eis erstarrt.
Ich habe ebenfalls genug von dem Lärm, doch anders als Cyrus muss ich nicht länger verweilen. So leicht ich hereingekommen bin, bahne ich mir auch einen Weg zurück zur Tür. Die geifernde Menschenmenge schließt begierig die von mir freigegebene Lücke. Nur dem Anstand ist es zu verdanken, dass der Boden noch frei von Sabber ist.
Draußen schütze ich meine Augen vor der gleißenden Mittagssonne und den grellen Marmorwänden des Palasts, die so weiß sind wie an ihrem ersten Tag. Von Weitem gleicht der Palast einer strahlenden Krone, die über den ziegelgedeckten Dächern der stufenförmig angelegten Sonnenstadtviertel thront.
Am Tor entdecke ich das Gesicht, das ich in der Menschenmenge gesucht habe.
»Dante!«, rufe ich ihm zu. »Du hast das Beste verpasst.«
Auf den ersten Blick würde man nicht vermuten, dass jemand mit einer so ungepflegten Erscheinung wie Dante Esparsa der beste Freund des Prinzen ist. In seinem lockeren Hemd und mit dem mit einer Pfauenfeder geschmückten Hut, den Cyrus ihm geschenkt hat, ist er viel legerer als die anderen gekleidet. Dazu glitzern Amethysten an seinen Ohren und eine Schärpe in den gleichen Tönen der Juwelen schmiegt sich um seine Taille. Genau wie ich findet er keinen Gefallen an der pastelligen Mode der Hauptstadt und trägt lieber kräftigere Farben, die seinen erdigen Hautton perfekt ergänzen. Papierbögen quellen aus einer Tasche über seiner Schulter – vermutlich Dokumente für seine Arbeit. Wenn er nicht gerade Kurse an der Universität besucht, übersetzt er Texte für die Palastbibliothek.
Seine Wurzeln sind gar nicht mal so bescheiden, denn er ist der Adoptivsohn eines ehemaligen balicanischen Staatsoberhaupts. Würde sich die Republik von Balica etwas aus Adelstiteln machen, hätte Dante wohl auch einen Titel. Allerdings meidet er all das höfische Gehabe ohnehin lieber. »Hätte ich das Bedürfnis, den ganzen Tag bevormundet zu werden, wäre ich bei meiner Großmutter geblieben«, waren einmal seine Worte dazu. Seit seiner frühen Jugend lebt er teils in Balica, teils in Auveny. Ursprünglich hat er Botschafter werden wollen, bis ihm die Politik dann doch zu große Kopfschmerzen bereitet hat. Ein Jammer, denn er gehört zu den Menschen, die sich glänzend mit allen verstehen, sofern er das will. Was er, wie sich herausgestellt hat, für gewöhnlich aber nicht tut.
Aus irgendeinem Grund hat er sich vor Jahren, als ich nach einem Lehrer suchte, mit mir angefreundet, obwohl ich alles andere als nette Gesellschaft bin. Vielleicht verstehen wir uns aber auch genau deshalb so gut. Manchmal braucht man einfach jemanden, bei dem man sich über alles beschweren kann.
Dante läuft mir entgegen und klemmt sich seinen Hut unter den Arm, als wir beide gemeinsam die Mitte des Innenhofs erreichen. »Sagen wir mal so: Wenn die Ankündigung vorbei ist, bin ich gerade rechtzeitig gekommen.«
»Wo warst du?«
»Mein Onkel reist heute ab. Musste ihn mit einem Mittagessen bestechen, damit er ein paar Briefe für die Familie für mich mitnimmt.« Ein gemächlicher Ritt bis zur balicanischen Grenze kann gut zwei Wochen dauern. Sein Onkel wird eine Weile unterwegs sein. »Also, was habe ich verpasst, hmm?« Dante klatscht die Hände zusammen. »Was für Gräueltaten hat Camilla diesmal begangen?«
Wir spazieren zu den westlichen Gärten, wo weniger los ist. Ein Mosaik aus Sonnenstrahlen ziert den Weg unter unseren Füßen und ich berichte ihm von der Bekanntgabe des Balls. Zarte grüne Triebe ragen aus der umgegrabenen Erde frisch gepflanzter Beete hervor. Ein Strauch in Löwengestalt zeigt uns sein aufgerissenes Maul, als wir unter seinen geschwungenen Pfoten hindurchlaufen.
Dante tippt nachdenklich mit dem Daumen an sein Kinn. »Hat Cyrus irgendetwas von seiner Reise erzählt? Etwas Besorgniserregendes?«
»Zum Beispiel?«
»Späher haben am Rand des Feenwalds verrottende Bäume entdeckt.«
»Im Elften Herzogtum. Schon gehört. Auch dass sie die Stellen abbrennen woll… Oh. Das ist in der Nähe von Balica, nicht wahr? Dort sind sie von der Idee wahrscheinlich nicht gerade begeistert.«
Er verzieht das Gesicht. »Das sind sie tatsächlich nicht.«
Offiziell herrscht zwischen Auveny und Balica seit zwei Jahrhunderten Frieden. Allerdings gab es auch immer wieder Streitigkeiten, die vor allem den Feenwald im Herzen des Sonnenkontinents betreffen. Er ist das letzte noch herrenlose Gebiet, ein verworrenes Geflecht knorriger Bäume und dornigen Gestrüpps. Für die meisten Lebewesen ist er unbewohnbar – abgesehen von den seltsamsten Wesen wie den Feen, die ihm seinen Namen geben.
Balica ist der Feenwald heilig. Auveny behandelt ihn hingegen wie einen Haufen wuchernden Unkrauts, der uns eines Tages verfluchen wird, wenn wir ihn zuvor nicht abfackeln.
Die Fäulnis ist nicht einmal das eigentliche Problem – auch wenn manche befürchten, dass sie das Grundwasser verunreinigen könnte. Sie symbolisiert vielmehr, wie unberechenbar der Feenwald ist. Er verhält sich nicht wie ein Wald. Die Jahreszeiten lassen ihn unberührt und die Pflanzen darin wachsen, wie und wann es ihnen beliebt. Manche behaupten, er sei nicht einmal ein Wald, sondern Magie in Form von Bäumen, die sich verwandeln und alles nach ihrem Gutdünken erschaffen kann. An der Grenze erzählt man sich Geschichten von Schemen, die im Schatten des Waldes flackern, von unwiderstehlichen verzauberten Früchten, die einem den Tod bringen, von Dingen, die nicht existieren sollten, die einen Moment erscheinen und im nächsten verschwinden.
Und doch brennt der Feenwald wie ein ganz normaler Wald, was sich Auveny, ohne mit der Wimper zu zucken, zunutze macht, um ihn zu bändigen – oder ihn zu erobern, je nachdem, wen man fragt. Die vier neuesten Herzogtümer waren zu Beginn von König Emilius’ Herrschaft noch Teil des Feenwalds. Balica hat den König bereits gewarnt, nicht zu weit zu gehen, doch er besteht darauf, dass der Feenwald eine Gefahr darstellt und ausgelöscht werden muss. Er hat erst vor acht Jahren nachgegeben, als die Warnungen ausuferten und es zu Auseinandersetzungen kam. Ein isolierter Vorfall, seit dem die Lage jedoch angespannt bleibt.
»Meinst du, wir sollten ihn nicht verbrennen?« Ich hole das kalte Vanillebrötchen hervor, das ich in meinem Ärmel deponiert hatte, rupfe ein großes Stück ab und halte es Dante hin, doch er lehnt ab.
»Nur weil uns der Wald fremd ist, ist er noch lange nicht gefährlich. Das Problem ist, dass er wirklich gefährlich sein könnte … und zwar gefährlicher, als wir ahnen. Auf der letzten Etappe seiner Reise ist Cyrus an dem verfaulten Waldstück vorbeigekommen. Von der Straße aus sieht man davon nichts, also ist er direkt bis zum Rand des Feenwalds gegangen und sah dort überall verstreut Rosen liegen.«
Ich verschlucke mich an meinem Bissen.
Dante schlägt mir kräftig auf den Rücken. »Alles in Ordnung?«
Blut und Rosen und Krieg. Japsend huste ich Krümel hervor. »Rosen? Stinknormale Rosen? Prophetische Rosen?«
»Hier, bleib erst mal am Leben …« Er reicht mir die Flasche von seinem Gürtel. »Hab irgendwie gehofft, du wüsstest das vielleicht. Hast du in letzter Zeit irgendwas geträumt?«
Ich verschlucke mich beinah wieder, als ich aus der Flasche trinke. Ich habe in Betracht gezogen, ihm von letzter Nacht zu erzählen, doch wenn diese Omen wahr sind … Es ist eine Sache, zu hoffen, dass Dante mich davon überzeugen kann, es sei ein Albtraum gewesen, eine ganz andere jedoch, wenn ich ihm erzähle, dass sein bester Freund dem Untergang geweiht ist.
»Nein, aber ich mache mir trotzdem Sorgen.« Ich wische mir möglichst langsam über den Mund, um Zeit zu schinden. »Es ist ein … Bauchgefühl. Großes geschieht meist auf einen Schlag. Da ist seine Krönung, dieser Ball …«
»Cyrus glaubt, Lord Denning habe die Rosen absichtlich dort platziert, um Gerüchte zu verbreiten. Es waren keine ganzen Sträucher, nur Knospen und Blüten. Aber sie waren frisch und ich bezweifle, dass da draußen jemand einen riesigen Rosengarten pflegt. Wo sind sie also hergekommen? Cyrus hat die Späher bestochen, damit sie dichthalten. Aber wenn doch etwas Prophetisches aus dem Feenwald auftaucht …«
»Dann sollte er wissen, dass er bei der Wahl seiner Braut nicht so stur sein sollte.«
Dante schnaubt. »Er hat schon seine Gründe, aber du hast recht.« Er blickt an mir vorbei zum Palast. »Hmm, wenn man vom Teufel spricht …«