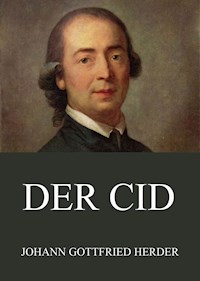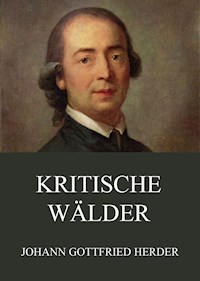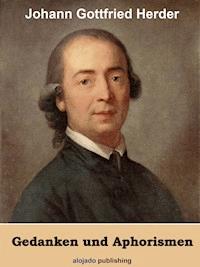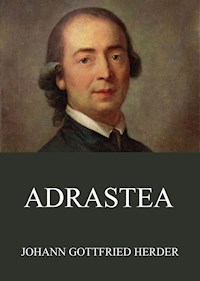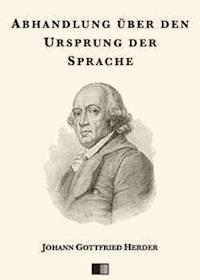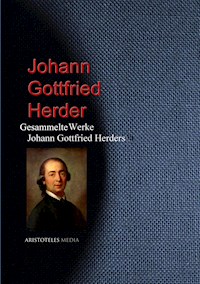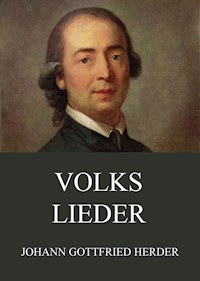
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Zeit seines Lebens wollte Herder beweisen, dass echte Poesie die Sprache der Sinne ist. Seine sorgfältig ausgewählten und übersetzten Volkslieder sollten dies einem breiten Publikum vermitteln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volkslieder
Johann Gottfried Herder
Inhalt:
Johann Gottfried Herder – Biografie und Bibliografie
Erster Theil
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Zweiter Theil
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch.
Volkslieder, J. G. Herder
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849627720
www.jazzybee-verlag.de
Dieses Werk bzw. Inhalt und Zusammenstellung steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz. Die Details der Lizenz und zu der Weiterverwertung dieses Werks finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/. Der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon wurden der TextGrid-Datenbank entnommen, wo der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon ebenfalls unter voriger Lizenz verfügbar sind. Eine bereits bestehende Allgemeinfreiheit der Texte bleibt von der Lizensierung unberührt.
Johann Gottfried Herder – Biografie und Bibliografie
Einer der hervorragendsten und einflußreichsten Schriftsteller und Denker Deutschlands, ward 25. Aug. 1744 zu Mohrungen in Ostpreußen als Sohn des Kantors, Glöckners und Schullehrers Gottfried H. und dessen zweiter Ehefrau, Anna Elisabeth Pelz, geboren und starb 18. Dez. 1803 in Weimar. Die Verhältnisse seiner Eltern waren bescheiden und beschränkt, nicht aber so dürftig, daß sie auf eine bessere Erziehung ihrer Kinder und namentlich des Knaben, dessen Begabung früh zutage trat, durchaus hätten verzichten müssen. H. besuchte die Stadtschule und wurde zum Studium der Theologie bestimmt. Die unfreundliche und willkürliche Einmischung des Diakonus S. F. Trescho, der Herders Eltern zu bestimmen suchte, den Knaben ein Handwerk lernen zu lassen, kreuzten die künftigen Lebenspläne. Trescho nahm den Knaben als Famulus in sein Haus, mißbrauchte jedoch seine Kräfte zu allerhand unwürdiger Arbeit, so daß es für H. eine Erlösung aus bittern Leiden war, als sich ein russischer Regimentschirurg erbot, ihn zur Erlernung der Chirurgie nach Königsberg und später nach Petersburg mitzunehmen. H. langte im Hochsommer 1762 in der ostpreußischen Hauptstadt an, und da er alsbald erkannte, daß er für den von seinem Beschützer in Aussicht gestellten Beruf gänzlich ungeeignet sei, ließ er sich 10. Aug. als Studiosus der Theologie immatrikulieren. An dem Buchhändler Kanter, dem er sich schon von Mohrungen aus durch Zusendung des »Gesanges an Cyrus« empfohlen hatte, gewann er einen hilfreichen Gönner; durch seine Anstellung als Lehrer an der Elementarschule des Collegium Fridericianum ward er der drückendsten Not rasch überhoben und überließ sich rückhaltlos seinem Bildungsdrang. Bedeutenden Einfluß auf die geistige Entwickelung des Jünglings übte von den Universitätslehrern nur Kant, außerhalb der Universitätskreise aber der »Magus aus Norden«, der originelle J. G. Hamann aus. Unter den Einwirkungen seiner mannigfaltigen und ausgebreiteten Lektüre war keine tiefer, sein ganzes Wesen bestimmender als die der Schriften J. J. Rousseaus. Im Herbst 1764 ward H. als Kollaborator an die Domschule nach Riga berufen, später auch als Pfarradjunkt an der Jesus- und an der Gertraudenkirche angestellt, so daß er in der alten Hauptstadt Livlands, die sich damals noch fast republikanischer Selbständigkeit erfreute, einen ausgebreiteten und nicht unwichtigen Wirkungskreis fand. Die Kreise des städtischen Patriziats erschlossen sich dem jungen vielversprechenden Mann, der sich in ihnen mancher Anregung und eines bis dahin ungekannten Lebensgenusses erfreute. Unter so günstigen Umständen eröffnete H. mit den »Fragmenten über die neuere deutsche Literatur« (Riga 1766–67), dem Schriftchen »Über Thomas Abbts Schriften. Der Torso von einem Denkmal, an seinem Grab errichtet« (das. 1768) und den »Kritischen Wäldern« (das. 1769) seine große literarische Laufbahn. Indem er darauf hinwies, daß die literarischen Erzeugnisse aller Nationen durch den besondern Genius der Volksart und Sprache bestimmt sind, und indem er die »kritische Betrachtungsweise Lessings durch seine eigne genetische ergänzte«, gewann H. seine selbständige Stellung in dem großen Kampf der Zeit. Die Angriffe gegen die seichte und verächtliche Clique der Klotzianer waren nur Konsequenzen seiner Anschauungen. Gleichwohl hatte sich H. Klotz und den Seinen gegenüber Blößen namentlich durch die Ableugnung der Autorschaft der »Kritischen Wälder« gegeben und ward, wie im spätern Leben noch oft, in ärgerliche Händel verwickelt, die ihm selbst das Behagen an seiner sonst so günstigen Stellung in Riga verleideten. Starker Reisedrang und das Verlangen, sich für eine künftige große Wirksamkeit (die er sich mehr als eine praktische, denn als eine literarische dachte) allseitig vorzubereiten, veranlaßten H., im Frühling 1769 seine Entlassung zu begehren, die man ihm gewährte in der Hoffnung, daß er zurückkehren werde. Im Juni d. J. trat er eine große Reise an, die ihn zunächst zu Schiff nach Nantes führte, von wo er im November nach Paris ging. Weil er sich rasch überzeugen mußte, daß es nicht möglich sein werde, mehrjährige Reisen nur mit Unterstützung seiner Freunde durchzuführen, war ihm der Antrag des fürstbischöflich lübeckischen Hofes in Eutin, den Erbprinzen Peter Friedrich Wilhelm als Reiseprediger zu begleiten, ganz willkommen. Anfang 1770 kam er nach Eutin und brach im Juni d. J. von dort mit dem Prinzen auf. Noch vor der Abreise hatte ihn ein Ruf des Grafen Wilhelm von Lippe in Bückeburg erreicht; gleich darauf lernte H. in Darmstadt seine nachmalige Gattin, Maria Karoline Flachsland (s. unten), kennen. Eine rasch gefaßte und erwiderte Neigung nährte in H. den Wunsch nach festen Lebensverhältnissen. Er folgte dem Prinzen nur bis Straßburg, begehrte vom eutinischen Hof seine (im Oktober gewährte) Entlassung, nahm die vom Grafen zur Lippe angetragene Stellung als Hauptprediger der kleinen Residenz Bückeburg und als Konsistorialrat an, blieb aber dann um einer (leider mißglückten) Augenoperation willen den Winter in Straßburg und knüpfte hier die freundschaftlichen Beziehungen zu dem um fünf Jahre jüngern Goethe an. Ende April 1771 trat H. seine neue Stellung in Bückeburg an. Sein Verhältnis zu dem Landesherrn des kleinen Ländchens, dem berühmten Feldherrn Grafen Wilhelm, ward bei aller Achtung, die der durch und durch soldatische und an keinen Widerspruch gewöhnte Fürst ihm zollte, kein erfreuliches. Auch als Graf Wilhelms Gemahlin, die liebenswürdige fromme Gräfin Maria, sich H. in herzlicher Verehrung anschloß, betrachtete dieser den Aufenthalt in Bückeburg als ein Exil. Doch wurden ihm diese Jahre durch die Liebe seiner im Mai 1773 heimgeführten Gattin und durch die reichen Ergebnisse seiner Studien verschönt. Die Zeit des Bückeburger Aufenthalts war für H. die eigentliche Sturm- und Drangperiode. Mit der geistvollen, von der Berliner Akademie preisgekrönten Abhandlung »Über den Ursprung der Sprache« (Berl. 1772), die er noch in Straßburg begonnen, den beiden Aufsätzen über »Of sian und die Lieder alter Völker« und über »Shakespeare« in den fliegenden Blättern »Von deutscher Art und Kunst« (Hamb. 1773; Neudruck von Lambel, Stuttg. 1893) und der Schrift »Ursache des gesunkenen Geschmacks bei den verschiedenen Völkern, da er geblühet«, trat er in den Mittelpunkt der Bewegung, die eine aus dem Leben stammende und auf das Leben wirkende, echte Natur atmende Dichtung wiedergewinnen wollte. Mit der Schrift »Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit« (o. O. [Riga] 1774) erklärte er der prahlerischen und öden Aufklärungsbildung des Jahrhunderts den Krieg. Rief schon diese Arbeit die entschiedensten Widersprüche, ja Herabsetzungen und Verlästerungen Herders hervor, so war dies in noch höherm Grade der Fall bei seinen theologischen und halbtheologischen Schriften, der »Ältesten Urkunde des Menschengeschlechts« (Riga 1774–76, 2 Tle.), den »Briefen zweener Brüder Jesu in unserm Kanon« (Lemgo 1775), den »Erläuterungen zum Neuen Testament, aus einer neueröffneten morgenländischen Quelle« (Riga 1775) und den 15 Provinzialblättern »An Prediger« (1774). Die Angriffe, die er erfuhr, veranlaßten ihn, seine schon zum Druck vorbereitete Sammlung der »Volkslieder« zurückzuhalten. Sie brachen ihm den Entschluß des Weiterwirkens nicht, aber sie steigerten eine hypochondrische Reizbarkeit und ein dämonisches Mißtrauen, die in Herders Seele früh erwacht waren. H. verhandelte eben wegen einer Berufung an die Universität Göttingen, als er durch Goethes freundschaftliche Bemühungen im Frühjahr 1776 als Generalsuperintendent, Mitglied des Oberkonsistoriums und erster Prediger an der Stadtkirche nach Weimar berufen wurde. Sein Weggehen von Bückeburg folgte dem Tode seiner Gönnerin, der Gräfin Maria, fast auf dem Fuß. Am 2. Okt. 1776 trat H., der besten Erwartungen und des besten Wissens voll, in Weimar ein. Obschon er hier die denkbar freundlichste Aufnahme fand, so blieben doch auch Mißhelligkeiten nicht aus. Da H. wahrzunehmen glaubte, daß in dem engern Kreise des Herzogs eine gründliche Gleichgültigkeit, ja verächtliche Geringschätzung gegen Kirche und Schule vorherrschte, vertrat er nicht nur, was sein gutes Recht war, deren Interessen aufs kräftigste und eifrigste, sondern setzte sich in Opposition gegen nahezu alle Meinungen, Richtungen und Neigungen jenes Kreises. Und so gewiß Weimar eine große Verbesserung Bückeburg gegenüber heißen durfte, so fühlte sich H. von der Kleinlichkeit und Enge auch vieler weimarischer Verhältnisse gedrückt. Dennoch wirkte die veränderte Lage günstig auf ihn, und seine literarische Produktivität nahm einen großen und immer gewaltigern Aufschwung. Der Läuterungsprozeß, durch den sich die hervorragendsten Repräsentanten des Sturmes und Dranges in die Hauptträger der deutschen klassischen Literatur verwandelten, nahm auch bei H. zu Ausgang der 1770er Jahre seinen Anfang. Die bedeutsame philosophische Abhandlung »Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume« (Riga 1778), die »Plastik. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Traum« (das. 1778) und die Herausgabe der »Lieder der Liebe« (Leipz. 1778) sowie der längst vorbereiteten »Volkslieder« (erst später von Johannes v. Müller »Stimmen der Völker in Liedern« betitelt, das. 1778–79) waren seine ersten von Weimar aus in die Welt gesandten Publikationen. Die von der Münchener Akademie preisgekrönte Abhandlung »Über die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker in alten und neuen Zeiten« (1778) galt einem neuen Nachweis, daß echte Poesie die Sprache der Sinne, erster mächtiger Eindrücke, der Phantasie und der Leidenschaft, daher die Wirkung der Sprache der Sinne allgemein und im höchsten Grade natürlich sei, eine Wahrheit, welche die mit umfassender Literaturkenntnis ausgewählten, lebendig nach- und anempfundenen, z. T. vorzüglich übersetzten »Volkslieder« eben weiten Kreisen zum Bewußtsein brachten.
Einen höchst glücklichen Einfluß auf Herders weitere geistige Entwickelung übte seit den ersten 1780er Jahren das wiederhergestellte innige Verhältnis Herders und seines Hauses zu Goethe. H. trat in den regsten Gedankenaustausch zu dem jüngern Freund, und während er seinen Weg unter dessen bewundernder Teilnahme weiter verfolgte, steigerte sich sein Gefühl für Schönheit und Klarheit des Vortrags, selbst sein poetisches Ausdrucksvermögen durch den reinen Formensinn Goethes. In ebendiesen 80er Jahren entstand beinahe alles, was Herders immer genialem Wirken durch innere Reise und äußere Vollendung bleibende Nachwirkung sicherte. Bezogen sich die »Briefe, das Studium der Theologie betreffend« (Weim. 1780–1781, 4 Tle.) und eine Reihe von vorzüglichen Predigten auf Herders Amt und nächsten Beruf, so leitete das große, leider unvollendet gebliebene Werk »Vom Geiste der Ebräischen Poesie« (Dessau 1782–83, 2 Tle.; hrsg. von Hoffmann, Gotha 1891) von der Theologie zur Poesie und Literatur hinüber. Aus der tiefsten Mitempfindung für die Naturgewalt, die Frömmigkeit und eigenartige Schönheit der hebräischen Dichtung wuchs ein Werk hervor, von dem Herders Biograph (R. Haym) mit Recht rühmt,-daß es »für Kunde und Verständnis des Orients Ähnliches geleistet wie Winckelmanns Schriften für das Kunststudium und die Archäologie«. 1785 aber begann H. die Herausgabe seines großen Hauptwerkes, der »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« (Riga 1784–91, 4 Bde.), die endliche Ausführung eines Lieblingsplans, die breitere Ausführung von Gedanken, die er längst in kleinern Schriften in die Welt gesandt hatte, und wiederum die energische Zusammenfassung alles dessen, was er über Natur und Menschenleben, die kosmische Bedeutung der Erde, über die Aufgabe des sie bewohnenden Menschen, »dessen einziger Daseinszweck auf Bildung der Humanität gerichtet ist, der alle niedrigen Bedürfnisse der Erde nur dienen und selbst zu ihr führen sollen«, was er über Sprachen und Sitten, über Religion und Poesie, über Wesen und Entwickelung der Künste und Wissenschaften, über Völkerbildungen u. historische Vorgänge gedacht und (wie seine Gegner erinnerten) geträumt hatte. Die Aufnahme des Werkes entsprach dessen großem Verdienst (vgl. Grundmann, Die geographischen und völkerkundlichen Quellen und Anschauungen in Herders. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit', Berl. 1900). Gleichzeitig veröffentlichte H. die Sammlung seiner »Zerstreuten Blätter« (Gotha 1785–97, 6 Tle.), in der eine Reihe der schönsten Abhandlungen und poetischen Übersetzungen die Geistesfülle und sittliche Grazie des Schriftstellers in herzgewinnender Weise offenbarte. Seiner Verehrung für Spinoza, in der er sich mit Goethe eins fühlte, gab er Ausdruck in den Gesprächen, die er 1787 u. d. T. »Gott« veröffentlichte.
Einen großen Abschnitt in Herders Leben bildete die Reise, die er 1788–89 nach Italien unternahm. Freilich wirkten seine hypochondrische Reizbarkeit und mancherlei ungünstige Zufälle zusammen, ihn eigentlich nur in Neapel zum Vollgenuß dieser Reise kommen zu lassen; doch empfing er bedeutende und bleibende Eindrücke, die vielleicht noch günstigere Folgen gehabt hätten, wenn ihn nicht in Italien eine abermalige ehrenvolle und vielverheißende Berufung nach Göttingen erreicht und die schwere Frage des Gehens oder Bleibens in Weimar ihn während der Rückreise gequält hätte. Goethe, von der Erwägung ausgehend, daß der Freund dem Kathederärger in Göttingen noch weniger gewachsen sein werde als dem Hof- und Konsistorialärger in Weimar, wirkte für Herders Bleiben und konnte im Einverständnis mit dem Herzog Tilgung der Herderschen Schulden, Gehaltsverbesserungen und mancherlei tröstliche Verheißungen für die Zukunft bieten. H. ließ sich mit einem gewissen Widerwillen zum Bleiben bestimmen, und beide Freunde sollten dieser Entscheidung nur kurze Jahre froh werden. Herders Gesundheitszustand war bloß vorübergehend gebessert, körperliche Leiden brachen ihm Lebenslust und Arbeitskraft; der fünfte Teil der »Ideen« blieb ungeschrieben, und bereits die »Briefe zur Beförderung der Humanität« (Riga 1793–97, 10 Sammlungen) trugen die Farbe seines verdüsterten Geistes. Die materiellen Sorgen im Herderschen Hause hatten sich leider nur vorübergehend gemildert, und die nur halb gerechtfertigten Ansprüche, die H. und seine Gattin auf Grund der Abmachungen von 1789 erhoben, führten zu einem unheilbaren Bruch mit Goethe. H. hatte schon zuvor mit reizbarer Eifersucht die wachsende Intimität zwischen Goethe und Schiller betrachtet. So trat allmählich ein Zustand der Isolierung und kränklich verbitterten Beurteilung alles ihn umgebenden Lebens bei H. ein. Die geistigen Gegensätze, in denen er sich zur Philosophie Kants, zur klassischen Kunst Goethes und Schillers fand, verstärkte und verschärfte H. gewaltsam und ließ sie in seinen literarischen Arbeiten mehr und mehr hervortreten. Zwar gab er, sowie er auf neutralem Gebiet stand, auch jetzt noch Vorzügliches und Erfreuliches. Dem Unterrichtswesen widmete er fortwährend eine liebevolle Teilnahme, die besonders in seinen formvollendeten und inhaltreichen Schulreden zum Ausdruck kam. Seine »Terpsichore« (Lübeck) 795), die den vergessenen neulateinischen Dichter Jakob Balde wieder einführte, seine »Christlichen Schriften« (Riga 1796–99, 5 Sammlungen), in denen das unbeirrteste Gefühl für den eigentlichen Kern des Christentums den schönsten und maßvollsten Ausdruck fand, seine Aufsätze für Schillers »Horen« bewährten den alten Herderschen Geist. Aber voll grimmer Bitterkeit und dazu mit unzulänglichen Waffen bekämpfte H. in der »Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft« (Leipz. 1799, 2 Tle.) die Philosophie und in der »Kalligone« (das. 1800) die Ästhetik Nants, voll absichtlicher Verkennung und unwürdiger Lobpreisung des Abgelebten und Halben richtete seine »Adrastea« (das. 1801–03, 6 Tle.) alle ihre versteckten Spitzen gegen die lebendige, schönheitsfreudige Dichtung Goethes und Schillers. Nur die Qual eines Zustandes, der ihn tief niederdrückte, und in dem er sich selbst bald als »dürrer Baum und verlechzte Quelle«, bald als »Packesel und blindes Mühlenpferd« schilderte, konnte diese letzte verhängnisvolle Wendung seiner literarischen Tätigkeit entschuldigen. Letzte Erquickung bereitete ihm, dessen körperliche Kraft mehr und mehr erlag, die poetische Arbeit an seinen »Legenden«, an der Übertragung der Romanzen vom »Cid« (s. d., S. 149) und an den dramatischen Gedichten: »Der entfesselte Prometheus« und »Admetus' Haus«. Die Annahme eines vom Kurfürsten von Bayern 1802 ihm verliehenen Adelsdiploms bereitete H. schweren Ärger, und seine endliche Ernennung zum Präsidenten des Oberkonsistoriums (1801) kam zu spät, um ihm Lebensmut zurückzugeben. In den Sommern 1802 und 1803 suchte er Heilung in den Bädern von Aachen und am Egerbrunnen; im Herbst des letztgenannten Jahres erfolgte ein neuer heftiger Anfall seines unheilbaren Leberübels, dem er im Winter erlag. Sein Grabdenkmal in der Stadtkirche zu Weimar trägt die Aufschrift: »Licht, Liebe, Leben«; vor der Kirche wurde ihm 1850 ein ehernes Standbild (von Schaller) errichtet.
Mannigfach rätsel- und widerspruchsvoll, ungleicher in seinen Leistungen als seine großen Zeitgenossen, aber unvergleichlich reich, vielseitig, voll höchsten Schwunges und schärfster Einsicht, eine Fülle geistigen Lebens in sich tragend und um sich erweckend, steht H. in der deutschen Literatur. In der großen Umbildung des deutschen Lebens am Ende des 18. Jahrhunderts hat er mächtiger und entscheidender eingegriffen als einer, und die Spuren seines Geistes lassen sich in der Literatur im engern Sinn, in Fachwissenschaften und Spezialzweigen, die aus seinen Anregungen hervorgegangen sind, überall nachweisen. Die Forderung der »Humanität«, der Heranbildung und Läuterung zum vergöttlichten Menschlichen, ist der durchgehende Grundgedanke in der Vielheit und Mannigfaltigkeit seiner Schriften. Bei allen seinen Gaben war ihm die künstlerische Gestaltungskraft versagt, so daß er als Dichter nur in einzelnen glücklichen Momenten und auf dem Gebiete der didaktischen Poesie zu wirken vermochte. Die Verbindung seines eignen ethischen Pathos mit Stimmungen und Gefühlen, die ihm aus der Dichtung der verschiedensten Zeiten und Völker ausgingen, war nie ohne Reiz; sein Verdienst als poetischer Übersetzer, als Aneigner und Erläuterer fremden poetischen Volksgeistes kann kaum zu hoch angeschlagen werden Die große Zahl von Herders poetischen Übertragungen aus den verschiedensten Sprachen, ihre Auswahl und die Resultate, die H. jedesmal aus ihnen zog, haben einer allgemeinen, über die »Gelehrtengeschichte« der vorausgegangenen akademischen Perioden hinauswachsenden Literaturgeschichte den Boden bereitet. Neben den »Volksliedern«, dem »Cid«, den Epigrammen aus der griechischen Anthologie, den Lehrsprüchen aus Sadis »Rosengarten« und der ganzen Reihe andrer Dichtungen und poetischer Vorstellungen, die Herders anempfindender Geist für die deutsche Literatur gewann, stehen jene morgenländischen Erzählungen, jene Paramythien und Fabeln, die H. im Wiedererzählen benutzt, um Momente seiner eignen sittlichen Anschauung, seiner Humanitätslehre beizugesellen, und die hierdurch wie durch ihre Vortragsweise zu seinem geistigen Eigentum werden. Höher aber als der Dichter steht überall der Prosaiker H., der große Kulturhistoriker, Religionsphilosoph, der feinsinnige Ästhetiker, der produktive Kritiker, der glänzende Essayist, der gehaltreiche und in der Form anziehende Prediger und Redner. Es ist Herders eigenstes Mißgeschick gewesen, daß die großen Ergebnisse seines Erkennens und Strebens rasch zum Gemeingut der Bildung, seine Anschauungen zu Allgemeinanschauungen wurden, so daß es erst der historischen und kritischen Zurückweisung auf die Genialität, die seelische Tiefe und den verschwenderischen Gedankenreichtum der Herderschen Schriften bedurfte, um das größere Publikum zu ihnen zurückzuführen.
Herders »Sämtliche Werke« erschienen zuerst in einer von J. Georg Müller, Johannes v. Müller und Heyne unter Mitwirkung von Herders Witwe und Sohn veranstalteten Ausgabe (Cotta, Stuttg. 1805–20, 45 Bde.; Taschenausg. mit den Nachträgen, das. 1827–1830, 60 Bde., und 1852–54, 40 Bde.). Die Entfremdung des Publikums veranlaßte die »Ausgewählten Werke« in einem Band (Cotta, Stuttg. 1844), ferner »Ausgewählte Werke«, hrsg. von Ad. Stern (Leipz. 1881, 3 Bde.), die des Cottaschen Verlags (mit Einleitung von Lautenbacher, Stuttg. 1889, 6 Bde.) und die in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur« (Stuttg. 1886 ff.); besonders gelungen ist die Auswahl der Werke in der gut kommentierten Ausgabe von Th. Matthias in der Klassikerbibliothek des Bibliographischen Instituts (Leipz. 1903, 5 Bde.). Vollständigkeit erstrebten die Ausgabe in der Hempelschen »Nationalbibliothek« (Berl. 1869–79, 24 Tle., mit Biographie von Düntzer) und die große kritische, von Suphan geleitete Ausgabe von »Herders sämtlichen Werken« (das. 1877–99, 32 Bde., wovon noch Bd. 14 fehlt). Auf Grund der letztern Ausgabe gaben Suphan und Redlich »Herders ausgewählte Werke« (Berl. 1884–1901, 5 Bde.) heraus. Eine ungekrönte Preisschrift Herders: »Denkmal Joh. Winckelmanns«, von 1778 veröffentlichte Alb. Duncker (Kassel 1882). Sammlungen von Briefen Herders veranstalteten Düntzer und Ferd. Gottfr. v. Herder in den Werken: »Aus Herders Nachlaß« (Frankf. 1856 bis 1857, 3 Bde.), »Herders Briefwechsel mit seiner Braut« (das. 1858), »Herders Reise nach Italien« (Gießen 1859) und »Von und an H.« (Leipz 1861–1862, 3 Bde.); O. Hoffmann gab Herders Briefwechsel mit Nicolai (Berl. 1887) und Herders Briefe an Hamann (das. 1889) heraus.
Von biographisch-kritischen Schriften über H. sind außer den von seiner Gattin gesammelten »Erinnerungen« (s. unten) und dem von seinem Sohn Emil Gottfried v. H. verfaßten »Lebensbild« (Erlang. 1846 bis 1847, 3 Bde.) zu erwähnen: Danz und Gruber, Charakteristik J. G. v. Herders (Leipz. 1805); ferner: H. Döring, Herders Leben (2. Aufl., Weim. 1829); »Weimarisches Herder-Album« (Jena 1845); Jegor v. Sivers, H. in Riga (Riga 1868) und Humanität und Nationalität, zum Andenken Herders (Berl. 1869); Joret, H. et la renaissance littéraireen Allemagne (Par. 1875); namentlich aber das biographische Hauptwerk: R. Haym, H. nach seinem Leben und seinen Werken (Berl. 1880–85, 2 Bde.), eine Meisterleistung streng sachlicher und zugleich liebevoller Lebensdarstellung und Beurteilung. Vgl. außerdem A. Werner, H. als Theologe (Berl. 1871); J. G. Müller, Aus dem Herderschen Hause, Aufzeichnungen 1780–1782 (hrsg. von J. Bächtold, das. 1881); Bärenbach, H. als Vorgänger Darwins und der modernen Naturphilosophie (Berl. 1877); Lehmann, H. in seiner Bedeutung für die Geographie (das. 1883); J. Böhme, H. und das Gymnasium (Hamb. 1890); Kühnemann, Herders Persönlichkeit in seiner Weltanschauung (Berl. 1893) und Herders Leben (Münch. 1894); Franke, H. und das Weimarische Gymnasium (Hamb. 1894); O. Hoffmann, Der Wortschatz des jungen H. (Berl. 1895); Bloch, H. als Ästhetiker (das. 1896); Tumarkin, H. und Kant (Bern 1890); Schaumkell, H. als Kulturhistoriker (Ludwigslust 1902); Genthe, Der Kulturbegriff bei H. (Jena 1902); Wiegand, H. in Straßburg, Bückeburg und in Weimar (Weim. 1903); Bürkner, H., sein Leben und Wirken (Berl. 1903).
Herders Gattin Maria Karoline, geborne Flachsland, geb. 28. Jan. 1750 zu Reichenweier im Elsaß, gest. 15. Sept. 1809 in Weimar, lebte nach ihres Vaters Tode bei ihrer Schwester in Darmstadt, wo sie H. kennen lernte, der sich 1773 mit ihr verheiratete. Nach Herders Tode ordnete sie dessen literarischen Nachlaß und schrieb: »Erinnerungen aus dem Leben Herders« (hrsg. von J. G. Müller, Stuttg. 1820, 2 Bde.; neue Ausg. 1830, 3 Bde.). Der älteste Sohn, Wilhelm Gottfried v. H., geb. 1774 in Bückeburg, studierte in Jena Medizin, ward 1800 Provinzialakkoucheur und 1805 Hofmedikus in Weimar, wo er 1806 starb. Er schrieb: »Zur Erweiterung der Geburtshilfe« (Leipz. 1803) und nahm teil an der Herausgabe der Werke seines Vaters. Der dritte und jüngste, Emil Gottfried v. H., war bis 1839 bei der Regierung für Schwaben und Neuburg tätig und starb als bayrischer Oberforst- und Regierungsrat 27. Febr. 1855 in Erlangen. Er gab in »Herders Lebensbild« (s. oben) eine liebevolle Darstellung des Lebens und Wirkens seines Vaters. Ein Enkel Herders, G. Th. Stichling, war weimarischer dirigierender Staatsminister und starb 22. Juni 1891.
Erster Theil
Allen Leuten ich nicht kann
Zu Dank sprechen noch soll.
Mein Buch hörte nie der Mann,
Dem es alles behagte wohl. –
Wer künnt bringen an Einen Sinn,
Die da Gott gescheiden hat,
Der wär nützer denn ich bin.
Vorrede zum Sachsenspiegel.
Zeugnisse über Volkslieder
Die Volkspoesie, ganz Natur, wie sie ist, hat Naivetäten und Reize, durch die sie sich der Hauptschönheit der künstlichvollkommensten Poesie gleichet.
Montagne B. 1. Kap. 54.
– – Sind Blumen, nicht, die feine Kunst
Auf Beeten zog, in Sträusser zierlich band,
Sind Blumen, die Natur, die gute Mutter,
Auf Hügel, Thal und Ebnen ausgoß.
Milton.
Nie hörte ich den alten Gesang Percy und Duglas, ohne daß ich mein Herz von mehr als Trompetenklang gerührt fand. Und doch war's nur irgend von einem blinden Bettler gesungen mit nicht rauherer Stimme als Versart – – –
Philipp Sidney.
Ein gewöhnlicher Volksgesang, an dem sich der gemeine Mann ergötzet, muß jedem Leser gefallen, der nicht durch Unwissenheit oder Ziererey sich jeder Unterhaltung unfähig gemacht hat. Die Ursache ist klar: Die nähmlichen Naturgemählde, die ihn dem gemeinsten Leser empfehlen, werden dem feinsten als Schönheit erscheinen – – –
Addison Zuschauer N. 70.
Lord Dorset, der wizigste Kopf, zugleich der redlichste Mann und einer der besten Kritiker und feinsten Dichter seiner Zeit, hatte eine grosse Anzahl alter Balladen und fand an ihnen groß Vergnügen. Das nehmliche kann ich von Dryden und einigen der feinsten Schriftsteller unsrer Zeit anführen – –
Addis. Zusch. N. 85.
Der gelehrte Selden war recht verliebt, diese alten Gesänge zu sammlen. Er fing die Pepys'sammlung an, die, bis 1700 fortgesetzt, über 2000 Stücke enthält – – – und pflegte überhaupt zu sagen, daß Dinge der Art das treuste Bild der Zeiten und den wahren Geist des Volks enthielten, so wie man »an einem in die Luft geworfenen leichten Strohhalm eher sehen könne: woher der Wind komme? als an einem schweren grossen Steine.« – S. Percy' Vorrede seiner Reliques of Anc. Engl. Poetry, hin und wieder, wo er auch die Namen Shenstone, Wharton, Garrik, Johnson, die besten neuern Köpfe Englands, als Beförderer und Liebhaber dieser Sammlung oft anführet.
***
Musika ist eine halbe Disciplin und Zuchtmeisterin, so die Leute gelinder und sanftmüthiger, sittsamer und vernünftiger machet. Die Musika ist eine schöne herrliche Gabe Gottes und nahe der Theologie. – – –
– Und sprach ferner darauf, wie gehet's doch zu, daß wir in Carnalibus so manche feine Poemata, und in Spiritualibus da haben wir so faul kalt Ding' und recitirte einige deutsche Lieder: den Turnier von den vollen u.f.
Luthers Tischreden.
Alle Nation haben ihre Zungen und Sprachen in Regeln gefasset, auch in ihre Kroniken und Handelbücher verzeichnet, wo etwas ehrlichs und mannlichs gehandelt, oder etwas künstlichs und höflichs ist geredt worden von den Ihren. Allein wir Deutschen sind Deutschen, haben solchs vergessen, das Unser geringe geachtet, wie ehrlich es auch gewesen, und auf andrer Leute und fremder Nation Wesen, Sitten und Geberde gegaffet, gleich als hätten unsere Alten und Vorfahren nie nichts gehandelt, geredet, gesetzt und geordnet, das ihnen ehrlich und rühmlich nachzusagen wäre. –
Agrikola Vorr. zu seinen deutschen Sprüchwörtern. 1530.
Gluck bemerkte, was die Zuhörer am meisten zu empfinden schienen, und da er fand, daß die planen und simplen Stellen die meiste Wirkung auf sie thaten: so hat er sich seit der Zeit beständig beflissen, für die Singstimme mehr in den natürlichen Tönen der menschlichen Empfindungen und Leidenschaften zu schreiben, als den Liebhabern tiefer Wissenschaft, oder grosser Schwierigkeiten zu schmeicheln; und es ist anmerkenswerth, daß die meisten Arien in seiner Oper Orpheus so plan und simpel sind, als die Engländischen Balladen.
Er ist dafür, die Musik zu simplificiren; und statt mit grenzenloser Erfindungskraft und Fähigkeit die eigensinnigsten Schwierigkeiten hervorzubringen, und seine Melodien mit buhlerischen Zierrathen zu verbrämen, thut er alles mögliche, seine Muse nüchtern und keusch zu erhalten.
Burneys Musik. Reise Th. 2. S. 195.175.
Lord Marschall hatte sich eine Sammlung von Nazionalmelodien gemacht, von fast allen Völkern unter der Sonnen. Er hatte fast bei jedem Stück eine Anekdote. Er erzählte mir auch von einem Bergschotten, welcher allemal weinte, wenn er eine gewisse langsame schottische Melodie spielen hörte.
Burney Th. 3. S. 85. 87. 88.
Sie würden auch daraus lernen, daß unter jedem Himmelsstriche Dichter geboren werden, und daß lebhafte Empfindungen kein Vorrecht gesitteter Völker sind. Es ist nicht lange, als ich in Ruhigs Litthauischem Wörterbuche blätterte, und am Ende der vorläufigen Betrachtungen über diese Sprache eine hierher gehörige Seltenheit antraf, die mich unendlich vergnügte. Einige Litthauische Dainos, oder Liederchen, nehmlich wie sie die gemeinen Mädchen daselbst singen. Welch ein naiver Witz! Welche reizende Einfalt!
Leßing in Litter. Br. Th. 2. S. 241. 242.
Keine Nazion in der Welt müste, meines Erachtens, einen reichern Schatz an Ueberbleibseln dieser Art aufzuweisen haben, als unsre nordische, vornemlich die Dänische, wenn wir erst einmal anfingen, so aufmerksam auf unsre eignen Vortheile zu werden, als es die meisten andern auf die ihrigen sind. Wir haben schon jezt eine ganze Sammlung alter lyrischer Gedichte, unter dem Namen Kiämpe-Viiser: nur Schade, daß die schätzbarsten Stücke aus ihren ursprünglichen Runen in das neuere Dänische übergetragen, und folglich um ein grosses Theil ihres Ansehens gekommen sind, u.s.w.
Gerstenberg. Br. über Merkw. d. Litt. St. 1. S. 108.
Wer nicht liebt Weib, Wein und G'sang,
Der bleibt ein Narr sein Lebenlang.
Luther.
Die Fortsezung künftig.
Erstes Buch
1. Das Lied vom jungen Grafen
Deutsch
Aus dem Munde des Volks in Elsaß. Die Melodie ist traurig und rührend; an Einfalt beinah ein Kirchengesang.
Ich steh auf einem hohen Berg,
Seh 'nunter ins tiefe Thal,
Da sah ich ein Schifflein schweben,
Darinn drey Grafen sass'n.
Der allerjüngst, der drunter war,
Die in dem Schifflein sass'n,
Der gebot seiner Lieben zu trinken
Aus einem venedischen Glas.1
»Was giebst mir lang zu trinken,
Was schenkst du mir lang ein?
Ich will jezt in ein Kloster gehn,
Will Gottes Dienerin seyn.«
»Willst du jetzt in ein Kloster gehn,
Willst Gottes Dienerin seyn,
So geh in Gottes Namen;
Deins gleichen giebts noch mehr!«
Und als es war um Mitternacht,
Dem jung'n Graf träumts so schwer,
Als ob sein allerliebster Schaz
Ins Kloster gezogen wär.
»Auf Knecht, steh auf und tummle dich;
Sattl' unser beide Pferd!
Wir wollen reiten, sey Tag oder Nacht;
Die Lieb ist reitens werth!«
Und da sie vor jen's Kloster kamen,
Wohl vor das hohe Thor,
Fragt er nach jüngst der Nonnen,
Die in dem Kloster war.
Das Nönnlein kam gegangen
In einem schneeweissen Kleid;
Ihr Häärl war abgeschnitten,
Ihr rother Mund war bleich.
Der Knab er sezt sich nieder,
Er saß auf einem Stein;
Er weint die hellen Thränen,
Brach ihm sein Herz entzwey.
2. Die schöne Rosemunde
Englisch
Aus den Reliqu. of anc.English Poetry Vol. II. p. 141.Es ist bereits in der N. Bibl. der sch. Wiss. Th. 2. St. 1. und, mich dünkt, sonst übersezt gewesen. Eine schöne Bußfertige von Corregio gemahlt, den Todesbecher in der Hand, in andächtiger Gestalt der mittlern Zeiten.
Einst herrscht' ein König, in der Zahl
Heinrich der zweit' er hieß,
Der liebte, nebst der Königin,
Ein Fräulein hold und süß.
Ihrs gleichen war auf Erden nicht
An Liebreiz und Gestalt;
Kein süßer Kind war auf der Welt
In Eines Manns Gewalt.
Ihr Lockenhaar, für feines Gold
Hätts jedermann erkannt;
Ihr Auge stralte Himmelsglanz
Wie Perl' aus Morgenland.
Das Blut in ihren Wangen zart
Trieb solch ein Roth und Weiß,
Als ob da Ros' und Lilie
Stritt um den Wettepreis.
Ja Rose, schöne Rosemund'
Hieß recht das Engelskind,
Der aber Königin Lenor'
War Todesfeind gesinnt.
Darum der König, ihr zum Schuz,
(Der Feindin zu entgehn)
Zu Woodstock baut' ein' solche Burg,
Als nimmer war gesehn.
Gar künstlich war die Burg erbaut
Von vestem Holz und Stein;
Nach hundertfunfzig Thüren erst
Kam man zur Burg hinein.
Und alle Gänge schlangen sich
So durch und durch ins Haus,
Daß sonder eines Leitgarnsbund
Niemand kam ein und aus.
Und ob des Königs Lieb und Gunst
Zu seiner holden Braut
Ward nur dem treusten Rittersmann
Die Wacht der Burg vertraut.
Doch ach! das Glück, das oft ergrimmt,
Wo es zuvor gelacht,
Beneidet bald des Königs Lust
Und Röschens Liebespracht.
Des Königs undankbarer Sohn,
Den er selbst hoch erhöht,
Empörte sich in Frankreich stolz
Nach Vaters Majestät.
Doch eh noch unser König hold
Sein Engelland verließ,
Da nahm er noch dies Lebewohl
Von seiner Bule süß:
»O Rosemunde, Rose mein,
Du meiner Augen Lust,
Die schönste Blum' in aller Welt
An deines Königs Brust.
Die Blume, die mein Herz erquickt
Mit süssem Wonnestral,
O meine Königsrose, leb',
Leb wohl zu tausendmal!
Denn, meine schönste Rose, nun
Werd' ich dich lang nicht sehn,
Muß übers Meer, muß Aufruhrsstolz
In Frankreich bändigen.
Doch meine Rose – ja gewiß!
Sollt bald mich wiedersehn!
Und mir im Herzen – o, da sollt
Du immer mit mir gehn!«
Als Rosemund', das holde Kind
Kaum Königs Wort gehört,
Da brach mit Macht der Kummer aus,
Der tief ihr Herz verzehrt.
Im Himmel ihrer Augen schwamm
Thrän' über Thrän' hinan,
Bis, wie ein Silber, Perlenthau
Von ihren Wangen rann.
Der Lippen zart Korallenroth
Ermattet' und erblich;
Für Kummer starrt ihr schönes Blut,
Und all ihr Geist entwich.
Sie sank, in Ohnmacht sank sie hin
Zu ihres Königs Knie,
Der oft denn seinen Königsarm
Voll Liebe schlang um sie.
Wohl zwanzig, zwanzigmale küßt
Er sie mit nassem Blick,
Bis endlich noch ihr sanfter Geist
Ins Leben kam zurück:
»Was ist dir Rose, Rose mein,
Was dir so Kummer macht?« –
»Ach, seufzt sie, ach, mein König zeucht
Ja fern in Todesschlacht!
Und da mein Herr in fremdes Land,
Vor wilder Feinde Heer,
Hinzeucht, und Leib und Leben wagt,
Was soll denn ich hier mehr?
Dein Waffenknabe laß mich seyn,
Gib Tartsche mir und Schwert,
Daß meine Brust dem Streiche steh,
Der dich zu tödten fährt.
Wie oder laß im Königszelt
Mich betten dir zur Nacht,
Und kühlen dich mit Bädern frisch,
Wenn du kommst aus der Schlacht.
So bin ich doch bei dir, und will
Nicht Arbeit scheun, noch Noth!
Ab'r ohne dich – ach, leb' ich nicht,
Da ist mein Leben Tod!«
»Besänft'ge dich, mein Liebchen, sieh,
Du bleibest heim in Ruh,
Im lieblich schönen Engelland;
Kein Feldziehn kommt dir zu!
Nicht blut'ger Krieg, der Friede sanft
Ist für dein sanft Geschlecht;
Auf schöner Burg ein Freudenfest,
Nicht Lager und Gefecht!
Mein Röschen soll hier sicher seyn
In Lust und Saitenspiel,
Indeß ich unter scharfem Speer
Den Feind aufsuchen will.
Mein Röschen glänzt in Perl' und Gold,
Indeß mich Stahl umhüllt;
Mein Liebchen tanzt hier Freudentanz,
Wenn dort mich Schlacht umbrüllt.«
»Und, Edler, den ich auserkannt
Zu meiner Liebe Wacht,
Hab, wenn ich weit entfernet bin,
Hab auf mein Röschen Acht!«
Und nun erseufzte tief der Held,
Als bräch' ihm ganz sein Herz,
Und Rosemund' ach! sprach nicht mehr,
Kein Wort nicht mehr für Schmerz.
Und freilich konnt' ihr Scheiden seyn
Für Beider Herz so schwer,
Denn seit der Zeit sah Rosemund
Nie ihren König mehr.
Kaum daß der Held fern über Meer
In Frankreich Krieg begann,
Kam Königin Lenore schon
Erbost zu Woodstock an.
Schaft schnell den Ritter zu sich her,
Ach unglücksel'ge Stund'!
Er kam von seiner Burg herab,
Und hatt' das Fadenbund.
Und als er hart verwundet war,
Gewann sie das Gebund,
Und kam, wo wie ein Engel schön
Saß Fräulein Rosemund.
Und da sie nun mit starrem Blick
Sah selbst der Schönen Glanz;
Ob aller Reize Treflichkeit
Stand sie versteinert ganz.
»Wirf ab, schrie sie, wirf ab das Kleid
So köstlich und voll Pracht,
Und trink hier diesen Todestrank,
Den ich für dich gebracht.«
Auf ihre Kniee fiel alsbald
Die schöne Rosemund,
Fleht tiefgebeugt ihr alles ab,
Was sie ihr Leids begunt.
»Erbarm dich, rief das holde Kind,
Doch meiner Jugend zart!
Mit solchem strengen Todesgift
Straf, ach! mich nicht so hart.
Ich will aus dieser Sündenwelt
Wo in ein Kloster fliehn,
Will, wenn du's foderst, fern verbannt
Die weite Welt durchziehn.
Und für die Schuld, die ich verbrach,
Ob nur aus Zwang verbrach,
Straf' ach! mich wie du willt, nur laß
Die Todesstrafe nach.«
Und mit den Worten rang sie oft
Und viel die Lilienhand,
Und längs das schöne Angesicht
Kam Thränenstrom gerannt.
Doch nichts, ach nichts! besänftigte
Die Wuth der Mörderin;
Sie stieß, noch kniend stieß sie ihr
Den Becher Gift dahin.
Zu trinken aus das Todesgift
Nahm sie es in die Hand,
Erhob ihr tiefgebeugtes Knie
Noch zitternd auf, und stand;
Und schlug die Augen himmelwärts,
Und fleht' um Gnade – ach!
Da trank sie aus das strenge Gift,
Das bald das Herz ihr brach.
Und als der Tod nun voller Wuth
Durch ihre Glieder wallt,
Da pries noch ihre Mördrin selbst
Die schöne Todsgestalt.
Und als ihr lezter Hauch entfloh,
Begrub man ihr Gebein
Zu Godstow nah nach Oxfort zu,
Wie's noch zu sehn soll seyn.
3. Die kranke Braut
Litthauisch
Durchs Birkenwäldchen,
Durchs Fichtenwäldchen,
Trug mich mein Hengst, mein Brauner,
Zu Schwiegervaters Höfchen.
Schön Tag! Schön Abend!
Frau Schwieger, liebe,
Was macht mein liebes Mädchen?
Was macht mein junges Mädchen?
Krank ist dein Mädchen,
O! krank von Herzen,
Dort in der neuen Tenne,
In ihrem grünen Bettchen.
Da übern Hof ich,
Und herzlich weint' ich,
Und vor der Thüre
Wischt' ich die Thränen.
Ich drückt' ihr Händchen,
Streift' ihr den Ring auf:
Wirds dir nicht besser, Mädchen?
Nicht besser, junges Mädchen?
Mir wird nicht besser,
Nicht deine Braut mehr!
Du wirst mich nicht betrauren,
Nach andern wirst du gaffen.
Durch diese Thüre
Wirst du mich tragen;
Durch jene reiten Gäste.
Gefällt dir jenes Mädchen?
Gefällt dirs junge Mädchen?
4. Abschiedslied eines Mädchens
Litthauisch
Dort im Garten blühten Majorane,
Hier im Garten blühten Tymiane,
Und wo unser Schwesterchen sich lehnte,
Da die allerbesten Blümlein blühten.
Warum liegst du hingelehnt, mein Mädchen?
Warum hingelehnt, mein junges Mädchen?
Ist nicht Jugend noch dein liebes Leben?
Und noch leicht und frisch dein junges Herzchen?
Ist gleich Jugend noch mein liebes Leben,
Und noch frisch und leicht mein junges Herzchen,
Dennoch fühl' ich junges Mädchen Schmerzen,
Heute geht zu Ende meine Jugend.
Durch die grüne Hofflur geht das Mädchen,
Ihren Brautkranz in dem weissen Händchen,
O mein Kränzel! o mein schwarzes Kränzel,
Weit von hinnen wirst du mit mir gehen!
Lebe wohl nun, Mutter, liebe Mutter!
Lebe wohl nun, Vater, lieber Vater!
Lebt wohl, liebe Brüder!
Lebt wohl, liebe Schwestern!
5. Der versunkne Brautring
Litthauisch
Die Litthauischen Daino's, die in diesem Theile vorkommen, sind dem Sammler von Herrn P.K. in K. worden. Leßings Urtheil über die Liederchen dieses Volks (Litter. Br. Th. 2. S. 242.) ist schon unter den Zeugnissen von Volksliedern angeführt. »Homers monotomisches Metrum (sagt der Verf. der Kreuzzüge des Philologen S. 216.) sollte uns wenigstens ebenso paradox vorkommen, als die Ungebundenheit des deutschen Pindars. Meine Bewunderung oder Unwissenheit von der Ursache eines durchgängigen Silbenmaaßes in dem griechischen Dichter ist bei einer Reise durch Kurland und Liefland gemässigt worden. Es gibt in angeführten Gegenden gewisse Striche, wo man das lettische oder undeutsche Volk bei aller ihrer Arbeit singen hört, aber nichts als eine Kadenz von wenig Tönen, die mit einem Metro viel Aehnlichkeit hat. Sollte ein Dichter unter ihnen aufstehen: so wäre es ganz natürlich, daß alle seine Verse nach diesem eingeführten Maasstab ihrer Stimmen zugeschnitten seyn würden. Es würde zu viel Zeit erfordern, diesen kleinen Umstand in sein gehörig Licht zu sezen und mit mehreren Phönomenen zu vergleichen.«
Zum Fischer reit' ich,
Den Fischer besuch' ich,
Sein Eidam wär' ich gerne!
Am Hafestrande
Spült' ich die Neze,
Rein wusch ich mir die Hände.
Weh! da entfiel mir
Vom Mittelfinger
Mein Bräutgamring zu Grunde.
Erfleh dir, Liebster,
Den Wind, den Nordwind,
Auf vierzehn lange Tage!
Vielleicht er würf ihn,
Den Ring, vom Grunde
Auf deiner Liebsten Wiese.
Da kömmt das Mädchen
Dort über Feld her
Am Rautengarten.
Verruhe dich, mein Liebster,
Leg ab die Sense
Hier in die Schwade,
Und deinen Schleifstein
Auf diese Schwade!
Verruhe dich, mein Liebster!
Dank dir, mein Mädchen,
Dank für dein Kommen,
Und für dein Mitleid,
Für deine süsse Rede! – – –
Schön Tag, schön Abend,
O gute Mutter!
Kann ich Nachtlager haben?
Nachtlager will ich
Dir nicht versagen,
Doch gut werd' ich dir nimmer.
6. Das Lied vom eifersüchtigen Knaben
Deutsch
Die Melodie hat das Helle und Feierliche eines Abendgesanges, wie unterm Licht der Sterne, und der Elsasser Dialekt schließt sich den Schwingungen derselben treflich an, wie überhaupt in allen Volksliedern mit dem lebendigen Gesange viel verlohren geht. Der Inhalt des Liedes ist kühn und schrecklich fortgehende Handlung: ein kleines lyrisches Gemählde, wie etwa Othello ein gewaltiges, großes Freskobild ist. Der Anfang des Liedes ist mehrern Volksliedern eine Lieblingsstelle.
Es stehen drey Stern' am Himmel,
Die geben der Lieb' ihren Schein.
Gott grüß euch, schönes Jungfräulein,
Wo bind' ich mein Rösselein hin.
»Nimm du es, dein Rößlein, beim Zügel, beim Zaum,
Bind's an den Feigenbaum.
Sez dich ein' kleine Weil nieder,
Und mach mir ein kleine Kurzweil.«
Ich kann und mag nicht sizen,
Mag auch nicht lustig seyn,
Mein Herz ist mir betrübet,
Feinslieb von wegen dein.
Was zog er aus der Taschen?
Ein Messer, war scharf und spiz;
Er stachs seiner Lieben durchs Herze;