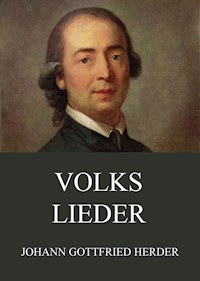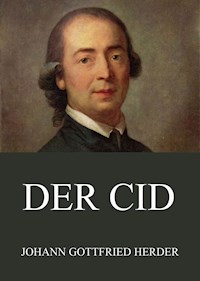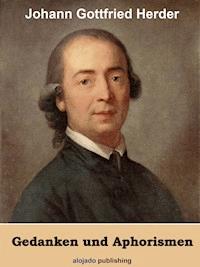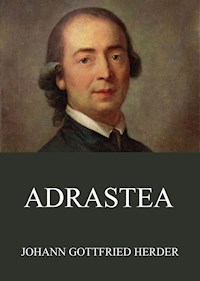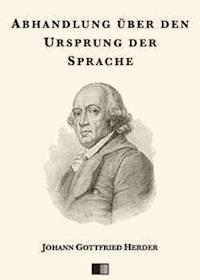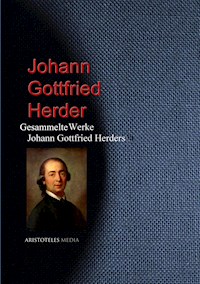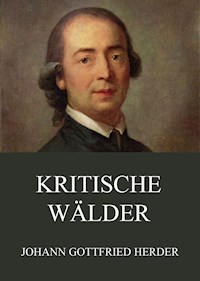
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kritische Wälder, oder Betrachtungen die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend, gilt als die wichtigste von Herders Studien. Dabei handelte es sich um eine Vertiefung und Erweiterung seiner Sprachphilosophie, die er auf den Satz Hamanns gründete, wonach "die Poesie die Muttersprache des menschlichen Geschlechts" ist. Die literarischen Erzeugnisse aller Nationen sind, so Herder, durch den besonderen Genius der Volksart und Sprache bedingt. Hier prägte er auch den Begriff Zeitgeist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 760
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kritische Wälder
oder Betrachtungen, die Wissenschaft und Kunstdes Schönen betreffend, nach Maßgabe neuerer Schriften
Johann Gottfried Herder
Inhalt:
Johann Gottfried Herder – Biografie und Bibliografie
Kritische Wälder oder Betrachtungen, die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend, nach Maßgabe neuerer Schriften
Erstes Wäldchen
Herrn Leßings Laokoon gewidmet
Analytischer Inhalt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Beschluß.
Zweites Wäldchen
über einige Klotzische Schriften
Analytischer Inhalt.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Drittes Wäldchen
noch über einige Klotzische Schriften
Vorrede.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
II.
Anmerkungen.
Kritische Wälder, J. G. Herder
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849627706
www.jazzybee-verlag.de
Johann Gottfried Herder – Biografie und Bibliografie
Einer der hervorragendsten und einflußreichsten Schriftsteller und Denker Deutschlands, ward 25. Aug. 1744 zu Mohrungen in Ostpreußen als Sohn des Kantors, Glöckners und Schullehrers Gottfried H. und dessen zweiter Ehefrau, Anna Elisabeth Pelz, geboren und starb 18. Dez. 1803 in Weimar. Die Verhältnisse seiner Eltern waren bescheiden und beschränkt, nicht aber so dürftig, daß sie auf eine bessere Erziehung ihrer Kinder und namentlich des Knaben, dessen Begabung früh zutage trat, durchaus hätten verzichten müssen. H. besuchte die Stadtschule und wurde zum Studium der Theologie bestimmt. Die unfreundliche und willkürliche Einmischung des Diakonus S. F. Trescho, der Herders Eltern zu bestimmen suchte, den Knaben ein Handwerk lernen zu lassen, kreuzten die künftigen Lebenspläne. Trescho nahm den Knaben als Famulus in sein Haus, mißbrauchte jedoch seine Kräfte zu allerhand unwürdiger Arbeit, so daß es für H. eine Erlösung aus bittern Leiden war, als sich ein russischer Regimentschirurg erbot, ihn zur Erlernung der Chirurgie nach Königsberg und später nach Petersburg mitzunehmen. H. langte im Hochsommer 1762 in der ostpreußischen Hauptstadt an, und da er alsbald erkannte, daß er für den von seinem Beschützer in Aussicht gestellten Beruf gänzlich ungeeignet sei, ließ er sich 10. Aug. als Studiosus der Theologie immatrikulieren. An dem Buchhändler Kanter, dem er sich schon von Mohrungen aus durch Zusendung des »Gesanges an Cyrus« empfohlen hatte, gewann er einen hilfreichen Gönner; durch seine Anstellung als Lehrer an der Elementarschule des Collegium Fridericianum ward er der drückendsten Not rasch überhoben und überließ sich rückhaltlos seinem Bildungsdrang. Bedeutenden Einfluß auf die geistige Entwickelung des Jünglings übte von den Universitätslehrern nur Kant, außerhalb der Universitätskreise aber der »Magus aus Norden«, der originelle J. G. Hamann aus. Unter den Einwirkungen seiner mannigfaltigen und ausgebreiteten Lektüre war keine tiefer, sein ganzes Wesen bestimmender als die der Schriften J. J. Rousseaus. Im Herbst 1764 ward H. als Kollaborator an die Domschule nach Riga berufen, später auch als Pfarradjunkt an der Jesus- und an der Gertraudenkirche angestellt, so daß er in der alten Hauptstadt Livlands, die sich damals noch fast republikanischer Selbständigkeit erfreute, einen ausgebreiteten und nicht unwichtigen Wirkungskreis fand. Die Kreise des städtischen Patriziats erschlossen sich dem jungen vielversprechenden Mann, der sich in ihnen mancher Anregung und eines bis dahin ungekannten Lebensgenusses erfreute. Unter so günstigen Umständen eröffnete H. mit den »Fragmenten über die neuere deutsche Literatur« (Riga 1766–67), dem Schriftchen »Über Thomas Abbts Schriften. Der Torso von einem Denkmal, an seinem Grab errichtet« (das. 1768) und den »Kritischen Wäldern« (das. 1769) seine große literarische Laufbahn. Indem er darauf hinwies, daß die literarischen Erzeugnisse aller Nationen durch den besondern Genius der Volksart und Sprache bestimmt sind, und indem er die »kritische Betrachtungsweise Lessings durch seine eigne genetische ergänzte«, gewann H. seine selbständige Stellung in dem großen Kampf der Zeit. Die Angriffe gegen die seichte und verächtliche Clique der Klotzianer waren nur Konsequenzen seiner Anschauungen. Gleichwohl hatte sich H. Klotz und den Seinen gegenüber Blößen namentlich durch die Ableugnung der Autorschaft der »Kritischen Wälder« gegeben und ward, wie im spätern Leben noch oft, in ärgerliche Händel verwickelt, die ihm selbst das Behagen an seiner sonst so günstigen Stellung in Riga verleideten. Starker Reisedrang und das Verlangen, sich für eine künftige große Wirksamkeit (die er sich mehr als eine praktische, denn als eine literarische dachte) allseitig vorzubereiten, veranlaßten H., im Frühling 1769 seine Entlassung zu begehren, die man ihm gewährte in der Hoffnung, daß er zurückkehren werde. Im Juni d. J. trat er eine große Reise an, die ihn zunächst zu Schiff nach Nantes führte, von wo er im November nach Paris ging. Weil er sich rasch überzeugen mußte, daß es nicht möglich sein werde, mehrjährige Reisen nur mit Unterstützung seiner Freunde durchzuführen, war ihm der Antrag des fürstbischöflich lübeckischen Hofes in Eutin, den Erbprinzen Peter Friedrich Wilhelm als Reiseprediger zu begleiten, ganz willkommen. Anfang 1770 kam er nach Eutin und brach im Juni d. J. von dort mit dem Prinzen auf. Noch vor der Abreise hatte ihn ein Ruf des Grafen Wilhelm von Lippe in Bückeburg erreicht; gleich darauf lernte H. in Darmstadt seine nachmalige Gattin, Maria Karoline Flachsland (s. unten), kennen. Eine rasch gefaßte und erwiderte Neigung nährte in H. den Wunsch nach festen Lebensverhältnissen. Er folgte dem Prinzen nur bis Straßburg, begehrte vom eutinischen Hof seine (im Oktober gewährte) Entlassung, nahm die vom Grafen zur Lippe angetragene Stellung als Hauptprediger der kleinen Residenz Bückeburg und als Konsistorialrat an, blieb aber dann um einer (leider mißglückten) Augenoperation willen den Winter in Straßburg und knüpfte hier die freundschaftlichen Beziehungen zu dem um fünf Jahre jüngern Goethe an. Ende April 1771 trat H. seine neue Stellung in Bückeburg an. Sein Verhältnis zu dem Landesherrn des kleinen Ländchens, dem berühmten Feldherrn Grafen Wilhelm, ward bei aller Achtung, die der durch und durch soldatische und an keinen Widerspruch gewöhnte Fürst ihm zollte, kein erfreuliches. Auch als Graf Wilhelms Gemahlin, die liebenswürdige fromme Gräfin Maria, sich H. in herzlicher Verehrung anschloß, betrachtete dieser den Aufenthalt in Bückeburg als ein Exil. Doch wurden ihm diese Jahre durch die Liebe seiner im Mai 1773 heimgeführten Gattin und durch die reichen Ergebnisse seiner Studien verschönt. Die Zeit des Bückeburger Aufenthalts war für H. die eigentliche Sturm- und Drangperiode. Mit der geistvollen, von der Berliner Akademie preisgekrönten Abhandlung »Über den Ursprung der Sprache« (Berl. 1772), die er noch in Straßburg begonnen, den beiden Aufsätzen über »Of sian und die Lieder alter Völker« und über »Shakespeare« in den fliegenden Blättern »Von deutscher Art und Kunst« (Hamb. 1773; Neudruck von Lambel, Stuttg. 1893) und der Schrift »Ursache des gesunkenen Geschmacks bei den verschiedenen Völkern, da er geblühet«, trat er in den Mittelpunkt der Bewegung, die eine aus dem Leben stammende und auf das Leben wirkende, echte Natur atmende Dichtung wiedergewinnen wollte. Mit der Schrift »Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit« (o. O. [Riga] 1774) erklärte er der prahlerischen und öden Aufklärungsbildung des Jahrhunderts den Krieg. Rief schon diese Arbeit die entschiedensten Widersprüche, ja Herabsetzungen und Verlästerungen Herders hervor, so war dies in noch höherm Grade der Fall bei seinen theologischen und halbtheologischen Schriften, der »Ältesten Urkunde des Menschengeschlechts« (Riga 1774–76, 2 Tle.), den »Briefen zweener Brüder Jesu in unserm Kanon« (Lemgo 1775), den »Erläuterungen zum Neuen Testament, aus einer neueröffneten morgenländischen Quelle« (Riga 1775) und den 15 Provinzialblättern »An Prediger« (1774). Die Angriffe, die er erfuhr, veranlaßten ihn, seine schon zum Druck vorbereitete Sammlung der »Volkslieder« zurückzuhalten. Sie brachen ihm den Entschluß des Weiterwirkens nicht, aber sie steigerten eine hypochondrische Reizbarkeit und ein dämonisches Mißtrauen, die in Herders Seele früh erwacht waren. H. verhandelte eben wegen einer Berufung an die Universität Göttingen, als er durch Goethes freundschaftliche Bemühungen im Frühjahr 1776 als Generalsuperintendent, Mitglied des Oberkonsistoriums und erster Prediger an der Stadtkirche nach Weimar berufen wurde. Sein Weggehen von Bückeburg folgte dem Tode seiner Gönnerin, der Gräfin Maria, fast auf dem Fuß. Am 2. Okt. 1776 trat H., der besten Erwartungen und des besten Wissens voll, in Weimar ein. Obschon er hier die denkbar freundlichste Aufnahme fand, so blieben doch auch Mißhelligkeiten nicht aus. Da H. wahrzunehmen glaubte, daß in dem engern Kreise des Herzogs eine gründliche Gleichgültigkeit, ja verächtliche Geringschätzung gegen Kirche und Schule vorherrschte, vertrat er nicht nur, was sein gutes Recht war, deren Interessen aufs kräftigste und eifrigste, sondern setzte sich in Opposition gegen nahezu alle Meinungen, Richtungen und Neigungen jenes Kreises. Und so gewiß Weimar eine große Verbesserung Bückeburg gegenüber heißen durfte, so fühlte sich H. von der Kleinlichkeit und Enge auch vieler weimarischer Verhältnisse gedrückt. Dennoch wirkte die veränderte Lage günstig auf ihn, und seine literarische Produktivität nahm einen großen und immer gewaltigern Aufschwung. Der Läuterungsprozeß, durch den sich die hervorragendsten Repräsentanten des Sturmes und Dranges in die Hauptträger der deutschen klassischen Literatur verwandelten, nahm auch bei H. zu Ausgang der 1770er Jahre seinen Anfang. Die bedeutsame philosophische Abhandlung »Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume« (Riga 1778), die »Plastik. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Traum« (das. 1778) und die Herausgabe der »Lieder der Liebe« (Leipz. 1778) sowie der längst vorbereiteten »Volkslieder« (erst später von Johannes v. Müller »Stimmen der Völker in Liedern« betitelt, das. 1778–79) waren seine ersten von Weimar aus in die Welt gesandten Publikationen. Die von der Münchener Akademie preisgekrönte Abhandlung »Über die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker in alten und neuen Zeiten« (1778) galt einem neuen Nachweis, daß echte Poesie die Sprache der Sinne, erster mächtiger Eindrücke, der Phantasie und der Leidenschaft, daher die Wirkung der Sprache der Sinne allgemein und im höchsten Grade natürlich sei, eine Wahrheit, welche die mit umfassender Literaturkenntnis ausgewählten, lebendig nach- und anempfundenen, z. T. vorzüglich übersetzten »Volkslieder« eben weiten Kreisen zum Bewußtsein brachten.
Einen höchst glücklichen Einfluß auf Herders weitere geistige Entwickelung übte seit den ersten 1780er Jahren das wiederhergestellte innige Verhältnis Herders und seines Hauses zu Goethe. H. trat in den regsten Gedankenaustausch zu dem jüngern Freund, und während er seinen Weg unter dessen bewundernder Teilnahme weiter verfolgte, steigerte sich sein Gefühl für Schönheit und Klarheit des Vortrags, selbst sein poetisches Ausdrucksvermögen durch den reinen Formensinn Goethes. In ebendiesen 80er Jahren entstand beinahe alles, was Herders immer genialem Wirken durch innere Reise und äußere Vollendung bleibende Nachwirkung sicherte. Bezogen sich die »Briefe, das Studium der Theologie betreffend« (Weim. 1780–1781, 4 Tle.) und eine Reihe von vorzüglichen Predigten auf Herders Amt und nächsten Beruf, so leitete das große, leider unvollendet gebliebene Werk »Vom Geiste der Ebräischen Poesie« (Dessau 1782–83, 2 Tle.; hrsg. von Hoffmann, Gotha 1891) von der Theologie zur Poesie und Literatur hinüber. Aus der tiefsten Mitempfindung für die Naturgewalt, die Frömmigkeit und eigenartige Schönheit der hebräischen Dichtung wuchs ein Werk hervor, von dem Herders Biograph (R. Haym) mit Recht rühmt,-daß es »für Kunde und Verständnis des Orients Ähnliches geleistet wie Winckelmanns Schriften für das Kunststudium und die Archäologie«. 1785 aber begann H. die Herausgabe seines großen Hauptwerkes, der »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« (Riga 1784–91, 4 Bde.), die endliche Ausführung eines Lieblingsplans, die breitere Ausführung von Gedanken, die er längst in kleinern Schriften in die Welt gesandt hatte, und wiederum die energische Zusammenfassung alles dessen, was er über Natur und Menschenleben, die kosmische Bedeutung der Erde, über die Aufgabe des sie bewohnenden Menschen, »dessen einziger Daseinszweck auf Bildung der Humanität gerichtet ist, der alle niedrigen Bedürfnisse der Erde nur dienen und selbst zu ihr führen sollen«, was er über Sprachen und Sitten, über Religion und Poesie, über Wesen und Entwickelung der Künste und Wissenschaften, über Völkerbildungen u. historische Vorgänge gedacht und (wie seine Gegner erinnerten) geträumt hatte. Die Aufnahme des Werkes entsprach dessen großem Verdienst (vgl. Grundmann, Die geographischen und völkerkundlichen Quellen und Anschauungen in Herders. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit', Berl. 1900). Gleichzeitig veröffentlichte H. die Sammlung seiner »Zerstreuten Blätter« (Gotha 1785–97, 6 Tle.), in der eine Reihe der schönsten Abhandlungen und poetischen Übersetzungen die Geistesfülle und sittliche Grazie des Schriftstellers in herzgewinnender Weise offenbarte. Seiner Verehrung für Spinoza, in der er sich mit Goethe eins fühlte, gab er Ausdruck in den Gesprächen, die er 1787 u. d. T. »Gott« veröffentlichte.
Einen großen Abschnitt in Herders Leben bildete die Reise, die er 1788–89 nach Italien unternahm. Freilich wirkten seine hypochondrische Reizbarkeit und mancherlei ungünstige Zufälle zusammen, ihn eigentlich nur in Neapel zum Vollgenuß dieser Reise kommen zu lassen; doch empfing er bedeutende und bleibende Eindrücke, die vielleicht noch günstigere Folgen gehabt hätten, wenn ihn nicht in Italien eine abermalige ehrenvolle und vielverheißende Berufung nach Göttingen erreicht und die schwere Frage des Gehens oder Bleibens in Weimar ihn während der Rückreise gequält hätte. Goethe, von der Erwägung ausgehend, daß der Freund dem Kathederärger in Göttingen noch weniger gewachsen sein werde als dem Hof- und Konsistorialärger in Weimar, wirkte für Herders Bleiben und konnte im Einverständnis mit dem Herzog Tilgung der Herderschen Schulden, Gehaltsverbesserungen und mancherlei tröstliche Verheißungen für die Zukunft bieten. H. ließ sich mit einem gewissen Widerwillen zum Bleiben bestimmen, und beide Freunde sollten dieser Entscheidung nur kurze Jahre froh werden. Herders Gesundheitszustand war bloß vorübergehend gebessert, körperliche Leiden brachen ihm Lebenslust und Arbeitskraft; der fünfte Teil der »Ideen« blieb ungeschrieben, und bereits die »Briefe zur Beförderung der Humanität« (Riga 1793–97, 10 Sammlungen) trugen die Farbe seines verdüsterten Geistes. Die materiellen Sorgen im Herderschen Hause hatten sich leider nur vorübergehend gemildert, und die nur halb gerechtfertigten Ansprüche, die H. und seine Gattin auf Grund der Abmachungen von 1789 erhoben, führten zu einem unheilbaren Bruch mit Goethe. H. hatte schon zuvor mit reizbarer Eifersucht die wachsende Intimität zwischen Goethe und Schiller betrachtet. So trat allmählich ein Zustand der Isolierung und kränklich verbitterten Beurteilung alles ihn umgebenden Lebens bei H. ein. Die geistigen Gegensätze, in denen er sich zur Philosophie Kants, zur klassischen Kunst Goethes und Schillers fand, verstärkte und verschärfte H. gewaltsam und ließ sie in seinen literarischen Arbeiten mehr und mehr hervortreten. Zwar gab er, sowie er auf neutralem Gebiet stand, auch jetzt noch Vorzügliches und Erfreuliches. Dem Unterrichtswesen widmete er fortwährend eine liebevolle Teilnahme, die besonders in seinen formvollendeten und inhaltreichen Schulreden zum Ausdruck kam. Seine »Terpsichore« (Lübeck) 795), die den vergessenen neulateinischen Dichter Jakob Balde wieder einführte, seine »Christlichen Schriften« (Riga 1796–99, 5 Sammlungen), in denen das unbeirrteste Gefühl für den eigentlichen Kern des Christentums den schönsten und maßvollsten Ausdruck fand, seine Aufsätze für Schillers »Horen« bewährten den alten Herderschen Geist. Aber voll grimmer Bitterkeit und dazu mit unzulänglichen Waffen bekämpfte H. in der »Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft« (Leipz. 1799, 2 Tle.) die Philosophie und in der »Kalligone« (das. 1800) die Ästhetik Nants, voll absichtlicher Verkennung und unwürdiger Lobpreisung des Abgelebten und Halben richtete seine »Adrastea« (das. 1801–03, 6 Tle.) alle ihre versteckten Spitzen gegen die lebendige, schönheitsfreudige Dichtung Goethes und Schillers. Nur die Qual eines Zustandes, der ihn tief niederdrückte, und in dem er sich selbst bald als »dürrer Baum und verlechzte Quelle«, bald als »Packesel und blindes Mühlenpferd« schilderte, konnte diese letzte verhängnisvolle Wendung seiner literarischen Tätigkeit entschuldigen. Letzte Erquickung bereitete ihm, dessen körperliche Kraft mehr und mehr erlag, die poetische Arbeit an seinen »Legenden«, an der Übertragung der Romanzen vom »Cid« (s. d., S. 149) und an den dramatischen Gedichten: »Der entfesselte Prometheus« und »Admetus' Haus«. Die Annahme eines vom Kurfürsten von Bayern 1802 ihm verliehenen Adelsdiploms bereitete H. schweren Ärger, und seine endliche Ernennung zum Präsidenten des Oberkonsistoriums (1801) kam zu spät, um ihm Lebensmut zurückzugeben. In den Sommern 1802 und 1803 suchte er Heilung in den Bädern von Aachen und am Egerbrunnen; im Herbst des letztgenannten Jahres erfolgte ein neuer heftiger Anfall seines unheilbaren Leberübels, dem er im Winter erlag. Sein Grabdenkmal in der Stadtkirche zu Weimar trägt die Aufschrift: »Licht, Liebe, Leben«; vor der Kirche wurde ihm 1850 ein ehernes Standbild (von Schaller) errichtet.
Mannigfach rätsel- und widerspruchsvoll, ungleicher in seinen Leistungen als seine großen Zeitgenossen, aber unvergleichlich reich, vielseitig, voll höchsten Schwunges und schärfster Einsicht, eine Fülle geistigen Lebens in sich tragend und um sich erweckend, steht H. in der deutschen Literatur. In der großen Umbildung des deutschen Lebens am Ende des 18. Jahrhunderts hat er mächtiger und entscheidender eingegriffen als einer, und die Spuren seines Geistes lassen sich in der Literatur im engern Sinn, in Fachwissenschaften und Spezialzweigen, die aus seinen Anregungen hervorgegangen sind, überall nachweisen. Die Forderung der »Humanität«, der Heranbildung und Läuterung zum vergöttlichten Menschlichen, ist der durchgehende Grundgedanke in der Vielheit und Mannigfaltigkeit seiner Schriften. Bei allen seinen Gaben war ihm die künstlerische Gestaltungskraft versagt, so daß er als Dichter nur in einzelnen glücklichen Momenten und auf dem Gebiete der didaktischen Poesie zu wirken vermochte. Die Verbindung seines eignen ethischen Pathos mit Stimmungen und Gefühlen, die ihm aus der Dichtung der verschiedensten Zeiten und Völker ausgingen, war nie ohne Reiz; sein Verdienst als poetischer Übersetzer, als Aneigner und Erläuterer fremden poetischen Volksgeistes kann kaum zu hoch angeschlagen werden Die große Zahl von Herders poetischen Übertragungen aus den verschiedensten Sprachen, ihre Auswahl und die Resultate, die H. jedesmal aus ihnen zog, haben einer allgemeinen, über die »Gelehrtengeschichte« der vorausgegangenen akademischen Perioden hinauswachsenden Literaturgeschichte den Boden bereitet. Neben den »Volksliedern«, dem »Cid«, den Epigrammen aus der griechischen Anthologie, den Lehrsprüchen aus Sadis »Rosengarten« und der ganzen Reihe andrer Dichtungen und poetischer Vorstellungen, die Herders anempfindender Geist für die deutsche Literatur gewann, stehen jene morgenländischen Erzählungen, jene Paramythien und Fabeln, die H. im Wiedererzählen benutzt, um Momente seiner eignen sittlichen Anschauung, seiner Humanitätslehre beizugesellen, und die hierdurch wie durch ihre Vortragsweise zu seinem geistigen Eigentum werden. Höher aber als der Dichter steht überall der Prosaiker H., der große Kulturhistoriker, Religionsphilosoph, der feinsinnige Ästhetiker, der produktive Kritiker, der glänzende Essayist, der gehaltreiche und in der Form anziehende Prediger und Redner. Es ist Herders eigenstes Mißgeschick gewesen, daß die großen Ergebnisse seines Erkennens und Strebens rasch zum Gemeingut der Bildung, seine Anschauungen zu Allgemeinanschauungen wurden, so daß es erst der historischen und kritischen Zurückweisung auf die Genialität, die seelische Tiefe und den verschwenderischen Gedankenreichtum der Herderschen Schriften bedurfte, um das größere Publikum zu ihnen zurückzuführen.
Herders »Sämtliche Werke« erschienen zuerst in einer von J. Georg Müller, Johannes v. Müller und Heyne unter Mitwirkung von Herders Witwe und Sohn veranstalteten Ausgabe (Cotta, Stuttg. 1805–20, 45 Bde.; Taschenausg. mit den Nachträgen, das. 1827–1830, 60 Bde., und 1852–54, 40 Bde.). Die Entfremdung des Publikums veranlaßte die »Ausgewählten Werke« in einem Band (Cotta, Stuttg. 1844), ferner »Ausgewählte Werke«, hrsg. von Ad. Stern (Leipz. 1881, 3 Bde.), die des Cottaschen Verlags (mit Einleitung von Lautenbacher, Stuttg. 1889, 6 Bde.) und die in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur« (Stuttg. 1886 ff.); besonders gelungen ist die Auswahl der Werke in der gut kommentierten Ausgabe von Th. Matthias in der Klassikerbibliothek des Bibliographischen Instituts (Leipz. 1903, 5 Bde.). Vollständigkeit erstrebten die Ausgabe in der Hempelschen »Nationalbibliothek« (Berl. 1869–79, 24 Tle., mit Biographie von Düntzer) und die große kritische, von Suphan geleitete Ausgabe von »Herders sämtlichen Werken« (das. 1877–99, 32 Bde., wovon noch Bd. 14 fehlt). Auf Grund der letztern Ausgabe gaben Suphan und Redlich »Herders ausgewählte Werke« (Berl. 1884–1901, 5 Bde.) heraus. Eine ungekrönte Preisschrift Herders: »Denkmal Joh. Winckelmanns«, von 1778 veröffentlichte Alb. Duncker (Kassel 1882). Sammlungen von Briefen Herders veranstalteten Düntzer und Ferd. Gottfr. v. Herder in den Werken: »Aus Herders Nachlaß« (Frankf. 1856 bis 1857, 3 Bde.), »Herders Briefwechsel mit seiner Braut« (das. 1858), »Herders Reise nach Italien« (Gießen 1859) und »Von und an H.« (Leipz 1861–1862, 3 Bde.); O. Hoffmann gab Herders Briefwechsel mit Nicolai (Berl. 1887) und Herders Briefe an Hamann (das. 1889) heraus.
Von biographisch-kritischen Schriften über H. sind außer den von seiner Gattin gesammelten »Erinnerungen« (s. unten) und dem von seinem Sohn Emil Gottfried v. H. verfaßten »Lebensbild« (Erlang. 1846 bis 1847, 3 Bde.) zu erwähnen: Danz und Gruber, Charakteristik J. G. v. Herders (Leipz. 1805); ferner: H. Döring, Herders Leben (2. Aufl., Weim. 1829); »Weimarisches Herder-Album« (Jena 1845); Jegor v. Sivers, H. in Riga (Riga 1868) und Humanität und Nationalität, zum Andenken Herders (Berl. 1869); Joret, H. et la renaissance littéraireen Allemagne (Par. 1875); namentlich aber das biographische Hauptwerk: R. Haym, H. nach seinem Leben und seinen Werken (Berl. 1880–85, 2 Bde.), eine Meisterleistung streng sachlicher und zugleich liebevoller Lebensdarstellung und Beurteilung. Vgl. außerdem A. Werner, H. als Theologe (Berl. 1871); J. G. Müller, Aus dem Herderschen Hause, Aufzeichnungen 1780–1782 (hrsg. von J. Bächtold, das. 1881); Bärenbach, H. als Vorgänger Darwins und der modernen Naturphilosophie (Berl. 1877); Lehmann, H. in seiner Bedeutung für die Geographie (das. 1883); J. Böhme, H. und das Gymnasium (Hamb. 1890); Kühnemann, Herders Persönlichkeit in seiner Weltanschauung (Berl. 1893) und Herders Leben (Münch. 1894); Franke, H. und das Weimarische Gymnasium (Hamb. 1894); O. Hoffmann, Der Wortschatz des jungen H. (Berl. 1895); Bloch, H. als Ästhetiker (das. 1896); Tumarkin, H. und Kant (Bern 1890); Schaumkell, H. als Kulturhistoriker (Ludwigslust 1902); Genthe, Der Kulturbegriff bei H. (Jena 1902); Wiegand, H. in Straßburg, Bückeburg und in Weimar (Weim. 1903); Bürkner, H., sein Leben und Wirken (Berl. 1903).
Herders Gattin Maria Karoline, geborne Flachsland, geb. 28. Jan. 1750 zu Reichenweier im Elsaß, gest. 15. Sept. 1809 in Weimar, lebte nach ihres Vaters Tode bei ihrer Schwester in Darmstadt, wo sie H. kennen lernte, der sich 1773 mit ihr verheiratete. Nach Herders Tode ordnete sie dessen literarischen Nachlaß und schrieb: »Erinnerungen aus dem Leben Herders« (hrsg. von J. G. Müller, Stuttg. 1820, 2 Bde.; neue Ausg. 1830, 3 Bde.). Der älteste Sohn, Wilhelm Gottfried v. H., geb. 1774 in Bückeburg, studierte in Jena Medizin, ward 1800 Provinzialakkoucheur und 1805 Hofmedikus in Weimar, wo er 1806 starb. Er schrieb: »Zur Erweiterung der Geburtshilfe« (Leipz. 1803) und nahm teil an der Herausgabe der Werke seines Vaters. Der dritte und jüngste, Emil Gottfried v. H., war bis 1839 bei der Regierung für Schwaben und Neuburg tätig und starb als bayrischer Oberforst- und Regierungsrat 27. Febr. 1855 in Erlangen. Er gab in »Herders Lebensbild« (s. oben) eine liebevolle Darstellung des Lebens und Wirkens seines Vaters. Ein Enkel Herders, G. Th. Stichling, war weimarischer dirigierender Staatsminister und starb 22. Juni 1891.
Kritische Wälder oder Betrachtungen, die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend, nach Maßgabe neuerer Schriften
Erstes Wäldchen- Herrn Leßings Laokoon gewidmet
1769
Leser, wie gefall ich dir?
Leser, wie gefällst du mir?
Logan.
Analytischer Inhalt.
1. Es ist unbillig, Leßing auf Winkelmanns Kosten zu loben. Unterschied beider Schriftsteller in Materie, Denkart und Styl.
2. Sophokles Philoktet leidet nicht mit brüllendem Geschrei. Die Helden Homers fallen nicht mit Geschrei zu Boden. Schreien kam nicht ein nothwendiger Charakterzug einer Helden- und Menschlichen Empfindung seyn.
3. Die Empfindbarkeit der Griechen zu sanften Thränen zeigt sich ganz anders. Sie ist auch den Griechen nicht allein und ausschliessend eigen. Proben und Charakter der alten Hersischen Gesänge.
4. Eine philosophische Geschichte der Elegischen Dichtkunst über Völker und Zeiten, oder Gründe der alten Heldenmenschlichkeit, aus ihrer Empfindung für Vaterland, Geschlecht, Heroische Freundschaft, einfältige Liebe und die Menschlichkeit des Lebens hergeleitet, nicht aber als ob sie einen Schlag mehr empfunden, und besser geschrien hätten, wie wir. Empfindbarkeit der Homerischen Helden zeigt sich würdiger.
5. Sophokles macht in seinem Philoktet gewiß nicht Geschrei zum Hauptmittel der Rührung. Bessere Eindrücke des Griechischen Drama. Ob körperlicher Schmerz je die Hauptidee eines Trauerspiels werden könne? Daß ers bei Sophokles nicht sey.
6. Die Behauptung: der Griechische Künstler schilderte das Schöne, ist wahr. Grenzen und Erklärung dieses Satzes aus ihrem Mythischen Cirkel und ihrer Heldengeschichte. Warum Timanthes seinen Agamemnon verhüllt gemalet?
7. Von den Hörnern des Bacchus. Von dem Einfluß der verschiednen Mythologischen Zeitalter auf Poesie und Kunst.
8. Wen Virgil in Schilderung seines Laokoon nachgeahmet haben möge? Urtheil über Quintus Calaber, und Petron, in ihren Schilderungen. Nach wem der Künstler gebildet haben könne?
9. Soll die Kunst nichts Vorübergehendes zu ihrem Anblicke wählen: so verliert sie ihr Leben. Soll sie für jede wiederholte Erblickung arbeiten: so ihr Wesen. Ursache, warum die Kunst ein Ideal der Schönheit habe, und insonderheit die stille Ruhe liebe, aus dem Grundsatz, daß sie für Einen ewigen Anblick arbeite.
10. Ueber Spence's Erläuterungen der Alten aus Kunstwerken. Rettung seines herunterschwebenden Mars. Frage, ob die Kunst schwebend Körper vorstellen könne?
11. Dem Künstler sind Götter und geistige Wesen nicht blos personisirte Abstrakta, so bald er sie in Handlung kann erscheinen lassen. Die Mythologie ist eigentlich Poetisch, und hat Dichterische Gesetze. Dem Dichter geht Individualität seiner Götter weit über Charakter; so hat er sie dem Künstler übergeben.
12. Ueber die Poetischen Attributen von Horaz, dem großen Liebhaber symbolischer Wesen, wird seine Ode an das Glück, sein Bild der Nothwendigkeit u.s.w. erklärt. Die Maschinen des Epischen Dichters müssen nicht Allegorische Abstrakta seyn: bei Homer sind sie es nicht.
13. Homers Nebel und Unsichtbarwerden sind keine Poetische Phrases: sondern gehören mit zum Mythischen Wunderbaren seiner Epopee. Unsichtbar seyn ist nicht der natürliche Zustand der Homerischen Götter.
14. Auch die Größe derselben ist bei ihm nicht solch ein Hauptzug, als Macht und Schnelligkeit. Unter welchen Bedingungen, und mit welcher Mäßigung er ihre Größe schildert? Erklärung des Helms der Minerva. Von wem er das Colossalische seiner Götter entlehnet?
15. Ob Homer für uns Deutsche übersetzt werden solle? Das Fortschreitende seiner Manier, und die beständig zirkelnden und wiederkommenden Züge in seinen Bildern sind kaum übersetzbar.
16. Das Succeßive in den Tönen ist nicht das Wesen der Dichtkunst. Ganz und gar auch nicht mit dem Coexsistenten der Farben zu vergleichen. Aus dem Succeßiven der Poesie folgt nicht, daß sie Handlungen schildere. Das Succeßive der Töne kommt jeder Rede zu.
17. Fehlschlüsse, wenn man die Succeßion der Töne für das Hauptmerkmal der Poesie annimmt. Homer wählt gar nicht das Fortschreitende seiner Schilderungen, um sie nicht coexsistent zu schildern; sondern weil jedesmal in dem Fortschreiten seiner Bilder die Energie derselben und seiner Gedichtart liegt.
18. Homers Gedichtart kann nicht allen Dichtarten Gesetze, und aus ihrer Manier ein oberstes Gesetz geben. Aus der Succeßion der Töne folgt keine Achtserklärung gegen die malende Poesie.
19. Energie ist das oberste Gesetz der Dichtkunst: sie malet also nie Werkmäßig. Urtheil über Harris Vergleichung und Unterscheidung der schönen Künste.
20. Ob die Schilderung körperlicher Schönheit der Dichtkunst verboten sey? Wo sie jede Schönheit durch Reiz zeigen könne? Ob sie jemals an einer Schönheitsschilderung Werkmäßig arbeite? Ob, wenn der Dichter häßliche Formen nutzen kann, er nicht auch schöne nutzen könne?
21. Homer macht Thersites nicht häßlich, um ihn lächerlich zu machen. Häßlichkeit an Seele und Körper ist sein Charakter, der blos dadurch gemildert wirb, daß er auf nichts Schädliches ausläuft. Es wird also der Person Thersites noch diesmal erlaubt, in Homer zu bleiben.
22. Wenn das Häßliche zum Lächerlichen hilft: so ists zum Contrast des Lächerlichen wesentlich. Zum Schrecklichen nicht so. Ja zum Schrecklichen thut es niemals nichts, sondern zum Abscheu. Ekel kommt eigentlich allein dem Geschmack und Geruch zu; andern Sinnen nur, so fern sie sich an deren Stelle setzen. Nicht alles Häßliche also ist ekelhaft.
23. Gebrauch des Lächerlichen, Schrecklichen, Ekelhaften in Poesie und Malerei. Abschied vom Laokoon.
24. Einzelne Fehler der Winkelmannischen Schriften. Sein Tod – – – Beschluß.
1.
Der Laokoon des Herrn Leßings, ein Werk, an welchem die drei Huldgöttinnen unter den Menschlichen Wissenschaften, die Muse der Philosophie, der Poesie, und der Kunst des Schönen, geschäftig gewesen, ist in unsrer jetzigen kritischen Pestilenz in Deutschland, für mich eine der angenehmen Erscheinungen gewesen, um welche Demokritus die Götter bat, als um die Seligkeit seines Lebens. Ich würde dasselbe auch sehr wohlfeil mit der Bildsäule vergleichen können, von der es den Namen hat, wenn nicht die Mine des Vollendeten, des Schriftstellerischen epoihse eben die wäre, die dieser Laokoon am wenigsten annehmen will. Es mag also diese Sprache durch Kunstvergleichungen immer unsern Schönheitskünstlern des Styls bleiben: ich will den Laokoon als eine Sammlung von Materialien, als einen Zusammenschuß von Collektaneen betrachten – auch als solcher allein, verdient er Betrachtung gnug.
Die Kunstrichter unsrer Zeit, eine Heerde der kleinen Geschöpfe, die Apollo Smintheus jetzt scheint auf unser liebes Vaterland gebannet zu haben, um auch die wenigen Blumen- und Fruchtreichen Auen zu verwüsten, die noch hie und da als Ländereien des Genies übrig geblieben – diese Boten Apollo haben meistens Laokoon nicht besser zu loben gewußt, als auf Winkelmanns Kosten; denn welch ein Lob fließt von den Lippen großer Leute wohl glatter herunter, als das auf Kosten eines Dritten? Leßing soll Winkelmannen so viel unverzeihliche Fehler gezeigt, ihn philosophiren gelehrt, ihn die Grenzen und das Wesen der Kunst gewiesen, und insonderheit in seinen Schriften das aufgedeckt haben, daß seine Känntniß der Alten ein schwankender Grund sey. Wäre das nicht viel? Einem Winkelmann, ihm, der sich so ganz nach den Alten gebildet, der in Griechenland lebet und webet, der in den Alten Kunstkänntniß, bis zum Erstaunen, zeiget, dem Homer, wie er selbst schreibet, täglich sein andächtiges Morgengebet gewesen, – diesem Mann zeigen, daß er Homer nicht gelesen, daß er die Griechen nicht kenne: warum? weil sie Leßing kennet, weil Leßing Homer gelesen! Noch ärger, daß Winkelmann kein Philosoph seyn soll, weil er nicht auf Leßings Art philosophirt, sondern lieber in der Akademie alter Griechischen Weisen, und insonderheit am heiligen Ilyßus wandelt. Und denn am ärgsten, Winkelmannen das Wesen der Kunst lehren – o der unseligen Richter, die taub und blödsinnig, wie Claudius, über die größesten Schriftsteller unsrer Zeit, nicht anders als im Schlafe, nicht anders als über Schüler urtheilen, bei denen Examen zu halten sey, über das, was sie wissen, und nicht wissen, zeigen und nicht zeigen, insonderheit, was ihnen gegen diesen und jenen fehle?1 – –
Auch Leßing wiederum hat, wie billig und recht ist, erleuchteten Kunstrichtern zum Vorwurf dienen müssen, die Schärfe ihrer Augen dem Publikum zu zeigen. Wenn der eine ihn zum größten Antiquar unsrer Zeiten, zum ersten Lehrer der Kunst machte: so war er dem andern, ach leider! ein witziger Kopf, und einem dritten, einem frommen kritischen Christen,2 ein Schulphilosoph, ein Aesthetiker aus Baumgartens Schule, der nach der Sprache unsrer neuen Schöndenker, mit ein paar Unzen Baumgartenscher Philosophie den Weltweisen aller Zeiten trotzen wolle. O! mit verstopftem Ohr durch diese Chöre quäckender Frösche hindurch, wie Ulysses durch den Gesang der Syrenen!
Für mich hat Laokoon an sich selbst Schönheit gnug, als daß er blos durch den Kontrast mit einem andern gewinnen dörfte. Vor und hinter demselben, was L. gegen W. habe, sind entweder nichts als Parerga, für die beide sie ansehen werden, oder wenigstens trifft nichts auf Winkelmanns Hauptzweck, die Kunst; und Laokoon also, als Abhandlung über die Gränzen der Poesie und Malerei, hat Werth und Vortreflichkeit; aber ihn als Streitschrift, als Prüfung der ganzen Winkelmannischen Werke betrachten zu wollen, ist meines Erachtens der falscheste Gesichtspunkt, und der Genius eines Leßings und Winkelmanns sind auch zu verschieden, als daß ichs von mir erlangen könnte, sie gegen einander abzumessen.
Wo Leßing in seinem Laokoon am vortreflichsten schreibt, spricht – der Critikus: der Kunstrichter des Poetischen Geschmacks: der Dichter. Wie Sophokles Philoktet leide, und die Helden Homers weinen, und Virgils Laokoon den Mund öfnen, und körperliche Schmerzen auf dem Theater winseln dörfen – wie Virgil, Petron und Sadolet den Laokoon bilden, und der Dichter den Künstler, und der Künstler den Dichter nachahmen könne – wer spricht hier überall, als der Kunstrichter des Poeten? Dieser ists, der dem Philoktet des Chateaubrun einen Streich giebt, der Spence'n und Caylus ihre Fehler zeiget, der Homers Poetische Wesen claßificirt, und Poetische von der Malerischen Schönheit unterscheidet – überall der Kunstrichter des Dichters: das ist sein Geschäft. Und sein Zweck derselbe. Dem falschen Poetischen Geschmack entgegen zu reden, die Grenzen zwoer Künste zu bestimmen, damit die eine der andern nicht vorgreifen, vorarbeiten, zu nahe treten wolle: das ist sein Zweck. Was er auf diesem Wege von dem Innern der Kunst findet, freilich nimmt ers auf; aber mir noch immer Leßing, der Poetische Kunstrichter, der sich selbst Dichter fühlt.
Winkelmann aber, ein Lehrer Griechischer Kunst, der selbst in seiner Kunstgeschichte mehr darauf bedacht ist, eine Historische Metaphysik des Schönen aus den Alten, absonderlich Griechen, zu liefern, als selbst auf eigentliche Geschichte. Und also auf eine Critik des Kunstgeschmack noch uneigentlicher. Um den falschen Geschmack andrer Zeiten und Völker ist ihm nie als um Hauptzweck zu thun; den züchtigt er blos, wenn er neben oder unmittelbar vor den Alten ihm zu Gesicht kommt: denn sonst, wie oft hätte er nach seiner vornehmen Griechischen Idee züchtigen, und seine Hand in Nebenstreichen ermüden müssen! Und schreibt er also nicht als Critikus des Kunstgeschmacks; wie weit entfernter vom Kunstrichter der Poesie? Als Künstler las er die Dichter, als Kunstlehrer brauchet er sie, und würde nicht so haben schreiben können, wenn er auch selbst die Dichter anders, und nicht als Künstler gelesen. Er, dem wie jenem Griechischen Künstler, die Schönheit selbst, (aber die Kunstschönheit) erschienen war; bezaubert von ihr, suchte er ihre Gestalt also mit Feuer in seinen Geist gemalt, brennend in seinem Auge, und sich in seinem Herzen regend – diese Gestalt der Kunstschönheit, dieß Bild der Liebe, suchte er allenthalben, wollte sie auch im bloßen Abglanz sehen, vermuthete sie selbst, wie Kleists Amynt seine geliebte Lalage, auch in Fußtritten, auch im Bilde des Wassers, auch im Hauche des Zephyrs, der freilich von einer andern Lalage, (der Schönheit des Dichters) kommen konnte. Im Gefühl also dieser bildenden und nicht dichtenden Schönheit stand er auch vor Virgils Laokoon, wie vor dem Laokoon des Polydorus, und so muß er gelesen werden: denn das sind Schranken der Menschlichen Natur, auf Einmal nur Eines sehen zu können, was man will, und wie man will – Dieß eine war bei Winkelmann die Kunst. Soll ich ihm also Känntniß der Alten absprechen, weil er Homer nicht als Dichter, sondern als Künstler, nicht also des Poetischen Wesens seiner Muse wegen, nicht wie Leßing gelesen? Soll ich ihm einen Seitenblick, den er auf die Poesie wirft, um seine Kunst zu erläutern, und gesetzt dieser Seitenblick träfe auch nicht auf das Innere der Dichtkunst, zum Hauptverbrechen anrechnen? Und soll ich, weil Leßing wiederum alles aus dem Grunde der Seele holt, soll ich ihn für einen spekulativen Witzling, und wenn er einigemal mit seinen muntern Schlüssen zu weit käme, für einen rathenden Kopf halten? Warum können wir denn nicht zween so originale Denker, Winkelmann und Leßing nehmen, wie jeder ist? Auch in der Schreibart so gar haben beide eine Griechische Grazie zur Freundin; nur daß sie bei beiden nicht Eine Grazie ist.
Winkelmanns Styl ist wie ein Kunstwerk der Alten. Gebildet in allen Theilen, tritt jeder Gedanke hervor, und stehet da, edel, einfältig, erhaben, vollendet: er ist. Geworden sey er, wo oder wie er wolle, mit Mühe oder von selbst, in einem Griechen, oder in Winkelmann; genug, daß er durch diesen auf einmal, wie eine Minerva aus Jupiters Haupt dastehet und ist. Wie also an dem Ufer eines Gedankenmeeres, wo auf der Höhe desselben der Blick sich in den Wolken verliert: so stehe ich an seinen Schriften, und überschaue. Ein Feld voll Kriegsmänner, die weit und breit zusammen geworben, die Aussicht erst lange ins Große führen; wenn aber endlich aus dieser Weite das Auge erhabner zurück kommt: so wird es sich an jeden einzelnen Kriegsmann heften, und fragen, woher? und betrachten, wer er sey? und alsdenn von vielen den Lebenslauf eines Helden erfahren können.
Leßings Schreibart ist der Styl eines Poeten, d.i. eines Schriftstellers, nicht der gemacht hat, sondern der da machet, nicht der gedacht haben will, sondern uns vordenket, wir sehen sein Werk werdend, wie das Schild Achilles bei Homer. Er scheint uns die Veranlassung jeder Reflexion gleichsam vor Augen zu führen. Stückweise zu zerlegen, zusammen zu setzen; nun springt die Triebfeder, das Rad läuft, ein Gedanke, ein Schluß giebt den andern, der Folgesatz kommt näher, da ist das Produkt der Betrachtung. Jeder Abschnitt ein Ausgedachtes das tetagmenon eines vollendeten Gedanken: sein Buch ein fortlaufendes Poem, mit Einsprüngen und Episoden, aber immer unstät, immer in Arbeit, im Fortschritt, im Werden. Sogar bis auf einzelne Bilder, Schilderungen und Verzierungen des Styls, erstrecket sich dieser Unterschied zwischen beiden, Winkelmann der Künstler, der gebildet hat, Leßing der schaffende Poet. Jener ein erhabner Lehrer der Kunst; dieser selbst in der Philosophie seiner Schriften ein muntrer Gesellschafter; sein Buch ein unterhaltender Dialog für unsern Geist.
So dörften beide seyn: und wie unterschieden! wie vortreflich bei dem Unterschiede! Weg also mit der Brille, durch die man von einem zum andern schielen will, um durch Kontrast zu loben! Wer L. und W. nicht lesen kann, wie jeder derselben ist, der soll keinen von beiden, der soll sich selbst lesen! – –
Fußnoten
1 Ich führe aus diesen hohen Urtheilen über Winkelmann nur Eins an: Klotz. acta litter. vol. III. p. 319. lassen sich bei Gelegenheit des Laokoon also vernehmen: Reddiderunt forte virum doctumnimiae laudes securiorem, quibus prima illius opuscola, multo meliora eo, quod de allegoria compilauit, extuleruntquidam, quibus si me quoque accensueris, nec miror, nec indignor. Vtinam ne exemplo Winkelmanns suo aliquandodoceat, saepe nocere auctorum famae et ingeniis praeconumet amicorum voces, plausus et laudes, minuere diligentiam,addere fastum et fiduciam! Es sei denn, daß Herr Klotz dieses aus eigner Erfahrung sage, weiß ich nicht, ob die einzelnen Urtheile, die Herr Klotz über Winkelmann zu fällen, und die manchen Verbesserungen, die er ihm anzudrehen beliebet hat, eben Ihn berechtigen, ein so entscheidendes Haupturtheil über Winkelmann zu fällen, ohne Beweise.
2 Auch hier führe ich nur einen Zeugen an: Huch über die Satyre Archilochus; und kann zu jedem angeführten Zuge einen anführen, wenn es der Mühe werth wäre.
2.
W. schildert seinen Laokoon,1 mit dem Gefühl, als hätte er ihn selbst geschaffen: »Der Schmerz, welcher sich in allen Muskeln und Sehnen des Körpers entdecket, und den man ganz allein, ohne das Gesicht und andre Theile zu betrachten, an dem schmerzlich eingezognen Unterleibe beinahe selbst zu empfinden glaubt; dieser Schmerz, sage ich, äußert sich dennoch mit keiner Wuth in dem Gesichte und in der ganzen Stellung. Er erhebt kein schreckliches Geschrei, wie Virgil von seinem Laokoon singet; die Oeffnung des Mundes gestattet es nicht: es ist vielmehr ein ängstliches und beklemmtes Seufzen, wie es Sadolet beschreibt. Der Schmerz des Körpers und die Größe der Seele sind durch den ganzen Bau der Figur mit gleicher Stärke ausgetheilet und gleichsam abgewogen. Laokoon leidet, aber er leidet, wie des Sophokles Philoktetes: sein Elend gehet uns bis an die Seele; aber wir wünschten, wie dieser große Mann, das Elend ertragen zu können.«
»Laokoon leidet, wie des Sophokles Philoktet.« Von dieser Vergleichung gehet Hr. Leßing2 aus, und will, daß es keine Vergleichung sey: daß Sophokles Philoktet nicht blos ängstlich und beklemmt seufze, sondern klage, schreie, mit wilden Verwünschungen das öde Eiland schrecklich anfülle, und auch das Theater von Tönen des Unmuths, des Jammers, der Verzweiflung durchhallen lasse. Winkelmann muß also zuerst wohl nicht recht gelesen haben, und zweitens also übel vergleichen, übel folgern.
Der Philoktet Sophokles mag entscheiden – wie leidet dieser? Es ist sonderbar, daß der Eindruck, den dieses Stück bei mir von lange her zurück gelassen, derselbe ist, den W. will: nämlich der Eindruck eines Helden, der mitten im Schmerz seinen Schmerz bekämpft, ihn mit holem Seufzen zurückhält, so lange, als er kann, und endlich, da ihn das Ach! das entsetzliche Weh! übermannet, noch immer nur einzelne, nur verstolne Töne des Jammers ausstößt, und das übrige in seine große Seele verbirgt. Lasset uns Sophokles aufschlagen, lasset uns lesen, als ob wir sähen, und ich glaube, wir werden den nämlichen Philoktet gewahr werden, den Sophokles schuff, und Winkelmann anführt, wie er geschaffen ist.
Mit Anfange des dritten Aufzuges überraschet ihn der Schmerz; aber mit brüllendem Geschrei? Nein: mit einem plötzlichen Stillschweigen, mit einer stummen Bestürzung, und da diese sich endlich lösen, mit einem holen verzognen a a a, das sich auch kaum vom Neoptolem will hören lassen.3 Was ist dir? fährt dieser auf. »Nichts böses, gehe nur, mein Sohn;« antwortet Philoktet, und wie anders, als mit einem Gesicht voll Liebe, voll zurückhaltendes Heldenmuthe. So geht die Scene des stummen Schmerzes fort: der bekümmerte, der unruhige, der fragende Neoptolem, und Philoktet, der – nicht brüllet und tobet, der seinen Schmerz beklemmt, ihn eine große Zeit selbst dem Neoptolem verbergen will, und nur immer zwischen inne mit einem bangen io teoi den Göttern klaget. Und eben diese stumme Scene des Schmerzes, von welcher, Wirkung muß sie auf den Zuschauer gewesen seyn? Er sieht Philoktet leiden, stumm, nur in einer verzognen Geberde, nur mit einem beklemmten Ach! leiden; und wer fühlt dieß beklemmte Ach! nicht mehr, als das brüllende Geschrei eines Mars, der in der Schlacht verwundet, wie zehn tausend Mann, oder warum nicht lieber, wie zehn tausend Ochsen? aufbrüllet? Hier erschrickt, dort fühlet man: mit Philoktet mitleidend bestürzt, als Neoptolemus, banget man, weiß nicht, woran man ist, was man thun, wie man helfen soll? Man tritt auf sein trauriges a a zu ihm: »Wie denn? du leidest! du redest nicht! Warum so verschlossen? Du wirst gepeiniget? warum seufzest du zu den Göttern?« – Und ein Philoktet antwortet mit verzognem Lächeln, mit einem Gesicht, in welchem sich Schmerz und Muth und Freundlichkeit mischen: Ich? Nein! ich empfinde Erleichterung! ich flehe zu den Göttern um glückliche Schiffahrt. Welch ein Griechischer Garrik gehöret dazu, den Schmerz und den Muth, die Menschliche Empfindung und die Heldenseele hier abzuwiegen!
Uebermannet endlich vom Schmerz unterliegt er; er bricht aus – aber in Töne der brüllenden Verzweiflung, des wütenden Geschreies? Nichts! in ein trauriges apolola teknon. brykomai teknon. papai. apappapai, papai, papai, papai, papai: das sind seine gezognen Klagetöne! Er bittet um die Heldencur, seinen Fuß abzuhauen: er winselt. – Nichts mehr? Nein, nichts mehr! Er war ausgebrochen, wie Neoptolem sagt, nur in iyghn kai sonon in Aechzen und Seufzen, und Ach! wie muß dieß rühren! Sein gekrümmter Fuß, sein verzognes Gesicht, seine vom Seufzer erhobene Brust, die vom Aechzen hole Seite, sein halbes Ach! – – Weiter geht der Dichter nicht: und um zuvor zu kommen dem Uebertreiben des Ausdrucks, läßt er Philoktet vor Schmerz in Unsinn fallen! So sehr hat er gelitten, so sehr seine Kräfte zusammen gefasset, daß er raset.
Er kommt wieder zu sich! er erholt sich! aber die Krankheit kommt, wie ein verirrter Wandrer wieder: schwarzes Blut sprüht hervor: sein apappapai fängt an: er bittet, ächzet; ein Fluch auf Ulysses, ein Zorn mit den Göttern, ein Ruff an den Tod, aber alles nur Ruckweise, nur Augenblicke! der Schmerz läßt nach; und siehe! den Augenblick der Erholung wendet er an, um den dritten Anfall zu erwarten. Er kommt, und da der Theatralische Ausdruck nicht höher steigen kann, so läßt ihn Sophokles – alles, was er ihn thun lassen kann, um ihn nicht schreien zu lassen: schwärmen, ächzen, bitten, zürnen, athemlos zu sich kommen und – – einschlafen. Peinlicher Auftritt! der höchste am Ausdrucke, den vielleicht je ein Tragisches Stück gefodert, und nur ein Griechischer Schauspieler erreichen konnte.
Aber in diesem peinlichen Auftritte, was ist da das Höchste am Ausdruck, was ist der Hauptton desselben? Etwa Geschrei? So wenig, daß Sophokles ja auf nichts sorgfältiger scheint, als zu vermeiden, daß dieß nicht Hauptton würde. Wo sind »die Klagen, das Geschrei, die wilden Verwünschungen, mit welchen sein Schmerz das Lager erfüllte, und alle Opfer, alle heilige Handlungen störte, die schrecklich durch das öde Eiland erschollen;«4 wo sind sie? auf dem Theater? Ja! aber in der Erzälung,5 in der Erzälung seines Feindes Ulysses, der sich darüber rechtfertigen will, daß man ihn ausgesetzt, und verlassen; nicht aber in der Aktion, nicht als ob dieß Geschrei Hauptausdruck wäre. Ein andrer Dichter, ein Aeschylus z.E. würde freilich hieraus mehr Hauptton gemacht, und vielleicht, wie durch seine Evmeniden eine Schwangere erschreckt haben, zu misgebähren: bei einem übertriebenen neuen Tragikus würde Philoktets Gebrülle gewiß schon hinter den Scenen anfangen, und er sich mit wüstem, wildem Geschrei aufs Theater stürzen, wie z.E. Hudemanns Kain durch den schönsten und neuesten Coup de Theatre sich vor dem Eintritt mit seiner Keule meldet, sie vor sich hin wirft, und ihr nach, Länge lang aufs Theater hinfällt. Aber bei dem weisen Sophokles? – Wie hat er den Ton der Angst abgewogen? wie sorgfältig auf ihn bereitet! wie lange unterdrückt! wie oft unterbrochen! wie sehr durchgängig gemildert! Der ganze Auftritt kann ein Gemälde des Schmerzes heißen durch alle seine Grade vom stummen, bis zum betäubenden Schmerze, der sich selbst gleichsam ertödtet; aber im Ganzen, doch das Gemälde des zurückgehaltenen und nicht des ausgelassenen Schmerzes, dieß ists unstreitig bey Sophokles vom Anfang zu Ende.
Und daher auch die Kürze des Akts, der kurz in Worten, aber lang in der Vorstellung ist. Käme es hier auf das Schreien, auf die jammervollen Ausruffungen, auf das ausgestoßne und »abgebrochne häufige a, a an,« wie Hr. L.6 will: so weiß ich nichts was entweder schneller auf einander folgen, oder den Zuschauer unwillig machen muß. Aber das Zurückhalten, das peinliche Verschmerzen, die langen Kämpfe mit dem Weh im Stillen, die endlich mit einem verstohlnen o moi! moi! geschlossen werden; diese dehnen, diese schleichen, und sie sind der Hauptton des ganzen Auftritts. Nun setzen Sie noch den dämmernden Chorus hinzu, der dem entschlafnen Philoktet sein Schlaf- sein Ruhelied, in sanften langsamen Zügen singet, und hier nicht bloß den Akt beschließet, sondern selbst im Akte ist; denn der schlafende Philoktet lieget dem Zuschauer vor Augen; diesen, sage ich, setze man hinzu, und es ist ein langer, ganzer, vollendeter Akt, der meine Seele füllet: aber nicht durchs Ausstoßen, sondern eben durch das Rückhalten des Ach! Und so kann Winkelmann mit Recht sagen: Laokoon leidet, wie Sophokles Philoktet: nur jener, als Bildsäule, bei welcher ein Seufzer ewig dauret, ewig die Brust beklemmet, und dieser als Tragische Person, die den langen Seufzer endlich mit einem Ach! schließen, und den wieder kommenden Schmerz mit einem Ach! empfangen muß, die zwar auf einer Saite des Jammers herum irret, aber mit abgesetzten, mit langsam wiederkommenden, mit etwas auf- und absteigenden, mit Zwischentönen des unterdrückten Schmerzes. Sophokles war also derselbe weise Meister in seinem Philoktet, wie Polydorus in seinem Laokoon, und bei beiden zeigt sich, nur nach der Verschiedenheit ihres Vorwurfs, einerlei Weisheit, den stillen, den prägnantsten Ausdruck, zu suchen, und dem übertriebnen Ausdruck zu entweichen. Und das sagt Winkelmann! Allerdings ist Schreien der natürliche Ausdruck des körperlichen Schmerzes:7 nur jede Kunst der Nachahmung, und so darf ich auch sagen, jede Gedichtart, hat in Nachahmung dieses Ausdruckes ihre eigenen Gränzen. Wie abwechselnd ist Homer in der Art, wie seine Krieger, seine Helden niederfallen, und wie wiederholend in dem, was den Niederfallenden und Sterbenden gemein ist; aber weder jene Abwechselung, noch diese Wiederholung macht mir das Leßingsche Wort verständlich: »Homers Krieger fallen nicht selten mit Geschrei zu Boden!«8Sehr selten, möchte ich sagen, (wenn mich nicht mein Gedächtniß aus Homer trügt) und fast gar nicht, außer wenn eine nähere Bestimmung dieses Charakters es fodert. So gewöhnlich ihm ist, das sein Krieger mit klirrenden Waffen, mit bebendem Boden u.s. w. fällt und stirbt indem ihm Dunkelheit die Augen deckt;9 so ungewöhnlich fällt und stirbt einer mit Geschrei, mit Heulen: und alsdenn ist dieß »nicht der natürliche Ausdruck des körperlichen Schmerzes,« sondern ein Charakterzug seines Verwundeten. So heult z.E. bei seiner Verwundung ein Pherekles;10 aber dieser Pherekles ist ein Trojaner, ein unkriegerischer Künstler, ein feiger Flüchtling, der auf der Flucht eingeholt wird; und freilich ein solcher kann sich durch ein Geheul auf seinen Knieen unterscheiden; aber offenbar »nicht der leidenden Natur ihr Recht zu lassen,« sondern vermöge seines Charakters. Vermöge dieses, schreiet die Venus laut;11 denn sie ist die weichliche Göttin der Liebe: ihre zarte Haut ist kaum gestreift, kaum wird sie den rothen Ichor, das Götterblut, gewahr, so entsinken ihr die Hände; sie verläßt die Schlacht, sie weint vor Bruder, Mutter, Vater und dem ganzen Himmel: sie ist untröstlich. Wer will nun sagen, daß mit diesem allen Homer sie charakterisiere, »nicht um sie als die weichliche Göttin der Wollust zu schildern, sondern vielmehr um der leidenden Natur ihr Recht zu geben?« Wäre dieß, wie würde er so genau die Seite des Weichlichen12 mit jedem Bilde, mit jedem Worte, mit jeder Bewegung zeichnen? wie würde er sie noch oben drein, von Pallas verspotten lassen, als hätte sie sich bei einem Liebeshandel vielleicht geritzt? wie würde selbst ihr lieber Vater Jupiter über sie lächeln? Lachet dieser, spottet jene, um der leidenden Natur ihr Recht zu geben? und welche leidende Natur ist ein Ritz der blendenden Haut? – Eben so wenig schreiet der eherne Mars13 aus einer andern Ursache, als eben – weil er der eherne, der Eisenfressende Mars ist, der im Getümmel der Feldschlacht raset, und eben so wild bei der Verwundung aufschreiet. Nichts ist ungezweifelter, als dieß, wenn wir Homer sagen lassen, was er sagt; denn wäre es ihm auch nur je eingefallen, das Schreien, als »einen natürlichen Ausdruck des körperlichen Schmerzes« und nicht mit höhern Absichten zu gebrauchen, so wäre der Ausdruck: »Er ward verwundet und schrie!« ihm so geläufig, als der »er fiel, und schwarze Nacht bedeckte seine Augen.«
So weit sind wir also, daß Homer »das Prädikat des Schreiens, nicht als einen allgemeinen Ausdruck des körperlichen Schmerzes,« nicht als eine absolute Bezeichnung, »der leidenden Natur ihr Recht wiederfahren zu lassen« gebrauche; es muß in dem Charakter eben dessen, den er schreien läßt, eine nähere Bestimmung dazu liegen, daß eben dieser schreiet und kein andrer. Und da dünkt es mich jetzt unbestimmt, von seinen Helden allgemein zu reden,14 was sie nach ihren Thaten und Empfindungen sind; denn keiner derselben ist an Empfindungen so wenig, als an Worten, Geberden, Körper, Eigenschaften dem andern gleich; jeder ist eine eigne Menschenseele, die sich in keinem andern äußert.
Noch minder scheinet mir »das Schreien« der wichtige unveränderliche Zug zu seyn, der zu der unveränderlichen Aeußerung eines Menschengefühls gehören müßte: denn einer kann seufzen, der andre ächzen, der dritte schreien, und ein Hannibal in seinem äußersten Kummer lachen. Am mindesten aber ists nothwendige Bestimmung des Helden, als Mensch betrachtet: so daß er ein Unmensch seyn müßte, wenn er nicht schrie. Wäre dieß: so hätte Homer lauter Unmenschen besungen. Sein Agamemnon, ein König der Völker, der herrlichste der Griechen vor Troja wird im tapfersten Gefecht verwundet: er fährt zusammen15 – aber aufzuschreien, zu weinen, vergißt er; er faßt sich, und stürzt mit seinem Spieße desto schärfer in die Feinde: sollte er deßwegen kein Mensch an Empfindung seyn, weil er nicht wie Mars, oder die Dame Venus aufschrie? Hektor, der tapferste Trojaner, wird von des Ajax großem Felsenstein niedergeworfen, und auf der Brust gequetscht: Spieß und Schild und Helm entfallen: rings um ihn klingen die ehernen Waffen16 – aber aufzuschreien vergißt er. Man muntert ihn auf, gießt ihm Wasser ein: er kommt zu sich: blickt auf; aber er sinkt in die Kniee, speiet schwarzes Blut – und doch denkt der Unmensch an eins nicht, über seine Brustschmerzen, über seine Seitenstiche zu schreien und zu weinen. – So mit allen Helden Homers, der auch in diesem Stücke Charakter beobachtet. Menelaus wird vom Pfeile Pandarus unvermuthet und im wichtigsten Zeitpunkte getroffen: sein Blut rinnt: Agamemnon fährt zusammen: Menelaus selbst;17 aber nichts mehr! da er den Pfeil in der Wunde sieht, zieht er ihn aus, und läßt seinen Bruder und seine Mitsoldaten um sich seufzen. Man weiß, daß Homer eine ordentliche Leiter der Tapferkeit habe, und er hat sie auch in dieser anscheinlichen Kleinigkeit sogar. Ulysses18 hält deßwegen seinen Schmerz zurück, weil er die Wunde nicht tödtlich fühlt; Agamemnon und Menelaus fahren19 bei der Verwundung doch noch zusammen; aber endlich der verwundete Diomedes »stand, rief dem Sthenelus, ihm den Pfeil aus der Wunde zu ziehen; und da das Blut quoll, so strömte seine Empfindung, statt in Thränen und Geschrei, in feurige Gebete wider die Feinde aus.20 Solche Unmenschen sind die Helden Homers, und je größerer Held, je größerer Unmensch: sein Achilles ist sogar am Körper unverletzlich.«
Ists also bei Homer, daß seine Helden schreien und weinen müssen, »um der menschlichen Natur treu zu bleiben, wenn es auf das Gefühl der Schmerzen, wenn es auf die Aeußerung dieses Gefühls durch Schreien oder durch Thränen ankommt?«21 Ich wollte nicht, daß ein alter Grieche, dessen Heldenseele, als ein seliger Dämon noch in der Welt unsichtbar wandelte, diese Behauptung läse. Was? würde er sagen, was ist wohl einem in die Schlacht ziehenden Helden natürlicher, als verwundet, getroffen werden; sich fürchten also kann er, wenn ihn ein unvermutheter Pfeil trifft; aber in der Schlacht schreien und weinen, das thut kein Homerischer Held der Griechen; selbst kein Held der Trojaner, die doch immer Homer in kleinen Zügen herunter setzt. Einem Hektor22 in seinem Tode entsinkt, selbst bei seiner letzten sterbenden Bitte, keine Thräne, kein Ton des Geschreies: ein Sarpedon23 knirscht, da er stirbt, und je tapferer, um so gefaßter bei dem Schmerze. Nur die Feigen zittern und weinen und schreien: Pherekles, der feige Flüchtling, und die weichliche Venus, und der Eisenfressende Trojanische Mars. So dichtet mein Homer.
Und so hält also die so einnehmende Leßingsche Betrachtung24 über die Empfindbarkeit der Griechen, und den Kontrast derselben gegen rohe Barbarn, und seine Europäer nicht Stich? Die Empfindbarkeit zum Schmerzen bei einem körperlichen Schmerze nicht wohl, wenigstens nicht als Homerischer Heldenzug, nicht allgemein, nicht als nothwendiges Kennzeichen der Menschlichen Empfindung. Giebts aber keine andre Empfindbarkeit zu Thränen, und auch zu lauten, zu klagenden Thränen, als körperlicher Schmerz? Ohne Zweifel, und eben diese Empfindbarkeit, wenn sie ein Vorzug der Griechen wäre, macht ihnen zwar mehr Ehre; allein die Abhandlung darüber wäre offenbar eine Ausschweifung von dem Satze, den Hr. L. glaubt erwiesen zu haben,25 »daß das Schreien,26 bei Empfindung körperlichen Schmerzes, besonders nach der alten Griechischen Denkart, gar wohl mit einer großen Seele bestehen kann;« ein seltner Satz, der im ersten Abschnitt, auch eben so selten, mit einer Armee von weinenden Helden, die ich im Homer nicht kenne, bewiesen wird.27 Um also doch nicht leer auszugehen, lasset uns Leßingen auf seinem Abwege folgen.
Fußnoten
1 Von der Nachahmung griechischer Werke. S. 22. [Werke I, 31]
2 Less. im Laok. p. 3. [377].
3Neo. erpA ei teleis, ti dh potA odA ex oydenos
Logoy siopas, kapoplhktos odA exh;
Pil. a a a.
Neo. ti estin;
Pil. oyden deinon. allA itA, o teknon k. t. l.
4 Laok. p. 3. [377]
5 Sophokl. Philokt. Akt. 1. Auftr. 1.
6 Laok. p. 4. [377]
7 Laok. p. 4.
8 Laok. p. 4.
9Ampi dA osse kelainh nyx ekalype.
10Iliad. E. 68. eripA oimoxas.
11 H de megA iaxoysa. Iliad. E.v. 343.
12ablhxrhn. Iliad.E.v.337.
13Iliad. E.v.859.
14Laok. p. 5. [377].
15Iliad. l. v.254. PIGHSEN tA arA epeita anax andron Agamemnon.
16Iliad. X. v.418.
17Iliad. . v.148.
18Iliad. L. v.439.
19Iliad. D. v.148.
20Iliad. E. v. 95. etc.
21Laok. p. 5. [378]
22Iliad. X.v.330. etc.
23Iliad. P. v.486.
24Laok. p. 4–9.[377 – 380]
25 Laok. p. 9.
26 Daß Homers Helden nicht bei andrer Gelegenheit das Schreien, ein tapfres Riesenmäßiges Geschrei, eigen gewesen, leugne ich nicht; wo gehört das aber hieher?
27 Hr. Klotz hat, wie Er Homer kennet, Leßingen hieß nachschreiben dörfen: clamor et eiulatus ex Graecorum opinione nihil detraxit magnitudini animi. Homeri heroes clamantes cadunt. Sunt quidem illi heroes Homeri natura mortali maiores, sed numquam tamen etc. Act. litter. Vol. III. p. 286.
3.
Die Empfindbarkeit der Griechen zu sanften Thränen, ist zu sehr bekannt in Aeußerungen, als daß man, wie Herr Leßing ein einzelnes Beispiel, und dazu aus einer bloßen Vermuthung1 nehmen dörfte, die hier, vielleicht nicht beweiset, was sie beweisen soll. Griechen und Trojaner sammlen ihre Todten. Beide vergießen heiße Thränen; aber den Trojanern verbietet dieß Priamus. Warum verbietet ers ihnen? Er besorgt, sagt die Dacier, sie würden sich zu sehr erweichen, und morgen mit wenigerm Muth an den Streit gehen. »Warum aber, fragt Herr Leßing, muß nur Priamus dieses besorgen? Der Sinn des Dichters geht tiefer. Er will uns lehren, daß nur der gesittete Grieche zugleich weinen und tapfer seyn könne; indem der ungesittete Trojaner, um es zu seyn, alle Menschlichkeit vorher ersticken müsse.« Zu hart für die armen Trojaner! Kann Priamus nicht ihren Thränen Einhalt thun wollen, nicht aus ungesitteter Barbarei, sondern weil die Thränen der Trojaner, seiner Kinder, fressender waren, als die Thränen der Griechen? Diese waren Angreifende, und stritten um der Ehre wegen; ihnen wards also leichter, neuen Muth zu fassen, und Agamemnon brauchte deßwegen keine Besorgniß. Die Trojaner aber litten: sie waren Angefallene, die nicht der Ehre so wohl als der Sicherheit, ihres Lebens wegen stritten,2 die sich in Bedrängniß fühlten, und halb in Verzweiflung, eines Räubers wegen, ihre Kinder und Männer verlieren, eines Räubers wegen die Ihrigen begraben mußten. Hier empörten sich die Empfindungen der Bedrängten, hier flossen heiße Thränen der murrenden Unschuld. Und Priamus ließ sie nicht weinen! Warum? weil er ein ungesitteter Barbar war, und seine Trojaner als solche kannte, die nicht zugleich weinen und streiten könnten? Wie wenn er sie zurückgehalten hätte, als ein Vater seiner unglücklichen Stadt, und seines Unglückbringenden Sohns? damit sie nicht in einem Schicksale, das ihm selbst so zu Herzen gieng, gar murren oder verzweifeln möchten? – Doch wenn das auch nicht: noch sind die Trojaner keine Lappländer, keine Scythen: denn sie weinen ja um die Ihrigen, und Priamus befürchtet eben ein zu weiches Herz, zu 32 tief einfressende Thränen. Gerade also das Gegentheil! – Doch aus solchen Deutungen kann man immer machen, was man will, und eine bloße Allegorie: »der Sinn des Dichters geht tiefer,« kann uns endlich so tief führen, daß der Boden sinkt.
Die ganze Dichtkunst der Griechen hat zu viel Spuren dieser Empfindbarkeit ihrer Nation zu Schmerz und Thränen, als daß man bloß muthmaßen dörfte, und sie ist einem großen Theile nach gleichsam ein ganzer lebender Abdruck dieses Gefühls, dieser weichen Seele. Lasset uns diesen Theil die Elegische Poesie nennen; aber niemand verstehe hier unter diesem Namen jenen hinkenden Affen, der sich nach unsern weisen Lehrbüchern der Poesie bloß im Sylbenmaas unterscheiden soll: sondern Elegie sei mir hier die klagende Dichtkunst, die versus querimoniae nach Horaz, sie mögen sich finden, wo sie wollen, in Epopee und Ode, in Trauerspiel, oder Idylle; denn jede dieser Gattungen kann Elegisch werden. In solchem Verstande hat die Elegie ein eignes Gebiet in der Menschlichen Seele, nämlich die Empfindbarkeit des Schmerzes und der Betrübniß: man kann also aus ihr über Völker und Zeiten hinaus sehen, und hier wird sich durch Vergleichungen auch die den Griechen eigne Stelle finden. Ich stecke einige Gesichtspunkte ab.
1. Nicht jedes Volk hat für milde Betrübnisse ein gleich zartes Herz; bei manchem haben selbst die Klagen eine rohe Vestigkeit, ein Heldenmäßiges Brausen, in welches sie verschlungen werden, und ein solches wird, bei sonst großen Dichtern, mit der Sprache dieser weichen Thränen sehr unbekannt seyn können. So die Nordischen Skandinavier, die auch bei Trauerfällen vom Heroismus gestält, kaum kurze Seufzer ausstießen und – schwiegen; wenn sie sangen, so war ihr Gesang kaum die milde Elegische Thräne.
Der König Regner Lodbrog stirbt3: er stirbt unter den entsetzlichsten Schmerzen. Stirbt er in Elegien? Läßt er der gequälten sterbenden Menschheit, dem von seinen Söhnen entfernten brechenden Vaterherze sein Recht wiederfahren? Eine einzige weiche Thräne hätte den Nachfolger Odins entweihet. Er stirbt im Triumphsliede, im Andenken an seine Thaten, voll Heldenfreude, voll Rache, voll Muth, voll Himmlischer Hoffnung. »Wir haben mit Säbelstreichen gefochten, so endet sein Gesang, o wüßten meine Söhne die Plagen, die ich erdulde; wüßten sie, daß giftige Nattern mir den Busen zerfleischen – wie heftig würden sie sich nach grausamen Schlachten sehnen! Denn die Mutter, die ich ihnen gab, hat ihnen ein Männliches Herz hinterlassen.
Wir haben mit Säbelstreichen gefochten; doch jetzt – nahet sich mein letzter Augenblick. Bald wird das Schwert meiner Söhne ins Blut des Ella getaucht seyn: ihr Zorn wird entflammen, und diese muthige Jugend die Ruhe nicht weiter dulden.
Wir haben mit Säbelstreichen gefochten in ein und funfzig Schlachten, wo die Fahnen flogen. Von meiner Jugend an lernte ich, die Spitzen der Lanzen mit Blute färben, und nie hätte ich einen tapferern König, als ich bin, zu finden geglaubt. – Aber es ist Zeit, aufzuhören: Odin sendet schon die Göttinnen mich in seinen Pallast zu führen. Da werde ich auf dem erhabensten Platze sitzend Bier mit den Göttern trinken. Die Stunden meines Lebens sind verflossen, ich sterbe lächelnd! –« Das beste Beispiel zu Herrn Leßings Bemerkung über den harten Nordischen Heldenmuth.
Ein anderes aus einer der besten kritischen Schriften4