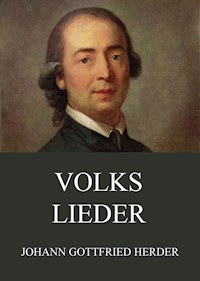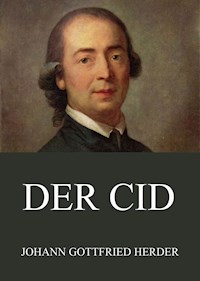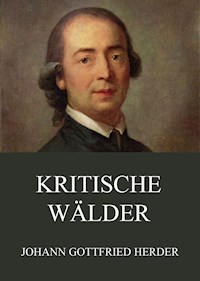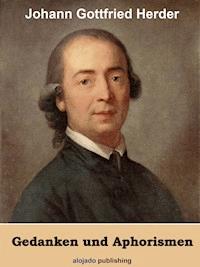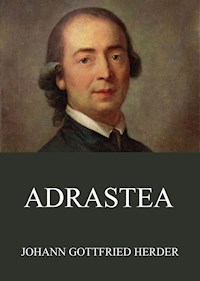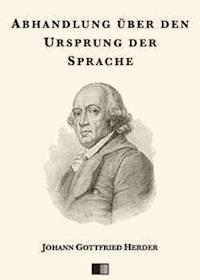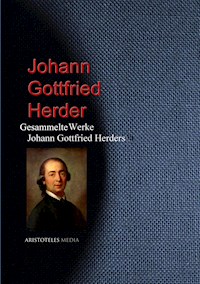Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem fiktiven Briefwechsel reflektiert Herder nicht nur die Natur des Menschen, sondern auch seine Aufgaben und sein Wesen. Herder war in vielerlei Hinsicht ein Spinozist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 975
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Briefe zur Beförderung der Humanität
Johann Gottfried Herder
Inhalt:
Johann Gottfried Herder – Biografie und Bibliografie
Briefe zur Beförderung der Humanität
Erste Sammlung
Gespräch nach dem Tode des Kaiser Josephs II.
Zweite Sammlung
Dritte Sammlung
Nachschrift
Vierte Sammlung
Fünfte Sammlung
Haben wir noch das Publikum und Vaterland der Alten?
I.
II.
Sechste Sammlung
Siebente Sammlung
Erstes Fragment
Nachschrift
Zweites Fragment
Nachschrift
Drittes Fragment
Nachschrift
Viertes Fragment
Fünftes Fragment
Achte Sammlung
Sechstes Fragment
Nachschrift
Siebentes Fragment
Achtes Fragment
Neuntes Fragment
Neunte Sammlung
[Der deutsche Nationalruhm]
Zehnte Sammlung
Neger-Idyllen
Die rechte Hand
Die Brüder
Zimeo
Der Geburtstag
Nachschrift des Herausgebers
Der Hunnenfürst
Das Kriegsgebet
Kahira
Das Kriegsrecht
Das Seerecht
Der betrogne Unterhändler
Zum ewigen Frieden
Al Hallils Rede an seinen Schuh275
Der Fürst
Ruhm und Verachtung
Al Hallils Klagegesang
Der Geist der Schöpfung
Die Zeitenfolge
Das Gegengift
Freude
Der Himmlische
Fußnoten
Briefe zur Beförderung der Humanität , J. G. Herder
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849627652
www.jazzybee-verlag.de
Johann Gottfried Herder – Biografie und Bibliografie
Einer der hervorragendsten und einflußreichsten Schriftsteller und Denker Deutschlands, ward 25. Aug. 1744 zu Mohrungen in Ostpreußen als Sohn des Kantors, Glöckners und Schullehrers Gottfried H. und dessen zweiter Ehefrau, Anna Elisabeth Pelz, geboren und starb 18. Dez. 1803 in Weimar. Die Verhältnisse seiner Eltern waren bescheiden und beschränkt, nicht aber so dürftig, daß sie auf eine bessere Erziehung ihrer Kinder und namentlich des Knaben, dessen Begabung früh zutage trat, durchaus hätten verzichten müssen. H. besuchte die Stadtschule und wurde zum Studium der Theologie bestimmt. Die unfreundliche und willkürliche Einmischung des Diakonus S. F. Trescho, der Herders Eltern zu bestimmen suchte, den Knaben ein Handwerk lernen zu lassen, kreuzten die künftigen Lebenspläne. Trescho nahm den Knaben als Famulus in sein Haus, mißbrauchte jedoch seine Kräfte zu allerhand unwürdiger Arbeit, so daß es für H. eine Erlösung aus bittern Leiden war, als sich ein russischer Regimentschirurg erbot, ihn zur Erlernung der Chirurgie nach Königsberg und später nach Petersburg mitzunehmen. H. langte im Hochsommer 1762 in der ostpreußischen Hauptstadt an, und da er alsbald erkannte, daß er für den von seinem Beschützer in Aussicht gestellten Beruf gänzlich ungeeignet sei, ließ er sich 10. Aug. als Studiosus der Theologie immatrikulieren. An dem Buchhändler Kanter, dem er sich schon von Mohrungen aus durch Zusendung des »Gesanges an Cyrus« empfohlen hatte, gewann er einen hilfreichen Gönner; durch seine Anstellung als Lehrer an der Elementarschule des Collegium Fridericianum ward er der drückendsten Not rasch überhoben und überließ sich rückhaltlos seinem Bildungsdrang. Bedeutenden Einfluß auf die geistige Entwickelung des Jünglings übte von den Universitätslehrern nur Kant, außerhalb der Universitätskreise aber der »Magus aus Norden«, der originelle J. G. Hamann aus. Unter den Einwirkungen seiner mannigfaltigen und ausgebreiteten Lektüre war keine tiefer, sein ganzes Wesen bestimmender als die der Schriften J. J. Rousseaus. Im Herbst 1764 ward H. als Kollaborator an die Domschule nach Riga berufen, später auch als Pfarradjunkt an der Jesus- und an der Gertraudenkirche angestellt, so daß er in der alten Hauptstadt Livlands, die sich damals noch fast republikanischer Selbständigkeit erfreute, einen ausgebreiteten und nicht unwichtigen Wirkungskreis fand. Die Kreise des städtischen Patriziats erschlossen sich dem jungen vielversprechenden Mann, der sich in ihnen mancher Anregung und eines bis dahin ungekannten Lebensgenusses erfreute. Unter so günstigen Umständen eröffnete H. mit den »Fragmenten über die neuere deutsche Literatur« (Riga 1766–67), dem Schriftchen »Über Thomas Abbts Schriften. Der Torso von einem Denkmal, an seinem Grab errichtet« (das. 1768) und den »Kritischen Wäldern« (das. 1769) seine große literarische Laufbahn. Indem er darauf hinwies, daß die literarischen Erzeugnisse aller Nationen durch den besondern Genius der Volksart und Sprache bestimmt sind, und indem er die »kritische Betrachtungsweise Lessings durch seine eigne genetische ergänzte«, gewann H. seine selbständige Stellung in dem großen Kampf der Zeit. Die Angriffe gegen die seichte und verächtliche Clique der Klotzianer waren nur Konsequenzen seiner Anschauungen. Gleichwohl hatte sich H. Klotz und den Seinen gegenüber Blößen namentlich durch die Ableugnung der Autorschaft der »Kritischen Wälder« gegeben und ward, wie im spätern Leben noch oft, in ärgerliche Händel verwickelt, die ihm selbst das Behagen an seiner sonst so günstigen Stellung in Riga verleideten. Starker Reisedrang und das Verlangen, sich für eine künftige große Wirksamkeit (die er sich mehr als eine praktische, denn als eine literarische dachte) allseitig vorzubereiten, veranlaßten H., im Frühling 1769 seine Entlassung zu begehren, die man ihm gewährte in der Hoffnung, daß er zurückkehren werde. Im Juni d. J. trat er eine große Reise an, die ihn zunächst zu Schiff nach Nantes führte, von wo er im November nach Paris ging. Weil er sich rasch überzeugen mußte, daß es nicht möglich sein werde, mehrjährige Reisen nur mit Unterstützung seiner Freunde durchzuführen, war ihm der Antrag des fürstbischöflich lübeckischen Hofes in Eutin, den Erbprinzen Peter Friedrich Wilhelm als Reiseprediger zu begleiten, ganz willkommen. Anfang 1770 kam er nach Eutin und brach im Juni d. J. von dort mit dem Prinzen auf. Noch vor der Abreise hatte ihn ein Ruf des Grafen Wilhelm von Lippe in Bückeburg erreicht; gleich darauf lernte H. in Darmstadt seine nachmalige Gattin, Maria Karoline Flachsland (s. unten), kennen. Eine rasch gefaßte und erwiderte Neigung nährte in H. den Wunsch nach festen Lebensverhältnissen. Er folgte dem Prinzen nur bis Straßburg, begehrte vom eutinischen Hof seine (im Oktober gewährte) Entlassung, nahm die vom Grafen zur Lippe angetragene Stellung als Hauptprediger der kleinen Residenz Bückeburg und als Konsistorialrat an, blieb aber dann um einer (leider mißglückten) Augenoperation willen den Winter in Straßburg und knüpfte hier die freundschaftlichen Beziehungen zu dem um fünf Jahre jüngern Goethe an. Ende April 1771 trat H. seine neue Stellung in Bückeburg an. Sein Verhältnis zu dem Landesherrn des kleinen Ländchens, dem berühmten Feldherrn Grafen Wilhelm, ward bei aller Achtung, die der durch und durch soldatische und an keinen Widerspruch gewöhnte Fürst ihm zollte, kein erfreuliches. Auch als Graf Wilhelms Gemahlin, die liebenswürdige fromme Gräfin Maria, sich H. in herzlicher Verehrung anschloß, betrachtete dieser den Aufenthalt in Bückeburg als ein Exil. Doch wurden ihm diese Jahre durch die Liebe seiner im Mai 1773 heimgeführten Gattin und durch die reichen Ergebnisse seiner Studien verschönt. Die Zeit des Bückeburger Aufenthalts war für H. die eigentliche Sturm- und Drangperiode. Mit der geistvollen, von der Berliner Akademie preisgekrönten Abhandlung »Über den Ursprung der Sprache« (Berl. 1772), die er noch in Straßburg begonnen, den beiden Aufsätzen über »Of sian und die Lieder alter Völker« und über »Shakespeare« in den fliegenden Blättern »Von deutscher Art und Kunst« (Hamb. 1773; Neudruck von Lambel, Stuttg. 1893) und der Schrift »Ursache des gesunkenen Geschmacks bei den verschiedenen Völkern, da er geblühet«, trat er in den Mittelpunkt der Bewegung, die eine aus dem Leben stammende und auf das Leben wirkende, echte Natur atmende Dichtung wiedergewinnen wollte. Mit der Schrift »Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit« (o. O. [Riga] 1774) erklärte er der prahlerischen und öden Aufklärungsbildung des Jahrhunderts den Krieg. Rief schon diese Arbeit die entschiedensten Widersprüche, ja Herabsetzungen und Verlästerungen Herders hervor, so war dies in noch höherm Grade der Fall bei seinen theologischen und halbtheologischen Schriften, der »Ältesten Urkunde des Menschengeschlechts« (Riga 1774–76, 2 Tle.), den »Briefen zweener Brüder Jesu in unserm Kanon« (Lemgo 1775), den »Erläuterungen zum Neuen Testament, aus einer neueröffneten morgenländischen Quelle« (Riga 1775) und den 15 Provinzialblättern »An Prediger« (1774). Die Angriffe, die er erfuhr, veranlaßten ihn, seine schon zum Druck vorbereitete Sammlung der »Volkslieder« zurückzuhalten. Sie brachen ihm den Entschluß des Weiterwirkens nicht, aber sie steigerten eine hypochondrische Reizbarkeit und ein dämonisches Mißtrauen, die in Herders Seele früh erwacht waren. H. verhandelte eben wegen einer Berufung an die Universität Göttingen, als er durch Goethes freundschaftliche Bemühungen im Frühjahr 1776 als Generalsuperintendent, Mitglied des Oberkonsistoriums und erster Prediger an der Stadtkirche nach Weimar berufen wurde. Sein Weggehen von Bückeburg folgte dem Tode seiner Gönnerin, der Gräfin Maria, fast auf dem Fuß. Am 2. Okt. 1776 trat H., der besten Erwartungen und des besten Wissens voll, in Weimar ein. Obschon er hier die denkbar freundlichste Aufnahme fand, so blieben doch auch Mißhelligkeiten nicht aus. Da H. wahrzunehmen glaubte, daß in dem engern Kreise des Herzogs eine gründliche Gleichgültigkeit, ja verächtliche Geringschätzung gegen Kirche und Schule vorherrschte, vertrat er nicht nur, was sein gutes Recht war, deren Interessen aufs kräftigste und eifrigste, sondern setzte sich in Opposition gegen nahezu alle Meinungen, Richtungen und Neigungen jenes Kreises. Und so gewiß Weimar eine große Verbesserung Bückeburg gegenüber heißen durfte, so fühlte sich H. von der Kleinlichkeit und Enge auch vieler weimarischer Verhältnisse gedrückt. Dennoch wirkte die veränderte Lage günstig auf ihn, und seine literarische Produktivität nahm einen großen und immer gewaltigern Aufschwung. Der Läuterungsprozeß, durch den sich die hervorragendsten Repräsentanten des Sturmes und Dranges in die Hauptträger der deutschen klassischen Literatur verwandelten, nahm auch bei H. zu Ausgang der 1770er Jahre seinen Anfang. Die bedeutsame philosophische Abhandlung »Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume« (Riga 1778), die »Plastik. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Traum« (das. 1778) und die Herausgabe der »Lieder der Liebe« (Leipz. 1778) sowie der längst vorbereiteten »Volkslieder« (erst später von Johannes v. Müller »Stimmen der Völker in Liedern« betitelt, das. 1778–79) waren seine ersten von Weimar aus in die Welt gesandten Publikationen. Die von der Münchener Akademie preisgekrönte Abhandlung »Über die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker in alten und neuen Zeiten« (1778) galt einem neuen Nachweis, daß echte Poesie die Sprache der Sinne, erster mächtiger Eindrücke, der Phantasie und der Leidenschaft, daher die Wirkung der Sprache der Sinne allgemein und im höchsten Grade natürlich sei, eine Wahrheit, welche die mit umfassender Literaturkenntnis ausgewählten, lebendig nach- und anempfundenen, z. T. vorzüglich übersetzten »Volkslieder« eben weiten Kreisen zum Bewußtsein brachten.
Einen höchst glücklichen Einfluß auf Herders weitere geistige Entwickelung übte seit den ersten 1780er Jahren das wiederhergestellte innige Verhältnis Herders und seines Hauses zu Goethe. H. trat in den regsten Gedankenaustausch zu dem jüngern Freund, und während er seinen Weg unter dessen bewundernder Teilnahme weiter verfolgte, steigerte sich sein Gefühl für Schönheit und Klarheit des Vortrags, selbst sein poetisches Ausdrucksvermögen durch den reinen Formensinn Goethes. In ebendiesen 80er Jahren entstand beinahe alles, was Herders immer genialem Wirken durch innere Reise und äußere Vollendung bleibende Nachwirkung sicherte. Bezogen sich die »Briefe, das Studium der Theologie betreffend« (Weim. 1780–1781, 4 Tle.) und eine Reihe von vorzüglichen Predigten auf Herders Amt und nächsten Beruf, so leitete das große, leider unvollendet gebliebene Werk »Vom Geiste der Ebräischen Poesie« (Dessau 1782–83, 2 Tle.; hrsg. von Hoffmann, Gotha 1891) von der Theologie zur Poesie und Literatur hinüber. Aus der tiefsten Mitempfindung für die Naturgewalt, die Frömmigkeit und eigenartige Schönheit der hebräischen Dichtung wuchs ein Werk hervor, von dem Herders Biograph (R. Haym) mit Recht rühmt,-daß es »für Kunde und Verständnis des Orients Ähnliches geleistet wie Winckelmanns Schriften für das Kunststudium und die Archäologie«. 1785 aber begann H. die Herausgabe seines großen Hauptwerkes, der »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« (Riga 1784–91, 4 Bde.), die endliche Ausführung eines Lieblingsplans, die breitere Ausführung von Gedanken, die er längst in kleinern Schriften in die Welt gesandt hatte, und wiederum die energische Zusammenfassung alles dessen, was er über Natur und Menschenleben, die kosmische Bedeutung der Erde, über die Aufgabe des sie bewohnenden Menschen, »dessen einziger Daseinszweck auf Bildung der Humanität gerichtet ist, der alle niedrigen Bedürfnisse der Erde nur dienen und selbst zu ihr führen sollen«, was er über Sprachen und Sitten, über Religion und Poesie, über Wesen und Entwickelung der Künste und Wissenschaften, über Völkerbildungen u. historische Vorgänge gedacht und (wie seine Gegner erinnerten) geträumt hatte. Die Aufnahme des Werkes entsprach dessen großem Verdienst (vgl. Grundmann, Die geographischen und völkerkundlichen Quellen und Anschauungen in Herders. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit', Berl. 1900). Gleichzeitig veröffentlichte H. die Sammlung seiner »Zerstreuten Blätter« (Gotha 1785–97, 6 Tle.), in der eine Reihe der schönsten Abhandlungen und poetischen Übersetzungen die Geistesfülle und sittliche Grazie des Schriftstellers in herzgewinnender Weise offenbarte. Seiner Verehrung für Spinoza, in der er sich mit Goethe eins fühlte, gab er Ausdruck in den Gesprächen, die er 1787 u. d. T. »Gott« veröffentlichte.
Einen großen Abschnitt in Herders Leben bildete die Reise, die er 1788–89 nach Italien unternahm. Freilich wirkten seine hypochondrische Reizbarkeit und mancherlei ungünstige Zufälle zusammen, ihn eigentlich nur in Neapel zum Vollgenuß dieser Reise kommen zu lassen; doch empfing er bedeutende und bleibende Eindrücke, die vielleicht noch günstigere Folgen gehabt hätten, wenn ihn nicht in Italien eine abermalige ehrenvolle und vielverheißende Berufung nach Göttingen erreicht und die schwere Frage des Gehens oder Bleibens in Weimar ihn während der Rückreise gequält hätte. Goethe, von der Erwägung ausgehend, daß der Freund dem Kathederärger in Göttingen noch weniger gewachsen sein werde als dem Hof- und Konsistorialärger in Weimar, wirkte für Herders Bleiben und konnte im Einverständnis mit dem Herzog Tilgung der Herderschen Schulden, Gehaltsverbesserungen und mancherlei tröstliche Verheißungen für die Zukunft bieten. H. ließ sich mit einem gewissen Widerwillen zum Bleiben bestimmen, und beide Freunde sollten dieser Entscheidung nur kurze Jahre froh werden. Herders Gesundheitszustand war bloß vorübergehend gebessert, körperliche Leiden brachen ihm Lebenslust und Arbeitskraft; der fünfte Teil der »Ideen« blieb ungeschrieben, und bereits die »Briefe zur Beförderung der Humanität« (Riga 1793–97, 10 Sammlungen) trugen die Farbe seines verdüsterten Geistes. Die materiellen Sorgen im Herderschen Hause hatten sich leider nur vorübergehend gemildert, und die nur halb gerechtfertigten Ansprüche, die H. und seine Gattin auf Grund der Abmachungen von 1789 erhoben, führten zu einem unheilbaren Bruch mit Goethe. H. hatte schon zuvor mit reizbarer Eifersucht die wachsende Intimität zwischen Goethe und Schiller betrachtet. So trat allmählich ein Zustand der Isolierung und kränklich verbitterten Beurteilung alles ihn umgebenden Lebens bei H. ein. Die geistigen Gegensätze, in denen er sich zur Philosophie Kants, zur klassischen Kunst Goethes und Schillers fand, verstärkte und verschärfte H. gewaltsam und ließ sie in seinen literarischen Arbeiten mehr und mehr hervortreten. Zwar gab er, sowie er auf neutralem Gebiet stand, auch jetzt noch Vorzügliches und Erfreuliches. Dem Unterrichtswesen widmete er fortwährend eine liebevolle Teilnahme, die besonders in seinen formvollendeten und inhaltreichen Schulreden zum Ausdruck kam. Seine »Terpsichore« (Lübeck) 795), die den vergessenen neulateinischen Dichter Jakob Balde wieder einführte, seine »Christlichen Schriften« (Riga 1796–99, 5 Sammlungen), in denen das unbeirrteste Gefühl für den eigentlichen Kern des Christentums den schönsten und maßvollsten Ausdruck fand, seine Aufsätze für Schillers »Horen« bewährten den alten Herderschen Geist. Aber voll grimmer Bitterkeit und dazu mit unzulänglichen Waffen bekämpfte H. in der »Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft« (Leipz. 1799, 2 Tle.) die Philosophie und in der »Kalligone« (das. 1800) die Ästhetik Nants, voll absichtlicher Verkennung und unwürdiger Lobpreisung des Abgelebten und Halben richtete seine »Adrastea« (das. 1801–03, 6 Tle.) alle ihre versteckten Spitzen gegen die lebendige, schönheitsfreudige Dichtung Goethes und Schillers. Nur die Qual eines Zustandes, der ihn tief niederdrückte, und in dem er sich selbst bald als »dürrer Baum und verlechzte Quelle«, bald als »Packesel und blindes Mühlenpferd« schilderte, konnte diese letzte verhängnisvolle Wendung seiner literarischen Tätigkeit entschuldigen. Letzte Erquickung bereitete ihm, dessen körperliche Kraft mehr und mehr erlag, die poetische Arbeit an seinen »Legenden«, an der Übertragung der Romanzen vom »Cid« (s. d., S. 149) und an den dramatischen Gedichten: »Der entfesselte Prometheus« und »Admetus' Haus«. Die Annahme eines vom Kurfürsten von Bayern 1802 ihm verliehenen Adelsdiploms bereitete H. schweren Ärger, und seine endliche Ernennung zum Präsidenten des Oberkonsistoriums (1801) kam zu spät, um ihm Lebensmut zurückzugeben. In den Sommern 1802 und 1803 suchte er Heilung in den Bädern von Aachen und am Egerbrunnen; im Herbst des letztgenannten Jahres erfolgte ein neuer heftiger Anfall seines unheilbaren Leberübels, dem er im Winter erlag. Sein Grabdenkmal in der Stadtkirche zu Weimar trägt die Aufschrift: »Licht, Liebe, Leben«; vor der Kirche wurde ihm 1850 ein ehernes Standbild (von Schaller) errichtet.
Mannigfach rätsel- und widerspruchsvoll, ungleicher in seinen Leistungen als seine großen Zeitgenossen, aber unvergleichlich reich, vielseitig, voll höchsten Schwunges und schärfster Einsicht, eine Fülle geistigen Lebens in sich tragend und um sich erweckend, steht H. in der deutschen Literatur. In der großen Umbildung des deutschen Lebens am Ende des 18. Jahrhunderts hat er mächtiger und entscheidender eingegriffen als einer, und die Spuren seines Geistes lassen sich in der Literatur im engern Sinn, in Fachwissenschaften und Spezialzweigen, die aus seinen Anregungen hervorgegangen sind, überall nachweisen. Die Forderung der »Humanität«, der Heranbildung und Läuterung zum vergöttlichten Menschlichen, ist der durchgehende Grundgedanke in der Vielheit und Mannigfaltigkeit seiner Schriften. Bei allen seinen Gaben war ihm die künstlerische Gestaltungskraft versagt, so daß er als Dichter nur in einzelnen glücklichen Momenten und auf dem Gebiete der didaktischen Poesie zu wirken vermochte. Die Verbindung seines eignen ethischen Pathos mit Stimmungen und Gefühlen, die ihm aus der Dichtung der verschiedensten Zeiten und Völker ausgingen, war nie ohne Reiz; sein Verdienst als poetischer Übersetzer, als Aneigner und Erläuterer fremden poetischen Volksgeistes kann kaum zu hoch angeschlagen werden Die große Zahl von Herders poetischen Übertragungen aus den verschiedensten Sprachen, ihre Auswahl und die Resultate, die H. jedesmal aus ihnen zog, haben einer allgemeinen, über die »Gelehrtengeschichte« der vorausgegangenen akademischen Perioden hinauswachsenden Literaturgeschichte den Boden bereitet. Neben den »Volksliedern«, dem »Cid«, den Epigrammen aus der griechischen Anthologie, den Lehrsprüchen aus Sadis »Rosengarten« und der ganzen Reihe andrer Dichtungen und poetischer Vorstellungen, die Herders anempfindender Geist für die deutsche Literatur gewann, stehen jene morgenländischen Erzählungen, jene Paramythien und Fabeln, die H. im Wiedererzählen benutzt, um Momente seiner eignen sittlichen Anschauung, seiner Humanitätslehre beizugesellen, und die hierdurch wie durch ihre Vortragsweise zu seinem geistigen Eigentum werden. Höher aber als der Dichter steht überall der Prosaiker H., der große Kulturhistoriker, Religionsphilosoph, der feinsinnige Ästhetiker, der produktive Kritiker, der glänzende Essayist, der gehaltreiche und in der Form anziehende Prediger und Redner. Es ist Herders eigenstes Mißgeschick gewesen, daß die großen Ergebnisse seines Erkennens und Strebens rasch zum Gemeingut der Bildung, seine Anschauungen zu Allgemeinanschauungen wurden, so daß es erst der historischen und kritischen Zurückweisung auf die Genialität, die seelische Tiefe und den verschwenderischen Gedankenreichtum der Herderschen Schriften bedurfte, um das größere Publikum zu ihnen zurückzuführen.
Herders »Sämtliche Werke« erschienen zuerst in einer von J. Georg Müller, Johannes v. Müller und Heyne unter Mitwirkung von Herders Witwe und Sohn veranstalteten Ausgabe (Cotta, Stuttg. 1805–20, 45 Bde.; Taschenausg. mit den Nachträgen, das. 1827–1830, 60 Bde., und 1852–54, 40 Bde.). Die Entfremdung des Publikums veranlaßte die »Ausgewählten Werke« in einem Band (Cotta, Stuttg. 1844), ferner »Ausgewählte Werke«, hrsg. von Ad. Stern (Leipz. 1881, 3 Bde.), die des Cottaschen Verlags (mit Einleitung von Lautenbacher, Stuttg. 1889, 6 Bde.) und die in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur« (Stuttg. 1886 ff.); besonders gelungen ist die Auswahl der Werke in der gut kommentierten Ausgabe von Th. Matthias in der Klassikerbibliothek des Bibliographischen Instituts (Leipz. 1903, 5 Bde.). Vollständigkeit erstrebten die Ausgabe in der Hempelschen »Nationalbibliothek« (Berl. 1869–79, 24 Tle., mit Biographie von Düntzer) und die große kritische, von Suphan geleitete Ausgabe von »Herders sämtlichen Werken« (das. 1877–99, 32 Bde., wovon noch Bd. 14 fehlt). Auf Grund der letztern Ausgabe gaben Suphan und Redlich »Herders ausgewählte Werke« (Berl. 1884–1901, 5 Bde.) heraus. Eine ungekrönte Preisschrift Herders: »Denkmal Joh. Winckelmanns«, von 1778 veröffentlichte Alb. Duncker (Kassel 1882). Sammlungen von Briefen Herders veranstalteten Düntzer und Ferd. Gottfr. v. Herder in den Werken: »Aus Herders Nachlaß« (Frankf. 1856 bis 1857, 3 Bde.), »Herders Briefwechsel mit seiner Braut« (das. 1858), »Herders Reise nach Italien« (Gießen 1859) und »Von und an H.« (Leipz 1861–1862, 3 Bde.); O. Hoffmann gab Herders Briefwechsel mit Nicolai (Berl. 1887) und Herders Briefe an Hamann (das. 1889) heraus.
Von biographisch-kritischen Schriften über H. sind außer den von seiner Gattin gesammelten »Erinnerungen« (s. unten) und dem von seinem Sohn Emil Gottfried v. H. verfaßten »Lebensbild« (Erlang. 1846 bis 1847, 3 Bde.) zu erwähnen: Danz und Gruber, Charakteristik J. G. v. Herders (Leipz. 1805); ferner: H. Döring, Herders Leben (2. Aufl., Weim. 1829); »Weimarisches Herder-Album« (Jena 1845); Jegor v. Sivers, H. in Riga (Riga 1868) und Humanität und Nationalität, zum Andenken Herders (Berl. 1869); Joret, H. et la renaissance littéraireen Allemagne (Par. 1875); namentlich aber das biographische Hauptwerk: R. Haym, H. nach seinem Leben und seinen Werken (Berl. 1880–85, 2 Bde.), eine Meisterleistung streng sachlicher und zugleich liebevoller Lebensdarstellung und Beurteilung. Vgl. außerdem A. Werner, H. als Theologe (Berl. 1871); J. G. Müller, Aus dem Herderschen Hause, Aufzeichnungen 1780–1782 (hrsg. von J. Bächtold, das. 1881); Bärenbach, H. als Vorgänger Darwins und der modernen Naturphilosophie (Berl. 1877); Lehmann, H. in seiner Bedeutung für die Geographie (das. 1883); J. Böhme, H. und das Gymnasium (Hamb. 1890); Kühnemann, Herders Persönlichkeit in seiner Weltanschauung (Berl. 1893) und Herders Leben (Münch. 1894); Franke, H. und das Weimarische Gymnasium (Hamb. 1894); O. Hoffmann, Der Wortschatz des jungen H. (Berl. 1895); Bloch, H. als Ästhetiker (das. 1896); Tumarkin, H. und Kant (Bern 1890); Schaumkell, H. als Kulturhistoriker (Ludwigslust 1902); Genthe, Der Kulturbegriff bei H. (Jena 1902); Wiegand, H. in Straßburg, Bückeburg und in Weimar (Weim. 1903); Bürkner, H., sein Leben und Wirken (Berl. 1903).
Herders Gattin Maria Karoline, geborne Flachsland, geb. 28. Jan. 1750 zu Reichenweier im Elsaß, gest. 15. Sept. 1809 in Weimar, lebte nach ihres Vaters Tode bei ihrer Schwester in Darmstadt, wo sie H. kennen lernte, der sich 1773 mit ihr verheiratete. Nach Herders Tode ordnete sie dessen literarischen Nachlaß und schrieb: »Erinnerungen aus dem Leben Herders« (hrsg. von J. G. Müller, Stuttg. 1820, 2 Bde.; neue Ausg. 1830, 3 Bde.). Der älteste Sohn, Wilhelm Gottfried v. H., geb. 1774 in Bückeburg, studierte in Jena Medizin, ward 1800 Provinzialakkoucheur und 1805 Hofmedikus in Weimar, wo er 1806 starb. Er schrieb: »Zur Erweiterung der Geburtshilfe« (Leipz. 1803) und nahm teil an der Herausgabe der Werke seines Vaters. Der dritte und jüngste, Emil Gottfried v. H., war bis 1839 bei der Regierung für Schwaben und Neuburg tätig und starb als bayrischer Oberforst- und Regierungsrat 27. Febr. 1855 in Erlangen. Er gab in »Herders Lebensbild« (s. oben) eine liebevolle Darstellung des Lebens und Wirkens seines Vaters. Ein Enkel Herders, G. Th. Stichling, war weimarischer dirigierender Staatsminister und starb 22. Juni 1891.
Briefe zur Beförderung der Humanität
Erste Sammlung
(1793)
1.
Mit Freude und Zustimmung, m. Fr., ist Ihr Vorschlag zu einem Briefwechsel über die Fort- oder Rückschritte der Humanität in älteren und neueren, am meisten aber in denen uns nächsten Zeiten von unsern sämtlichen Freunden aufgenommen und bewillkommet worden. »Ich bin ein Mensch,« sagte D., »und nichts, was die Menschheit betrifft, ist mir fremde. Mit jedem Jahr des Lebens fällt uns ein beträchtlicher Teil des Flitterstaats nieder, mit dem uns von Kindheit auf so wie in Handlungen, so auch in Wissenschaften, in Zeitvertreib und Künsten die Phantasie schmückte. Unglücklich ist, wer lauter falsche Federn und falsche Edelsteine an sich trug; glücklich und dreimal glücklich, wem nur die Wahrheit Schmuck ist und der Quell einer teilnehmenden Empfindung im Herzen quillet. Er fühlt sich erquickt, wenn andre, bloß Menschen von außen, rings um ihn winseln und darben; im allgemeinen Gut, im Fortgange der Menschheit findet er sich gestärkt, seine Brust breiter, sein Dasein größer und freier.«
»Sein Dasein größer und freier,« fiel L. ein, »denn indem er sich über den schleichenden, alltäglichen Gang der Dinge erhoben fühlet, atmet er ein reineres Element; er vergißt den niedrigen Kummer, der ihm da und dort das Herz drückte, wenn er den Strom der Zeit stockend und sich in einem stehenden Sumpf gesenkt glaubte. Der Strom der Zeit steht nie still; jetzt rieselt er sanft, jetzt rauscht er gewaltig; allenthalben aber wehet auf ihm Odem des Lebens.«
»In die Gedanken- oder Handlungssphäre andrer größerer Menschen gesetzt,« sagte B., »nehmen wir teil an ihrem Geist: wir denken mit ihnen, auch wenn wir mit ihnen nicht wirken konnten, und freuen uns ihres Daseins. Je reiner die Gedanken der Menschen sind, desto mehr stimmen sie zusammen; die wahre unsichtbare Kirche durch alle Zeiten, durch alle Länder ist nur eine.«
»Und in diese wollen wir rein eintreten, meine Freunde,« fügte A. hinzu, »mit ungeteiltem Herzen, mit reinen Händen. Kein Parteigeist soll unser Auge benebeln, keine Schmeichelei unser Angesicht schänden. Unter uns ist, wie jener Apostel sagte, kein Jude noch Grieche, kein Knecht noch Freier, kein Mann noch Weib; wir sind eins und einer. Indem wir an uns und nicht an die Welt schreiben, gehen wir aller eitlen Rücksichten müßig; warum sollten wir heucheln? Das lohnte der Mühe nicht, die Feder einzutunken; wir dürften sodann nur lesen.«
»Lesen!« sagte das ganze Chor und ging in ein Detail über das, was jener hier, dieser dort gelesen hatte; alle waren darüber einig, daß es der Seele eine Arznei sei, wenn sie vom zerteilten, vielfachen Lesen in sich zurückgezogen werde und wie durch ein Gelübde, oder vor einem heiligen Gericht, über das, was sie gehört, gelesen, gesehen hat, sich selbst redliche Rechenschaft gebe.
»Diese Rechenschaft wollen wir uns einander geben,« fügte ich hinzu; und so ward ein Bund der Humanität geschlossen, vielleicht wahrer, wenigstens unanmaßender und stiller, als je einer geschlossen ward. Fangen Sie nun an, mein Freund; unsre Freunde sind, wie Sie wissen, hie und da zerstreuet; alle sind bereit, sie warten auf Ihren Anklang.1
2.
Endlich ist mir die Lebensbeschreibung eines meiner Lieblinge in unserm Jahrhundert, Benjamin Franklins, von ihm selbst für seinen Freund geschrieben, zu Händen gekommen; aber bedauren Sie's, nur in der französischen Übersetzung, und nur ein kleines Stück derselben, die früheren Lebensjahre des Mannes, ehe er völlig in seine politische Laufbahn trat.2 Sollte die Politik der Engländer vermögend sein, das Übrige und Ganze in der Ursprache zu unterdrücken, so bedauren Sie mit mir den sinkenden Geist der Nation und lassen indessen dies Buch ja unter uns zirkulieren.
Sie wissen, was ich von Franklin immer gehalten, wie hoch ich seinen gesunden Verstand, seinen hellen und schönen Geist, seine sokratische Methode, vorzüglich aber den Sinn der Humanität in ihm geschätzt habe, der seine kleinsten Aufsätze bezeichnet. Auf wie wenige und klare Begriffe weiß er die verworrensten Materien zurückzuführen! Und wie sehr hält er sich allenthalben an die einfachen, ewigen Gesetze der Natur, an die unfehlbarsten praktischen Regeln, aus Bedürfnis und Interesse der Menschheit! Oft denkt man, wenn man ihn lieset: ›Wußte ich das nicht auch? aber so klar sahe ich's nicht, und weit gefehlt, daß es bei mir schlichte Maxime des Lebens wurde.‹ Zudem sind seine Einkleidungen so leicht und natürlich, sein Witz und Scherz so gefällig und fein, sein Gemüt so unbefangen und fröhlich, daß ich ihn den edelsten Volksschriftsteller unseres Jahrhunderts nennen möchte, wenn ich ihn durch diesen mißbrauchten Namen nicht zu entehren glaubte. Unter uns wird er dadurch nicht entehrt! Wollte Gott, wir hätten in ganz Europa ein Volk, das ihn läse, das seine Grundsätze anerkennte und zu seinem eignen Besten darnach handelte und lebte; wo wären wir sodann!
Franklins Grundsätze gehen allenthalben darauf, gesunde Vernunft, Überlegung, Rechnung, allgemeine Billigkeit und wechselseitige Ordnung ins kleinste und größeste Geschäft der Menschen einzuführen, den Geist der Unduldsamkeit, Härte, Trägheit von ihnen zu verbannen, sie aufmerksam auf ihren Beruf, sie in einer milde fortgehenden, unangestrengten Art geschäftig, fleißig, vorsichtig und tätig zu machen, indem er zeigt, daß jede dieser Übungen sich selbst belohnet, jede Vernachlässigung derselben im Großen und Kleinen sich selbst strafe. Er nimmt sich der Armen an, nicht anders aber als daß er ihnen Wege des Fleißes mit überwiegender Vernunft eröffnet. Mehrmals hat er es erwiesen, wie hell und bestimmt er in die Zukunft sah, wie entwirrt die verworrensten Geschäfte der Leidenschaft in einfachen Resultaten vor seinem Auge lagen. Einen solchen Mann von sich selbst sprechen, am Rande des Lebens ihn seinem Sohn erzählen zu hören, wer er sei und wie er, was er ist, geworden – wen das nicht reizend belehrte! –
Hören Sie nun den guten Alten, und Sie finden in seiner Lebensbeschreibung durchaus ein Gegenbild zu Rousseaus »Konfessionen«. Wie diesen die Phantasie fast immer irreführte, so verläßt jenen nie sein guter Verstand, sein unermüdlicher Fleiß, seine Gefälligkeit, seine erfindende Tätigkeit, ich möchte sagen, seine Vielverschlagenheit und ruhige Beherztheit. Begleiten Sie ihn in diesem Betracht aus der Bude des Lichtziehers in die Werkstätte des Messerschmiedes, in die Buchdruckerei, von Boston nach Neu-York, nach Philadelphia, London u. f. und bemerken, wie er allenthalben zu Hause ist, sich zu finden weiß, Freunde gewinnt, überall ins größere Allgemeine blickt und in jedem Verhältnis einen fortstrebenden Geist zeiget. Die Galerie seiner Bekannten und Mitgenossen, die er dabei aufstellt, wie dieser hier verdirbt, dort jener zugrunde geht, und wie er dies oft voraussiehet und zu seinem Besten gebrauchet, ist äußerst lehrreich. Für junge Leute kenne ich fast kein neueres Buch, das ihnen so ganz eine Schule des Fleißes, der Klugheit und Sittsamkeit sein könnte, als dieses. Und wie ruhig ist's gedacht! wie angenehm-scherzhaft erzählt der liebenswürdige Alte! Glücklich, wer auf sein Leben zurücksehen kann, wie Franklin, dessen Bestrebungen das Glück so herrlich gekrönt hat. Nicht der Erfinder der Theorie elektrischer Materie und der Harmonika ist mein Held (obwohl auch in diesen ruhmwürdigen Erfindungen ein und derselbe Geist wirkte), der zu allem Nützlichen und Wahren aufgelegte und auf die bequemste Weise werktätige Geist, er, der Menschheit Lehrer, einer großen Menschengesellschaft Ordner, sei unser Vorbild! Auch außer denen ihm freilich äußerst vorteilhaften Zeit- und Landesumständen mag er uns dieses sein; denn Franklins Geist fände sich überall zurecht, auch da, wo wir leben.
Zu diesem Zweck werden Sie in seinem Leben besonders bemerken, wie er sich, trotz seiner Armut und mechanischen Berufsart, selbst literarische Bildung gab, seinen Stil formte und jedes Mittel, auch die Buchdruckerei, dazu anwandte; wie er in dieser die popularsten Wege, Zeitungen, Kalender, einzelne Blätter, die gemeinsten und beliebtesten Einkleidungen auffand, um Ideen unter das Volk zu bringen und sich durch die Stimme der Nation zu belehren; wie endlich von frühen Jahren an er nicht sowohl gelehrte als belehrende Gesellschaften liebte, deren Mitglieder sich miteinander übten. Auch dieserhalb wünschte ich jedem gutartigen Jünglinge diese Jugendjahre Franklins in die Hände. Der Unbegüterte, der sich selbst nicht verläßt, wird finden, daß er von Gott durch dessen großes und vielfaches Organ, die Menschheit, nie verlassen werde; er wird auf das zurückgeführt, was der edle Jüngling Persius für den Zweck aller menschlichen Weisheit erkannte:
Quid sumus et quidnam victuri gignimur; ordo
Quis datus aut metae quam mollis flexus et unde;
Quis modus argento; quid fas optare; quid asper
Utile nummus habet; patriae carisque propinquis
Quantum elargiri deceat; quem te Deus esse
Jussit et humana qua parte locatus es in re,
Disce –
Nächstens sende ich Ihnen Franklins Plan zu einer seiner früheren Gesellschaften; lassen Sie unsre Freunde daraus oder dabei bemerken, was für uns dienet: denn das Philadelphia, für welches diese Gesellschaft gestiftet ist, kann überall liegen.
3.
Fragen zu Errichtung einer Gesellschaft der Humanität von Benjamin Franklin
»Haben Sie heut morgen die Fragen durchgelesen, um zu erwägen, was Sie der Gesellschaft über eine derselben zu sagen haben möchten, nämlich
1. Ist Ihnen irgend etwas in dem Schriftsteller, welchen Sie zuletzt gelesen, aufgestoßen, das merkwürdig oder zur Mitteilung an die Gesellschaft schicklich ist, besonders in der Geschichte, Moral, Poesie, Naturkunde, Reisebeschreibungen, mechanischen Künsten oder andern Teilen der Wissenschaften?«
(Mich dünkt, die Frage ist für uns geschrieben. Wie einst die Pythagoreer, so sollte jeder Rechtschaffene am Abend sich selbst fragen, was er, vielleicht unter vielem Nichtswürdigen, heut wirklich Nützliches gelesen und bemerkt habe. Jeder gebildete Mensch wird sich auf diesem Wege in kurzem nach einem andern sehnen, dem er sein Merkwürdiges mitteile und der ihm das Seinige mitteile; denn das einsame Lesen ermattet: man will sprechen, man will sich ausreden. Kommen nun verschiedne Menschen mit verschiednen Wissenschaften, Charakteren, Denkarten, Gesichtspunkten, Liebhabereien und Fähigkeiten zusammen, so erwecken, so vervielfachen sich unzählbare Menschengedanken. Jeder trägt aus seinem Schatze vom Wucher seines Tages etwas bei, und in jedem andern wird es vielleicht auf eine neue Art lebendig. Geselligkeit ist der Grund der Humanität, und eine Gesellung menschlicher Seelen, ein wechselseitiger Darleih erworbener Gedanken und Verstandeskräfte vermehrt die Masse menschlicher Erkenntnisse und Fertigkeiten unendlich. Nicht jeder kann alles lesen; die Frucht aber von dem, was der andre bemerkte, ist oft mehr wert als das Gelesene selbst.)
»2. Haben Sie etwa neuerlich eine Geschichte gehört, deren Erzählung der Gesellschaft angenehm sein könnte?«
(So gemein diese Frage scheinet, so ein fruchtbares Samenkorn kann sie in der Hand verständiger Menschen werden. Aus Geschichte wird unsre Erfahrung; aus Erfahrung bildet sich der lebendigste Teil unsrer praktischen Vernunft. Wer nicht zu hören versteht, verstehet auch nicht zu bemerken; und aus dem Erzählen zeigt sich, ob jemand zu hören gewußt habe. Franklins beste Einkleidungen gingen aus solchen verständig angehörten lebendigen Tatsachen hervor; von ihnen empfingen sie ihre gefällige Gestalt, ihre leichte Wendung. In Zeiten, da man viel hörte, viel erzählte und wenig las, schrieb man am besten; so ist's noch in allen Materien, die aus lebendiger Ansicht menschlicher Dinge entspringen müssen und dahin wirken. Schrift und Rede ist bei uns oft zu weit voneinander getrennt; daher sind Bücher oft Leichname oder Mumien, nicht lebendig-beseelte Körper. Griechen und Römer, auch unter Galliern und Briten die erlesenste Schriftsteller waren sprechende oder gar handelnde Personen; der Geist der Rede und Handlung atmet also auch in ihren Schriften. Überhaupt äußert sich in den entscheidendsten Fällen der wahre Geist der Humanität mehr sprechend und handelnd als schreibend. Wohl dem Menschen, der in lobwürdiger und angenehmer lebendiger Geschichte lebet!)
»3. Hat irgendeine Bürger nach Ihrem Bewußtsein neulich in seinen Verrichtungen Fehler begangen? und was war nach Ihrer erhaltenen Nachricht die Ursache davon?«
»4. Haben Sie neulich vernommen, daß irgendeinem Bürger etwas besonders geglückt sei? und durch welche Mittel? Haben Sie z.B. gehört, auf was Weise ein jetzt reicher Mann hier oder sonst irgendwo zu seinem Vermögen kam?«
(Fragen, die in einem aufstrebenden jungen Handelsstaat von der nützlichsten Wirkung sein konnten und in keinem Staate unnütz sein werden, in dem Industrie, Erfindung, Unternehmung noch nicht gar ausgetilgt sind. Ein auf den Mitbürger neidisches Auge schadet sich selbst am meisten; wo findet dies aber mehrere Nahrung als in despotischen Verfassungen, wo von Schmeichelei, Gunst, Betrug und Willkür so vieles abhängt? In Verfassungen von freier Konkurrenz der Verstandes- und Gemütskräfte sowie der Kunst und des Fleißes ist das Auge der Mitkämpfer und Mitwerber gewiß nicht träger, aber verständiger aufeinander gerichtet. Man gewöhnet sich, Glück und Unglück, Reichtum und Armut, Verdienst und Trägheit natürlich anzusehen, forschet den Mitteln nach, wodurch jener sich hob, dieser sank; so lernt man von beiden. Schon der alte Hesiodus unterschied zwo Gattungen der Eifersucht, die böse und die gute; diese beschreibt er als nützlich, jene als niederträchtig und schädlich. Je mehr sich die Einrichtung menschlicher Dinge bessert, um so mehr muß auch der falschen Eifersucht Zaum und Zügel angelegt werden, indem nämlich die freie und edle Eifersucht emporkommt. Wer sollte sich nicht einen Zustand denken können, in welchem alle Handlungen und Vorteile der Menschen natürlich betrachtet, mithin auch also geschätzt und erworben werden? Da tritt sodann das Gute und Böse gleich ans Licht; jeder darf frei darüber sprechen und daran lernen. Wie weit wir aber noch von diesem Ziele sind, mag nur der Markt der Wissenschaft zeigen. Wie selten urteilt ein Beurteiler fremder Werke nach der strengen Frage: »Welche Fehler hat mein Mitbürger begangen? und was ist die Ursache davon? Hat dieser, redlich betrachtet, seine Sache weitergebracht? wodurch ist's ihm gelungen? und was stehet andern Mitbürgern noch zurück?« Und doch ist diese Frage die einzig billige, nützliche und gerechte; sonst urteilen nur Sklaven oder Despoten. Von uns sei dieser Geist des kleinen Neides oder des übermütigen Stolzes gleich fern, aber die edle Eifersucht auf alles Gute, Nützliche und Schöne, dessen die menschliche Natur fähig ist, sei unsre Göttin!)
»5. Ist Ihnen irgendein Mitbürger bekannt, der neulich eine würdige Handlung getan hat, welche Preis und Nachahmung verdienet? oder der einen Fehler begangen, welcher uns zur Warnung und zu dessen Vermeidung dienlich sein kann?«
»6. Welche unglückliche Wirkungen haben Sie neulich an der Unmäßigkeit, Unvorsichtigkeit, an der Hitze oder irgendeinem Laster oder Torheit wahrgenommen? Welche glückliche Wirkungen hingegen haben Sie von der Nüchternheit, Klugheit, Mäßigkeit oder irgendeiner andern Tugend erfahren?«
(So fragt ein Lehrer der Humanität, so frage jeder Vater und Hausvater die Seinen. Wie weit wären wir gelangt, wenn über alle Fehler und Tugenden der Menschen, in Beziehung auf ihre Folgen, nur so klar und unbewunden gesprochen werden könnte, als wir bei uns gedenken. Was die falsche Bescheidenheit oder gar eine demütige Heuchelei hier verschweigt, das entdeckt und übertreibt dort eine kecke Lästerzunge desto ärger. So wird endlich der Sinn der Menschheit verrückt und das moralische Auge geblendet. Alles scheint uns natürlich, nur die Natur des Menschen nicht, deren Weisheit und Torheit mit ihren klaren Folgen uns unanschaubare Dinge, unaussprechliche Rätsel bleiben sollen. Und doch, welche Natur von außen und innen läge uns näher als die Natur des Menschen?)
»7. Sind Sie oder jemand Ihrer Bekannten neulich krank oder verwundet gewesen? Welche Mittel wurden gebraucht, und welches waren die Wirkungen?«
(So hoch die Arzneikunst gestiegen ist, so hat jeder geschicktere Arzt anerkannt, daß sie zum Wohl des Menschengeschlechts noch viel höher steigen könne und steigen werde. Daher die fast schon unzählbaren Bemerkungen einzelner Ärzte; daher die Bemühungen großmütiger Menschen, erprobte Mittel aus der Dunkelheit ans Licht zu ziehen; daher endlich die Bemühungen ganzer Gesellschaften, aus andern Weltteilen, wäre es auch von Wilden, dergleichen Heil- und Hülfsmittel zu gewinnen und in Europa zu verbreiten. Ist das Wort Humanität kein leerer Name, so muß sich die leidende Menschheit dessen am meisten zu erfreuen haben.)
»8. Fällt Ihnen etwas ein, wodurch die Versammlung dem Menschengeschlecht, Ihrem Vaterlande, Ihren Freunden oder sich selbst nützlich sein könnte?«
»9. Ist irgendein verdienter Ausländer seit der letzten Zusammenkunft in der Stadt angekommen? und was haben Sie von seinem Charakter oder Verdiensten vernommen oder selbst bemerkt? Glauben Sie, daß es im Vermögen der Gesellschaft stehe, ihm gefällig zu sein oder ihn, wie er es verdient, aufzumuntern?«
»10. Kennen Sie irgendeinen jungen verdienten Anfänger, der sich neulich etabliert hat und welchen die Gesellschaft auf irgendeine Weise aufzumuntern vermögend wäre?«
»11. Haben Sie einen Mangel in den Gesetzen Ihres Vaterlandes neulich bemerkt, um deswillen es ratsam wäre, die gesetzgebende Macht um Verbesserung anzusprechen? Oder ist Ihnen ein wohltätiges Gesetz bekannt, was noch mangelt?«
»12. Haben Sie neulich einen Eingriff in die rechtmäßigen Rechte des Volks bemerkt?«
»13. Hat irgend jemand neulich Ihren guten Namen angegriffen, und was kann die Gesellschaft tun, um ihn sicherzustellen?«
»14. Ist irgendein Mann, dessen Freundschaft Sie suchen und welche die Gesellschaft oder ein Glied derselben Ihnen zu verschaffen vermögend ist?«
»15. Haben Sie neulich den Charakter eines Mitgliedes angreifen hören, und auf welche Weise haben Sie ihn geschützt? Hat Sie irgend jemand beeinträchtigt, von welchem die Gesellschaft vermögend ist, Ihnen Genugtuung zu verschaffen?«
»16. Auf was Weise kann die Gesellschaft oder ein Mitglied derselben Ihnen in irgendeiner Ihrer ehrsamen Absichten beförderlich sein?«
»17. Haben Sie irgendein wichtiges Geschäft unter der Hand, bei welchem Sie glauben, daß der Rat der Gesellschaft Ihnen dienlich sein könnte?«
»18. Welche Gefälligkeiten sind Ihnen neulich von einem nicht anwesenden Mann erzeigt worden?«
»19. Ist irgendeine Schwierigkeit in Angelegenheiten vorhanden, welche sich auf Meinungen, auf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit beziehen und die Sie gern auseinandergesetzt haben möchten?«
»20. Finden Sie irgend etwas in den jetzigen Gebräuchen oder Verfahrungsarten der Gesellschaft fehlerhaft, welches verbessert werden könnte?«
(Ohne alle Anmerkung sprechen diese Fragen zum Herzen wie zum Verstande. Manche geheime Gesellschaft, die zur Besserung der Menschheit wirken wollte, mag auch dahingegangen sein; diese kann vor den Augen der Welt allenthalben als ein Bund der Edlen und Guten fortdauern, denn sie ist auf die Tugend selbst gegründet.)
Folgendes waren die Fragen, die jeder, der in der Gesellschaft aufgenommen werden wollte, die Hand auf seine Brust gelegt, beantworten mußte:
»1. Haben Sie irgendeine besondre Abneigung gegen eins der hiesigen Mitglieder?«
»2. Erklären Sie aufrichtig, daß Sie das Menschengeschlecht, ohne Rücksicht von welcher Hantierung oder Religion jemand sei, überhaupt lieben?«
»3. Glauben Sie, daß jemand an Körper, Namen oder Gut, bloß spekulativer Meinungen oder der äußerlichen Art des Gottesdienstes wegen, gekränkt werden müsse?«
»4. Lieben Sie die Wahrheit um der Wahrheit willen und wollen sich bestreben, sie unparteiisch zu suchen und, wenn sie sie gefunden, auch andern mitzuteilen?«
Die Hand aufs Herz, meine Brüder! Ja, Amen.
4.
Glauben Sie nicht, m. Fr., daß Sie der einzige Liebhaber Franklins in unsrer kleinen Zahl sind. Alle Brüder reichen Ihnen die Hand auf seine Fragen, und von F. werden Sie nächstens ein Kästchen von amerikanischem Holz empfangen, in dem Sie eine Sammlung kleiner und größerer Aufsätze Franklins finden, unter welchen Ihnen wahrscheinlich manches neu sein wird. Freund F. hat sie mit vieler Sorgfalt zusammengesucht und glaubt daran einen moralisch-politischen Schatz zu haben.3
Ist es nicht sonderbar, daß in alten und neuen Zeiten die höchste und fruchtbarste Weisheit immer aus dem Volk entsprungen, immer mit Naturkenntnis, wenigstens mit Liebe zur Natur und Ansicht der Dinge verbunden, immer von ruhiger Unbefangenheit des Geistes, von heiterm Scherz begleitet gewesen und am liebsten unter der Rose gewohnt hat? Doch warum nenn ich dies sonderbar, da es Natur der Sache selbst ist. Nur wer die Menschen kennet, kann für sie sorgen; nur wer durch das Bedürfnis geweckt, durch Not gereizt, in mancherlei Verhältnissen umhergetrieben, die süße Frucht der Mühe schmeckte, kann diese auf die bequemste Art andern zu kosten geben. Er hat sich die schwere Wahrheit leicht gemacht; so macht er sie auch andern angenehm und faßlich.
Daß Franklins Leben ganz und im Original erscheinen werde, will ich nicht zweiflen. Dem bessern Teil der englischen Nation ist es bekannt genug, daß er kein Aufrührer gewesen, daß er zum Frieden und zur Aussöhnung die einsichtvollesten Vorschläge getan habe, die, wie Weissagungen eines Propheten, die Zeit genugsam bestärkt hat. Äußerst schwor ging er an den Gedanken, daß England und Amerika sich trennen sollten; er fand es diesem Lande selbst nicht vorteilhaft und hielt auch das für gefährlich, daß es zur Freiheit so bald gelangte. Da nun die Zeit hierüber mit einer gebietenden Stimme bereits entschieden und England auf andre Weise schadlos gehalten hat, so glaube ich, daß nur wenige Augen sich schließen dürfen, und Franklins Lebensgeschichte wird uns gegönnet sein und bleiben. Lesen Sie in beikommendem Nekrolog4 die wenigen Fragmente seines politischen Lebens, und Sie werden den schönen Friedensstern, der in Franklin leuchtete, bis auf den Augenblick, da er in der westlichen Welt untergeht, segnen. Die letzte Rede, mit der er den Beitritt der widersinnigen Provinzen zur Konstitution bewirkte, so ganz in seinem Geist und Charakter, ist der scheidende Strahl dieses Sternes.
Aber ach, indem ich Ihnen den Nekrolog zusende, wie trübe sinkt mein Blick! Kein Stern mehr; ich wandle auf einem Kirchhofe und schaue traurig zur Erde nieder, insonderheit unter den deutschen Gebeinen. Die Pyramide hinten auf dem Umschlage dünkt mich Cestius' Pyramide zu Rom, neben welcher der Ausländer-Protestanten, meistens der Deutschen, Körper ruhn, verscharret hier in der Fremde. Welch eine niederschlagende Erinnerung gibt uns das Leben der meisten!5 Arm geboren, fleißig, redlich, einesteils talent-, andernteils verdienstreich, kamen sie nicht weiter, als daß sie ihr Leben entweder mühsam durchlebten oder in der Hälfte desselben fast unbemerkt niedergingen und starben. Loudon glänzt als ein Gestirn in diesem Totentale; aber lesen Sie, wie es auch ihm gegangen, wie schwer es ihm gemacht worden, und wie er zuletzt sein Grabmal von Trümmern einer unerstürmten Pforte sich selbst als ein castrum doloris aufgerichtet. Aus dem Wirtenberger Hahn, diesem wahrhaftig newtonischen Kopfe, aus Schäffer, Ferber, Reiz, Meier und so manchen andern, was wäre in England geworden? (Was aus Herschel nicht geworden wäre, wenn er in der hannoverschen Hofkapelle diente!) Und wie ging's dem verdienten Crollius in Zweibrück, dem guten Meggenhofen in Bayern! wie verschwand Crugot, dieser sanft- und helleuchtende Stern, so bald unter Wolken! Auf welche Irrwege ward Basedow geführt, und wie traurig schreitet der arme Ephraim Kuh seine Laufbahn danieder! – Diese liegen nun neben Joseph II., neben Elliot, Howard, Franklin, Kreittmayr hier begraben. Sie schlafen freilich nebeneinander allesamt in Frieden; aber der Name auf ihren Leichsteinen gibt mehr zu denken, als selbst in Grays »Elegie auf dem Landkirchhofe« ausgedrückt sein möchte. Dem Toten, meine Freunde, gebühret eine Träne; so manchem deutschen Toten gebührt mehr als ein Seufzer.
5.
Der Trübsinn, der Sie bei dem Nekrolog angewandelt hat, ist nicht ganz ohne Grund; lassen Sie uns diesen aber näher beleuchten. Sollte die Grabstätte selbst, die hier errichtet worden, daran nicht etwa mit schuld sein?
Der Name »Totenregister« ist schon ein trauriger Name. Laß Tote ihre Toten begraben; wir wollen die Gestorbnen als Lebende betrachten, uns ihres Lebens, ihres auch nach dem Hingange noch fortwirkenden Lebens freuen und eben deshalb ihr bleibendes Verdienst dankbar für die Nachwelt aufzeichnen. Hiermit verwandelt sich auf einmal das Nekrologium in ein Athanasium, in ein Mnemeion; sie sind nicht gestorben, unsre Wohltäter und Freunde; denn ihre Seelen ihre Verdienste ums Menschengeschlecht, ihr Andenken lebet.
Damit veränderte sich auch der Entwurf dieses Buches, und gewiß zu seinem Vorteil, wenn anders der Entwurf auszuführen wäre.
1. Nur deren Leben gehörte in diese Sammlung, die zum Besten der Menschheit wirklich beigetragen haben; und es wäre Hauptblick des Erzählers, wie sie dies taten, wie sie die wurden, die sie waren, womit sie zu kämpfen, was sie zu überwinden hatten, wie weit sie's brachten und was sie andern zu tun nachließen, endlich, wie sie ihr Geschäft, das Werk ihres Lebens, selbst ansahn. Eine treue Erzählung hievon, wo möglich aus dem Munde oder den Schriften der Entschlafnen oder von denen, die sie nahe gekannt und bemerkt haben, wäre wie eine Stimme aus dem Grabe, wie ein Testament des Verstorbnen über sein eigenstes Eigentum, über seinen edelsten Nachlaß.
2. Hieraus folgte, daß bei Männern der Wissenschaft man sich notwendig auf den Wert und die Wirkung ihrer Schriften, bei tätigen Geschäftsmännern auf den Beruf einlassen müßte, in welchem sie der Menschheit dienten. Bei Crugot z.B. sind seine »Predigten vom Verfasser des Christen in der Einsamkeit« nicht genannt, mit denen er doch, zumal im zweiten Teil, seinen Zeitgenossen so weit vorschritt. Crugots wenige Schriften verdienen zu bleiben, solange die deutsche Sprache bleibt; und es war mir ein angenehmer Umstand, hier zu finden, daß Carmer den »Christen in der Einsamkeit« zum Druck gefördert habe. Wie nun? sollte der helldenkende, liebenswürdige Mann, dessen Moral so ganz die reine Humanität Christi atmet, ohne hinterlassene, des Drucks würdige Schriften gestorben sein? Und sollte Carmer, sollten die zwei Prinzen und die Prinzessin, die, wie die Biographie sagt, ihren verdienstvollen Lehrer in ihm ehrten und liebten, sollten die Freunde, die ihn näher kannten, dies Geschenk für Welt und Nachwelt verloren sein lassen? Ich hoffe nicht; denn nebst Sack und Spalding war Crugot nicht nur in jenen Gegenden, sondern für Deutschland überhaupt einer der ersten Verbreiter des guten Geschmacks und einer hellen Philosophie im Kreise seines Berufes. Er muß nicht tot sein, sondern er lebe!
3. Da schwerlich etwas Langweiligeres als ein unbestimmtes Leichenlob sein kann, so sind eben die zartesten Saiten des menschlichen Herzens auch hier, wie mich dünkt, aufs leiseste zu berühren. Familien-, Freundes-, Privatsituationen, wenn sie nicht auf einem hellen Detail beruhen, ertragen in allgemeinen Ausdrücken selten ein langes Lob; man überschlägt's oder ermüdet. Überhaupt ist das, was der Lehrer der Menschen vom Innern der Moralität sprach, auch in Absicht auf die Darstellung derselben wahr: »Was fürs Auge des Allsehenden allein gehöret und vor ihm getan ward, will nicht vor dem Auge der Menschen prangen, gesetzt, daß es auch der wahreste Freund des Verstorbnen vorzeigte.« Anders ist's mit bestimmten Tatsachen; die sprechen durch sich selbst, sie ermahnen, lehren, trösten.
4. Eingänge zu Lebensbeschreibungen durch einen Allgemeinsatz sind höchst mißlich. Welcher Allgemeinsatz erschöpft ein menschliches Leben? Welcher verführt nicht öfter, als er zurechtweiset? In den lateinischen memoriis sind solche Gemeinplätze hergebracht; hier, wünscht man, wachse die Bemerkung an ihrer natürlichen Stelle im Fortgange der Erzählung hervor, oder sie versiegle zuletzt den Eindruck des Ganzen. Über manches dieser Leben hätte viel Starkes können gesagt werden, bald mit einem strengen Blick, bald mit einem herzdurchdringenden Seufzer.
5. Denn freilich, m. Fr., ist's wahr: Deutschland weinet um manche seiner Kinder; es ruft: Sie sind nicht mehr, sie gingen gekränkt, beistand- und trostlos unter. Hier also auf dem Grabe des Verstorbnen, als auf einer heiligen Freistätte, müssen Wahrheit und Menschlichkeit, diese sanft und rührend, jene unparteiisch und strenge, ihre Stimmen erheben und sprechen: »Dieser Mann ward unterdrückt, jener gemißbraucht, dieser verlockt und gestohlen. Ohne Recht und Urteil schmachtete er viele Jahre im Felsenkerker; das Auge seines Fürsten weidete sich an ihm; seine späte Entlassung ward Gnade, und nie bekam er die Ursache seines Gefängnisses zu wissen, bis an den Tag seines Todes.«7 Wahre Begegnisse dieser Art müßten von Munde zu Munde, von Tagebuch zu Tagebuch fortgepflanzt werden; denn wenn Lebendige schweigen, so mögen aus ihren Gräbern die Toten aufstehn und zeugen.
Auf diese Weise geführt, was wäre lehrreicher und nützlicher als ein solches Register der Toten? Es ist kein Bösewicht auf der Erde, den nicht, wenn sein schuldloser oder gar edler Gegner mit hingestreckten Armen daliegt und die Totenglocke über ihm ertönet, das, wodurch er ihm im Leben wehe tat, jetzt im Herzen steche und nage. Die Schlangen der Rache, des Neides und Undanks entschlafen am Grabe des Toten und wenden sich gegen den lebenden Verbrecher. Hier also sitze, wie dort auf Ajax Grabe, Tugend und Menschenwürde und wäge und richte.
Ich weiß wohl, wie schwer dies alles auszuführen sei, zumal in Deutschland. Eben aber, daß Mösers patriotische Phantasie »Aufmunterung und Vorschlag zu einer westfälischen Biographie« hier in einem weiteren Umfange erfüllet werden könnte, daß, wenn sonst nirgend, wenigstens auf einem Gottesacker die verdienten Männer mehrerer und aller deutschen Provinzen sich zusammenfänden und endlich doch in der Erde sich als Landesleute, als Brüder, als Mitarbeiter an einem Werk des Menschenberufs erkennten; das allein schon sollte jeden Gutgesinnten aufmuntern, aus seiner Gegend, wie er weiß und kann, zur Vervollkommung des Ganzen mit beizutragen.
6. Vor allen Dingen aber wünschte ich eigne Biographienerlesner merkwürdiger Menschen. Wie weit stehen wir Deutsche hierin andern Nationen, Franzosen, Engländern, Italienern, nach! Wir lebten, dachten, müheten uns; aber wir konnten nicht schreiben. Die rauhe oder ermattete Hand, die das Schwert, den Zepter, das Handwerk- und Kunstwerkzeug, wohl auch die breite Kanzleifeder führte, verachtete meistens die Reißfeder mühsamer Selbstschilderung; mit der alten Chronikenzeit ging auch das häusliche und Familiengefühl, für die Seinen und mit ihnen fortzuleben, großenteils zu Grabe. Was also von merkwürdigen alten Selbstbeschreibungen gerettet, was von neuen hie und da entdeckt werden kann, sollte gerettet und genützt werden, bis (ich weiß gewiß, daß die Zeit kommt) merkwürdige Geschäfte auch freiere Gesinnungen und diese den Geist einer edlen Publizität erwecken werden, bei dem alle Stände im Lichte wandeln. »Praecipuum munus annalium, ne virtutes sileantur; utque pravis dictis factisque ex posteritate et infamia metus sit.«
Der Patriot
Von allen Helden, die der Welt
Als ewige Gestirne glänzen,
Durch alle Gegenden bis an der Erde Grenzen,
O Patriot, bist du mein Held.
Der du, von Menschen oft verkannt,
Dich ganz dem Vaterlande schenkest,
Nur seine Leiden fühlst, nur seine Größe denkest,
Und lebst und stirbst fürs Vaterland.
Umsonst sucht von der Tugend Bahn
Der Eigennutz dich zu verdrängen,
Und führet wider dich, mit Jauchzen und Gesängen,
Die lockende Verführung an;
Und ihr Gefolg, die güldne Pracht,
Den stolzen Reichtum, mit der Ehre,
Die Pfauenflügel schwingt, und einem Freudenheere,
Das um die süße Wollust lacht.
Siegprangender als Cäsar war,
Schlägt sich durch diesen furchtbarn Haufen
Die große Seele durch, mit Gold nicht zu erkaufen,
Nicht zu erschüttern durch Gefahr.
Denn wie ein Fels, der unbewegt,
Wann Wogen sich auf Wogen türmen,
Im Ozeane steht und ruhig in den Stürmen
Den ganzen Zorn des Himmels trägt:
So stehest du mit festem Mut
Und trotzest, ohne Freund, verlassen,
Dem Grimm der Mächtigen, der Bösen, die dich hassen,
Und ihrer ungerechten Wut.
Das Vaterland beglückt zu sehn,
Ist dir die göttlichste der Freuden,
Ist dir Ambrosia, selbst in dem härtsten Leiden,
Wann Bürger dich undankbar schmähn.
Bis dich der Himmel wieder ruft,
Die lichte Wohnung wahrer Helden,
Und wer du warest, einst des Volkes Tränen melden,
Verströmt um deine stille Gruft.
Unrühmlich, unbeweint im Tod,
Vermodern in vergeßnen Höhlen
Die Bürger schlimmer Art, in deren kleinen Seelen
Nur niedrer Eigennutz gebot.
Die Schändlichen! Das Vaterland,
Das ihnen, was sie hatten, Leben,
Ruh, Ehr und Überfluß und sichre Lust gegeben,
Bat hülflos mit erhobner Hand;
Sie aber wichen scheu zurück,
Und nützten den erzürnten Himmel
Zu häßlichem Gewinn, und dachten im Getümmel
Nur sich und ihres Hauses Glück.
Ihr Haus entflieht der Rache nicht,
Die endlich den Verbrecher findet:
Was mit verruchter Hand ein Bösewicht gegründet,
Zerstört ein andrer Bösewicht.
Des Bürgers Glück blüht mit dem Staat,
Und Staaten blühn durch Patrioten.
Athen besiegten Stolz und Eigennutz und Rotten,
Noch eh es Philipps Ehrsucht tat.
Und so fiel Rom, die Königin
Der Könige von allen Zonen,
Von ihrem Thron gestürzt; und ihre güldnen Kronen
Nahm ein erkaufter Barbar hin.
Oft wann in schauervoller Nacht
Ihr Schutzgeist ihren Schutt umflieget,
Stillschweigend übersieht, wie Rom im Staube lieget,
In Trümmern seiner alten Pracht;
Und dann die großen Taten denkt,
Die sein geliebtes Volk vollbrachte,
So lang fürs Vaterland der Bürger Liebe wachte,
Von niedrer Absicht unbeschränkt;
Als alles fremden Goldes Feind,
Ein Curius und Scipione
Und die Fabricier und männliche Catone
Noch lebten, mit dem Staat vereint;
Dann klagt er laut: »Sie sind nicht mehr!«
Des Kolosseums öde Mauern
Beginnen, rund umher antwortend, mit zu trauern,
Tiefbrausend wie ein stürmisch Meer.
»Sie sind nicht mehr, und Rom starb nach!
Erhoben durch die Patrioten,
Fiel mein geliebtes Rom, als allen Bürgerrotten
Ein patriotisch Herz gebrach.«
Daß dieser Fall der großen Stadt
Die sicher-stolzen Völker lehre,
Der größte Staat sei schwach, der ungezählte Heere,
Doch keine Patrioten hat.
Uz
6.
Ein Athanasium, ein Mnemeion Deutschlands! Wahrlich, unser Vaterland ist zu beklagen, daß es keine allgemeine Stimme, keinen Ort der Versammlung hat, wo man sich sämtlich höret. Alles ist in ihm zerteilt, und so manches schützet diese Zerteilung: Religionen, Sekten, Dialekte, Provinzen, Regierungen, Gebräuche und Rechte. Nur auf dem Gottesacker kann uns etwa eine Stelle gemeinsamer Überlegung und Anerkennung gestattet werden.
Aber warum nur hier? Arbeiten nicht in allen, vom höchsten bis zu den niedrigsten Ständen, sichtbare und unsichtbare Kräfte, diese gemeinsame Überlegung und Anerkennung zu erleichtern, zu bewirken? Ein Teil Deutschlands hatte sich vor dem andern mit unleugbaren Vorschriften ein großes Voraus gegeben; der andre Teil eifert ihm nach, und wir können bald an der Stelle sein, ein Ebenmaß zu finden. Jeder biedre Mensch muß sich bestreben, dieses zu fördern, und glücklicherweise scheinen mir diejenigen, die die biedersten Deutschen sein sollen, die Fürsten, auf denselben Weg zu treten. Gewiß, der Unterschied der Religionen macht es nicht, denn in allen Religionen Deutschlands gibt es aufgeklärte, gute Menschen. Der Unterschied von Dialekten, von Bier- und Weinländern macht es auch nicht, was uns voneinander hält und sondert; ein leidiges Staatsinteresse, eine Anmaßung mehreren Geistes, mehrerer Kultur auf der einen, auf der andern Seite mehreren Gewichts, mehreren Reichtums u. f. war es, was uns entzweiet; und dem, dünkt mich, muß und wird die allmächtige Zeit obsiegen.
Denn sagen Sie, was hindert uns Deutsche, uns allesamt als Mitarbeiter an einem Bau der Humanität anzuerkennen, zu ehren und einander zu helfen? Haben wir nicht alle eine Sprache, ein gemeinschaftliches Interesse, eine Vernunft, ein und dasselbe menschliche Herz? Der Philosophie und Kritik hat man nirgend den Weg versperren können; sie arbeitet sich überall durch; sie wird in allen guten Köpfen rege. Ihre Regeln sind allenthalben dieselbe; ihr Zweck allenthalben nur einer. Auch der Wetteifer verschiedner Provinzen gegeneinander kann nicht anders, als diesen Zweck befördern.
Ruhm und Dank verdienet also ein jeder, der die Gemeinschaft der Länder Deutschlands durch Schriften, Gewerbe und Anstalten zu befördern sucht; er erleichtert die Zusammenwirkung und Anerkennung mehrerer und der verschiedensten Kräfte; er bindet die Provinzen Deutschlands durch geistige und also die stärksten Bande.
Daß uns eine Hauptstadt fehle, tut zu unsrer Sache gewiß nichts. Der Ausbildung des Geschmacks mag ihr Mangel eine Hindernis sein; und auch der Geschmack kann durch sie ebensowohl verderbt und gefesselt werden, als sie ihm anfangs Politur und Flügel verleihen mochte. Einsichten aber, ruhige Überlegungen, tätige Versuche, Empfindungen und Äußerungen dessen, was örtlich und allenthalben zu unserm Frieden dienet, sie verschmähen die Mauern einer Hauptstadt und suchen das freie Land; ihre Werkstätte ist das gesamte Deutschland. Je mehrere und leichtere Boten allenthalben her, allenthalben hin gelangen, desto mehr wird die Mitteilung der Gedanken befördert, und kein Fürst, kein König wird diese zu hemmen suchen, der die unendlichen Vorteile der Geistesindustrie, der Geisteskultur, der gegenseitigen Mitteilung von Erfindungen, Gedanken, Vorschlägen, selbst von begangenen Fehlern und Schwächen einsieht. Jedes dieser Stücke kommt der Menschennatur, mithin auch der Gesellschaft, zugut; der Fehler wird entdeckt, der Irrtum wird gebessert, Gedanke weckt Gedanken, Empfindungen und Entschlüsse regen und treiben. Denn das ist eben die große und gute Einrichtung der menschlichen Natur, daß in ihr, wenn ich so sagen darf, alles im Keim da ist und nur auf seine Entwickelung wartet. Entschließet sich die Blüte nicht heute, so wird sie sich morgen zeigen. Auch alle möglichen Antipathien sind in der menschlichen Natur da; jedem Gift ist nicht nur sein Gegengift gewachsen, sondern die ewige Tendenz der waltenden lebendigen Kraft geht dahin, aus dem schädlichsten Gift die kräftigste Arznei zu bereiten. Ach, die Extreme liegen in unsrer engebeschränkten Natur so nahe, so dicht beieinander, daß es oft nur auf einen geschickten Fingerdruck ankommt, aus dem Einfalls- den Absprungswinkel zu machen, da unabänderlichen Gesetzen nach beide in ihrem Verhältnis einander gleich sind. Gedanken zu hemmen, dies Kunststück hat noch keine irdische Politik erfunden; ihr selbst wäre es auch sehr unzuträglich. Aber Gedanken zu sammlen, zu ordnen, zu lenken, zu gebrauchen, dies ist ihr, für alle Zeiten hinaus, unabsehlicher großer Vorteil.
Doch die Seite des Verstandes ist's nicht allein, in Absicht welcher ich Deutschland einen gemeinsamen Zusammenhang wünschte; vielmehr ist's die Seite des Charakters, der Entschlüsse, der Unternehmung. Wir wissen alle, daß die Deutschen von jeher mehr getan, als von sich reden gemacht haben; das tun sie auch noch. In jeder Provinz Deutschlands leben Männer, die ohne französische Eitelkeit, ohne englischen Glanz, gehorsam, oft leidend, Dinge tun, deren Anblick jedermann schönen und großen Mut einspräche, wenn sie bekannt wären. Denen vollends wünsche ich keinen Hof, keine Hauptstadt; einen Altar der Biedertreue wünsche ich ihnen, an dem sie sich mit Geist und Herzen versammeln. Er kann nur im Geist existieren, d. i. in Schriften; und, o daß ausgezeichnet vor allen eine solche Schrift da wäre! An ihr würden sich Seelen entflammen und Herzen stärken. Der deutsche Namen, den jetzt viele Nationen gering zu halten sich anmaßen, würde vielleicht als der erste Name Europas erscheinen, ohne Geräusch, ohne Anmaßung, nur in sich selbst stark, fest und groß.
7.
Wir sind darüber einig, daß, wenn ein großer Name auf Europa mächtig gewirkt hat, es Friedrich gewesen. Als er starb, schien sein hoher Genius die Erde verlassen zu haben; Freunde und Feinde seines Ruhms standen gerührt; es war, als ob er auch in seiner irdischen Hülle hätte unsterblich sein mögen.
Sie denken leicht, wie begierig ich auf seine nachgelassenen Schriften8 war: hier, sagte ich, lebt und spricht noch sein Geist nach dem Ableben seines alten vielgeübten Körpers. Briefe, Gespräche, ja Worte von ihm, die, solang er König war, als Ehre gesucht, als Schätze umhergetragen wurden, sind jetzt ein gemeines Gut. Man kann sie unerschrocken prüfen, im Zusammenhange seines langen Lebens beherzigen; man darf ihnen widersprechen und sie mit seinen Taten vergleichen.
Zuerst also griff ich nicht nach Werken, die er absichtlich für die Welt geschrieben hatte, sondern nach seinem Briefwechsel, und unter diesem auf den längsten und interessantsten, mit Voltaire. Er erstreckt sich von 1736 bis 1777, also über vierzig Jahre, und zeigt die Seele des großen Königes in den verschiedensten Situationen seines Lebens. Ich will einige Züge und Stellen auszeichnen.