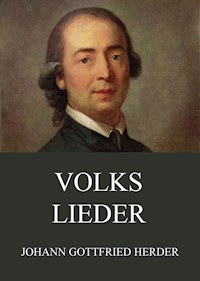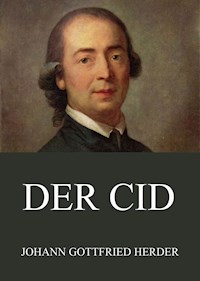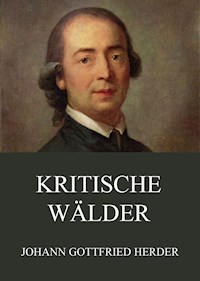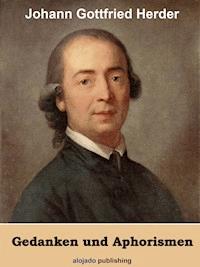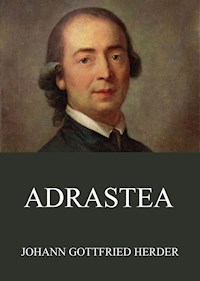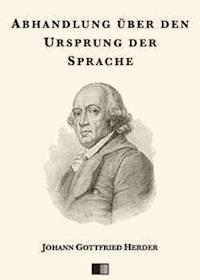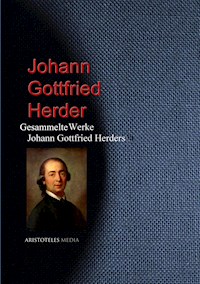4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Herders »Abhandlung über den Ursprung der Sprache« misst gegenüber den Arbeiten seiner Vorgänger der Sprache eine neue Bedeutung bei. Sprache ist nicht mehr nur Mittel zum Zweck der Erkenntnis, sondern gehört wesentlich zur menschlichen Natur und determiniert ihre Erkenntnismöglichkeiten. Deshalb erfordert die Reflexion über Sprache mehr, als Grammatik oder Rhetorik leisten können, sie wird zu einer philosophischen Aufgabe. Mit seiner Aufwertung der Sprache hat Herder nicht nur das Denken seiner Zeit und literarischen Epoche geprägt, sondern auch nachwirkende Impulse für die Sprachreflexion der kommenden zwei Jahrhunderte gegeben. »Ich habe lange eine philosophische Sprachkunst für unsere Sprache gewünscht, aber wenig Materialien dazu gefunden«, schrieb Herder 1767. Eine 1769 gestellte Preisfrage der Berliner Akademie der Wissenschaften war ihm dann der willkommene Anlass, seine »Abhandlung über den Ursprung der Sprache« zu schreiben, die dann auch den Preis der Akademie erhielt. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Johann Gottfried Herder
Abhandlung über den Ursprung der Sprache
Reclam
1966 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Bibliographisch ergänzte Ausgabe 2015
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2017
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960955-3
Inhalt
Faksimile: Motto nach Cicero, Topica VIII, 35.
[5]Erster TeilHaben die Menschen, ihren Naturfähigkeiten überlassen, sich selbst Sprache erfinden können?
Erster Abschnitt
Schon als Tier hat der Mensch Sprache. Alle heftigen und die heftigsten unter den heftigen, die schmerzhaften Empfindungen seines Körpers, alle starke Leidenschaften seiner Seele äußern sich unmittelbar in Geschrei, in Töne, in wilde, unartikulierte Laute. Ein leidendes Tier sowohl als der Held Philoktet, wenn es der Schmerz anfället, wird wimmern, wird ächzen, und wäre es gleich verlassen, auf einer wüsten Insel, ohne Anblick, Spur und Hoffnung eines hülfreichen Nebengeschöpfes. Es ist, als obs freier atmete, indem es dem brennenden, geängstigten Hauche Luft gibt; es ist, als obs einen Teil seines Schmerzes verseufzte und aus dem leeren Luftraum wenigstens neue Kräfte zum Verschmerzen in sich zöge, indem es die tauben Winde mit Ächzen füllet. So wenig hat uns die Natur als abgesonderte Steinfelsen, als egoistische Monaden geschaffen! Selbst die feinsten Saiten des tierischen Gefühls (ich muß mich dieses Gleichnisses bedienen, weil ich für die Mechanik fühlender Körper kein besseres weiß!), selbst die Saiten, deren Klang und Anstrengung gar nicht von Willkür und langsamen Bedacht herrühret, ja deren Natur noch von aller forschenden Vernunft nicht hat erforscht werden können, selbst die sind in ihrem ganzen Spiele, auch ohne das Bewußtsein fremder Sympathie zu einer Äußerung auf andre Geschöpfe gerichtet. Die geschlagne Saite [6]tut ihre Naturpflicht: sie klingt, sie ruft einer gleichfühlenden Echo, selbst wenn keine da ist, selbst wenn sie nicht hoffet und wartet, daß ihr eine antworte.
Sollte die Physiologie je so weit kommen, daß sie die Seelenlehre demonstrierte, woran ich aber sehr zweifle, so würde sie dieser Erscheinung manchen Lichtstrahl aus der Zergliederung des Nervenbaues zuführen; sie vielleicht aber auch in einzelne, zu kleine und stumpfe Bande verteilen. Lasset sie uns jetzt im Ganzen, als ein helles Naturgesetz annehmen: Hier ist ein empfindsames Wesen, das keine seiner lebhaften Empfindungen in sich einschließen kann; das im ersten überraschenden Augenblick, selbst ohne Willkür und Absicht, jede in Laut1äußern muß. Das war gleichsam der letzte, mütterliche Druck der bildenden Hand der Natur, daß sie allen das Gesetz auf die Welt mitgab: »Empfinde nicht für dich allein: sondern dein Gefühl töne!«, und da dieser letzte schaffende Druck auf alle von einer Gattung einartig war, so wurde dies Gesetz Segen: »Deine Empfindung töne deinem Geschlecht einartig und werde also von allen wie von einem mitfühlend vernommen!« Nun rühre man es nicht an, dies schwache, empfindsame Wesen! So allein und einzeln und jedem feindlichen Sturme des Weltalls es ausgesetzt scheinet, so ists nicht allein: es steht mit der ganzen Natur im Bunde! Zartbesaitet, aber die Natur hat in diese Saiten Töne verborgen, die, gereizt und ermuntert, wieder andre gleichzart gebaute Geschöpfe wecken und, wie durch eine unsichtbare Kette, einem entfernten Herzen Funken mitteilen können, für dies ungesehene Geschöpf zu fühlen. Diese Seufzer, diese Töne sind Sprache. Es gibt also eine Sprache der Empfindung, die unmittelbares Naturgesetz ist.
Daß der Mensch sie ursprünglich mit den Tieren gemein habe, bezeugen jetzt freilich mehr gewisse Reste als volle Ausbrüche; allein auch diese Reste sind unwidersprechlich. Unsre künstliche Sprache mag die Sprache [7]der Natur so verdränget, unsre bürgerliche Lebensart und gesellschaftliche Artigkeit mag die Flut und das Meer der Leidenschaften so gedämmet, ausgetrocknet und abgeleitet haben, als man will; der heftigste Augenblick der Empfindung, wo und wie selten er sich finde, nimmt noch immer sein Recht wieder und tönt in seiner mütterlichen Sprache unmittelbar durch Akzente. Der auffahrende Sturm einer Leidenschaft, der plötzliche Überfall von Freude oder Froheit, Schmerz und Jammer, wenn sie tiefe Furchen in die Seele graben, ein übermannendes Gefühl von Rache, Verzweiflung, Wut, Schrecken, Grausen usw., alle kündigen sich an und jede nach ihrer Art verschieden an. So viel Gattungen von Fühlbarkeit in unsrer Natur schlummern, so viel auch Tonarten. – Ich merke also an, daß je weniger die menschliche Natur mit einer Tierart verwandt, je ungleichartiger sie mit ihr am Nervenbaue ist: desto weniger ist ihre Natursprache uns verständlich. Wir verstehen, als Erdentiere, das Erdentier besser als das Wassergeschöpf und auf der Erde das Herdetier besser als das Waldgeschöpf; und unter den Herdetieren die am meisten, die uns am nächsten kommen. Nur daß freilich auch bei diesen Umgang und Gewohnheit mehr oder weniger tut. Es ist natürlich, daß der Araber, der mit seinem Pferde nur ein Stück ausmacht, es mehr versteht als der, der zum erstenmal ein Pferd beschreitet2; fast so gut, als Hektor in der Iliade3 mit den seinigen sprechen konnte. Der Araber in der Wüste, der nichts Lebendiges um sich hat als sein Kamel und etwa den Flug umirrender Vögel, kann leichter jenes Natur verstehen und das Geschrei dieser zu verstehen glauben als wir in unsern Behausungen. Der Sohn des Waldes, der Jäger, versteht die Stimme des Hirsches und der Lappländer seines Renntiers – doch alles das folgt oder ist Ausnahme. Eigentlich ist diese Sprache der Natur eine Völkersprache für jede Gattung unter sich, und so hat auch der Mensch die seinige.
[8]Nun sind freilich diese Töne sehr einfach; und wenn sie artikuliert und als Interjektionen aufs Papier hinbuchstabiert werden, so haben die entgegengesetztesten Empfindungen fast einen Ausdruck. Das matte Ach ist sowohl Laut der zerschmelzenden Liebe als der sinkenden Verzweiflung; das feurige O sowohl Ausbruch der plötzlichen Freude als der auffahrenden Wut, der steigenden Bewunderung als des zuwallenden Bejammerns; allein sind denn diese Laute da, um als Interjektionen aufs Papier gemalt zu werden? Die Träne, die in diesem trüben, erloschnen, nach Trost schmachtenden Auge schwimmt – wie rührend ist sie im ganzen Gemälde des Antlitzes der Wehmut; nehmet sie allein, und sie ist ein kalter Wassertropfe, bringet sie unters Mikroskop und – ich will nicht wissen, was sie da sein mag! Dieser ermattende Hauch, der halbe Seufzer, der auf der vom Schmerz verzognen Lippe so rührend stirbt – sondert ihn ab von allen seinen lebendigen Gehülfen, und er ist ein leerer Luftstoß. Kanns mit den Tönen der Empfindung anders sein? In ihrem lebendigen Zusammenhange, im ganzen Bilde der würkenden Natur, begleitet von so vielen andern Erscheinungen sind sie rührend und gnugsam; aber von allen getrennet, herausgerissen, ihres Lebens beraubet, freilich nichts als Ziffern. Die Stimme der Natur ist gemalter, verwillkürter Buchstabe. – Wenig sind dieser Sprachtöne freilich; allein die empfindsame Natur, sofern sie bloß mechanisch leidet, hat auch weniger Hauptarten der Empfindung, als unsre Psychologien der Seele als Leidenschaften anzählen oder andichten. Nur jedes Gefühl ist in solchem Zustande, je weniger in Fäden zerteilt, ein um so mächtiger anziehendes Band: die Töne reden nicht viel, aber stark. Ob der Klageton über Wunden der Seele oder des Körpers wimmere? Ob dieses Geschrei von Furcht oder Schmerz ausgepreßt werde? Ob dies weiche Ach sich mit einem Kuß oder einer Träne an den Busen der Geliebten drücke? Alle solche [9]Unterschiede zu bestimmen, war diese Sprache nicht da. Sie sollte zum Gemälde hinrufen; dies Gemälde wird schon vor sich selbst reden! Sie sollte tönen, nicht aber schildern! – Überhaupt grenzen nach jener Fabel des Sokrates4 Schmerz und Wohllust: die Natur hat in der Empfindung ihre Ende zusammengeknüpft, und was kann also die Sprache der Empfindung anders als solche Berührungspunkte zeigen? – Jetzt darf ich anwenden.
In allen Sprachen des Ursprungs tönen noch Reste dieser Naturtöne; nur freilich sind sie nicht die Hauptfäden der menschlichen Sprache. Sie sind nicht die eigentlichen Wurzeln, aber die Säfte, die die Wurzeln der Sprache beleben.
In einer feinen, spät erfundnen metaphysischen Sprache, die von der ursprünglichen wilden Mutter des menschlichen Geschlechts eine Abart vielleicht im vierten Gliede und nach langen Jahrtausenden der Abartung selbst wieder Jahrhunderte ihres Lebens hindurch verfeinert, zivilisiert und humanisiert worden: eine solche Sprache, das Kind der Vernunft und Gesellschaft, kann wenig oder nichts mehr von der Kindheit ihrer ersten Mutter wissen; allein die alten, die wilden Sprachen, je näher zum Ursprunge, enthalten davon desto mehr. Ich kann hier noch nicht von der geringsten menschlichen Bildung der Sprache reden, sondern nur rohe Materialien betrachten. Noch existiert für mich kein Wort, sondern nur Töne zum Wort einer Empfindung; aber sehet! in den genannten Sprachen, in ihren Interjektionen, in den Wurzeln ihrer Nominum und Verborum wieviel aufgefangene Reste dieser Töne! Die ältesten morgenländischen Sprachen sind voll von Ausrüfen, für die wir später gebildeten Völker oft nichts als Lücken oder stumpfen, tauben Mißverstand haben. In ihren Elegien tönen, wie bei den Wilden auf ihren Gräbern, jene Heul- und Klagetöne, eine fortgehende Interjektion der Natursprache; in ihren Lobpsalmen das Freudengeschrei und die wiederkommenden [10]Hallelujas, die Shaw5 aus dem Munde der Klageweiber erkläret und die bei uns so oft feierlicher Unsinn sind. Im Gang, im Schwunge ihrer Gedichte und der Gesänge andrer alten Völker tönet der Ton, der noch die Krieges- und Religionstänze, die Trauer- und Freudengesänge aller Wilden belebet, sie mögen am Fuße der Cordilleras oder im Schnee der Irokesen6, in Brasilien oder auf den Karaiben wohnen. Die Wurzeln ihrer einfachsten, würksamsten, frühesten Verben endlich sind jene ersten Ausrüfe der Natur, die erst später gemodelt wurden, und die Sprachen aller alten und wilden Völker sind daher in diesem innern, lebendigen Tone für Fremde ewig unaussprechlich!
Ich kann die meisten dieser Phänomene im Zusammenhange erst später erklären; hier stehe nur eins. Einer der Verteidiger des göttlichen Ursprunges der Sprache*7 findet darin göttliche Ordnung zu bewundern, daß sich die Laute aller uns bekannten Sprachen auf etliche zwanzig Buchstaben bringen lassen. Allein das Faktum ist falsch und der Schluß noch unrichtiger. Keine einzige lebendigtönende Sprache läßt sich vollständig in Buchstaben bringen und noch weniger in zwanzig Buchstaben; dies zeugen alle Sprachen sämtlich und sonders. Die Artikulationen unsrer Sprachwerkzeuge sind so viel, ein jeder Laut wird auf so mannigfaltige Weise ausgesprochen, daß z. E. Herr Lambert im zweiten Teil seines Organon8 mit Recht hat zeigen können, wie weit weniger wir Buchstaben als Laute haben und wie unbestimmt also diese von jenen ausgedrückt werden können. Und das ist doch nur aus der deutschen Sprache gezeiget, die die Vieltönigkeit und den Unterschied ihrer Dialekte noch nicht einmal in eine Schriftsprache aufgenommen hat: viel weniger wo die ganze Sprache nichts als solch ein lebendiger Dialekt ist. Woher rühren alle Eigenheiten und [11]Sonderbarkeiten der Orthographie, als wegen der Unbehülflichkeit, zu schreiben, wie man spricht? Welche lebendige Sprache läßt sich ihren Tönen nach aus Bücherbuchstaben lernen? Und welche tote Sprache daher aufwecken? Je lebendiger nun eine Sprache ist, je weniger man daran gedacht hat, sie in Buchstaben zu fassen, je ursprünglicher sie zum vollen, unausgesonderten Laute der Natur hinaufsteigt, desto minder ist sie auch schreibbar, desto minder mit zwanzig Buchstaben schreibbar, ja oft für Fremdlinge ganz unaussprechlich. Der Pater Rasles9, der sich zehn Jahr unter den Abenakiern in Nordamerika aufgehalten, klagt hierüber so sehr, daß er mit aller Aufmerksamkeit doch oft nur die Hälfte des Worts wiederholet und sich lächerlich gemacht – wie weit lächerlicher hätte er mit seinen französischen Buchstaben beziffert? Der Pater Chaumonot10, der fünfzig Jahr unter den Huronen zugebracht und sich an eine Grammatik ihrer Sprache gewagt, klagt demohngeachtet über ihre Kehlbuchstaben und ihre unaussprechlichen Akzente: oft hätten zwei Wörter, die ganz aus einerlei Buchstaben bestünden, die verschiedensten Bedeutungen. Garcilasso di Vega11 beklagt sich über die Spanier, wie sehr sie die peruanische Sprache im Laute der Wörter verstellet, verstümmelt, verfälscht, und aus bloßen Verfälschungen den Peruanern das schlimmste Zeug angedichtet. De la Condamine12 sagt von einer kleinen Nation am Amazonenfluß, ein Teil von ihren Wörtern könnte nicht, auch nicht einmal sehr unvollständig, geschrieben werden. Man müßte wenigstens neun oder zehn Silben dazu gebrauchen, wo sie in der Aussprache kaum drei auszusprechen scheinen. La Loubère13 von der siamschen Sprache: »Unter zehn Wörtern, die der Europäer ausspricht, versteht ein geborner Siamer vielleicht kein einziges: man mag sich Mühe geben, soviel man will, ihre Sprache mit unsern Buchstaben auszudrücken.« Und was brauchen wir Völker aus so entlegnen Enden der Erde? Unser kleine Rest von Wilden in [12]Europa, Estländer und Lappen usw., haben oft ebenso halbartikulierte und unschreibbare Schälle als Huronen und Peruaner. Russen und Polen, solange ihre Sprachen geschrieben und schriftgebildet sind, aspirieren noch immer so, daß der wahre Ton ihrer Organisation nicht durch Buchstaben gemalt werden kann. Der Engländer, wie quälet er sich, seine Töne zu schreiben, und wie wenig ist der noch, der geschriebnes Englisch versteht, ein sprechender Engländer? Der Franzose, der weniger aus der Kehle hinaufholet, und der Halbgrieche, der Italiener, der gleichsam in einer höhern Gegend des Mundes, in einem feinern Äther spricht, behält immer noch lebendigen Ton. Seine Laute müssen innerhalb der Organe bleiben, wo sie gebildet worden: als gemalte Buchstaben sind sie, so bequem und einartig sie der lange Schriftgebrauch gemacht habe, immer nur Schatten!
Das Faktum ist also falsch und der Schluß noch falscher: er kommt nicht auf einen göttlichen, sondern gerad umgekehrt, auf einen tierischen Ursprung. Nehmet die sogenannte göttliche erste Sprache, die hebräische, von der der größte Teil der Welt die Buchstaben geerbet: daß sie in ihrem Anfange so lebendigtönend, so unschreibbar gewesen, daß sie nur sehr unvollkommen geschrieben werden konnte, dies zeigt offenbar der ganze Bau ihrer Grammatik, ihre so vielfachen Verwechselungen ähnlicher Buchstaben, ja am allermeisten der völlige Mangel ihrer Vokale. Woher kommt die Sonderbarkeit, daß ihre Buchstaben nur Mitlauter sind und daß eben die Elemente der Worte, auf die alles ankommt, die Selbstlauter, ursprünglich gar nicht geschrieben wurden? Diese Schreibart ist dem Lauf der gesunden Vernunft so entgegen, das Unwesentliche zu schreiben und das Wesentliche auszulassen, daß sie den Grammatikern unbegreiflich sein müßte, wenn Grammatiker zu begreifen gewohnt wären. Bei uns sind die Vokale das Erste und Lebendigste und die Türangeln [13]der Sprache; bei jenen werden sie nicht geschrieben. – Warum? – Weil sie nicht geschrieben werden konnten. Ihre Aussprache war so lebendig und feinorganisiert, ihr Hauch war so geistig und ätherisch, daß er verduftete und sich nicht in Buchstaben fassen ließ. Nur erst bei den Griechen wurden diese lebendige Aspirationen in förmliche Vokale aufgefädelt, denen doch noch Spiritus14 usw. zu Hülfe kommen mußten; da bei den Morgenländern die Rede gleichsam ganz Spiritus, fortgehender Hauch und Geist des Mundes war, wie sie sie auch so oft in ihren malenden Gedichten benennen. Es war Othem Gottes, wehende Luft, die das Ohr aufhaschete, und die toten Buchstaben, die sie hinmaleten, waren nur der Leichnam, der lesend mit Lebensgeist beseelet werden mußte! Was das für einen gewaltigen Einfluß auf das Verständnis ihrer Sprache hat, ist hier nicht der Ort zu sagen; daß dies Wehende aber den Ursprung ihrer Sprache verrate, ist offenbar. Was ist unschreibbarer als die unartikulierten Töne der Natur? Und wenn die Sprache, je näher ihrem Ursprunge, desto unartikulierter ist – was folgt, als daß sie wohl nicht von einem höhern Wesen für die vierundzwanzig Buchstaben und diese Buchstaben gleich mit der Sprache erfunden, daß diese ein weit späterer, nur unvollkommener Versuch gewesen, sich einige Merkstäbe der Erinnerung zu setzen, und daß jene nicht aus Buchstaben der Grammatik Gottes, sondern aus wilden Tönen freier Organe entstanden sei*15. Es wäre doch sonst artig, daß eben die Buchstaben, aus denen und für die Gott die Sprache erfunden, mit Hülfe derer er den ersten Menschen die Sprache beigebracht, eben die allerunvollkommensten in der Welt wären, die gar nichts vom Geist der Sprache sagten und in ihrer [14]ganzen Bauart offenbar bekennen, daß sie nichts davon sagen wollen.
Es verdiente diese Buchstabenhypothese freilich ihrer Würde nach nur einen Wink: aber ihrer Allgemeinheit und mannigfaltigen Beschönigung wegen mußte ich ihren Ungrund entblößen und in ihm sie zugleich erklären, wie mir wenigstens keine Erklärung bekannt ist. Zurück auf unsre Bahn:
Da unsre Töne der Natur zum Ausdrucke der Leidenschaft bestimmt sind, so ists natürlich, daß sie auch die Elemente aller Rührung werden! Wer ists, dem bei einem zuckenden, wimmernden Gequälten, bei einem ächzenden Sterbenden, auch selbst bei einem stöhnenden Vieh, wenn seine ganze Maschine16 leidet, dies Ach nicht zu Herzen dringe? Wer ist der fühllose Barbar? Je harmonischer das empfindsame Saitenspiel selbst bei Tieren mit anderen Tieren gewebt ist, desto mehr fühlen selbst diese miteinander: ihre Nerven kommen in eine gleichmäßige Spannung, ihre Seele in einen gleichmäßigen Ton, sie leiden würklich mechanisch mit. Und welche Stählung seiner Fibern! Welche Macht, alle Öffnungen seiner Empfindsamkeit zu verstopfen, gehört dazu, daß ein Mensch hiegegen taub und hart werde!–Diderot* meint, daß ein Blindgeborner gegen die Klagen eines leidenden Tiers unempfindlicher sein müßte als ein Sehender; allein ich glaube unter gewissen Fällen das Gegenteil. Freilich ist ihm das ganze rührende Schauspiel dieses elenden, zuckenden Geschöpfs verhüllet, allein alle Beispiele sagen, daß eben durch diese Verhüllung das Gehör weniger zerstreut, horchender und mächtig eindringender werde. Da lauschet er also im Finstern, in der Stille seiner ewigen Nacht, und jeder Klageton geht ihm um so inniger und schärfer, wie ein Pfeil, zum Herzen! Nun nehme er noch das tastende, langsam umspannende Gefühl zu Hülfe, taste die [15]Zuckungen, erfühle den Bruch der leidenden Maschine sich ganz – Grausen und Schmerz fährt durch seine Glieder: sein innrer Nervenbau fühlt Bruch und Zerstörung mit: der Todeston tönet. Das ist das Band dieser Natursprache!
Überall sind die Europäer, trotz ihrer Bildung und Mißbildung, von den rohen Klagetönen der Wilden heftig gerührt worden. Lery17 erzählt aus Brasilien, wie sehr seine Leute von dem herzlichen, unförmlichen Geschrei der Liebe und Leutseligkeit dieser Amerikaner bis zu Tränen seien erweicht worden. Charlevoix18 und andre wissen nicht gnug den grausenden Eindruck auszudrücken, den die Krieges- und Zauberlieder der Nordamerikaner machen. Wenn wir später Gelegenheit haben werden zu bemerken, wie sehr die alte Poesie und Musik von diesen Naturtönen sei belebet worden, so werden wir auch die Würkung philosophischer erklären können, die z. E. der älteste griechische Gesang und Tanz, die alte griechische Bühne, und überhaupt Musik, Tanz und Poesie noch auf alle Wilde machen. Und auch selbst bei uns, wo freilich die Vernunft oft die Empfindung und die künstliche Sprache der Gesellschaft die Töne der Natur aus ihrem Amt setzet, kommen nicht noch oft die höchsten Donner der Beredsamkeit, die mächtigsten Schläge der Dichtkunst und die Zaubermomente der Aktion dieser Sprache der Natur durch Nachahmung nahe? Was ists, was dort im versammleten Volke Wunder tut, Herzen durchbohrt und Seelen umwälzet? – Geistige Rede und Metaphysik? Gleichnisse und Figuren? Kunst und kalte Überzeugung? Sofern der Taumel nicht blind sein soll, muß vieles durch sie geschehen, aber alles? Und eben dies höchste Moment des blinden Taumels, wodurch wurde das? – Durch ganz eine andre Kraft! Diese Töne, diese Gebärden, jene einfachen Gänge der Melodie, diese plötzliche Wendung, diese dämmernde Stimme – was weiß ich mehr? Bei Kindern und dem Volk der Sinne, bei Weibern, bei [16]Leuten von zartem Gefühl, bei Kranken, Einsamen, Betrübten würken sie tausendmal mehr, als die Wahrheit selbst würken würde, wenn ihre leise, feine Stimme vom Himmel tönte. Diese Worte, dieser Ton, die Wendung dieser grausenden Romanze usw. drangen in unsrer Kindheit, da wir sie das erstemal hörten, ich weiß nicht, mit welchem Heere von Nebenbegriffen des Schauders, der Feier, des Schreckens, der Furcht, der Freude in unsre Seele. Das Wort tönet, und wie eine Schar von Geistern stehen sie alle mit einmal in ihrer dunkeln Majestät aus dem Grabe der Seele auf: sie verdunkeln den reinen, hellen Begriff des Worts, der nur ohne sie gefaßt werden konnte. Das Wort ist weg, und der Ton der Empfindung tönet. Dunkles Gefühl übermannet uns: der Leichtsinnige grauset und zittert – nicht über Gedanken, sondern über Silben, über Töne der Kindheit, und es war Zauberkraft des Redners, des Dichters, uns wieder zum Kinde zu machen. Kein Bedacht, keine Überlegung, das bloße Naturgesetz lag zum Grunde: Ton der Empfindung soll das sympathetische Geschöpf in denselben Ton versetzen!
Wollen wir also diese unmittelbaren Laute der Empfindung Sprache nennen, so finde ich ihren Ursprung allerdings sehr natürlich. Er ist nicht bloß nicht übermenschlich, sondern offenbar tierisch: das Naturgesetz einer empfindsamen Maschine.
Aber ich kann nicht meine Verwunderung bergen, daß Philosophen, das ist Leute, die deutliche Begriffe suchen, je haben auf den Gedanken kommen können, aus diesem Geschrei der Empfindungen den Ursprung menschlicher Sprache zu erklären: denn ist diese nicht offenbar ganz etwas anders? Alle Tiere, bis auf den stummen Fisch, tönen ihre Empfindung: deswegen aber hat doch kein Tier, selbst nicht das vollkommenste, den geringsten, eigentlichen Anfang zu einer menschlichen Sprache. Man bilde und verfeinere und organisiere dies [17]Geschrei, wie man wolle; wenn kein Verstand dazukommt, diesen Ton mit Absicht zu brauchen, so sehe ich nicht, wie nach dem vorigen Naturgesetze je menschliche, willkürliche Sprache werde. Kinder sprechen Schälle der Empfindung, wie die Tiere; ist aber die Sprache, die sie von Menschen lernen, nicht ganz eine andre Sprache?
Der Abt Condillac* ist in dieser Anzahl. Entweder er hat das ganze Ding Sprache schon vor der ersten Seite seines Buchs erfunden vorausgesetzt, oder ich finde auf jeder Seite Dinge, die sich gar nicht in der Ordnung einer bildenden Sprache zutragen konnten. Er setzt zum Grunde seiner Hypothese »zwei Kinder in eine Wüste, ehe sie den Gebrauch irgendeines Zeichens kennen«. Warum er nun dies alles setze, »zwei Kinder«, die also umkommen oder Tiere werden müssen, »in eine Wüste«, wo sich die Schwürigkeit ihres Unterhalts und ihrer Erfindung noch vermehret, »vor dem Gebrauch jedes natürlichen Zeichens und gar vor aller Kenntnis desselben«, ohne welche doch kein Säugling nach wenigen Wochen seiner Geburt ist – warum, sage ich, in eine Hypothese, die dem Naturgange menschlicher Kenntnisse nachspüren soll, solche unnatürliche, sich widersprechende Data zum Grunde gelegt werden müssen, mag ihr Verfasser wissen; daß aber auf sie keine Erklärung des Ursprungs der Sprache gebauet sei, getraue ich mich zu erweisen. Seine beiden Kinder kommen ohne Kenntnis jedes Zeichens zusammen, und – siehe da! im ersten Augenblicke (§ 2) sind sie schon im gegenseitigen Kommerz. Und doch bloß durch dies gegenseitige Kommerz lernen sie erst, »mit dem Geschrei der Empfindungen die Gedanken zu verbinden, deren natürliche Zeichen jene sind«. Natürliche Zeichen der Empfindung durch das Kommerz lernen? Lernen, was für Gedanken damit zu verbinden sind? Und doch gleich im ersten Augenblick der Zusammenkunft, noch [18]