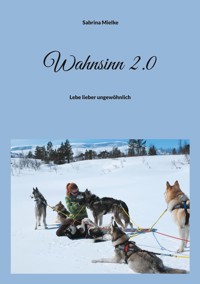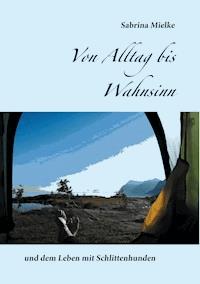
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch führt sie durch die Weiten Kanadas, Alaskas, Neuseelands, Australiens und zu guter Letzt auch noch durch Skandinavien. Humorvoll und mit einem zuweilen sarkastischen Blick auf mich und die Welt, beschreibe ich den Tag und seine Tücken. Man lernt, wie man die Stille und Weite der Landschaft atmet und dass es auch schön sein kann, wenn es einem tagelang in den Kaffee regnet. Vom Auswandern nach Norwegen und vom Anfang eines Traumes bis zu einem Leben mit vier Siberian Huskies und das alles mit einem Schuss Chaos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich wurde 1980 in Königs-Wusterhausen bei Berlin geboren, lernte Bootsbauer und Sozialhelfer. Doch arbeitete ich unter anderem auch schon in Norwegen und Kanada auf Huskykennels mit über 100 Hunden. Dort leitete ich als Guide Sommer- und Wintertouren in die Wildnis. Wenn ich nicht gerade mit meinen eigenen Huskies oder dem Rucksack unterwegs bin, male ich an fröhlich, farbigen Ölbildern. Momentan lebe ich mit meinen Hunden und meinem Mann in Norwegen, Hovden i Setesdal.
In Gedenken an meine Sharon, die kurz vor Fertigstellung dieses Buches gestorben ist.
Du hast mich so lange auf meinen Wegen begleitet, ich habe so viel von dir gelernt.
Run free and wild
Ich liebe dich
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Aller Anfang
Erster Eintrag ins Tagebuch
Kanada
Neuseeland
Australien
Winteraufenthalte im Yukon
Norwegen, die Erste
Zwischendurch
Skandinavien im Sommer
Winter in Schweden und Norwegen
Norwegen, die Zweite
Ende
Dank
Prolog
Wer bin ich und warum? Eine allseits beliebte Frage, deren Lösung so manch einem von uns Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte beschert. Aber eine Grundlage unseres Strebens.
Ich bin in Ostberlin groß geworden, als kleines schüchternes Mädchen, das dadurch so manche Prügel einsteckte. Damals als Kind ist es meist das größte Bestreben dazuzugehören, nicht anders zu sein! Aber ist dies erstrebenswert? Inzwischen weiß ich, okay, ich bin anders, irgendwie, und das ist auch vollkommen gut so. Wobei das auch immer eine Frage des Blickwinkels ist, was für einen anders ist.
Zurzeit lebe ich mit meinem Mann und vier Siberian Huskies in Norwegen und darf einen lieben Kreis „Anderer“ meine Freunde nennen. Welche, die genauso verrückt und durchgeknallt sind wie ich und meinen Lebenserhalt und Glück darstellen.
Meine Freunde sind auch die, die mich zu diesem Buch angeregt haben, das sie jetzt lesen können, oder müssen. Wie auch immer sie dazu gekommen sind. Wenn es passt, lesen sie es bis zu Ende, wenn nicht kann man es sicherlich gut als Brennmaterial oder auch wenn ein Stuhl kippelt benutzen. Oder schenken sie es an Freunde, die sie mögen oder auch nicht. Ganz wie sie es wollen.
Aller Anfang
Ich bin ein 1980 geborenes Kind, das die Maueröffnung 1989 von der Ostseite her miterlebte. In meiner Kindheit gab es weder Computer noch Handys. Das Telefon stand in der Mitte des Dorfes in Form einer großen gelben Telefonzelle. Da ich außerhalb Berlins im Wald wohnte, wuchs ich inmitten von Tieren und Bäumen auf. Wenn man mich suchte, fand man mich meist irgendwo auf einem Baum sitzend. Dies war dann mein Spielzimmer. Zudem segelte ich leidenschaftlich gern und werkelte schon früh an allem Möglichen herum, was wohl auch ziemlich typisch für den Osten war. Dies war natürlich die Grundlage später zum Berufswunsch eines Bootsbauers. Dazu musste ich aber einige Hürden nehmen. Zum einen, eine Firma zu finden, die bereit war, auch eine Frau anzustellen und dann, zum anderen, dass man in Monatsblöcken ins Internat musste.
Dies lag in Travemünde auf dem Priwall, was schon die meisten abschreckt. In meinem Fall aber bedeutete es, zwischen Automechanikern, Dachdeckern, Segelmachern und Bootsbauern als einziges Mädchen rumzuspringen. Ich kann nur dazu sagen: Das härtet ab. Nach dreieinhalb Jahren ist man nicht mehr allzu schnell aus der Fassung zu bringen. Wobei ein späterer Job da wohl noch locker einen drauf setzte. Denn da leitete ich für knapp sechs Jahre eine Bootsbau – Tischler- Werkstatt mit bis zu 50 Männern aus sozial benachteiligten Verhältnissen, wie man es „politisch korrekt“ nennt. Das heißt, ich stand da und musste Aufträge und Material beschaffen, Rechnungen und Berichte schreiben, Maschinen reparieren, die ich vorher nie von innen gesehen hatte, und mich um die bunte Truppe von 50 Männern aus allen Berufssparten kümmern, die oft eher das Hobby hatten, ihrem Gegenüber eine neue Gesichtsstruktur einzuprügeln. Hinzu kamen Drogen und Alkohol bei ihnen in Unmengen. Alles, womit ich bisher nichts zu tun hatte und nun als kleine blonde Frau quasi hineingeworfen wurde. Learning by Doing und das aber auf die harte Tour. Dort lernte ich mich wirklich zu behaupten und durchzusetzen. Wenn aber nach einer gewissen Zeit immer eine Struktur drin war, hatte es eine eigene Bewegung. Viele kamen zur Arbeit, weil es ein Stück Zuhause, eine Art Familie war, was sie vorher nie hatten. Schade war oft nur, dass meist alle ¾ Jahre eine neue Truppe als Maßnahme kam und man quasi wieder bei null anfangen musste. Und auch wenn es zurückblickend eine der härtesten Zeiten in meinem Leben war, möchte ich doch auch nicht einen Tag davon vermissen. Ich liebte meine Werkstatt und sorgte mich um „meine“ Jungs. So viel wie in dieser Zeit habe ich noch nie gelernt. Die Werkstatt musste leider geschlossen werden, nachdem das Gelände an einen neuen Besitzer ging und dieser Eigenanspruch stellte. Es brach mir das Herz. Bis heute müssen alle meine Freunde sich immer wieder die Geschichte anhören: „Damals in meiner Werkstatt...“
Zurück zu der Zeit in der Berufsschule. Nun muss man erwähnen, dass das Völkchen der Bootsbauer schon ein wenig außergewöhnlich ist. Was genau bedeutet, dass es viele von Ihnen für kurz oder lang ein wenig in die Welt hinauszog. Auch ich, begeisterter Leser von Reiseliteratur, in denen Menschen auf aller Art und Weise die Welt erkundeten, zog es hinaus. Natürlich zum Schrecken meiner Eltern.
In ihren Augen natürlich stand fest, dass ihr kleines Mädchen, die einmal um den Erdball herum wollte, mindestens von einem Tier wie Bär, Wolf, Krokodil oder Schlange gefressen würde. Weil natürlich ihr kleines Mädchen es auch noch vorzog, die gesamte Zeit im Zelt zu leben. 2000 war es dann soweit, der Rucksack war gepackt, Survival-Bücher nochmal verschlungen und ein großes Päckchen Flugtickets in der Hand.
Der grobe Trip bestand aus Kanada, Alaska, USA, Neuseeland, Australien, Singapur und zurück. Alles sehr große Länder, so dass ich nicht wie andere, viele Länder in meinen „Round the World Trip“ nahm, sondern stattdessen viel Zeit in die einzelnen Länder steckte.
Nicht dass ich danach irgendwie fertig war und brav in den Alltag zurückkehrte. Nein, danach war ich fertig, um nie wieder in ein sogenanntes „bürgerliches Leben“ zurückzukehren. Oder sollte ich „normales“ sagen? Aber dann haben wir ja wieder so eine Definitionssache aufgeworfen. Danach kehrte ich nach Kanada zurück und wurde endgültig vom sogenannten „Huskyvirus“ infiziert. Da aber die Immigration nach Kanada ein doch größeres Problem darstellt und es auch nicht gerade um die Ecke liegt, entschied ich mich später für Norwegen, wo ich ein Arbeitsangebot bekam. Was zwar schlussendlich erst im zweiten Anlauf nun für länger sein sollte, aber dazu später mehr.
Erster Eintrag ins Tagebuch
Auf den ersten beiden Seiten beginnt mein Tagebuch mit zwei Gedichten, die eine wunderbare Einleitung auf dieses Buch und mein Leben geben. Dies möchte ich ihnen nicht vorenthalten und sie ein wenig einstimmen.
Ist es das mit dem Traum und dem Traumland,
nicht etwas Neues zu finden, sondern etwas wiederzufinden.
Etwas was schon lange in einem schlummert.
In einer fast vergessenen Ecke der Seele.
Viele kamen, viele scheiterten,
aber ist es nicht besser zu scheitern,
anstatt zu bereuen, es niemals versucht zu haben,
seinen Traum zu verwirklichen, sein Traumland zu finden!?
Leider weiß ich nicht, wer dieses Gedicht verfasst hat. Aber ich denke, wir alle sollten versuchen, unser Traumland zu finden. Ich meine damit nicht unbedingt ein anderes Land. Es kann direkt vor unserer Haustür oder unserer Seele liegen...
Robert Service hingegen drückt für mich in „Zauber des Yukon“ mein persönliches Traumland aus. Auch dies muss für mich nicht unbedingt in Kanada liegen. Viele fragen mich, wo war es denn nun am Schönsten? Es kann für mich an einem stillen Tag auch einfach im Garten meiner Eltern sein, oder hier wo ich in Norwegen lebe. Die Stille, die Frieden mir bringt.
„Der Zauber des Yukon“
Ich kam, um Gold zu suchen,
ich wühlte im Dreck wie ein Sklave.
Ob Hunger oder Skorbut, ich bezwang es
und warf meine Jugend ins Grab.
Ich wollte das Gold und ich bekam es.
Im Herbst fand ich doch das Glück,
doch merkte ich, es ist nicht das Wahre.
Jetzt weiß ich, das Gold ist nicht alles.
Nein, es ist das Land,
hast du es gesehen?
So rau und spröde, wie ich´s nie anders sah.
Bewacht von gewaltigen Bergen
und Tälern, so still wie der Tod.
Dies unendlich weite Land dort,
die Wälder, in denen Ruhe ich fand,
die Schönheit erfüllt mich mit Staunen
und Stille, die Frieden mir bringt.
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie für sich, ihre persönliche heile Welt/ ihr Traumland finden und schützen. Und wenn Sie diese noch nicht gefunden haben, suchen Sie weiter, geben sie nicht auf und finden Sie den Platz, wo Sie Ruhe empfinden.
Kanada
Noch in Deutschland, als ich in den Flieger stieg, war ich mir noch nicht im Vollen und Ganzen meines Vorhabens bewusst. Als der Flieger aber zur Startbahn rollte, stellte sich ein eigenartiges Gefühl ein. Freude und Angst im selben Ausmaß. Ich wollte das hier alles, aber wusste ich wirklich was ich tat?
Der Flieger hob ab und ich lächelte. Ade Deutschland, willkommen Unbekanntes. Nach etlichen Stunden Flug setzte der Flieger in Toronto auf und spuckte mich auf die Straße. Da stand ich nun, alleine mit kaum Englisch im Gepäck.
Allein in der Ferne
Wo nun hin? Mein Zug ging erst am nächsten Morgen, so dass ich die Nacht hier verbringen musste. Doch sofort lernte ich die Freundlichkeit der Kanadier kennen, die mir ob mit Händen oder zeichnerisch immer wieder auf der Reise auf die Sprünge helfen sollten. So fand ich den Weg in ein Hostel und konnte den Nachmittag gemütlich durch Toronto schweifen. Den Weg dorthin nahm ich quasi schon fast als kleinen Stadtrundtrip wahr. Denn ich musste Bus, U-Bahn und Straßenbahn fahren und beschrieb damals die Strecke als unglaublich schön. An der Straße standen die farbenprächtigsten Häuser, eines schöner als das andere, für mich waren es schon halbe Paläste und alles typisch ohne Zaun. Eine Unglaublichkeit für deutsche Verhältnisse. Aber auch die Menschen bewegten sich so offen und freundlich, so unverschlossen. Überall wurde ich angesprochen, ob ich Hilfe bräuchte und wohin des Weges ich ging. In meinem Tagebuch erwähne ich immer wieder, dass die Menschen auf den Straßen einen alle anlächeln. Da ist man als Berliner doch verwirrt, dass es dies noch auf der Welt gibt. Ich fühlte mich ganz winzig klein und bin wohl die ganze Zeit mit offenem Mund durch die Straßen gefahren und gegangen. Schlagartig war ich auf meinen eigenen Beinen und würde in den nächsten Monaten lernen mit mir und der Welt eins zu sein.
Am nächsten Tag bestieg ich dann in den Zug, der die Gesamtstrecke von 4466 km quer durchs Land von Toronto nach Vancouver fuhr. Dabei durchfährt man die Provinzen Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta und Britisch Kolumbien. Man kann beliebig aus- und zusteigen und durchfährt eine atemberaubende Landschaft. Ich wollte jeden Moment davon in mich hineinsaugen, festhalten. Ich traute mich kaum, mal zu zwinkern, ich könnte ja was verpassen. Alles zieht so schnell an einem vorbei. Abends richtet einem das Zugpersonal ein kleines Himmelbettchen und man kann noch bis tief in die Nacht hinein im Liegen die Landschaft genießen. Nachdem in Ontario die Landschaft immer hügeliger und felsiger wurde, war Manitoba der volle Kontrast, denn, als wenn man einen Strich gezogen hätte, war in Manitoba alles flach. Ich hatte den Eindruck, es gab nur Felder und unendliche Ferne. Nichts versperrte den Blick. Ich war damals der Meinung, dass irgendeiner sich wohl als Strafarbeit hier hinstellen musste und die Landschaft glatt gebügelt hat. Der Abend senkte sich in einem unglaublichen Sonnenuntergang.
In Jasper
In Alberta veränderte sich die Landschaft wieder gewaltig, es begannen rechts und links riesige Berge in den Himmel zu wachsen. Die Spitzen waren schneebedeckt und die Gegend durchzogen von wilden Flüssen, Bächen und wunderschönen Seen, in einem Blau, Grün oder Türkis, das man so nicht wiedergeben kann. Die Dimensionen hauten mich einfach um. Die Wälder waren so riesig tief und grün, man konnte es nicht glauben.
Vancouver City
Vancouver, in Britisch Kolumbien, empfing mich, ganz seinem Ruf entsprechend, als Regenstadt mit Regen, viel Regen. Es goss wie aus Eimern.
Zum Glück beruhigte sich das Wetter zum nächsten Tag hin und ich brach auf in den Stanley Park. Er ist gut 400 Hektar groß und wird von 200 km Waldwegen durchzogen. Der Wald ist noch natürlich gewachsen und man hat noch zum Teil einen Primärwald. Durch Naturkatastrophen waren und sind die Waldbestände aber immer wieder gefährdet.
Früher war der Park noch eine Insel, die von den Ureinwohnern bewohnt wurde. Noch heute erinnern wundervolle, monumentale Totempfähle an die ursprünglichen Bewohner. Ich bin immer wieder von dieser fantastischen Schnitzkunst beeindruckt. Diese findet man vor allem bei den Indianern der amerikanischen Westküste, sie werden aus einem langen Baumstamm gefertigt. Bei der Errichtung der Pfähle wurde ein Potlach gefeiert, und die Stellung der Familie in der sozialen Hierarchie ihres Stammes wurde hierdurch bestätigt. Totempfähle werden in der Regel von unten nach oben gelesen und nur Familienmitglieder dürfen ihre Geschichte erzählen. Sie werden aus ganz unterschiedlichen Gründen errichtet. Sie erinnern an Verstorbene oder beherbergen deren gelegentlich sterbliche Überreste. Sie erzählen die Familiengeschichte und repräsentieren deren Stellung. Oft sind verschlüsselte mehrdeutige Botschaften in ihnen. Aber es gibt auch Pfähle, die den Eigentümer verspotten. Dies geschah beispielsweise dann, wenn der Auftraggeber den Pfahl nicht bezahlte oder Regeln verletzte. Es ist unglaublich schade, dass diese fantastischen Werke, wenn sie draußen stehen, meist nicht älter als 100 Jahre werden. Ich konnte mich an ihnen einfach nicht satt sehen.
Den nächsten Tag ging es dann für mich nach Horseshore Bay, was wundervoll am Wasser liegt, umgeben mal wieder von gewaltigen Bergen und Wald. Von dort nahm ich dann die Schaukelfähre nach Nanaimo, was auf Vancouver Island liegt. Zu Nanaimo schrieb ich damals gerade mal, dass der Name wohl das Interessanteste an dem Ort war. Das einzige was ich als sehr erleichternd empfand war, dass man hier nicht mehr die ganzen traurigen Menschen sah, die auf der Straße leben mussten. Man muss dazu sagen, dass ich nichts gegen die Randgruppen der Gesellschaft habe. Ich habe später selbst lange Zeit mit diesen gearbeitet. In Vancouver sammelte sich aber durch das doch recht milde Klima nur der größte Anteil an Obdachlosen des Landes und es bedrückte mich sehr, die zuweilen ganz alten Menschen oder auch in meinem Alter jungen Menschen auf der Straße sitzen zu sehen. Ich hatte oft das Gefühl, dass die Hälfte der Einwohner Vancouvers aus Obdachlosen bestand. Es war ein so großer Kontrast zu dem, dass ich in Deutschland erst gearbeitet hatte und mir nun finanziell diese Auszeit gönnen konnte. Wie behütet ich doch in einer Familie war, in gewisser Hinsicht. Viele Menschen fallen einfach durchs Raster und haben dann kaum mehr eine Chance jemals in das sogenannte „normale Leben“ wieder zurückzukehren.
Mein Weg führte mich nun die Küste entlang bis fast zur Spitze von Vancouver Island, bis nach Port Hardy. Die Insel ist über 450 km lang und rund 100 km breit, somit gut zu erschließen. Das Klima ist natürlich auch hier für kanadische Verhältnisse sehr mild, was an den Meeresströmungen liegt. Dafür ist man hier immer gut geduscht, womit ich natürlich die hohe Niederschlagsmenge im Jahr meine. Auch ich erlebte eine zwar schöne, aber sehr nasse Landschaft der Insel. In Port Hardy baute ich voller Freude im strömenden Regen mein Zelt auf. Eine Sache die man sich eigentlich nicht schön reden kann. Das Feuer danach im Regen und mit nassem Holz zu entfachen, erforderte einen gewissen Gleichmut, um nicht aufzugeben. Doch als es dann brannte, ich mein Essen fertig gekocht hatte und danach in Regenkleidung im strömenden Regen mein Süppchen verspeiste, fühlte ich mich wie die Königin der Welt. Es gibt kein vergleichbares Wohlgefühl, das beschreiben kann, was es heißt, im strömenden Regen zu stehen und eine heiße Suppe zu genießen, die einen wärmt und satt macht.
Rings um mich herum sprangen hunderte von Hasen, die sich wohl hier zur Plage entwickelt hatten. Trotzdem musste ich zugeben, dass ich es genoss, später aus meinem Zelt zu gucken und den kleinen Pelzknäulen beim Fressen und Putzen zuzuschauen. Amüsieren taten mich dann aber auch noch die Gesichter von den Insassen dreier vorbeifahrender Autos. Für die gab ich wohl einen erbärmlichen Eindruck ab. Die Wahrheit war allerdings, dass ich die Nacht dann doch recht zitternd verbrachte und mich in meinem Einmannzelt kaum bewegen konnte, da die Wände anfingen durchzuhängen und ich nicht gegen diese kommen durfte, um die Undichtigkeit zu vermindern.
Tags darauf erblickte ich dafür quasi als Entschädigung meinen ersten Schwarzbär aus der Ferne und lernte eine Frau kennen, die neun Kinder hatte. Sie gab mir eine Plastikplane für das Zelt, da sie Angst hatte, es würde irgendwann doch seinen Dienst quittieren und fuhr mich dann nach Downtown und auch wieder zurück. Um all dies hatte ich sie noch nicht einmal gebeten. Die Freundlichkeit, die mir auf meiner gesamten Reise immer wieder entgegen gebracht wurde, sollte mich immer wieder verwundern.
Über Tag gesellten sich dann noch ein Zelt und ein Wohnwagen zu mir, ein Pärchen aus Australien und ein Mann namens Rick. Er war derjenige, der uns dann überredete noch abends zu seiner Show zu kommen, da er Sänger und Gitarrist war. Den Abend beschrieb ich dann in meinem Tagebuch als recht lustig. Ich gebe ehrlich zu, ich habe nicht den geringsten Schimmer mehr von diesem Abend und das obwohl ich nicht einmal Alkohol trinke. Die Nacht war mal wieder kuschelig nass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Hatte ich erwähnt, dass wir inzwischen schon Mitte Juni hatten?!
Der Tag darauf wurde auch nicht wärmer und trockener.
Im Gegenteil, es kam noch ein ziemlicher Sturm hinzu. Dies sollte irgendwie, wie ich später mal reflektierte, bei all meinen Reisen zu 80% der Fall sein. Ich sollte lernen, den Regen mit einem gewissen Gleichmut zu betrachten. Zeit wird relativ, wenn man im Zelt sitzt und den Regen auf das Zeltdach tropfen hört, er lässt einen vergessen. Die Zeit, den Tag, gegessen wird wenn der Magen sich meldet. Nur wenn es in meinen Kaffee regnete, das ging ja nun mal gar nicht.
Einen gewissen Kaffeeservice durfte ich die Tage allerdings noch genießen, denn Rick der Musiker stellte mir ab und an einfach eine Tasse vor das Zelt. Nächsten Abend kamen dann noch welche mit ihrem Camper und machten spontan eine Grillparty für alle. Was soll ich sagen, alle die mit Rucksack und Zelt durch die Welt ziehen verlieren meist erheblich an Gewicht. Ich kam nach meiner Reise mit mehr Gewicht nach Hause als ich je gewogen hatte. Was in dem Fall, da ich stark untergewichtig war, durchaus etwas Gutes hatte. Ich lernte Essen ganz anders wertzuschätzen. Kannte ich vorher Hunger und Gelüste eigentlich nicht, taten sich irgendwann auf der Reise so manche Visionen auf. Vorne weg, als ich nach der Reise wiederkam, fand ich in meiner Küche den Fußboden voll mit Essen, das mir meine Eltern gekauft hatten. Lauter Leckereien. Ich musste wohl in meinen Karten nach Hause unbewusst viel über das Essen geschrieben haben.
Port Hardy
Nach einem also recht gehaltvollen Abendbrot bei der Grillparty, ging es den Tag darauf in den Flieger nach Vancouver und dann hoch in mein geliebtes Whitehorse. Der Flieger hatte nur zwölf Plätze und man konnte den beiden jungen Piloten über die Schulter schauen. In Whitehorse nahm mich mal wieder eine liebe Frau vom Flughafen mit nach Downtown. Ich nahm dann für eine Nacht ein Bett in einem Hotel in Anspruch und genoss eine ausgiebige heiße Dusche. Mann, kann das die Lebensgeister wecken! Danach gestaltete ich das Zimmer zu einem Trockenraum um. Gut, dass davon das Hotelpersonal nichts mitbekam.
Nach meiner Trocknungsorgie schlenderte ich am nächsten Tag das Ufer des Yukons entlang und traf dort einen alten Mann, der sein Kanu belud. Er nahm mich einfach spontan mit auf einen Tagestrip. Wir machten vier Stopps und gingen die Gegend erkunden. Ungewohnt war jedoch für mich das Tragen einer Flinte. Mann, ist so ein Ding scheiß schwer!
Der Blick über den Yukon
Aber wir entdeckten allerlei. Von frischen Bärenspuren bis zu Bibern. Auch zeigte er mir einen besonders großen Biberdamm. Ich war jedenfalls ganz schön fertig nach dem langen Tag mit so vielen neuen Eindrücken und der neuen körperlichen Belastung. Am Ende lud er mich in einem Golfclub zum Essen ein und organisierte für mich die Rückfahrt bei einem Pärchen im Auto. Alles war so selbstverständlich und unkompliziert. Ich konnte mich erst mal nicht daran gewöhnen. Der alte Mann hingegen zog seines Weges, mit dem Kanu weiter den Yukon hinunter. Ich habe ihn nie mehr wieder gesehen. Zurück an meinem Zelt, das ich glücklicherweise zuvor aufgebaut hatte, dachte ich noch lange darüber nach, wie oft sich die Menschen doch ihr Leben selbst verkomplizieren. Alles ist beschleunigt worden, in sogenannte Normen gestopft worden, so dass die wenigsten noch über den Tellerrand gucken. Wohl auch aus Angst, erschreckt zu werden. Am Morgen ging es dann für mich auf eine kleine Runde zum Schwatka Lake. Es war unglaublich ruhig und still hier, ich konnte am Steilhang sitzen und einfach nur gucken und mich stundenlang über die spielenden Möwen amüsieren.
Sie flogen hoch in die Lüfte und ließen sich dann einfach fallen und platschten in die Strömung. Dort kringelten sie sich eine Weile, um sich dann wieder in die Lüfte zu begeben und dasselbe Spiel wieder zu veranstalten.
Vom Schwatka Lake aus bin ich auch in zwei Tagesmärschen über Miles Canyon rüber auf die andere Seite des Sees. Die Strecke war zwar lang und mühsam, aber man wurde von fantastischen Aussichten belohnt. Am anderen Ufer angekommen, kippte ich zugegeben erst mal tot um. Ich war zwar langsam nach fast einem Monat den Rucksack gewöhnt, aber man kann sich bequemeres vorstellen. Die Sonnenstrahlen und die Umgebung brachten mich dann doch schnell wieder auf die Beine und ich machte ein Feuer, um mir wieder einmal ein Süppchen zu kochen. Auch dies wurde inzwischen so sehr zur Routine, dass das ganz schnell ging und ich zufrieden meine Erbsensuppe löffelte.
In genau diesem Moment der Einfachheit, sitzend auf meiner Isomatte, löffelnd meine Erbsensuppe essend, konnte ich mir kein besseres Leben vorstellen. Ich war soweit. Ich war angekommen in der Natur, ihrer Stille und Ruhe und dem Frieden, den sie einem schenkt. Ich war da, ich lebte, ich atmete die Luft in vollen Zügen.
In dieser Nacht lag ich nur auf der Isomatte im Schlafsack draußen und beobachtete die halbe Nacht die Biber beim Spielen. Tags darauf wurde mir die Tour allerdings irgendwann lang. Da ich kein Essen mehr hatte, hing mir der Magen in den Kniekehlen. Als ich zurück in Whitehorse war, verschlang ich in der Grizzly Bar einen riesigen Burger und machte danach Großshopping im Supermarkt und fand mich im Park sitzend, Karamellbonbons in mich hineinstopfend, wieder und das, bis ich nahe am Platzen war. Gestärkt konnte ich mich dann an so Alltäglichkeiten wie das Waschen meiner Wäsche machen. Zugegeben zwar sehr übersichtlich mit zwei Hosen, zwei Shirts, zwei Pullovern und einer Handvoll Socken und Schlüpfern, aber ein Problem, wenn man es gerade neben dem Zelt aufgehangen hat und es ausgerechnet dann mal wieder anfangen muss zu regnen. Ist ja mal wieder typisch. Trotz allem steht in meinem Tagebuch dazu der Eintrag: „Ach ja, aber dies alles ist Leben. Selbst meinem Hals geht es besser, ich werde sogar langsam braun und es geht mir einfach gut. Ich lebe in meinem eigenen Rhythmus. Und ich habe mich schon längst an dieses Leben gewöhnt. Ich habe aus dem Yukon getrunken.“
Zur Erklärung: Es gibt einen Aberglauben in Whitehorse, dieser besagt, wer einmal aus dem Yukon getrunken hat, der will immer wieder von ihm trinken! Zu dem Zeitpunkt, knapp einen Monat nach meinem Start in Deutschland, genau gesagt nach 21 Tagen, schmiedete ich schon Pläne für den Aufenthalt im nächsten Winter hier im Yukon. Ich war infiziert.
Nach einer mal wieder saukalten Nacht, in der ich des Öfteren eine Showeinlage lieferte, indem ich um mein Zelt hüpfte, ging ich eine Runde spazieren und traf, wie ich es damals formulierte, einen komischen, interessanten Typen, der auch zeltete. Er kochte sich gerade eine heiße Schokolade und lud mich dazu ein. Ich kann nur sagen, der Himmel. Es stellte sich heraus, dass er aus der Schweiz kam, so hatten wir zumindest keine Verständigungsprobleme. Danach, so steht es ebenfalls in meinem Tagebuch, wurde es ein sehr komischer Tag. Wir verbrachten irgendwie den Tag zusammen, saßen da und unterhielten uns über Gott und die Welt.
Er selbst sah sehr indianisch aus, mit seinen langen Haaren und dem restlichen Erscheinungsbild. Was mich irritierte waren seine blauen Augen, die aber wie die einer Katze wirkten. Das machte das Ganze schon wieder ein wenig gruselig. Zudem gab er sich spirituell und glaubte an Geister, die durch seinen Körper strömen. Diese, so glaubte er, könne er auch einsetzen und so durch Handauflegen heilen. Auch könne er aus Augen Gedanken lesen. Dies war jedenfalls schon ein wenig schräg. Er betreibt in Deutschland auch einen Laden mit indianischen und spirituellen Sachen, aber reist immer wieder Monate lang durch alle möglichen Länder. Ein durch aus nicht unbedingt schlechtes Leben. Auch den nächsten Tag verbrachten wir noch mit Reden. Auch wenn ich nicht an diese Sachen glaubte, fragte ich mich doch, ob es in gewisser Weise möglich sei Gedanken zu lesen und fand den Gedanken nicht unbedingt beruhigend. Waren meine Gedanken inzwischen so sortiert, dass es kein Problem wäre, wenn sie doch jemand lesen würde? Ich hatte die Reise ja zu diesem Grund angetreten. Mich zu sortieren, Vergangenes zu begraben und zu mir selbst zu finden, beziehungsweise meinen Weg zu finden. Auf diesem Weg war ich auf alle Fälle, denn es ging mir immer besser, ich schloss Stück für Stück Frieden mit mir selbst.
Ich erinnerte mich an ein Buch, das ich zuhause gelesen hatte. Dort war ein Pärchen aufgebrochen zu einer kleinen Reise, die schlussendlich 16 Jahre dauerte. Der Mann sprach davon, dass er irgendwann seinen inneren Indianer gefunden hat, der ihn auf dem richtigen Weg hielt und ihn vor Gefahren warnte. Auch Toni hier erzählte von seinem inneren Indianer. Ich denke, dass zumindest ein Teil davon war ist. Wir haben in unserer schnellen, industriellen Welt vieles eher verkompliziert. Wir sind von allem möglichen abgelenkt, es ist laut, bunt und schrill. So haben wir verlernt, auf unsere innere Stimme zu hören. Diese kann man auch einfach in gewisser Weise Instinkt nennen. Denn grundsätzlich sind wir alle damit geboren worden.
Mir wurde bewusst, dass ich nie mehr wirklich in diese Welt zurückkehren konnte, ich würde nie mehr so sehen wie früher.
Ein Monat ist um und mal wieder gibt es Dauerregen und kuschelige Temperaturen um den Gefrierpunkt. Wir haben den 30. Juni!!! Und ich eine Sinnkrise... Nein, mir war nur oft traurig zumute, dass ich nie einem meiner Freunde oder meiner Familie all diese Schönheit zeigen könnte, die Einfachheit des Seins, die Stille. Ich stand an einem See und niemand war da, ich hätte schreien, heulen oder sonst ein Zirkus veranstalten können, niemand hätte es gehört. Es war traurig, komisch, lustig, ein wenig beängstigend und schön zu gleich. Halt irgendwie verwirrend. Anders kann man es nicht formulieren. Es war die absolute Freiheit.