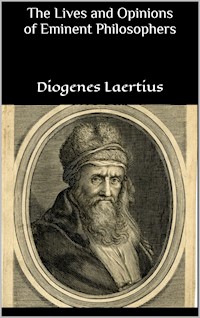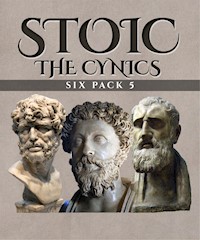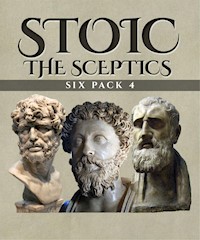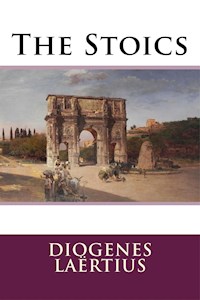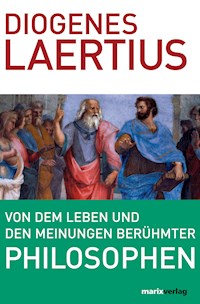
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marix Verlag ein Imprint von Verlagshaus Römerweg
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die Berichte über das Leben von 62 antiken Philosophen, wurden etwa 220 n.Chr. verfasst. Die Darstellungen des Diogenes Laertius, einem spätantiken Philosophiehistoriker, der im 3. Jahrhundert n.Chr. lebte, bieten neben den philosophischen Positionen Lebensbeschreibungen der antiken Philosophen und Denker - von Anaximander über Demokrit bis zu Epikur - und stellen damit ein wichtiges und viel diskutiertes philosophiehistorisches Dokument dar. Diogenes gliedert seine Viten in Nachrichten über Herkunft, Lebenslauf, Charakter, Werke und Briefe, schließlich Testament und Todesumstände jedes Denkers und würzt seine Darstellung mit unterhaltsamen Anekdoten. Diogenes' Werk ist die umfangreichste erhaltene Quelle zur Philosophiegeschichte der Antike. Epochales Meisterwerk der antiken Philosophiegeschichte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 868
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cover
Über den Autor
Über den Autor
AUGUST CHRISTIAN B. BORHECK (1751–1816) war Philologe und Historiker und arbeitete zunächst als Lehrer und Gymnasialrektor. Später wurde er zum Professor der Beredsamkeit und Geschichte an der Universität Duisburg ernannt. Er übersetzte u.a. die Briefe Ciceros (1792 ff., 5 Bde.) und die Schriften Xenophons (1778–1808, 6 Bde.).
Zum Buch
Zum Buch
EPOCHALES MEISTERWERK DER ANTIKEN PHILOSOPHIEGESCHICHTE
Die Berichte des Diogenes Laertius über das Leben der großen antiken Philosophen, bieten neben den philosophischen Positionen Lebensbeschreibungen antiker Philosophen und Denker – von Anaximander über Demokrit bis zu Epikur – und stellen damit ein wichtiges philosophiehistorisches Dokument dar. Diogenes gliedert seine Viten in Nachrichten über Herkunft, Lebenslauf, Charakter, Werke und Briefe, schließlich Testament und Todesumstände jedes Denkers und würzt seine Darstellung mit unterhaltsamen Anekdoten. Diogenes’ Werk ist die umfangreichste erhaltene philosophiegeschichtliche Schrift des Altertums und damit eine wichtige Quelle zur Philosophiegeschichte der Antike.
Über das Leben des griechischen Philosophen Diogenes Laertius ist wenig bekannt. Er lebte Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. und war ein spätantiker Philosophiehistoriker, der um 220 das Werk »Von dem Leben und den Meinungen berühmter Philosophen« in zehn Büchern schrieb. Diese griechische Philosophiegeschichte ist kein wissenschaftliches Werk – sein kompendienhafter Charakter weist vielmehr darauf hin, dass Diogenes seine zahlreichen gesammelten biographischen Nachrichten, anekdotenhaften Geschichten und sentenzartigen Meinungsäußerungen unterhaltsam präsentieren wollte.
Haupttitel
Diogenes Laertius
Von dem Leben und den Meinungen berühmter Philosophen
Aus dem Griechischen von Dr. L. Aug. Borheck
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten Copyright © by marixverlag GmbH, Wiesbaden 2011 Der Text wurde behutsam revidiert nach der zweibändigen Ausgabe Franz Haas, Wien und Prag 1807 Lektorat: Dr. Lenelotte Möller, Speyer Covergestaltung: Nele Schütz Design, München Bildnachweis: akg-images GmbH, Berlin Korrekturen: Christine Klinger, Usingen eBook-Bearbeitung: Medienservice Feiß, Burgwitz Gesetzt in der Palatino Ind Uni – untersteht der GPL v2 ISBN: 978-3-8438-0018-1 www.marixverlag.deERSTER BAND
Einleitung des Übersetzers
Diese Übersetzung des Diogenes Laertius übernahm ich auf die Bitte des Herrn Buchhändlers Haas in Wien für seine Sammlung der verdeutschten Griechen. Ich habe bei derselben die Ausgabe Heinrich Stephans 1593 in Oktav, die Ausgabe von Ägidius Menage, London 1663 in Folio und die Ausgabe von Longolius, Chur im Vogtlande 1739 in 2 Bänden in Oktav gebraucht. Die Wettsteinsche Ausgabe in 2 Quartbänden zu Amsterdam 1693 konnte ich nicht erhalten. Alle drei Ausgaben, die ich besitze, sind sehr fehlerhaft und äußerst nachlässig abgedruckt, überhaupt ist auch Diogenes’ Text noch nicht mit gehöriger Kritik bearbeitet. Herr Professor Buhle, Philologe und Philosoph zugleich, wie er an seinem Aristoteles gezeigt hat, wäre der Mann zu diesem Geschäft! Mir scheint es mehr als wahrscheinlich, dass wir den echten Diogenes nicht, sondern nur Auszüge aus seinem Werke, und auch diese wieder von Einschüben verfälscht, besitzen, die sich oft leicht entdecken lassen. Ein Geschichtsschreiber der Philosophen kann unmöglich so wenig Philosoph gewesen sein, als man den Verfasser unseres jetzigen Diogenes fast überall findet. Stil hat er auch gar nicht. Als Übersetzer musste ich mein Original so treu als möglich mit allen seinen Fehlern übertragen. Ich musste den Philosophen die Meinungen wieder beilegen, die er ihnen beilegt, ihre Systeme wieder so darstellen, wie er sie dargestellt hat. Wo im Diogenes Mangel an Deutlichkeit und Zusammenhang ist, da blieb dieser auch in der Übersetzung sichtbar: denn ich blieb möglichst genau bei seinem Ausdruck, nur bei den häufig eingerückten Versen erlaubte ich mir eine freiere Übersetzung, um sie wieder in Versen zu verdeutschen. Anmerkungen habe ich nicht hinzugesetzt, außer an einzelnen wenigen Stellen, denn wollte ich überall Anmerkungen machen, wo sie zur Berichtigung des griechischen Textes, oder der Meinungen der Philosophen, oder der Diogenischen Darstellung derselben hätten gemacht werden können, so möchten diese wohl eben so stark als der Text selbst geworden sein. Ich werde daher alles, was ein deutscher Leser Diogenes’ erwarten könnte, in das erklärende Register zusammenstellen, das den letzten Band ausmachen und auch einige kleine Versuche zur Berichtigung des Diogenischen Textes enthalten wird. Eine kurze Einleitung von Diogenes Laertius, seinen Schriften und Ausgaben, habe ich aus der Longolischen Ausgabe vorgesetzt, und aus der angeführten zweiten Stephanischen Ausgabe, die Bruchstücke der Pythagoräer und die kleine Schrift des Hesychius Illustrius von berühmten Gelehrten; und aus der Menageschen Ausgabe eines Ungenannten Leben Aristoteles’, und Olympiodors Leben Platons im Anhang hinzugefügt. Deutsche Übersetzungen sind mir außer der Goldhagenschen vom Leben Xenophons, die sich bei dessen Übersetzung der Griechischen Geschichte Xenophons befindet, nicht bekannt, ich konnte also keinen Vorgänger benutzen. Meine Verdeutschung würde auch minder genau ausgefallen sein, wenn nicht mein schätzbarer Freund, unser gelehrter Herr Professor der Philosophie und Kanonikus Dahmen, mich dabei unterstützt, und meine Handschrift vor ihrer Absendung nach Wien erst durchgesehen und verbessert hätte, wofür ich demselben hier öffentlich aufs Verpflichtetste danke.
Köln am Rhein, am 1. Brumaire des 13ten Jahres der französischen Zeitrechnung.
Dr. A. Chr. Borheck
Nachricht von Diogenes Laertius, dessen Schriften und ihren Ausgaben
Diogenes Laertius ist in Ansehung seiner Herkunft und Abstammung ganz unbekannt. Man kennt weder seinen Vater und seine Mutter, noch seine Familie und sein Vaterland. Es lässt sich auch nicht mit Gewissheit angeben, woher er den Namen Laertius hat, und die Vermutungen der Gelehrten darüber weichen sehr von einander ab. Mir scheint die Heumannische noch die wahrscheinlichste, dass der Ursprung des Namens ein Städtchen Laerte gewesen, wovon einer der Vorfahren unsers Diogenes bekannt worden, welcher Name, so wie der Name Vitellius von der Stadt Vitellia, und Egnatius von Egnatia, hernach auf die Nachkommen desselben fortgeerbt worden. Es war also in der Folge ein Familienname, so wie wir einen Quintus Laertius in den Inschriften bei [Ianus] Gruter, S. CCC. und einen Caius Laertius Sabininanus bei Fabretti S. 251 finden. Diese Vermutung scheint auch die Ordnung der Namen, Laertius Diogenes, in den meisten Handschriften von Diogenes, und bei Hesychius und Phorius zu bestätigen.
Die Zeit, in welcher unser Diogenes Laertius gelebt hat, ist ebenfalls ungewiss, nur soviel ist gewiss, dass er nach der christlichen Zeitrechnung gelebt hat, denn er erwähnt Epiktets und Plutarchs, die um Trajans Zeiten lebten, Favorins, der unter Trajan und Adrian, des Sophisten Sabins, der unter Adrian, und des Empirikers Sextus, der unter Commodus lebte. Er muss also später als diese gelebt haben. Da nun Stephanus, oder vielmehr Hermolaus von den Städten, und Hesych von Milet sich auf Laertius beziehen, auch Sopater nach Photius Cod. CLXI. sein sechstes Buch aus dem 1., 5., 9. und 10. Buche Diogenes’ zusammengestoppelt hat, so behauptet Jonsius, dass unser Laertius vor Konstantins des Großen Zeiten, wo Sopater lebte, oder vor Justinians Zeiten, da die andern lebten, gelebt habe. Lipsius, Bossius und andere setzen ihn in Markus Antonins Zeiten, und auch Menage glaubt, er könne nicht nach demselben gelebt haben, da er dieses Kaisers, der ein Stoiker war, und über stoische Philosophie in griechischer Sprache schrieb, bei der Sekte der Stoiker sonst erwähnt haben würde. Indes dies beweist nichts, denn er gedenkt mehrerer älterer Philosophen, wie des Peripatetikers Kratipp, und des Stoikers Seneca ebenfalls nicht, vor deren Zeiten er gewiss nicht gelebt hat. Reinesius will unsern Laetius in Galens Zeiten setzen, weil die von Galen erwähnte Arria das gelehrte Frauenzimmer sei, an welche Diogenes Laertius dieses sein Werk gerichtet hat, wie wir im 3. und 10. Buche desselben sehen. Hierin tritt Menage dem Reinesius bei, und auch Fabricius hält diese Vermutung für glücklich. Allein diese Arria kann das Frauenzimmer nicht sein, weil Laertius viel jünger als sie war, wie Brucker gezeigt hat. Jonsius sucht daher auf alle Art zu erweisen, dass Diogenes zu Severs Zeiten gelebt habe. Ihm folgen Olearius, Fabricius Heumann und vor ihm schon Casaubon, sie suchen aus der Anführung Potamons, der zu und nach Alexander Severs Zeiten gelebt, zu erweisen, dass Laertius um die Mitte des dritten christlichen Jahrhunderts gelebt habe. Dodwell und Gesner setzen ihn in Konstantins des Großen Zeitalter. Schwerlich lässt sich etwas Gewisses darüber bestimmen.
Der Verfasser des Lebens unseres Laertius vor der Englischen Übersetzung will aus dem, was derselbe von Potamon sagt, folgern, dass er ein Anhänger Potamons in der Philosophie gewesen sei. Allein dies kann daraus nicht hergeleitet werden, denn Laertius führt Potamons Meinung nicht mit ihrer Billigung an, und Potamons Gedanke war auch nicht, keiner Sekte zu folgen, sondern von jeder das Gewisse anzunehmen, und so eine neue Sekte zu stiften, die aber ohne Namen und Beifall geblieben ist, weil es Potamons Schriften an Geist zu fehlen schien, wie Isaak Casaubon zum Dio Chrysostom bemerkt hat. Mehrere haben unseren Diogen für einen Epikureer gehalten, wie Isaak Casaubon, Menage, Samuel Parker. Bossius legt ihm einen Hang zur Epikureischen Sekte bei. Heumann erkennt seinen besonderen Fleiß in seinen Nachrichten von Epikur und der Epikureischen Philosophie an, aber er hält dies noch für keinen Beweis, dass er ein Anhänger dieser Sekte gewesen sei, denn man findet eben diesen Fleiß bei seinen Nachrichten von Platon und den Platonikern, von Pyrrhon und den Skeptikern. Er scheint keiner Sekte zugetan, und gar kein Philosoph gewesen zu sein, sondern bloß ein Sammler der Nachrichten von den Lebensumständen, Schriften und Meinungen der Philosophen, von denen er die lobte, wobei er etwas Gutes zu finden glaubte. Ebensowenig lässt sich aus der Stelle im fünften Buche, wo er von Aristoteles sagt, er habe einem bösen Menschen ein Almosen gegeben, schließen, dass Diogenes ein Christ gewesen sei, weil dieses aus dem Neuen Testamente entlehnt sein soll. Fabricius hat die Grundlosigkeit dieser Erklärung schon gezeigt.
Seine Schriften sind folgende, die er selbst anführt:
1. Yammetros, ein Inschriften-Buch in verschiedenen Versarten auf berühmte Männer. Dies führt er sehr häufig an, und rückt Verse daraus ein. Das ganze Buch ist verloren, und dieser Verlust in Rücksicht auf Poesie gewiss nicht groß, wie die noch daraus vorhandenen Verse zeigen. Es kommen auch Epigramme von ihm in der Anthologie des Maximus Planudes, und in Joan-nes Tzetzes Chiliaden vor, die vielleicht aus diesem Pammetros sind.
2. Zehn Bücher von dem Leben, den Meinungen und Denksprüchen berühmter Philosophen, die noch vorhanden sind. Vor diesem Werke scheint sich eine Zuschrift an ein gelehrtes Frauenzimmer, das er im dritten und zehnten Buch anredet, befunden zu haben, die verloren gegangen ist, wie Menage, Fabricius und Heumann schon bemerkt haben. Menage hat in seinen Anmerkungen schon den Gedanken geäußert, dass sich sehr viele unechte Einschübe in diesem Werke finden, die nicht von Diogenes sind, und dass der Stil desselben ganz ungebildet sei. Auch Bayle beschuldigt ihn der Ungenauigkeit, Dunkelheit und Zweideutigkeit. Sein Übersetzer Ambrosius, Hieronymus Froben in der Vorrede, Casaubon in der Vorrede, und Barthol. Kekermann bemerken, dass Laertius mehr Fleiß aufs Sammeln, als auf die Verarbeitung und Anordnung seiner Sammlungen verwandt habe, und dass es ihm oft an richtiger Beurteilung fehle. Auf gleiche Art urteilen von ihm Lipsius, Parker, Stanley, Stoll. Ich habe meine Gedanken über diese Schrift in der Vorrede gesagt, worauf ich mich hier beziehe.
Ich komme nun auf die Ausgaben und Übersetzungen unseres Diogenes Laertius.
Eine lateinische Übersetzung Diogens erschien zuerst von dem Kamaldulenser Mönch und nachherigen General seines Ordens, Ambrosius Civenius, der Franz Philelphus ersuchte, die im Laertius vorkommenden Verse wieder in Lateinische Verse zu übertragen. Philelph aber tat dies aus Neid lange Zeit nicht, obgleich er es in einem Briefe heilig versprach, und sie wurden erst nach Ambrosius’ Tode in die Brognolische Ausgabe der Übersetzung desselben eingerückt. Ob sich gleich diese Ambrosische Übersetzung durch ihre Simplizität empfiehlt, so hat Ambrosius doch in vielen Stellen den Sinn des Laertius verfehlt, und einige ganz ausgelassen, ja nach Menagens Urteil hat er sich bei seiner Übersetzung solche Freiheiten genommen, dass man sie eher eine Geschichte der Philosophen nach Laertius, als eine Übersetzung desselben nennen könnte. Philelph verdammt auch diese Ambrosische Übersetzung als schlecht, und voller Irrtümer. Nach Ambrosius’ Tode hat sie Benedikt Brognoli durchgesehen und sie in Venedig durch Nikol. Jenson im Jahr 1475 in Quart und schöner Schrift abdrucken lassen, welche Ausgabe nachher oft nachgedruckt worden ist, so in Nürnberg 1476 und 1479. Ohne Angabe des Jahrs druckte sie auch Jean Petit in Paris in Quart, dessen Abdruck aber sich durch nichts empfiehlt; doch befindet sich in derselben der Brief des Ambrosius an Brognoli, welchen auch Stephanus in seinen Ausgaben wieder hat abdrucken lassen, mit verschiedenen Proben Brugnolischer Verbesserungen. Sie kam auch zu Basel bei Valentin Curio 1524 in Quart heraus, in welcher Ausgabe Konrad Heresbach nach Vergleichung einer griechischen Handschrift des Matthäus Aurogallus einiges verbessert, besonders die Epigramme, und einige von Ambrosius und Brognoli ausgelassene Verse lateinisch übersetzt und griechisch beigefügt hat. In der Folge kam Laertius wieder lateinisch heraus, zu Köln 1542 in Oktav, zu Leiden 1546 in Oktav und bei Sebastian Gryphius 1559, 1583 in Duodez, in Paris 1585 in Duodez. Bei Plantin zu Antwerpen wurde sie 1566 in Oktav, von Johann Sambuk von Tirnau und Fulvius Ursin neu durchgesehen, gedruckt; wie auch zu Lyon 1592 in Duodez bei Anton Gryphius und zu Leiden in der Plantinschen Druckerei bei Fr. Rapheleng 1596 in Duodez, nach der Sambukischen verbesserten Ausgabe, und bei Jakob Chouet 1595 in Duodez.
Griechisch wurde der ganze Diogenes Laertius zuerst in Basel in der Druckerei Hieronymus Frobens und Nikol. Episkopius im Jahr 1533 in Quart gedruckt, nach einer Handschrift des Matthäus Aurogallus, die schon Valentin Curio bei seiner lateinischen Ausgabe gebraucht hatte. Vorher waren schon die Leben Aristoteles’ und Theophrasts in der Aldinischen Ausgabe der Werke Aristoteles’ zu Venedig 1495 in Folio und in der Aldinischen Ausgabe Theophrasts bei von den Steinen zu Venedig 1497 griechisch abgedruckt, so wie man seitdem auch die Leben aus Laertius den Ausgaben der Werke Platons, Xenophons und anderer vorgesetzt hat; aber der ganze Laertius war vor der angeführten Frobenischen Ausgabe von 1533 noch nicht griechisch gedruckt. Die Ausgabe von 1531 ist ein Irrtum.
Die erste griechisch-lateinische Ausgabe des Laertius ist die Heinrich Stephanische 1570 in Oktav. Sie enthält am Schluss die Ambrosische Übersetzung, Heinr. Stephans Verbesserungen und die Fragmente der Pythagoräer aus Stobäus in griechischer Sprache. Die zweite Heinrich Stephanische Ausgabe erschien 1593 in Oktav mit seinen Castigazionen und der Brugolischen Rezension der Ambrosischen Übersetzung und den Fragmenten der Pythagoräer. Die Ambrosische Übersetzung aber steht zur Seite des griechischen, und Isaak Casaubons gelehrte Anmerkungen über Laertius, die zuerst einzeln unter dem Namen Isaak Hertibons 1583 in Oktav erschienen waren, sind hier vermehrt und verbessert. Sie enthält auch Hesychius Illustrius’ Leben der Philosophen. Die dritte Ausgabe mit Heinrich Stephans und Isaak Casaubons Noten, den Fragmenten der Pythagoräer, dem Hesychius Illustrius, und Adrian Junius’ Übersetzung mit dessen und Heinrich Stephans Castigazionen, erschien in Genf 1615 in Oktav bei Johann Vignon, Jakob Stoer, Peter und Jakob Chouet, und Samuel Crispin. In einigen Exemplaren befindet sich auch noch Eunapius’ Leben der Sophisten griechisch mit Junius’ Übersetzung, und wird auch auf dem Titel erwähnt, in anderen aber ist dies nicht befindlich, und auch auf dem Titel nicht erwähnt.
Eine vierte griechisch-lateinische Ausgabe mit Thomas Aldrobandins Übersetzung und dessen gelehrten Anmerkungen, die aber nicht über Leukipps Leben im neunten Buche hinausgehen, weil der Verfasser vor der Vollendung seiner Arbeit gestorben, erschien zu Rom, bei Aloys Zanneti 1594 in Folio. Der Herausgeber war der Kardinal Peter Aldrobandin, der Oheim des Übersetzers. Sie enthält auch den griechischen Text nach alten Handschriften, besonders einer Farnesischen, sehr verbessert. Aldrobandins Übersetzung ist elegant und mit Fleiß gearbeitet, und würde vollkommener sein, wenn er die letzte Hand hätte daran legen können.
Die fünfte griechisch-lateinische Ausgabe erschien nicht zu Leiden, wie in den Brandenburgischen Pandekten unter Aldrobandin steht, und auch nicht, wie Lipen schreibt, zu Haag 1656 in Quart mit Heinr. Stephans, Isaak Casaubons, Thom. Aldrobandins und Gassendis Noten; sondern in London 1663 in Folio. In dieser ist die römische Ausgabe mit Aldrobandins Übersetzung und Noten wiederholt, zu welchen Ägidius Menagens gelehrte Kommentare und ein Register der von Laertius angeführten Schriften hinzugekommen. Menage gebrauchte außer der Florentinischen drei Pariser Königliche Handschriften, ließ seine Kommentare auf seine Kosten in Paris bei Edmund Martin 1662 in Oktav abdrucken, und schickte sie so zum neuen Abdruck Johann Pearson in London zu. Diese Menageschen Kommentare sind bis jetzt die besten über Diogenes. Ferner befinden sich in dieser Londoner Ausgabe noch die Anmerkungen Isaak Casaubons und dessen Sohnes Mericus Casaubons, in welchem unter anderen Olympiodors Leben Platons mit Jakob Vindets Übersetzung und Anmerkungen eingerückt ist. Menage hat auch in seine Kommentare ein noch nicht gedruckt gewesenes Leben Aristoteles eingerückt und erläutert. Schade, dass das Äußere dieser Ausgabe, die ich vor mir liegen habe, dem Inneren nicht entspricht; (bei englischen Ausgaben ein seltener Fall!) und dass sie sehr viele Druckfehler in Text und der Interpunktion hat. Menage schrieb in den Jahren 1679 und 1680 an den Leipziger Senator Friedrich Benedikt Carpzov, dass seine Pariser Ausgabe des Laertius durch den großen Londoner Brand zu einer äußersten Seltenheit geworden sei, und dass er sich mit einer neuen, sehr verbesserten und vermehrten beschäftige.
Die sechste Ausgabe, welche die vorhergehenden alle fast ganz enthält, und sie an Schönheit im Äußeren weit übertrifft, kam in Amsterdam bei H. Wettstein im Jahr 1693 in zwei großen Quartbänden heraus. Im ersten Bande ist der griechische Text des Laertius mit aller Sorgfalt und Schönheit abgedruckt. Die römische Ausgabe liegt zum Grunde, welche Mark. Meibom in Abschnitte eingeteilt, und in sehr vielen Stellen aus den älteren Ausgaben, und aus einer Arundelischen und Canterburyschen Handschrift verbessert hat. Bei dem Text befindet sich die Am- brosische Übersetzung, von Meibom so ausgebessert und ergänzt, dass sie einer fast ganz neuen gleicht. Ferner befinden sich darin 24 Bildnisse der Philosophen, nämlich Thales, Solon, Pittakus, Anacharsis, Sokrates, Äschines, Aristipp, Euklides, Platon, Xenokrat, Karneades, Aristoteles, Theophrast, Antisthenes, Diogenes, Monim, Chrysipp, Pythagoras, Archytas, Herklit, Zenon, Demokrit, Sextus Empirikus und Epikur, nach alten Münzen und Gemmen in Kupfer gestochen. Unter dem Text stehen auf jeder Seite die sämtlichen Anmerkungen Heinrich Stephans, beider Casaubone, Aldrobandins, und Meiboms, welcher letzteren vorher noch ungedruckt war. Er war nämlich schon vor Menage mit einer Bearbeitung Diogenes’ beschäftigt. Der zweite Band enthält die Kommentare Menages, die er Wettstein unter der Bedingung, dass er sie abgesondert von den Anmerkungen anderer Gelehrter abdrucken lassen solle, viel vollständiger, als sie in der Londoner Ausgabe stehen, mitgeteilt hatte; ferner dessen Geschichte der Philosophinnen, die schon bei einem Italienischen Gedichte Petrarchs zu Leiden 1692 in Duodez, und in eben dem Jahr auch besonders zu Amsterdam von Wettstein in Oktav gedruckt waren. Auf diese folgen die kurzen, aber sehr gelehrten Anmerkungen des Straßburgers Joachim Kuhns über den Laertius, die über viele dunkle Stellen ein schönes Licht verbreiten und noch nicht gedruckt worden waren. Dann folgen abweichende Lesarten aus der Arundelischen und Canterburyschen Handschrift von Thomas Gale gesammelt. Endlich enthält auch diese Wettstein’sche Ausgabe die Vorreden der vorhergegangenen Ausgaben, worunter sich aber die Briefe Brognolis und Sambuks, und H. Stephans Recensio der Brognolischen Durchsicht der Ambrosischen Übersetzung nicht befinden, die nicht hätten ausgelassen werden sollen, wie auch nicht Olympiodors von Zindetus erläutertes Leben Platons. Die Register Johann le Clercs bei dieser Ausgabe sind trefflich. Sie enthält aber nicht, vermutlich wegen ihrer Stärke, und weil sie schon oft besonders gedruckt waren, die Anmerkungen und philosophischen Kommentare Peter Gassendis über Diogenes’ zehntes Buch oder Epikurs Leben, das Gassendi auch aufs Neue lateinisch übersetzt hat. Diese Gassendische Ausgabe ist gedruckt zu Paris 1646 in Folio, nachgedruckt zu Leyden 1649 und 1675 in Folio, und in Gassendis Werken zu Leiden 1658 in Folio. Gassendis kritische Noten führt Menage zuweilen an, sie werden aber von ihm und Merikus Casaubon und vorzüglich von Meibom getadelt, welcher letztere anmerkt, dass Gassendi ein größerer Philosoph als Sprachkenner gewesen.
Diogenes’ und Aristipps Leben aus Laertius hat auch Paulus Leopardus ausgezogen, lateinisch übersetzt, und zu Antwerpen 1556 in Octav abdrucken lassen.
Die siebente Ausgabe des Laertius ist die Longolische in zwei Oktavbänden zu Chur im Vogtlande 1739. Sie enthält den griechischen Text, und die lateinische Übersetzung aus der Wettstein’schen Ausgabe, ohne alle Anmerkungen, und die elend nachgestochenen Bildnisse der 26 Philosophen. Die Meibomischen Zahlen der Abschnitte, ob sie gleich meistens sehr unschicklich gemacht sind, behielt Longolius deswegen bei, weil Laertius darnach angeführt zu werden pflegt, aber er teilte außerdem jedes Buch in so viele Kapitel, als Leben darin enthalten sind, und die Kapitel wieder in so viele Zahlen, als die Sache zu erfordern schien; diese seine neuen Abschnitte bezeichnete Longolius mit römischen, die Meibom’schen mit gemeinen Zahlzeichen. Die Register verfertigte er ganz neu. Das Papier dieser Longolischen Ausgabe ist schön, aber die Schrift zu groß und nicht angenehm, dabei ist sie auch äußerst nachlässig korrigiert, und wimmelt von Fehlern, dass ich oft zu älteren Ausgaben zurück zu gehen genötigt war. Ob Longolius Anmerkungen, die er in der Vorrede, aus welcher diese Nachricht von Laertius Leben und Schriften ausgezogen ist, verspricht, noch erschienen sind, ist mir nicht bekannt.
Die achte griechisch-lateinische Ausgabe, welche außer dem Abdruck des griechischen Textes und der lateinischen Übersetzung nach der Longolischen Ausgabe und dessen Register, nichts enthält, ist in einem Großoktavbande zu Leipzig auf Kosten des Wiener Buchhändlers Krause gedruckt und hat in Ansehung des Äußern unstreitige Vorzüge vor der Longolischen. Ob sie sorgfältiger korrigiert ist, kann ich nicht sagen, da ich sie in dem Augenblick, da ich dieses schreibe, erst bekomme. Mehr Ausgaben sind mir von Diogenes Laertius nicht bekannt, außer dass sich vor der Zweibrücker Ausgabe Platons auch das Leben dieses Philosophen aus Laertius befindet. Er ist einer von den Schriftstellern des Altertums, der noch seinen Kritiker und Erklärer erwartet, wozu ich Herrn Professor Tuhle wohl auffordern möchte.
Übersetzungen in neuere Sprachen führt Longolius an, die italienische von Felix Astolfo, die zweimal, 1535 und 1545, zu Venedig in Oktav gedruckt worden; die französische von Franz de Fougerolles, einem Doktor der Medizin, mit Anmerkungen, zu Lyon 1602, in Oktav gedruckt; eine andere französische von M.B. zu Paris 1668, in Duodez gedruckt, und die französische Übersetzung des Lebens Aristipps von M. le Fevre mit Anmerkungen, die in den Memoires de Litterature, Tom. I. P II. n. II. und in Daciers Vie des hommes illustres de Plutarque T. IX. gedruckt ist. Eine englische Übersetzung von mehreren Verfassern ist in London 1682 in zwei Oktavbänden gedruckt, und eben daselbst 1696 wieder aufs neue gedruckt, die Brüggemann in seinem View anführt. Vor beiden Ausgaben befindet sich ein Leben Diogenes’ in englischer Sprache. Noch erschienen in London 1702, in Oktav, Leben der alten Philosophen von den besten Verfassern, meistens von Diogenes Laertius, nebst einigen neueren von Eunapius und den Leben der Philosophinnen von Ägid. Menage. Nach Longolius ist auch eine holländische Übersetzung und eine deutsche, zu Augsburg 1490 gedruckt, vorhanden. Degen führt außer dem Leben Xenophons vom älteren Goldhagen nur dessen griechische Geschichte Xenophons, keine neue deutsche Übersetzung Diogenes’ an.
Diogenes Laertius,
von dem Leben, den Meinungen, und Sprüchen der berühmten Philosophen
Vorrede des Diogenes Laertius
1. (1)1 Nach der Meinung einiger hat der Vortrag der Philosophie bei den Ungriechen seinen Ursprung genommen, denn die Perser hatten ihre Magier, die Babylonier und Assyrier ihre Chaldäer, und die Indier ihre Gymnosophisten. Bei den Kelten und Galliern waren die sogenannten Druiden und Semnotheen, wie Aristoteles in seinem Magischen Buche, und Sition im 23. der Folgen sagt. Darüber hinaus wird noch der Phöniker Ochus, der Thraker Zamolxis, und der Lybier Atlas genannt. Die Ägypter nennen Hephästus, einen Sohn des Nils, als den Schöpfer der Philosophie, deren Lehrer ihre Priester und Propheten sind.
2. (2) Von diesem bis auf Alexander den Makedonier sollen 48 863 Jahre verflossen sein, in welchen sich 373 Sonnen- und 823 Mondfinsternisse ereignet hätten. Von den Magiern, an deren Spitze der Perser Zoroaster steht, schreibt der Platoniker Hermodor in seinem Buche von den Wissenschaften, sind bis auf Trojas Zerstörung 5 000 Jahre verflossen, der Lydier Xanthus aber zählt von Zoroaster bis auf den Zug des Xerxes 600 Jahre, und sagt, dass auf ihn der Reihe nach mehrere Magier gefolgt sind, nämlich Ostanes, Astrapsych, Gobrias und Pazatas, bis auf Persiens Überwältigung durch Alexander.
3. (3) Ihnen sind aber die gerechten Ansprüche der Griechen unbekannt, bei welchen nicht allein die Philosophie, sondern auch die Menschheit selbst ihren Anfang genommen hat, welches sie den Ungriechen beilegen. Denn bei den Athenern war ja Musäus, und bei den Thebanern Linus, von welchen der erste ein Sohn Eumolps gewesen, und zuerst die Theogonie und die Sphäre besungen, und behauptet hat, dass alles aus einem entstehe, und auch darin wieder aufgelöst werde. Er sei zu Phaleri gestorben, und sein Grabmahl habe diese elegische Inschrift bekommen:
Hier deckt Phaleris Erde den Eumolpeden Musäus. Seinen erstarrten Leib birgt dieses heilige Grab.
Von dieses Musäus’ Vater sind auch die Eumolpiden zu Athen benannt. (4) Linus aber soll ein Sohn des Hermes und der Muse Urania gewesen sein, und über die Kosmogonie, den Lauf der Sonne und des Mondes, und die Erzeugung der Tiere und Pflanzen geschrieben haben. Er beginnt seine Gedichte mit diesen Worten:
Eine Zeit, die alles erzeugte zusammen, die war einst.
Und daher nahm Anaxagoras seine Behauptung, dass alle Dinge zugleich entstanden, und durch den hinzugekommenen Verstand durchgängig geordnet worden. Linus aber soll in Euböa, getroffen von einem Pfeil Apolls, gestorben sein, und diese Inschrift bekommen haben:
Hier empfing die Erde den toten Linus aus Theben. Schönbekränzt war er, der Urania Sohn.
So hat also die Philosophie ihren Ursprung bei den Griechen gehabt, und der Name Philosophie zeigt auch schon, dass sie nicht ungriechischen Ursprungs ist.
4. (5) Diejenigen, welche den Ungriechen die Erfindung der Philosophie beilegen, führen den Thraker Orpheus an und sagen, dieser sei ein Philosoph, und zwar ein uralter gewesen. Ich weiß aber nicht, ob einer, der solche Dinge, wie er von den Göttern vorträgt, ein Philosoph genannt werden könne; ja wie ich den nennen soll, der ohne Scheu den Göttern alle menschlichen Leidenschaften beilegt, sowohl die schändlichen Dinge, die einige Menschen im Geheimen begehen, als die, welche öffentlich zur Sprache kommen. Man hat die Sage von ihm, dass er durch Weiber umgebracht worden, aber eine zu Dios in Makedonien befindliche Inschrift sagt in folgenden Worten, dass er vom Blitz erschlagen worden ist.
Hier begruben die Musen den Thraker mit goldener Leier, Orpheus, ihn erschlug der donnernde Zeus.
5. (6) Diejenigen, welche der Philosophie einen ungriechischen Ursprung geben, setzen auch die Art zu philosophieren, wie sie bei diesen Völkern war, auseinander. Sie sagen, die Gymnosophisten und Druiden hätten in rätselhaften Sprüchen philosophiert: man müsse vor den Göttern Ehrfurcht haben, nichts Böses tun, sich in der Mannhaftigkeit üben. Klitarch schreibt auch im zwölften Buche, dass die Gymnosophisten den Tod verachten.
6. Dass aber die Chaldäer sich mit Astronomie und Wahrsagen beschäftigen, dass die Magier sich dem Gottesdienst widmen, und Opfer und Gebete verrichten, als ob sie allein gehört würden. Sie halten Vorträge über das Wesen und die Erzeugung der Götter, die, ihrer Behauptung nach, Feuer, Erde und Wasser sind. Sie verwerfen die Götterbilder, und missbilligen besonders die Sagen von männlichen und weiblichen Gottheiten. (7) Sie halten Vorträge über die Gerechtigkeit, und erklären die Verbrennung der Leichen für etwas Verruchtes, aber die fleischliche Vermischung mit Müttern und Töchtern halten sie für unsträflich, wie Sotion im 23. Buche schreibt. Sie geben sich auch mit Weissagen und Vorbedeuten ab, und behaupten, dass ihnen die Götter erscheinen. Sie lehren, die Luft sei mit geistigen Wesen angefüllt, die auf eine sehr feine, und den Ausdünstungen gleiche Art einen Einfluss auf die Augen der Scharfsehenden haben; sie untersagen äußeren Schmuck und das Goldtragen. Ihre Kleidung ist weiß, ihr Lager die Erde; ihre Speise Gemüse, Käse und Brot; ihr Stab ein Rohr, auf dessen Spitze sie, wie man sagt, Käse stecken, ihn emporheben, und essen. (8) Magische Weissagungen kennen sie nicht, wie Aristoteles in seinem Magischen Buche und Dinon im 5. Buche seiner Geschichten schreiben, welch letzterer auch sagt, dass der Name Zoroaster einen Verehrer der Gestirne bedeute. Eben das schreibt auch Hermodor. Aristoteles aber im 1. Buche von der Philosophie schreibt, dass die Magier älter sind als die Ägypter, und dass sie zwei Urwesen, einen guten und einen bösen Dämon, annehmen, welchen ersten sie Zeus und Oromasdes, und den letztern Hades und Arimanius nennen. Eben das sagen auch Hermipp im 1. Buche von den Magiern, Eudox im Periodus, und Theopomp im 8. Buche der Philippika, (9) welcher auch noch schreibt, dass die Menschen nach der Lehre der Magier wieder lebendig werden, und zur Unsterblichkeit gelangen, und dass alle Dinge ihre Benennungen behalten werden. Eben das schreibt auch der Rhodier Eudem. Hekätus aber schreibt, dass ihrer Meinung nach auch die Götter erzeugt worden. Klearch von Soli, in seinem Buche von der Unterweisung, sagt, dass die Gymnosophisten von den Magiern herstammen, und einige wollen auch die Juden von diesen ableiten. Überdies tadeln auch die Schriftsteller von den Magiern den Herodot; denn Xerxes habe weder Pfeile gegen die Sonne abgeschossen, noch Fesseln ins Meer geworfen, weil die Magier diese für Götter hielten; die Götterbilder aber habe er allerdings mit Recht zerstört.
7. (10) Die Ägypter philosophieren so über die Götter und über die Gerechtigkeit. Sie nehmen eine erste Materie an, wovon die vier Elemente abgesondert und einige lebendige Wesen gebildet werden. Sonne und Mond halten sie für Götter und nennen die erstere Osiris, den letzteren Isis und deuten sie durch einen Käfer, Drachen, Habicht und andere Tiere an, wie Manethon in seinem kurzen Begriff der Naturlehre und Hekätus im 1. Buche von der ägyptischen Philosophie schreiben. Sie stellen Bilder auf und legen Heiligtümer an, weil sie die Gestalt der Gottheit nicht wissen. (11) Die Welt halten sie für erzeugt, für zerstörbar und für kugelförmig. Die Sterne halten sie für Feuer, durch deren Einfluss alles auf der Erde hervorgebracht werde. Der Mond werde verfinstert, wenn er in den Schatten der Erde komme. Die Seele sei unsterblich, und wandere aus einem Körper in den anderen. Die Regen entstünden durch Umwandlung der Luft. Diese und andere Dinge lehren sie über die Natur, wie Hekätus und Aristagoras schreiben. Sie haben auch Gerechtigkeitsgesetze gemacht, die sie dem Hermes zuschreiben. Sie verehren auch die nützlichen Tiere als göttlich. Ferner behaupten sie, die Sterndeuterei, die Rechnungskunde und die Erdmesskunst erfunden zu haben. – So weit von der Erfindung.
8. (12) Den Namen Philosophie hat Pythagoras zuerst gebraucht und sich einen Philosophen genannt, da er sich mit Leon, dem Beherrscher der Sikyonier oder Philiaster unterhielt, wie der pontische Heraklides in seinem Buch von der Entseelten schreibt, denn kein Mensch sei weise, sagte er, sondern nur allein Gott. Vorher wurde nämlich das, was jetzt Philosophie heißt, Sophia oder Weisheit genannt, und die Männer, welche diese lehrten, hießen Sophen, oder Weise, als solche, die in die Tiefen der Seele ganz eingedrungen wären: Philosophen aber, oder Liebhaber der Weisheit, hießen die Schüler derselben.
9. Nicht aber Sophen allein, sondern auch Sophisten wurden die Weisen genannt, welchen letztern Namen man auch den Dichtern beilegte; denn Kratin nennt im Archiloch, wo er Homer und Hesiod rühmt, diese beiden Sophisten. (13) Den Namen Weise führten folgende: Thales, Solon, Periander, Kleobul, Chilon, Bias, Pittakus; zu welchen man noch den Skythen Anacharsis, den Cheneer Myson, den Syrer Pherekydes, und den Kreter Epimenides hinzusezt. Einige zählen auch noch den Athener Fürsten Pisistrat darunter. Diese heißen Weise.
10. Es gab aber eine zweifache Folge der Philosophen; eine von Anaximander und die andere von Pythagoras, wovon jeder den Thales gehört hat, Pythagoras aber war ein Zuhörer des Pherekydes. Die Philosophie der ersteren bekam den Namen der Ionischen, weil Thales ein Ionier aus Milet war, und Anaximander unterrichtete: die zweite ward von Pythagoras die italische genannt, weil dieser meistens in Italien lebte. (14) Jene, die ionische, hörte mit Klitomach, Chrysipp und Theophrast auf, die italische aber mit Epikur. Denn auf Thales folgte Anaximander, auf diesen Anaximenes, auf diesen Anaxagoras, auf diesen Archelaus, und auf diesen Sokrates, der Erfinder der Moralphilosophie. Auf ihn folgten mehrere Sokratiker, unter welchen Platon die alte Akademie stiftete, auf welchen Speusipp, Xenokrat, Polemon, Krantor und Krates folgten. Arkesilaus, der Nachfolger des letzteren, stiftete die mittlere Akademie, und auf ihn folgte Lakydes, ein Philosoph der mittleren Akademie, auf diesen Karneades und auf diesen Klitomach, bis auf welchen sie sich auf diese Art fortpflanzte. (15) Die Folge der Philosophen bis auf Chrysipp war diese: Sokrates’ Nachfolger war Antisthenes, auf diesen folgte Diogenes der Hund [= Kyniker], auf diesen Krates der Thebaner, auf diesen Zenon der Kittier, auf diesen Kleanth, auf diesen Chrysipp. Die Folge bis auf Theophrast war diese: Platons Zuhörer war Aristoteles, und dessen Zuhörer Theophrast. So pflanzte sich die ionische Philosophie fort. Die italische Philosophie nahm folgenden Gang: Pherekydes lehrte den Pythagoras, dem sein Sohn Telauges folgte, und diesen folgten Xenophanes, Parmenides, Zenon von Elea, Leukipp, Demokrit, auf welchen mehrere, und namentlich Nausphanes und Naukydes, folgten, deren Nachfolger Epikur war.
11. (16) Von den Philosophen sind einige Dogmatiker, andere Ephektiker gewesen. Dogmatiker sind diejenigen, welche über die Dinge so, als wenn sie begriffen werden könnten, entscheiden. Ephektiker aber, die nichts bestimmen und so sprechen, als wenn nichts mit Gewissheit begriffen werden könne. Einige von ihnen haben Schriften hinterlassen, andere haben gar nichts geschrieben, zu welchen letzteren nach einigen Sokrates, Stipo, Philipp, Menedem, Pyrrhon, Theodor, Karneades und Bryson, nach andern auch noch Pythagoras und bis auf einige Briefe auch der Chier Ariston gehören. Einige haben nur ein Buch geschrieben, als Meliß, Parmenides, Anaxagoras; Zenon schrieb viele Bücher, noch mehr Xenophanes, noch mehr Demokrit, noch mehr Aristoteles, noch mehr Epikur, und noch mehr Chrysipp.
12. (17) Einige Philosophen wurden nach den Städten benannt, wie die Elischen, Megarischen, Eretrischen, und Kyrenäischen; andere von den Lehrplätzen, wie die Akademischen und Stoischen; noch andere von zufälligen Dingen, wie die Peripatetiker: wieder andere hatten einen Spottnamen, wie die Kyniker; noch andere waren von ihren Gegenständen benannt, wie die Eudämoniker; einige benannte man von ihren Einbildungen, wie die Philalethen, die Elenchtiker, die Analogiker. Einige wurden nach ihren Lehrern benannt, wie die Sokratiker, die Epikureer, und mehrere. Einige heißen wegen ihrer Naturforschungen Physiker; andere von ihren Beschäftigungen mit der Moral Ethiker. Von der Art ihres Vortrags hießen einige auch Dialektiker, weil sie nach einer besonderen Schärfe und Genauigkeit des Ausdrucks strebten.
13. (18) Es hat aber die Philosophie drei Teile, die Physik, Ethik und Dialektik. Die Physik beschäftigt sich mit der ganzen Welt und was in derselben befindlich ist; die Ethik mit dem menschlichen Leben und den Dingen, die sich auf uns beziehen; die Dialektik sucht für beide Seiten einer Sache Gründe auf. Bis auf Archelaus war nur die Physik üblich; seit Sokrates aber, wie schon vorher gesagt worden, die Ethik, und Zenon von Elea brachte die Dialektik empor. In der Ethischen Philosophie gab es 10 Sekten: die Akademische, Kyrenäische, Eleische, Megarische, Kynische, Eretrische, Dialektische, Peripatetische, Stoische und Epikurische. (19) Das Haupt der älteren Akademie war Platon, der mittlern Arkesilaus und der neueren Lakydes. Das Haupt der Kyrenäischen Sekte war Aristipp, der Eleischen Phädon der Eleer; der Megarischen Euklides der Megareer, der Kynischen Antisthenes der Athener; der Eretischen Menedem der Eretrier, der Dialektischen Klitomach der Karthager, der Peripatetischen, Aristoteles der Stagirit; der Stoischen Zenon der Kittier; der Epikureische wird von Epikur selbst benannt. Hippobot in seiner Schrift über die Philosophensekten sagt, dass deren neun und neun Schulen gewesen: die Megarische, Eretrische, Kyrenäische, Epikureische, Annikerische, Tyeodorische, Zenonische oder Stoische, die ältere Akademische, die Peripatetische: (20) der Kynischen, Eleischen, und Dialektischen erwähnt er nicht. Die Pyrrhonische Sekte rechnen die meisten nicht mit, wegen ihrer geringen Bekanntheit. Andere sagen, man könne sie in gewissen Stücken zwar eine Sekte nennen, in gewissen Stücken aber auch nicht; sie scheint aber eine Sekte zu sein. Eine Sekte ist nämlich diejenige, die in Ansehung dessen, was scheint, gewisse Gründe befolgt, oder zu befolgen scheint, und so könnte man mit Grund auch die Skeptische eine Sekte nennen: nennen wir aber eine Sekte diejenige, die mit einander übereinstimmende Lehrsätze behauptet, so möchte ihr der Namen einer Sekte nicht zukommen, denn sie hat keine Lehrsätze. Dies vom Entstehen der Philosophie, von den aufeinander folgenden Philosophen, von ihren Abteilungen und den verschiedenen Sekten in derselben.
14. (21) Seit kurzem ist aber auch noch eine eklektische Sekte durch den Alexandriner Potamon eingeführt worden, der diejenigen Lehrsätze der verschiedenen Sekten auswählte, die ihm gefielen. Er hielt aber dafür, wie er in seinem Handbuche sagt, dass es Kennzeichen der Wahrheit gebe; eines, von welchem das Urteil ausgeht, oder das anführende und eines, durch welches geurteilt wird, oder die allergenaueste Vorstellung. Der Anfang aller Dinge sei die Materie, deren Beschaffenheit, Wirkung und Ort, woraus und von wem, wo und worin. Das Ziel, wohin alles strebe, sei ein in allen Tugenden vollkommenes Leben und ohne die körperlichen, natürlichen und äußeren Güter. Ich will aber nun von den Männern selbst reden, und zwar zuerst von Thales.
Erstes Buch
Erstes KapitelThales
1. (22) Thales war, wie Herodot, Duris und Demokrit sagen, ein Sohn des Hexamius und der Kleobuline, aus dem Hause der Theliden, die zu den edelsten Phönikern gehörten und von Kadmus und Agenor abstammen, wie auch Platon bezeugt. Er bekam den Namen eines Weisen zuerst, als Damasius Archon zu Athen war, zu welcher Zeit auch die Sieben den Namen der Weisen bekommen haben, wie der Phalerier Demetrius in seiner Schrift von den Archonten erzählt. Er erhielt das Bürgerrecht zu Milet, wie er mit Nileus dahin kam, der Phönike hatte verlassen müssen, oder nach dem Bericht der meisten war er ein geborener Milesier, und zwar aus einem glänzenden Hause.
2. (23) Außer den Staatsgeschäften widmete er sich auch der Beobachtung der Natur, hinterließ aber, wie einige sagen, keine Schriften, denn die ihm beigelegte nautische Astrologie soll von dem Samier Phokas sein. Kallimach aber nennt ihn als den Erfinder des kleinen Bären, und singt von ihm in seinen Jamben:
Des Wagens Sternchen hat er auch bestimmt, Wonach der Phöniker den Nachen steuert.
Nach einigen hat er nur zwei Abhandlungen geschrieben, von den Sonnenwenden und von der Nachtgleiche, weil er das übrige für leicht zu begreifen hielt. Nach einigen soll er zuerst die Sterne gedeutet und die Sonnenfinsternisse und Wenden vorausgesagt haben, wie Eudem in seiner Geschichte der Astrologie schreibt, weswegen ihn auch Xenophanes und Herodot bewundern. Eben das bezeugen aber auch Demokrit und Heraklit.
3. (24) Nach einigen hat er auch zuerst behauptet, dass die Seelen unsterblich seien, unter andern sagt dies der Dichter Choirilus. Er erfand auch zuerst den Sonnenlauf von einer Wende zur anderen und zeigte zuerst, dass die Größe der Sonne den Mond 720 mal übertreffe, wie einige sagen. Er war auch der erste, der den letzten Monatstag den dreißigsten nannte, auch hat er, nach einigen, zuerst über die Natur philosophiert. Aristoteles aber und Hippias schreiben, dass er auch leblosen Dingen Seelen beigelegt und den Beweis aus dem Magnetstein und dem Bernstein hergenommen habe. Pamphilas sagt, dass er von den Ägyptern zuerst die Erdmesskunst erlernt und, nachdem er den rechtwinkligen Triangel eines Zirkels beschrieben, einen Stier geopfert habe. (25) Andere, unter welchen sich der Rechenmeister Apollodor befindet, sagen dies von Pythagoras. Er erweiterte auch die von Kallimach in seinen Jamben dem Phrygier Eusorbus beigelegte Erfindung, nämlich das ungleichseitige Dreieck und die Theorie der Linien. Auch in Staatsangelegenheiten soll er am besten geraten haben, denn da Krösus wegen eines Kriegsbündnisses an die Milesier schickte, hinderte er solches, wodurch er, da Kyrus die Oberhand erhielt, die Stadt rettete. Heraklides sagt von ihm, dass er für sich allein und als Privatmann gelebt habe.
4. (26) Einige aber schreiben, er sei verheiratet gewesen, und habe einen Sohn, Kibissus gehabt; noch andere wollen, dass er unverheiratet geblieben, aber seiner Schwester Sohn zu dem seinigen angenommen habe. Als man ihn fragte, warum er sich nicht verheirate, soll er geantwortet haben, weil er kein Kinderfreund sei; auch soll er seiner Mutter, wie sie in ihn drang, dass er heiraten solle, die Antwort gegeben haben: Noch ist es, bei Zeus! die Zeit nicht. Und als er schon über die blühenden Jahre hinaus war, und sie noch in ihn drang, soll er gesagt haben: Die Zeit ist vorüber.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!