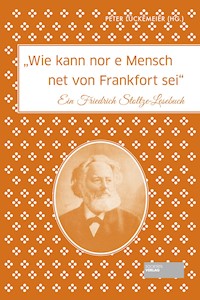8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Schnorren mit Richard Wagner. Ein guter Mensch werden mit Mutter Teresa. Oder bei Woody Allen abgucken, wie man Macken in Kreativität verwandelt – Peter Lückemeier zeigt uns Normalos, was bedeutende Frauen und Männer geleistet haben und wie wir ihnen nacheifern können. Amüsante Lebenshilfe, Unterhaltung auf hohem Niveau und immer wieder hinreißende Lebensgeschichten: Der Autor von »Männer verstehen« und »Neue Herzblatt-Geschichten« gibt viele geldwerte Tipps für Neuanfänge, Kehrtwenden und Besserungen jeder Art.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Lückemeier
Von den Großen lernen
Über dieses Buch
Schnorren mit Richard Wagner. Ein guter Mensch werden mit Mutter Teresa. Oder bei Woody Allen abgucken, wie man Macken in Kreativität verwandelt – Peter Lückemeier zeigt uns Normalos, was bedeutende Frauen und Männer geleistet haben und wie wir ihnen nacheifern können. Amüsante Lebenshilfe, Unterhaltung auf hohem Niveau und immer wieder hinreißende Lebensgeschichten: Der Autor von »Männer verstehen« und »Neue Herzblatt-Geschichten« gibt viele geldwerte Tipps für Neuanfänge, Kehrtwenden und Besserungen jeder Art.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491003-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Reich werden mit den Aldis
Stur bleiben mit Churchill und Luther
Sich anstacheln lassen mit Hillary Clinton
Ein guter Mensch werden mit Mutter Teresa
Prominent werden ohne Leistung mit Verona
Sich ernst nehmen mit Reich-Ranicki
Sich nicht so ernst nehmen mit Johannes XXIII.
Sich Zeit lassen mit Fontane
Von Sucht loskommen mit Konstantin Wecker
Frauen verführen mit Casanova und Lauterbach
Sich nichts gefallen lassen mit Coco Chanel
Fliehen mit Goethe
Willenskraft trainieren mit Cäsar und Thatcher
Auf Reisen gehen mit Farin Urlaub
Loben lernen mit Dale Carnegie
Schnorren mit Richard Wagner
Auf dem Teppich bleiben mit Günther Jauch
Faulheit überwinden mit Thomas Mann
Macken nutzen mit Woody Allen
Luxus genießen mit Oscar Wilde
Macht erringen mit Merkel und Kohl
Arm und reich werden mit Franziskus
Großzügig sein mit Axel Springer
Zivilcourage lernen mit Sophie Scholl
Staunen üben mit Einstein
Ein guter Vater werden mit Fürst Rainier
Kritik ertragen mit Heinrich Mann
Lebenskünstler werden mit Gunter Sachs – und Ihnen!
Dank
Namenregister
Für Dani
Reich werden mit den Aldis
Einmal wurde einer sehr reichen, sehr liebenswürdigen Frankfurterin die Frage gestellt, was ihr Reichtum bedeute. Man saß in ihrer riesigen, wunderschönen Wohnung mit Blick auf den Main, eine Wand ging sicherlich zehn Meter hoch ins Obergeschoss und hing dicht an dicht voller Gemälde, und da sowohl die Dame als auch ihr Mann mäzenatisch nach vielen Richtungen ihr Geld verschenkten und stifteten, stand zu erwarten, dass sie auf die Frage, was ihr Geld bedeute, das Übliche sagen würde: Es macht nicht glücklich, aber es beruhigt, und man kann damit ganz doll viel Gutes tun. Aber die Dame reagierte völlig unvermutet. Sie warf die Arme hoch, strahlte übers ganze Gesicht und jubelte förmlich: »Ich finde es herrlich, reich zu sein. Ich genieße es jeden Tag!«
Ungewöhnlich. Die allermeisten Reichen behaupten, Geld mache ihnen eher Sorgen. Aber so richtig überzeugen kann das nicht. Warum würden sonst die Reichen so heftig daran arbeiten, noch reicher zu werden? Nein, da halten wir es doch lieber mit dem saudischen Prinzen al-Walid ibn Talal Al Saud, der als eine Art Schnäppchenjäger auf hohem Niveau unter anderem mit dem Ankauf maroder Firmen oder mit Beteiligungen an angeschlagenen, aber im Kern gesunden Unternehmen reich geworden ist. Und was antwortet der Prinz in ›Bunte‹ auf die Frage, ob Geld glücklich mache: »Jeder Mensch, der das Gegenteil sagt, hat unrecht. Geld erzeugt Fröhlichkeit und Glücksgefühle.«
Weil dies so ist, wollen Sie jetzt sicherlich wissen, wie man es eigentlich anstellt, reich zu werden, und in wem Sie sich ein Vorbild suchen könnten. Dann nehmen Sie sich bitte als Erstes Kurt Tucholskys Feststellung zu Herzen: »Zu dir kommt kein Geld, weil du es nicht zündend genug liebst. Na ja, du möchtest es gern haben. Aber damit ist es nicht getan! Gern haben? Du sollst nicht nur begehren deines Nächsten Bankkonto – du musst Geld inbrünstig lieben!«
Wer aber sein Geld inbrünstig liebt, der gibt es auch nicht unbekümmert her.
Nicht grundlos ranken sich unzählige Legenden um die Sparsamkeit, ja den Geiz der Reichen: Friede Springer wurde dabei beobachtet, nach Abendeinladungen in Berlin weder eine Limousine mit Fahrer noch ein Taxi zu ordern. Vielmehr steuerte sie einen unauffälligen Golf Diesel selbst nach Hause; Ingvar Kamprad, reichster Mann Schwedens, fährt einen uralten Volvo, Erivan Haub und seine Frau (ihnen gehört immerhin Tengelmann) rufen ihre Kinder tagsüber nicht in Übersee an, sondern warten auf den günstigeren Nachttarif; Lidl-Gründer Dieter Schwarz leistete sich seinen S-Klasse-Benz nur als Auslaufmodell; der unermesslich reiche Öltycoon J. Paul Getty notierte noch im Alter von sechsundsechzig Jahren die Ausgaben eines Tages: »Haarschnitt 25 Centime, Trinkgeld 2 Centime«. Theo Albrecht (Aldi) aber trug bei seiner Entführung einen so billigen Anzug, dass die Kidnapper sich fragten, ob sie überhaupt den Richtigen erwischt hatten, und sich erst einmal seinen Ausweis zeigen ließen; Rod Stewart lässt sich im Restaurant schon mal die Reste einpacken. Nur Rudolf Augstein ging viel lässiger mit seinem Geld um, als er eines Tages in seiner Hamburger Stadtvilla von zwei Einbrechern überrascht wurde. Er feilschte nicht lange, musste allerdings feststellen, dass er die geforderten 50000 Mark nicht im Haus hatte. Also rief er seinen Verlagsleiter Alfred Theobald an. Der pumpte sich schnell von solventen Bekannten das Bargeld zusammen, fuhr zu Augsteins Haus und übergab die Summe. Die ganze Zeit über hatte der Spiegel-Herausgeber die nervösen Einbrecher beruhigt. Alles ging gut, Geiz wäre in diesem Fall bestimmt lebensgefährlich geworden.
Nun aber zurück zu der Frage, wegen der Sie ja dieses Kapitel lesen: Wie schafft man es, reich zu werden? Sieht man sich die einschlägigen Listen an, in denen, wie verlässlich auch immer, die reichsten Menschen erfasst und bewertet werden, so kommt man als Erstes zu dem Ergebnis, dass wohl – zumindest in Deutschland – die vielleicht wichtigsten Eigenschaften reicher Menschen Diskretion, Understatement und Zurückhaltung heißen. Unter Deutschlands Milliardären finden sich Namen, die man selten in der ›Bunten‹ liest: Hasso Plattner, Andreas und Thomas Strüngmann, Michael Otto, Reinhold Würth, Adolf Merckle, Curt Engelhorn, Dieter Schwarz und – als Einzige vom Glanz des Geheimnisvollen umweht – die Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht. Sie alle geben keine oder nur selten Interviews, leben zurückgezogen, laden zu den Hochzeiten ihrer Kinder keine bunten Blätter ein und kommentieren ihre Jahresabschlüsse nicht vor laufenden Kameras auf Pressekonferenzen.
Reichtum kann zahlreiche Wurzeln haben. Es gibt Vermögen, die über viele Generationen so ansehnlich geworden sind, dass der verstorbene Fürst Johannes von Thurn und Taxis sagen konnte: »Ein so großes Vermögen kann man nicht versaufen, nicht verhuren, nicht verfressen, man kann es nur verdummen.« Und es gibt Vermögen, die in erster Generation entstehen, weil ihre Erzeuger eine umwerfende Idee hatten. Betrachten wir solche Ideen und fragen uns, was es außer diesem genialen Einfall noch brauchte, um Reichtum zu schaffen.
Erster Fall: Karl und Theo Albrecht. Geboren 1920 und 1922 im Ruhrgebiet. Vater Kumpel, Staublunge, danach Hilfsarbeiter. Die Mutter betreibt einen Lebensmittelladen in Essen, 35 Quadratmeter. 1946 – beide Albrechts waren aus dem Krieg zurück – übernahmen Karl und Theo den Laden der Mutter. Von diesem Moment an beginnt ein sagenhafter Aufstieg. Weil die beiden eine Idee haben, die wie die meisten genialen Einfälle ganz einfach ist. Unter dem Namen »Albrecht Discount« eröffnen sie im Ruhrgebiet einen Laden nach dem anderen und setzen in der Nachkriegszeit nur auf den Preis. Sie verzichten auf Regale, sie verzichten auf alles, was den Einkauf zum »Erlebnis« macht. Der Triumph des Schlichten wird später einmal der Titel eines Buches lauten, das den Erfolg der Brüder nachzeichnet: Sie stapeln die Ware auf Paletten auf den Boden, der Kunde greift unter dem Schein schmuckloser Neonröhren nach Zucker und Mehl – sogar nach »guter Butter«. Denn obwohl es in den ersten Jahren keine Tiefkühltruhen gibt, also auch kein Fleisch, keine Milch, keine Joghurtprodukte, zählt Butter von Anfang an zum Grundsortiment, sie wird abends zum Kühlen in den Keller gebracht. Verkäufer? Wozu! Die Waren erklären sich von selbst, und vor allem sind sie so wunderbar billig. Weil sich die Brüder zunächst auf wenige Artikel mit hohem Absatz konzentrieren, können sie günstiger einkaufen als andere. Den Preisnachlass, den die Konkurrenz in Form von Rabattmärkchen gewährt, gibt es bei Albrecht sofort an der Kasse, ohne Umweg.
Zu Beginn der sechziger Jahre trennen sich die Wege der Brüder. Sie taufen ihre Firma in »Aldi« um, Karl übernimmt das Geschäft in Süd-, Theo das in Norddeutschland. Bald verliert das Unternehmen sein Arme-Leute-Image, vor allem, nachdem sich herumspricht (und von der Stiftung Warentest bestätigt wird), dass die Sachen dort zwar preiswert, aber nicht schlecht sind. Die Geiz-ist-geil-Mentalität beschert neue Kunden, heute fährt man auch im Porsche bei Aldi vor. Die Läden sind irgendwie kultig geworden, es erscheint ein Kochbuch nach dem anderen mit Aldi-Produkten, man ist nicht mehr peinlich berührt, wenn man am Weinregal einen Bekannten trifft, und noch immer ist man frappiert von der bunten Kühnheit der potthässlichen Zeitungsannoncen, an denen wohl noch nie ein Graphik-Designer seine Spuren hinterlassen durfte.
Reich geworden sind die Albrecht-Brüder also durch eine Idee, durch den Mut zur Schlichtheit. Auf Ideen freilich können viele kommen. Sie werden nicht reich, wenn es Ihnen an Grundtugenden wie Fleiß und Beharrlichkeit fehlt und – wie im Falle der Albrecht-Brüder – an der Entschlossenheit, einem einmal als richtig erkannten Prinzip treu zu bleiben. Vor allem ist an den beiden mittlerweile alten Männern, die als reichste Deutsche gelten, eines mit Erstaunen zu registrieren: ihre mangelnde Eitelkeit. Ein so tolles Konzept zu ersinnen, mit solcher Konsequenz eine äußerst erfolgreiche Marke zu schaffen und darüber auch noch milliardenschwer geworden zu sein – jeder andere würde Bände über sich schreiben lassen und obendrein eine dicke Autobiographie veröffentlichen, würde mindestens dann und wann vor Fernsehkameras Auskunft geben über diesen beispiellosen Aufstieg: Von den Albrechts lernen heißt Bescheidenheit lernen.
Und was lernen wir von unserem zweiten Fall, von Hasso Plattner? Er hat es gemeinsam mit seinen Kollegen Hans-Werner Hector, Dietmar Hopp und Klaus Tschira auf die Milliardärsliste gebracht – und das in relativ wenigen Jahren. Plattner und die anderen Herren gründeten im Jahr 1972 ein Unternehmen in der Provinz. Sie nannten es wenig aufregend »Systemanalyse und Programmentwicklung«, aus den Initialen wurde SAP. Hasso Plattner und die anderen Informatiker und Manager hatten zuvor alle für den Computergiganten IBM gearbeitet. Und sie hatten – wie die Albrecht-Brüder – eine einfache, jedoch grundlegend neue Idee.
Bis dahin waren die EDV-Programme in den Unternehmen wie Maßanzüge gewesen. Als Systemberater hatten die SAP-Gründer aber festgestellt, dass sich viele Arbeitsabläufe in den Unternehmen glichen, dass also für Firmen völlig unterschiedlicher Branchen immer gleiche oder doch ähnliche Programme zu entwickeln waren. Also begannen sie, Anwender-Software als Standardprodukte zu programmieren. Aus den Maßanzügen waren Anzüge von der Stange geworden, die sich blendend verkauften. In einer beispiellosen Erfolgsgeschichte eroberte das Unternehmen fortan die Märkte. Am Anfang hatte eine simple Idee gestanden. Und danach machten die Gründer einfach alles richtig.
Aber noch etwas ist interessant an der SAP-Story. Lesen Sie, was einer der anderen SAP-Gründer, Dietmar Hopp, für die bestimmende Erfolgskomponente hält: »In meiner Zeit bei SAP habe ich intelligente, möglichst Sport treibende Leute eingestellt. Die wurden dann zu einem strategisch arbeitenden Team zusammengeschweißt. Das war und ist sicherlich eines der Erfolgsgeheimnisse bei SAP.« Intelligenz und sportliche Betätigung? Wären Sie darauf gekommen?
Also, fangen Sie an, Ihren IQ und Ihren Body zu trainieren. Darin mögen die Geheimnisse auch Ihres Erfolgs liegen! Und wenn der sich dann in Form des Reichtums eingestellt hat, dann könnte Sie am Ende ja die Frage belasten, wem Sie all ihr Geld, Ihre Ferienhäuser in Südfrankreich und Ihre Appartements in New York vererben. Da dürfen Sie sich getrost an Warren Buffett orientieren. Der alte Mann vermacht den Großteil seiner 62 Milliarden Dollar der Stiftung des Microsoft-Gründers Bill Gates. Als Familienvater hält er sich eher zurück: »Man sollte seinen Kindern so viel Geld hinterlassen, dass sie alles tun können, aber nicht so viel, dass sie nichts tun müssen.«
Kann aber auch aus einem Mann, der sich keine Zahlen merken kann, ein Milliardär werden? Klar. Er kann aus seiner Zahlenschwäche sogar eine Stärke machen. Indem er all seinen Produkten Namen gibt. Zum Beispiel Billy. Oder Gutvik und Bonde. Die dann genau unter diesen Namen auf der ganzen Welt verkauft werden. Massenhaft. Der Mann mit dem schlechten Zahlen-, aber guten Namensgedächtnis heißt Ingvar Kamprad. Er hat Ikea gegründet.
Der Drang zum Geschäftemachen, zum Geldverdienen, zum Unternehmertum beginnt bei den Reichen häufig in den Jugendjahren. Auch Kamprad fing früh an. Er war siebzehn, als er Ikea gründete. Noch früher dran war Warren Buffett, der heute als reichster Mensch der Erde gilt. Mit elf spekulierte der Sohn eines Wertpapierhändlers zum ersten Mal an der Börse. Vierzehn war er, als er aus den Spekulationsgewinnen Grundstücke in seiner Vaterstadt Omaha in Nebraska erwarb. Was war sein Weg zum Erfolg? Sein Erfolgsrezept ist relativ schwer nachzumachen, denn es ist mit ungeheuer viel Arbeit und Wissen verbunden. Wer ein zweiter Warren Buffett werden will, der muss nicht nur so früh anfangen wie der nach wie vor bescheiden lebende Milliardär, der lieber Cola als Champagner trinkt – er oder sie muss auch immens fleißig sein, einen scharfen Verstand besitzen und vor allem von allergrößter Urteilssicherheit sein. Nicht grundlos war Buffett der einzige Absolvent der Columbia University Business School, dem Professor Benjamin Graham je die Bestnote zugestand.
Warren Buffetts Methode wird nach ihm »Buffettology« genannt und bedeutet schlicht, dass er versucht, Unternehmen ausfindig zu machen, deren tatsächlicher Wert höher ist als ihr Aktienkurs. »Buffett verließ sich in der Beurteilung stets nur auf seine eigenen Analysen, nie auf Gutachten von Wirtschaftsprüfern«, schreibt das Munzinger-Archiv. Und das mit ungeheurem Erfolg: Wer sich 1970 mit nur 10000 Dollar an Buffetts Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway Inc. beteiligt hätte, der hätte 1998 ein Aktienvermögen von 360 Millionen Dollar vorweisen können. Unglaublich? Unglaublich. Wir können nur staunen und den Hut ziehen, Warren Buffett zum Vorbild nehmen hieße sich überschätzen. Blicken wir uns lieber noch rasch nach einer anderen Person um, an der wir uns auf dem Weg zum Reichtum orientieren können. Übrigens macht Buffett vor, dass man auch als reichster Mensch der Welt kein unangenehmer, knauseriger Grantler sein muss. Die für viele Menschen gültige Gleichung, Geld verderbe den Charakter, hat auf besonders charmante Weise Thomas Gottschalk entkräftet. Nein, nicht auf sich selbst bezogen (»mir waren wohlhabende Menschen so lange suspekt, bis ich selber einer wurde«), sondern über den vielleicht noch etwas solventeren Gunter Sachs (siehe Schlusskapitel), der als Erbe eines Riesenvermögens vormacht, dass man sich auch als reicher Mann nicht langweilen muss. Andere Reiche haben ebenfalls vorgeführt, dass man als Geldmensch nicht eindimensional werden muss: Der legendäre Deutsche-Bank-Chef Hermann Josef Abs war ein Kunstkenner von Gnaden, die Waschmittel-Witwe Gabriele Henkel ist eine stilvolle Gastgeberin und Sammlerin, Giovanni Agnelli verstand nicht nur etwas von Autos, und der reichste Angehörige der europäischen Königshäuser, Willem Alexander Prinz der Niederlande, hat sich nicht nur auf sein Thrönchen kapriziert, sondern ist ein international angesehener Experte für Wasserwirtschaft geworden.
So reich wie der niederländische Kronprinz dürften Sie nie werden, weswegen Sie sich auf dem Weg zum Millionär noch schnell von T. Harv Eker inspirieren lassen sollten. Dieser amerikanische Motivationstrainer und Buchautor (So denken Millionäre) behauptet sinngemäß, es komme nicht so sehr auf Wissen als aufs Verhalten an. Arme und Angehörige der Mittelschicht würden oft unbewusst in Gelddingen dasselbe Verhalten an den Tag legen wie ihre armen oder mittelständischen Eltern: zu ängstlich, zu bescheiden, zu schnell mit kleinem Erfolg zufrieden, ohne den Willen zum großen Reichtum. Was man braucht, ist ein »Millionaire Mind«, also die innere autosuggestive Eigenprogrammierung. Mit anderen Worten: Wer Reiche beneidet, wird niemals selbst reich. Deshalb empfiehlt Eker den Lesern seines Buches und den Teilnehmern seiner (teuren) Intensivseminare, mit der Hand auf dem Herzen laut zu deklamieren: »Ich bewundere reiche Leute. Ich segne reiche Leute. Ich liebe reiche Leute. Eines Tages werde ich einer von ihnen sein.«
Ob das hilft? Versuchen Sie es einfach mal! Bei Mister Eker jedenfalls ging es gut. T. Harv Eker ist Millionär geworden – durch sein Buch.
Stur bleiben mit Churchill und Luther
Churchill könnte man für Vieles als Vorbild nennen. Als einen Mann von ungeheurer Energie zum Beispiel, der nicht nur zweimal in seinem Leben das Amt des britischen Premierministers einnahm, sondern auch Oppositionsführer war, Kriegsminister, Kriegsberichterstatter, Unterhausabgeordneter, Kolonialminister, Schatzkanzler, Kriegsgewinner, Wahlverlierer. Als einen Mann, der sich immer wieder von Niederlagen aufrappelte und emporstieg zu neuen Siegen. Als einen politischen Weltstar, der wie so viele andere Genies seine Karriere ungewöhnlich früh begann (mit sechsundzwanzig Jahren zog er ins Unterhaus ein). Als einen eigenbrödlerischen Kauz, der zu seinen Schrullen stand, früh und lange vor Ludwig Erhard die Zigarre zu einem Wiedererkennungsmerkmal machte und durch den Ausspruch »No sports« das Lebensmotto aller vergnügten Leibfaulen prägte; eine übrigens kaum zu unterschätzende Leistung, die ihm so en passant gelang. Als einem der vielen körperlich kleinen Männer, die es weit brachten – er maß nur 1,67 Meter. Als einem neben seiner politischen Arbeit ungewöhnlich produktiven Schriftsteller – als er 1953 den Literaturnobelpreis erhielt, umfasste sein Werk in damals fünfundfünfzig Lebensjahren siebenundzwanzig Bücher, darunter den Bestseller über den Zweiten Weltkrieg, der es auf die sagenhafte Auflage von 1,75 Millionen Exemplaren brachte. Als einem Schwermütigen, der seine schwarzen Stunden oft erfolgreich bekämpfte, indem er Gäste einlud oder malte. Aber dies alles soll hier keine Rolle spielen, Winston Churchill sei hier gepriesen als ein Musterbeispiel an Sturheit.
Gemeinhin wird Sturheit zumindest unterschwellig als etwas Negatives empfunden. Sturen Menschen wird nicht nur nachgesagt, dass sie beharrlich ihr Ziel verfolgen, sondern auch unbeeinflussbar sind, auf keine besseren Argumente hören, dass sie selbst dann noch bei ihrer Meinung bleiben, wenn alle Welt eine andere vertritt.
Sturheit darf aber auch als Talent und Charakterstärke begriffen werden. Zum Beispiel dann, wenn jemand wie Winston Churchill an einer Idee, einem Plan oder einer Überzeugung festhält. In seinem Falle lautet das positive Synonym für Sturheit: Unbeirrbarkeit.
Eine seiner Überzeugungen, die der auf einem Schloss geborene Enkel des 7. Herzogs von Marlborough ein Leben lang hegt, ist die entschiedene Ablehnung von Zwang und Unterdrückung, was wohl biographische Ursachen hat: Ständig fühlt er sich als Jüngling eingeengt – durch den übermächtigen Vater, die Schule, die Kadettenanstalt. Viel früher als seine Landsleute wittert der freiheitsliebende Mann auch den Ungeist, der von Hitler und dessen nationalsozialistischer Bewegung ausgeht, ebenso dessen latent aggressiven Expansionsdrang, den er schon im Oktober 1930 vorhersagte. 1933, im Jahr der Machtergreifung, als noch kaum jemand im Ausland ahnt, was mit Hitler auf Europa zukommt, beginnt er ungewöhnlich hellsichtig diesen Kampf, und er wird sechs Jahre später in seiner Artikelsammlung Step by Step beweisen, dass er längst vor 1939 überdeutlich vor Englands militärischer Schwäche und Deutschlands Aufrüstung gewarnt hat.
Dieses Buch verweist wie viele ähnliche Äußerungen seiner Zeitgenossen, auf das, was auch nach heutigem Forschungsstand als Churchills historische Lebensleistung gilt: dass er Hitlers Sieg verhindert hat. Er überzeugt die Briten in der scheinbar aussichtslosen Lage des Sommers 1940 davon, den Krieg noch nicht verloren zu geben, stärkt ihren Durchhaltewillen und legt die Grundlagen für den Sieg über Hitler-Deutschland.
In diesem Sommer 1940 ist Hitler auf dem Höhepunkt seiner Macht angelangt. Bald wird er Frankreich im Sturme nehmen, deutsche Truppen werden Paris besetzen, der Eroberer lässt sich symbolträchtig unterm Eiffelturm fotografieren. England ist im wahrsten Sinne des Worts schlecht »gerüstet« für die gut geschmierte deutsche Kriegsmaschinerie. In der britischen politischen Klasse überwiegen bis dahin noch immer die Anhänger des Appeasements, der Beschwichtigungspolitik. Churchills eigentliche Sturheitsleistung liegt ein paar Jahre zurück, als die vornehme Zurückhaltung gegenüber dem deutschen Aufrüsten in Großbritannien so allgemein akzeptiert war wie vielleicht in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts in Deutschland die scheinbar unabänderliche Dauerhaftigkeit der Teilung des Landes. Seine Leistung besteht darin, gegen den Zeitgeist nicht von seiner Überzeugung abgewichen zu sein.
Als er aber zurückkehrt in die große Politik, als er am 10. Mai 1940 Premierminister wird, da denken auch die Briten um, denn Hitler setzt soeben dazu an, Frankreich zu überrennen. Drei Tage später hält der neue Premier im Unterhaus eine Antrittsrede, die später das Gütesiegel »historisch« erhalten wird. Churchills schon früh ausgeprägter Hang zum Pompösen und Dramatischen – vorher und später oft genug unangemessen – hat hier den richtigen Augenblick, die passende Gelegenheit gefunden. Bis heute schwingt das Pathos der Stunde mit, wenn wir die Hauptaussage hören: »I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat« – Ich habe nichts anzubieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Viele Jahrzehnte später wird Helmut Schmidt in der ›Zeit‹ über diese Rede sagen: »Ein Machtwort war das nicht, aber ein gewaltiges Wort, das das ganze englische Volk zum Widerstand gegen Hitler mobilisierte.« Churchill selbst umschrieb die Wirkung seiner Mobilisierungs- und Durchhaltepolitik später mit den Worten: »Der glückliche Zufall wollte es, dass ich dazu berufen war, den Löwen zum Brüllen zu bringen.«
Was sind nach der Meinung dieses Welterfolgspolitikers übrigens die Eigenschaften, die einen fähigen Staatsmann ausmachen? Sir Winston rekurriert bei der Antwort auf diese Frage nicht auf die Historiker oder Philosophen, er zieht einen Vergleich aus der Tierwelt heran: »Zu einem guten Politiker gehören die Haut eines Nilpferdes, das Gedächtnis eines Elefanten, die Geduld des Bibers, das Herz des Löwen, der Magen des Vogels Strauß und der Humor einer Krähe. Diese Eigenschaften sind allerdings noch nichts wert ohne die Sturheit des Maulesels.«
Bleiben wir beim Thema, aber gehen wir vier Jahrhunderte zurück. Es ist kein Krieg, der Deutschland bedroht, aber es tobt dennoch ein gewaltiger Kampf, der das Land nachhaltig verändern wird. Es ist die Reformation, und ihr Held heißt Martin Luther. Darf man auch Martin Luther als stur bezeichnen? Ja, man darf. Stur und unbeirrbar hält er sein Leben lang an seinen Überzeugungen fest, auch da, wo es weh tut. Auch da, wo andere eingeknickt wären.
Luther wächst in einer Welt voller düsterer, enger und strenger Verhältnisse auf, in einer Gesellschaft der Unterdrückung, der Buße, der Strafe und der Furcht. Das beginnt im Elternhaus mit dem gestrengen Vater, der ihn schlägt. Es setzt sich fort in der Lateinschule, die nicht von ungefähr so heißt: Die Schüler haben sich lateinisch zu Wort zu melden, sonst trifft sie die Rute (der kleine Martin soll sie an einem einzigen Tag fünfzehnmal gespürt haben). Schließlich drückt auch das Klosterleben in Erfurt den Augustinermönch durch eine fortwährende Angst vor der Strafe Gottes, durch das Aufstehen um 2 Uhr früh und die erste Mahlzeit gegen Mittag physisch und psychisch nieder, Luther lebt in einem Kosmos aus Angst, Kontrolle und Strafe. Die Begriffe, die sein Leben und Denken bestimmen, heißen Sünde, Sühne, Beichte, Reue, die permanente Bedrohung ist ein Dauerschrecken aus fünf Buchstaben und heißt Hölle.
Aber er lehnt sich auf. Er erträgt die Unterdrückung nicht länger. Luthers Weg ist ein einziger Akt der Befreiung. Der Vater will, dass der Sohn Jurist wird, Martin setzt sich zum Zorn der Eltern darüber hinweg und tritt ins Augustinerkloster ein. Er ist bereits Doktor der Theologie, als er beim Studium des Römerbriefes eine Art Erweckungserlebnis hat. Er entdeckt die Freiheit der Christen, die darin liegt, dass Gott die Menschen durch Gnade erlöst, nicht als Belohnung für gute Werke, auch nicht durch andere Leistungen, sondern sola gratia, allein aus Gnade. Nur ein auf diese Weise gestärkter Christ wird später wie Luther die Kraft aufbringen, auch vor den höchsten weltlichen Herren, dem Kaiser und den Fürsten, standhaft seine eigene Meinung zu vertreten. Luthers Entdeckung der Gnade Gottes ist wiederum ein Befreiungsakt, eine Unabhängigkeitserklärung vor der Meinung der Welt.
Und so wie heute jeder Autor eines Bestsellers einen Nerv treffen muss, ein Bedürfnis sehr vieler Menschen, zu genau diesem Thema etwas Wissenswertes, Anregendes oder Agitierendes zu erfahren, so trifft der Doktor Martinus Luther im Jahr des Herrn 1517 punktgenau die Seelentemperatur eines ganzen Volkes, als er seine 95 Thesen unter die Menschen bringt. Es sind lauter kurze Sätze wie diese 21. These: »Daher irren die Ablassprediger, die da sagen, dass durch des Papstes Ablass der Mensch von aller Strafe los und selig werde.« Und die 36. lautet: »Ein jeder Christ, der wahre Reue und Leid hat über seine Sünden, der hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbrief gehört.«
Das ist eine Revolution. Das gemeine Volk soll keinen Papst, keinen Bischof, keinen Priester mehr brauchen zur Vergebung der Sünden? Vollkommene, ehrliche Reue allein soll schon genügen? Geld zu zahlen für Ablassbriefe ist unnötig und das Kassieren ein Betrug der Kirche an ihren Gläubigen? Das ist eine Kampfansage. Das richtet sich gegen das ganze damals etablierte System des Katholizismus, es greift den Papst persönlich an, denn Luther fragt, warum der reiche Mann aus Rom das Geld der Gläubigen braucht, um St. Peter zu bauen.
Der Ablasshandel ist ein geniales System zur Finanzierung der Kirche. Früher hatten die Gläubigen ihre Sünden, auch die intimsten, einem Priester beichten müssen, eine unangenehme Angelegenheit. Dem schlichten Volke wird nun eingeredet, durch den Erwerb eines Ablassbriefes Sünden tilgen zu können – im Nachhinein, im Voraus und sogar zur Abgeltung der Sünden verstorbener Angehöriger. Ohne Beichte, ohne Reue, ohne Buße, ohne den Vorsatz der Besserung. Wohin fließen die Gelder? Zur Hälfte dienen sie dem Bau des Petersdoms in Rom, die anderen fünfzig Prozent gehen im konkreten, Luther betreffenden Falle an den Bischof Albrecht. Der muss Schulden bei den Fuggern begleichen und bedient sich der exzellenten Verkaufstalente des Ablasshändlers Tetzel, der wiederum die Hälfte seiner Umsätze für sich behalten darf. Es handelt sich also um ein sehr frühes, sehr modernes Vertriebssystem, um eine Drückerkolonne im Auftrag des Herrn: Der Papst gewährt kraft seiner spirituellen Autorität den Nachlass der Sünden und kassiert von jedem eingenommenen Dukaten fünfzig Prozent, der Bischof als Zwischenhändler bekommt fünfundzwanzig Prozent und der Direktverkäufer Tetzel ebenfalls ein Viertel. Der Ablass für einen Meineid zum Beispiel kostet neun Dukaten, Vielweiberei wird schon für sechs verziehen.
Luther bemerkt den immer schwungvolleren Handel mit Ablässen daran, dass er immer weniger Menschen in seinem Beichtstuhl vorfindet. Sie kaufen lieber die anonyme Vergebung der Sünden, als sie zu gestehen. Er beobachtet die Sache genau und zieht in seinen 95 Thesen schließlich die Konsequenzen.
95 kurze Sätze. Aber welche Kraft in ihnen steckt! Wie ein Funke eine altersschwache Scheune voller Stroh in Minuten in ein loderndes Inferno verwandelt, so treffen diese Thesen den Geist der Zeit. Wie ein Lauffeuer sprechen sie sich herum, werden in gelehrten Kreisen, aber vor allem im Volk diskutiert und beklatscht. Luther hat die epochale Bedeutung seiner Sätze weder vorhergesehen noch erwünscht. Zum Shooting Star seiner Zeit wird er unfreiwillig. Er wird bejubelt und angegriffen, vor allem die Kirche macht Druck. Der päpstliche Legat bestellt ihn in Augsburg ein, Luther soll widerrufen. Doch der aufrechte und sture Theologe von der Universität Wittenberg denkt nicht daran.
Schließlich lädt ihn am 17. und 18. April 1520, zweieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung seiner Thesen, der Kaiser zum Reichstag nach Worms ein. Auf dem Weg dorthin wird Luther gefeiert wie ein Held, die Menschen säumen die Straße, um ihn zu sehen. Auf dem Reichstag selbst ist die Stimmung weit weniger freundlich. Der neu gewählte Kaiser Karl V. hat die Zusammenkunft einberufen. Der junge Monarch, soeben erst von den Kurfürsten auserkoren (sie heißen Kurfürsten, weil sie küren, also wählen dürfen) erweist sich letztlich als fairer Gegner.
Am 17. April also steht Doktor Martinus Luther vor dem Reichstag, vor dem Kaiser, den Fürsten und den Reichsständen. Wie angespannt er bei diesem Auftritt sein muss, zeigt sich indirekt an der Erleichterung, nachdem alles überstanden ist und er befreit ausruft: »Ich bin hindurch!« Noch aber steht er hier vor den Mächtigen des Reiches, und Luther lässt schon in seiner Anrede keinen Zweifel daran, wer hier die Chefs sind: »Allergnädigster Herr und Kaiser! Durchlauchtigste Fürsten! Gnädigste Herrn!«
Der Offizial des Erzbischofs von Trier befragt ihn streng: Sind diese Bücher hier von ihm? Kennt er den Inhalt? Ist er bereit zu widerrufen? Da geschieht das Ungeheure. Vor den Machthabern des ganzen Landes bittet der Mönch um Bedenkzeit. Was bildet er sich ein? Was glaubt er, wer er ist? Er lässt die hohen Herren warten! Karl V. gewährt ihm die Frist.
Nein, es ist keine Anmaßung, es ist eine Mischung aus Sturheit, Zivilcourage und dem unbeirrten Drang, das Richtige zu tun. Dass der Mann, der die Welt verändern wird, nicht auftrumpft, zeigt sich am nächsten Tag schon bei seiner Vorrede. Um 16 Uhr ist er wieder vor dem Reichstag erschienen. Wenn er aus Unkenntnis vielleicht irgendjemanden nicht in der richtigen Form anreden oder sonst gegen höfische Etikette verstoßen sollte, bittet er um Entschuldigung: »Denn ich bin nicht bei Hofe, sondern im engen mönchischen Winkel aufgewachsen.« Aber so demütig er im Ton beginnt, so hart bleibt er bei seiner Überzeugung. Nein, er widerruft nicht. Er nimmt sich das Recht, von der Freiheit, die er in jedem Christenmenschen erkannt hat, auch selbst Gebrauch zu machen, nur seinem Gewissen fühlt er sich verpflichtet. Und der Heiligen Schrift: Weder dem Papst, sagt er, noch den Konzilien wolle er sich unterordnen, denn es stehe fest, dass beide sich schon geirrt hätten. Gebunden fühlt er sich an die Bibel, er fühlt sich gefangen im Worte Gottes. Und dann spricht er die historischen Worte: »Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!« Dass er gesagt haben soll: »Hier stehe ich, ich kann nicht anders«, ist historisch nicht verbürgt.
Luther wird freies Geleit zugesichert, kurz darauf wird jedoch die Reichsacht ausgesprochen, er ist vogelfrei. Sein Kurfürst Friedrich der Weise lässt ihn entführen (mit Luthers Einverständnis) und auf die Wartburg bringen. Er ist inkognito dort, lässt Bart und Haare wuchern, nennt sich Junker Jörg. Er übersetzt die Bibel aus dem Griechischen in sein kraftvolles Deutsch, er leistet damit einen unschätzbaren Beitrag zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache. Der Rest ist bekannt.
Zwei Männer, mehr als vierhundert Jahre liegen zwischen ihnen, haben die Welt, in der sie lebten, nachhaltig beeinflusst, ja verändert. Wie würde Europa heute aussehen, hätte kein Winston Churchill sein Volk und die Alliierten angetrieben, Hitler zu widerstehen? Wie sähe Deutschland heute aus ohne Luther und die Reformation, ohne die folgenden Bauernkriege, den Dreißigjährigen Krieg, ohne das Pochen auf die Freiheit des Christenmenschen? Zwar gäbe es den einen und einzigen (katholischen) Glauben, aber wäre Deutschland nicht ärmer ohne diese prägende evangelische, freiheitliche, mal verkniffen schmallippige, mal liberal bis radikaldemokratische Fähigkeit zum Diskurs?
Zwei historische Figuren, kaum vergleichbar, waren zur rechten Zeit zur Stelle und ließen sich nicht von ihrem Wege abbringen, gleichgültig, wie heftig der Wind des Zeitgeistes ihnen entgegenblies. Wir staunenden Betrachter lernen: Sturheit kann etwas sehr Gutes und Folgenreichendes sein.
Sich anstacheln lassen mit Hillary Clinton
Sie hatten einen überaus strengen Vater? Der überdies außerordentlich starrköpfig war, keine andere Meinung gelten ließ und geizig war bis zum Exzess? Das mag alles unangenehm für Sie gewesen sein. Aber gut für Ihre Karriere. Möglicherweise hätten Sie es mit diesem familiären Hintergrund bis zur Senatorin von New York gebracht. Wie Hillary Clinton.
Sie wuchs mit einer Mutter auf, deren albtraumartige Kindheit auch Charles Dickens nicht grausamer hätte erfinden können. Und Hillarys Dad war, wie sie selbst in ihrem Erinnerungsbuch Gelebte Geschichte schreibt, »unglaublich sparsam und konnte Verschwendung nicht ertragen«. Selbst über ein neues Kleid für Hillarys Abschlussball musste wochenlang hart mit ihm verhandelt werden. »Vergaß eines von uns Kindern, die Verschlusskappe auf die Zahnpastatube zu schrauben, warf mein Vater diese aus dem Fenster und wir mussten hinausgehen, und sei es bei Schnee, um in den Büschen vor dem Haus danach zu suchen.« Und als die kleine Hillary im vierten Schuljahr in Mathe nicht mitkam, da weckte er sie morgens extra früh auf, um die Multiplikationstabellen mit ihr zu pauken. Brachte sie gute Noten heim, knurrte er nur: »Dann kann die Schule ja nicht so schwer sein.«
Grässlich, oder? Auf einen solchen Vater hätten Sie dankend verzichtet? Klar, aber aus Ihnen ist eben auch nicht Hillary Clinton geworden. Die im Laufe ihres Lebens noch einiges wegstecken musste. Ihre härteste Bewährungsprobe dürfte die Lewinsky-Affäre gewesen sein. Sie begann relativ harmlos: »Am Morgen des 21. Januar, es war ein Mittwoch, weckte mich Bill früh am Morgen. Er setzte sich auf die Bettkante und sagte: ›Es steht etwas in den Zeitungen, das du wissen solltest.‹«
Was dann folgte, war der Tornado einer Affäre, wie ihn die Welt selten erlebt hat, an dessen Ende Millionen Menschen nicht nur in Amerika aus dem Internet erfuhren, was eine gewisse Monica Lewinsky in einem Abhörprotokoll über sexuelle Handlungen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von sich gab. Fast bis zum Schluss war Bill Clinton gegenüber seiner Frau feige geblieben: »Er stritt jegliches unangemessene Verhalten ab, gestand jedoch ein, dass die junge Frau seine Aufmerksamkeit möglicherweise falsch interpretiert haben könnte.«