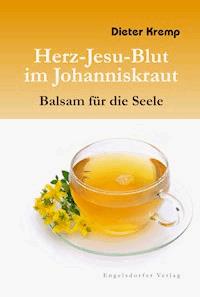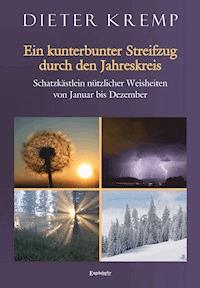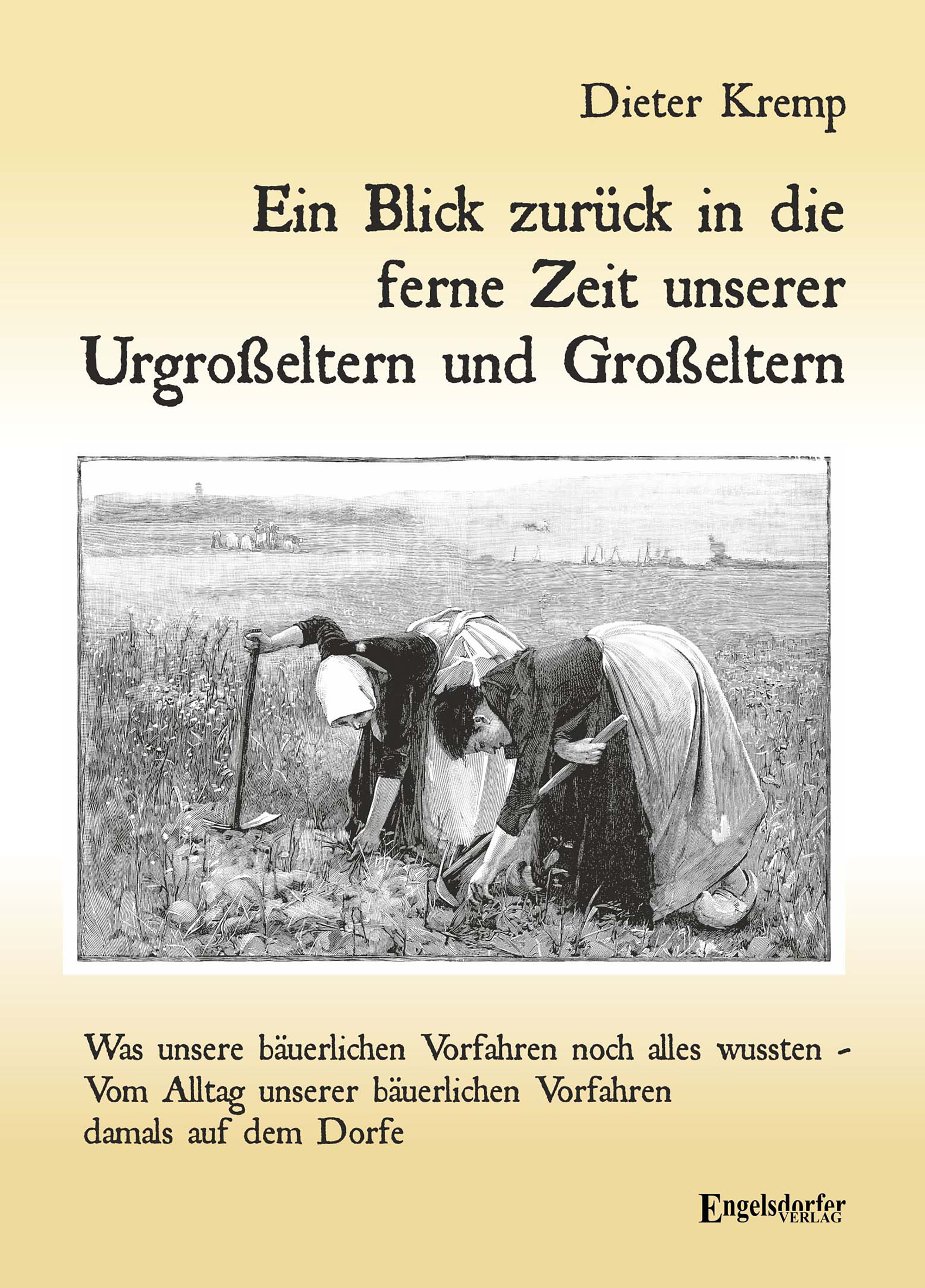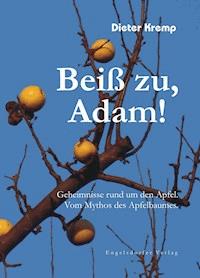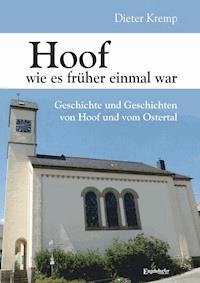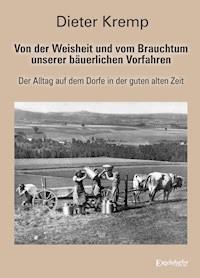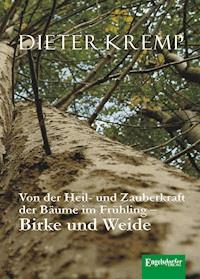
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als junger Baum ist die Birke am schönsten. Später gleicht sie einer alten Frau, die ihre Falten mit viel Schminke zu verstecken sucht. Zusammen mit der Weide ist die Birke der leibhaftige Frühling, einer Baumnymphe gleich, die an einem Frühlingstag in ihrem zartgrünen Blätterkleid die Jugend verkörpert, das Wachsen und das Wiederauferstehen. Das Birkenfest unserer Vorfahren war eine Freudenfeier der Wiedergeburt und der Hochzeit zwischen Himmel und Erde. Im zeitigen Frühjahr, wenn und die Schwere und Müdigkeit noch in den Gliedern steckt, dann ist es Zeit für eine Frühjahrskur mit erfrischendem Birkensaft. Die gekrümmten Gestalten der Weiden, in zottige Fetzen gehüllt, mit aufgedunsenen Köpfen und wild zu Berge stehenden Haaren waren bei unseren Vorfahren Hexenbäume. Die Weide galt aber auch als heilender Baum, der die Fähigkeit besaß, Unheil und Krankheit auf sich zu nehmen. Das ursprüngliche heidnische Fest der blühenden Weidenzweige war so stark im Volk verwurzelt, dass die Kirche es nach der Christianisierung nicht unterdrücken konnte. Die samtweichen Weidenkätzchen wurden zu Palmkätzchen am Palmsonntag. Schon in der Volksmedizin früherer Zeiten wurde die Weidenrinde zur Behandlung von Fieber, Schmerzen und rheumatischen Erkrankungen verwendet. Der in der Weidenrinde vorhandene Wirkstoff Salicin wurde später zum Aspirin in der Schulmedizin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Kremp
Von der Heil- und Zauberkraft der Bäume im Frühling – Birke und Weide
Birkensaft als Frühjahrskur und Aspirin in der Weidenrinde
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2012
Alle Angaben der Rezepte und Wirkungen sind ohne Gewähr!
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Coverfoto © Tino Hemmann
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhalt
Gewidmet meinen Enkelkindern Helena, Joshua und Samuel,
meiner Frau Waltrud, meiner Tochter Julia, meiner Schwiegertochter Jutta,
meiner Schwester Ursula, meinem Sohn Stefan und Schwiegersohn Dieter.
Die Birke ist der leibhaftige Frühling
Alte Bäume sind etwas Herrliches! Mit ihrem mächtigen Stamm, den kräftigen Ästen und dem riesigen Blätterdach scheinen sie den Himmel zu tragen. Je älter ein Baum wird, umso mehr festigt sich sein ihm eigener Charakter in der Baumgestalt. Er wird immer mehr zur Persönlichkeit.
Die Birke macht da eine Ausnahme. Als junger Baum ist sie am schönsten. Später gleicht sie einer alten Frau, die ihre Falten mit viel Schminke zu verstecken sucht.
Aber in der Jugend übertrifft sie alle anderen Bäume an Schönheit und Grazie. Der weiße, schlanke Stamm ist so elegant und das feingliedrige, zartgrüne Blattkleid so anmutig.
Sie ist der leibhaftige Frühling. Eine Baumnymphe, die der Birke an einem Frühlingstag entstiege, würde sicher den zarten, blumigen Frauengestalten auf den Bildern Botticellis gleichen.
Haselstrauch, Birke und Erle gehören zur Familie der Birkengewächse. Jeder dieser drei Bäume war für die Menschen das Sinnbild eines bestimmten Punktes im Kreislauf des Lebens. Die Haselnuss stand am Anfang als Baum der Kinder und der Zeugung, die Birke verkörperte die Jugend, das Wachsen und Entstehen, die Erle symbolisierte das Alter, welches schon mit dem Geheimnis des Todes vertraut wird.
Das Fest der Birke wird bei uns schon seit uralter Zeit gefeiert, denn die Heimat dieses Baumes sind die nördlichen, gemäßigten und arktischen Gebiete.
Auf Island und Grönland waren die Birken sogar einmal die einzigen Bäume. In diesen Ländern, in denen Väterchen Frost besonders arg wütet, ist die Freude groß über den Frühling mit seinen ersten, sich begrünenden Bäumen: Weide und Birke. Während die Weide den Frühling und auch das Absterben symbolisierte, war die Birke ein Baum der reinen Freude. Ihr Fest war jedes Mal eine Freudenfeier der Wiedergeburt und der Hochzeit zwischen Himmel und Erde.
Der bekannteste Brauch um die Birke war der des Maibaums, der noch in unserer Zeit lebt.
Am ersten Mai holten die jungen Burschen des Dorfes eine große Birke aus dem Wald, schmückten sie mit bunten Bändern, Eiern, Brezeln und Kuchen.
Manchmal, so wie es bei einem russischen Pfingstbrauch üblich war, wurde der Baum mit Frauenkleidern behängt, und so zur leibhaftigen Frühlingsgöttin gemacht.
Mit der Birke als Maibaum holten sich die Dorfbewohner einen Teil der neu erwachten Natur in ihr Dorf und stellten ihn als Pfand auf dem Dorfplatz auf, damit die Frühlingsgöttin ihre Familien segne. Auch für die einzelnen Höfe wurden am ersten Mai kleinere Birken gehauen und vor die Tore und Türen gestellt. An diesem Tag zogen in vielen Gegenden Europas die Menschen singend hinaus in den Wald, um »den Mai zu suchen«.
Auch das »Pfeffern« oder »Schmackostern«, das noch im 19. Jahrhundert weit verbreitet war, hat seinen Ursprung in alten, heidnischen Maifeiern. Frische Birkenzweige wurden zur Lebensrute, mit der die jungen Männer durchs Dorf zogen und die Bevölkerung, besonders die jungen Mädchen, pfefferten, d. h. schlugen. Wer mit solch einer Lebensrute eins übergezogen bekam, der war vor Krankheit für das weitere Jahr geschützt.
In der Nacht zum ersten Mai, in der »Hexen- oder Walpurgisnacht«, stellten die jungen Männer ihrer Angebeteten ein Birkenbäumchen vors Haus, als Zeichen ihrer Liebe und als symbolischen Heiratsantrag.
Warum es gerade in dieser Nacht zum ersten Mai Liebeserklärungen und Heiratsanträge nur so hagelte, das hat seinen Ursprung wieder in sehr alter Zeit. Das Fest der Urmutter, aus der später die germanische Frühlings-, Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin Freya wurde, die hier in Form einer Birke verehrt wurde, das man in allen Kulturen zu Jahresbeginn feierte, stand immer im Zusammenhang mit der geheimnisvollen, heiligen Hochzeit, der Hieros Gamos. Die Urmutter, und mit ihr die ganze Erde, feierte in der Zeit des Neuerwachens der Natur Hochzeit mit dem Himmel. Beide, Himmel und Erde, müssen sich zusammentun, damit ein neuer Anfang entsteht. Ein Königs- oder Priesterpaar vollzog diese Hochzeit stellvertretend im Tempel, um die Fruchtbarkeit des Landes neu zu erwecken.
In Prozessionen trug man die frohe Botschaft des Neubeginns durch das Dorf und auf die Felder hinaus. Hochzeiten, die in diesen Tagen geschlossen wurden, galten als besonders glücklich.
Die wilden Feiern wurden später zu bösen Hexennächten wie die Walpurgisnacht umgemünzt.
Und wer war der Bräutigam der schönen Frühlingsgöttin?
Auf der Suche nach ihm stößt man auf einen wilden Gesellen. Es ist der Laubmann, der Pfingstbutz, wilde Mann, grüne Georg und zuletzt der heilige Georg.
Während der vorchristlichen Maiumzüge wurde ein männlicher Vegetationsdämon mitgeführt. Er war entweder eine geschmückte Strohpuppe oder ein ganz in Laub und Moos gehüllter Mann. Wahrscheinlich hat er so ähnlich ausgesehen wie die »wilden Männle« aus Oberstdorf, die alle fünf Jahre ihren uralten heidnischen Tanz aufführen, oder wie die vermummten Maskenmenschen bei der Fastnacht in Süddeutschland.
Dieser Dämon war besonders für die Fruchtbarkeit der Haustiere und für das Regenmachen zuständig. Er symbolisierte jedoch auch die Notwendigkeit des Sterbens, um neues Leben entstehen zu lassen. Deshalb wurde er am Ende der Frühjahrsfeiern in den Bach geworfen oder während eines wilden Reiterfestes besiegt.
Aus dem grünen Georg ist der heilige Georg geworden, der noch heute am St. Georgstag die Pferde segnet.
Nach der Christianisierung haben die weltlichen und geistlichen Herren immer wieder versucht, die alten Maifeiern zu verbieten. Den Fürsten ärgerte es, dass alljährlich viele Birken aus seinem Waldbesitz geschlagen wurden. Es sind Aufzeichnungen überliefert, die vom strikten Verbot der Maibäume sprechen.
Auch der Kirche wäre es lieber gewesen, wenn nicht jedes Jahr zur Maienzeit die alten heidnischen Götter zu neuem Leben erweckt worden wären.
Die Kirchenväter haben schließlich Kompromisse schließen müssen, und der alte Maibrauch wurde dann zum Fronleichnamsfest umgewandelt. Jetzt durften die Straßen wieder mit Birkenzweigen und Birkenbäumchen geschmückt werden.
Die Birke ist ein Lichtbaum. In einem dunklen Wald kann sie nicht gedeihen. Birkenwälder sind immer licht und hell, das leichte Blätterdach lässt noch genügend Licht auf den Boden fallen.
Ansonsten stellt die Birke keine weiteren Ansprüche an ihren Standort. In einem Birkenwald stellt sich jedoch keine reichhaltige Flora unter den weißen Stämmen ein. Die Wurzeln der Birke holen ihre Nährstoffe nicht nur aus der Tiefe, sondern streichen auch an der Oberfläche entlang und entziehen der oberen Schicht die Nährstoffe. Da bleibt nicht mehr viel übrig für andere Pflanzen.
Dass die Birke auch auf dem feuchtesten Boden gedeihen kann, hat sie bereits vor Jahrtausenden bewiesen. Damals, nachdem sich die Eisgletscher gegen Ende der Eiszeit zurückgezogen hatten und eine feuchte, baumlose Moorlandschaft zurückließen, gehörte die Birke zu den ersten Bäumen, die das Neuland besiedelten. Noch heute werden Birken auf Ödland, Geröllhalden und feuchten Böden zum Befestigen und Entwässern angepflanzt.
Selbst ein eisiger Winter kann der Birke nicht schaden, denn ihre luftgepolsterte Rinde ist ein guter Kälteschutz. Kein Laubbaum ist so winterhart wie die Birke. Außerdem ist die Birkenrinde besonders wasserundurchlässig.
Diese Eigenschaften der Rinde haben sich die Menschen nördlicher Breitengrade zu Nutzen gemacht. Sie gebrauchten die Birkenrinde zum Abdecken der Häuser und schufen so wasserdichte und gut isolierte Dächer.
Die Indianer Nordamerikas verwendeten die Rinde der dort heimischen Birkenarten zum Bau ihrer besonders leichten Kanus.
Die Rinde junger Birken lässt sich wie Leder gebrauchen, sie ist weich und geschmeidig. Die Lappländer fertigten aus ihr sogar Umhänge und Gamaschen.
Die innere Rinde enthält viel Zucker, Öl und sogar Vitamin C. Sie war für die Indianer und so manchen Trapper oder Goldsucher in besonders strengen Wintern eine Notration, die das Leben retten konnte. Essbar ist aber nur die zarte, gelbe Innenrinde, das Cambium, das vorsichtig abgeschabt werden muss, nachdem man die äußere Rinde entfernt hat. Die Indianer zerschnitten sie in kleine Stücke, trockneten und pulverisierten sie. Aus diesem »Birkenmehl« backten die Frauen eine Art Pfannkuchen.
Ein weiterer Bestandteil der Rinde ist ein hoher Gehalt an Gerbstoff. Deshalb war die Rinde ein gebräuchliches Mittel zum Gerben. Die mit Birkenrinde behandelten Felle strömen einen intensiven, würzigen Geruch aus. Daran lassen sich die »Juchtenleder«, die mit Birkenrinde gegerbten Felle, von den mit anderem Material gegerbten ellen unterscheiden.
Die Rinde blättert nicht in dicken Schuppen ab, sondern sie schält sich elegant in papierähnlichen Querbändern. Dieses »Baumpapier« war früher ein billiges Schreibmaterial.
Hieronymus Bock berichtet darüber in seinem Kräuterbuch, das im 16. Jahrhundert erschein:
»Der Birkenbaum ist vor zeitten in grosser würde gewesen / darumb das man auff die weissen Rinden des selben baums etwas geschriben / ehe dann die lumpen zum Papyr erfunden seind worden / wie ich daselbs zu Chur im Schweitzerland etlich Carmina Vergilii auff weisse Birkenrinden geschriben / gesehen und gelesen hab/«
Vom Birkenholz lässt sich nicht viel Rühmliches berichten. Es ist nicht von bester Qualität. Sehr selten wird es zum Möbelbau verwendet.
Aber es ist ein Geheimtipp für alle, die im nassen Wald ein Feuer entfachen müssen. Das Holz brennt auch im frischen und feuchten Zustand durch den eingelagerten Birkenteer. Auch die feine, innere Rinde ergibt einen guten Zunder bei feuchtem Wetter. Durch den Birkenteer brennt das Holz mit einer sehr hellen Flamme, weshalb es bevorzugt zum Verbrennen im offenen Kamin gebraucht wird.
Im zeitigen Frühjahr, wenn die Schwere und Müdigkeit noch in den Gliedern steckt, dann ist es Zeit für eine Frühjahrskur, die den Körper reinigt und neu belebt.
Gerade jetzt ist die Birke zu neuem Leben erwacht. Sie schiebt ihre harzig duftenden Blätter heraus, und in den Stamm steigt süßer Saft.
Jetzt hat die Birke in Blättern und Saft die meisten Heilstoffe und bietet sich für eine Frühjahrskur geradezu an. Ihre Heilstoffe bilden zusammen eine gelungene Komposition, die belebend und reinigend auf den menschlichen Körper wirkt.
Die Birke, die als Moorbewohner so gut mit dem Wasser umzugehen weiß, kann als Heilmittel in den Wasserhaushalt des menschlichen Körpers regulierend eingreifen. Sie regt Blase und Niere an und hilft so bei Wassersucht, Rheuma, Gicht, Arthritis, Nieren- und Blasensteinen.
Diese Eigenschaften wirken sich außerdem günstig zur Behandlung verschiedenster Hautkrankheiten aus, da neben Blase und Nieren die Ausscheidungstätigkeit der Haut angeregt wird. Schon bei den alten Germanen galt der Birkensaft als Schönheitstrunk. Zur Unterstützung empfiehlt sich auch die äußerliche Anwendung in Form von Waschungen und Umschlägen mit Birkenwasser und Birkenblättertee.
Nicht umsonst peitscht man in nordischen Saunen mit frischen Birkenreisern, denn dies unterstützt die Ausschwitzungen der Haut.
Für einen Birkenblättertee sammelt man die jungen, noch klebrigen Blattknospen im April oder Mai. Durch ihren hohen Gehalt an ätherischem Öl strömen sie einen balsamischen Duft aus. Nach dem Sammeln müssen sie gleich zum Trocknen auf einem Tuch oder feinen Gitterrost ausgebreitet werden. Bei feuchter Witterung sollte man die Blättchen bei sehr niedriger Temperatur im Backofen trocknen.
Von den getrockneten Blättern reichen 2 Teelöffel auf eine Tasse Wasser. Man übergießt sie mit dem kochenden Wasser und lässt 10 Minuten ziehen. Die Frühjhrskur sollte ca. 3 Wochen dauern. In diesem Zeitraum trinkt man täglich 2 bis 3 Tassen Tee.
Eine noch durchgreifendere Wirkung hat der frische Birkensaft. Wenn im März und April die Säfte in den Stamm steigen, dann ist die günstigste Zeit, um eine Birke zu »melken«.
Eine kräftige Birke übersteht das Anzapfen ohne Schaden, wenn es nur alle zwei Jahre wiederholt wird.
In ca. einem Meter Höhe bohrt man die Birke etwa 3 cm tief an. Der Durchmesser des Bohrloches sollte nicht viel mehr als ½ cm betragen. Nun steckt man ein Glasröhrchen in die Öffnung und bindet einen Behälter um den Baum, so dass der Saft aufgefangen wird. Nie ein Metallgefäß verwenden, sondern nur emaillierte oder Kunststoffbehälter. Statt einem Glasröhrchen kann man auch ein Stückchen von einem Holunderast verwenden. Das Mark lässt sich leicht herausschieben.
Nach einem »Aderlass« von 2 bis 3 Litern muss der Baum wieder gut verschlossen werden, da er sonst verbluten kann. Man besorgt sich für diese Operation Baumwachs oder Pech. Normales Wachs eignet sich nicht dafür, denn es rutscht wieder heraus.
Der frische Saft ist eine glasklare Flüssigkeit, die leicht süßlich schmeckt. Zu einer Trinkkur genehmigt man sich davon täglich 2 Schnapsgläschen, so lange bis die 2 oder 3 Liter aufgebraucht sind.
Und da ergibt sich schon eine Schwierigkeit. Der Saft beginnt sehr schnell zu gären. Deshalb muss er im Kühlschrank aufbewahrt werden. Man kann ihn auch portionsweise im Gefrierfach einfrieren. Gibt man in die Flaschen eine halbe Stange Zimt und einige Gewürznelken, so hält sich der Saft länger durch die keimtötende Eigenschaft des Zimtes und der Nelken.
Der Saft kann auch äußerlich verwendet werden. Er ist ein gutes Waschmittel für schlecht heilende Wunden und Hautausschläge. Will man ihn hierfür das ganze Jahr zur Verfügung haben, so gibt man ein Drittel der Menge hochprozentigen Alkohol dazu. Als Wundmittel kann er mit Arnikatinktur gemischt werden. Gleichermaßen ist der Saft ein gutes Gesichtswasser. Er reinigt und pflegt die Haut.
Als haarwuchsförderndes Mittel ist der Birkensaft noch sehr populär. Hier ist ein Rezept für en hausgemachtes Haarwasser:
Birkenhaarwasser
Man nimmt 2 Handvoll frische Birkenblätter, 1 Esslöffel Brennnesselwurzeln, 2 Esslöffel Brennnesselblätter, 1 Esslöffel Kapuzinerkresse, Blätter und Blüten, 1 Esslöffel Arnikablüten, ½ Esslöffel Rosmarin, eventuell 4 Gewürznelken, 1 Liter 70%iger Alkohol.
Die Birkenblätter sollten frisch gepflückt sein. Alle anderen Kräuter können auch in getrocknetem Zustand verwendet werden, jedoch ergeben frische Kräuter ein besseres Haarwasser.
Alles in ein Schraubglas füllen und mit dem Alkohol übergießen. Verschließen und 3 Wochen ziehen lassen. Gelegentlich umschütteln. Abseihen und in eine Tropfflasche füllen.
Birkenlegendchen
Wegen ihrer grazilen Schönheit galt die Birke oft als die Baumnymphe schlechthin. Börries von Münchhausen besang in seinem Gedicht »Birkenlegendchen« ihre Mädchengestalt:
Birke, du schwankende, schlanke,
Wiegend am blassgrünen Hag.
Lieblicher Gottesgedanke
Vom dritten Schöpfungstag!
Gott stand und formte der Pflanzen
Endlos wuchernd Geschlecht.
Schuf die Eschen zu Lanzen,
Weiden zum Schildegeflecht.
Gott schuf die Nessel zum Leide,
Alraunenwurzeln zum Scherz.
Gott schuf die Rebe zur Freude,
Gott schuf die Distel zum Schmerz.
Mitten in Arbeit und Plage
Hat er leise gelacht,
Als an den sechsten der Tage,
Als er an Eva gedacht.
Sinnend in göttlichen Träumen
Gab seine Schöpfergewalt
Von den mannhaften Bäumen
Einem die Mädchengestalt.
Göttliche Hände im Spiele
Lockten ihr blonden das Haar,
Dass ihre Haut ihm gefiele,
Seiden und schimmernd sie war.
Biegt sie und schmiegt sie im Winde
Fröhlich der Zweiglein Schwarm,
Wiegt sie, als liegt ihr in Kinde
Frühlingsglückselig im Arm.
Birke, du mädchenhaft schlanke,
Schwankend am grünenden Hag,
Lieblicher Gottesgedanke
Vom dritten Schöpfungstag.
(Börries von Münchhausen)
Die Birke – der mythische Baum der Nordländer
Den nordischen Völkern ist die Birke Sinnbild des Frühlings und seiner Lebenskraft. In Gestalt des Maibaums ist sie Symbol der erwachenden Liebe, sie liefert die Lebensrute, deren Schlag gesund und fruchtbar macht und vor Verhexung bewahrt.
Die Isländer hielten die Birke für wunderwirkend, ihre Priester beteten zu ihr und richteten Zaubersprüche an sie. In einem alten Runenlied heißt es:
»Beoak (Birke) ist früchtelos,
trägt eben wohl
Zweige ohne Samen.
Doch in der Spitze
rauscht sie, lieblich
bewachsen mit Blättern
von der Luft bewegt.«
In ihrer nordischen Heimat ist sie eng mit dem Leben des Menschen verbunden, vieles gibt sie ihm zu seinem täglichen Bedarf: Kleidung, Feuerung, Geräte für Haus und Hof, Heilmittel und anderes mehr.
Sie ist der Lieblingsbaum der Finnen, der weltschöpferische Baum. Im Nationalepos der Finnen, der Kalevala, rodet der Held Väinämoinen den Wald, um Ackerland zu schaffen; eine Birke aber lässt er stehen:
»Väinämoinen alt und weise,
der bestellt ein scharfes Beil sich,
alle schönen Bäume stürzt er,
rodet er das große Brandland,
ebnet ungemessenen Boden,
bleiben lässt er eine Birke,
recht als Vogelrufplatz fertig,
recht als Kuckucksrufplatz künftig.
Her vom Himmel kam ein Adler,
er, der oberen Lüfte Vogel,
kam alles anzuschauen:
»Warum ward denn so gelassen
diese Birke ungebrochen,
ungestürzt der schöne Baum nur?«
Sprach der alte Väinämoinen:
»Deshalb ist sie so gelassen,
allen Vögelein zum Ausruhn,
hier des Himmels Aar zu Sitzen.«
Bei einer Überschwemmung der Erde rettet sich der Weltgeist in Gestalt eines Adlers auf die Birke. Als Dank dafür, dass Väinämoinen die Birke verschonte, nimmt der Adler den Heiden, der tagelang hilflos umhergeschwommen war, auf seinen Rücken und gibt ihn der Erde zurück.
Für die Germanen war die Birke ein heiliger Baum; auch sie war der Freya (Frigga), der Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit geweiht. Ihr zu Ehren pflanzte man den Maibaum, unter ihm huldigte man der Göttin und feierte so das Erwachen der Natur. Gegen diesen heidnischen Brauch wetterten die christlichen Glaubenseiferer; auch die weltliche Obrigkeit folgte beflissen den Wünschen der Kirche und stellte das Einholen des Maibaums unter schwere Strafe – vergebens, der Brauch hat sich bis heute gehalten.
Denn noch immer stellen die heiratswilligen Burschen junge Birkenzweige vor die Haustür der Angebeteten; sie stehen dort als Symbol des Frühlings und der Liebe. In Niederbayern treibt man immer noch das Vieh mit Birkenzweigen aus den Ställen auf die Weide. Die Birkenzweige schützen als Lebensruten die Tiere vor Krankheiten und Schäden, und sie sorgen auch dafür, dass die Kühe fruchtbar blieben und das ganze Jahr über reichlich Milch gaben.
Die gleichen Bräuche gab es auch in Russland. Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde dort die Birke verehrt, ja angebetet. Hier gingen jedoch die Mädchen in den Wald, um den Baum zu holen. Dabei sangen sie:
»Freut euch nicht, Eichen,
freut euch nicht, grüne Eichen,
nicht zu euch gehen die Mädchen,
nicht euch bringen sie Kuchen,
Backwerk, Omletten.
So, so Semik und Troitsa!
Freut euch ihr Birken,
freut euch ihr grünen!
Zu euch gehen die Mädchen,
Euch bringen sie Kuchen,
Backwerk und Omletten.«
Birkenreiser wurden in ganz Europa zum Abstecken von Grenzen und zum Auspeitschen von Delinquenten und Irren verwendet, da man der Meinung war, damit böse Geister vertreiben zu können. Im keltischen Alphabet steht die Birke als erster Baum für den Buchstaben B , denn sie ist der Baum des Anfangs. Sie ist der erste Baum des Waldes, der Blätter ansetzt. Nach ihm richten sich die Bauern bei der Aussaat des Sommergetreides.
Das keltische Horoskop sah die Birke als die Schöpferische, sie stand für die am 24. 6. Geborenen, dem Tag des Sonnenhöchststandes. Es heißt dort: »Die Birke ist ein zarter und schöner Baum; lebhaft, anziehend und elegant. Sie ist anspruchslos und verlangt nicht viel. Selbst frei von Überheblichkeit und Snobismus, verabscheut sie alles Vulgäre und Pöbelhafte. Sie liebt das Leben in der Natur, kann sich aber auch mit Leichtigkeit jeder anderen Lebensweise anpassen, - wenn man sie in Ruhe arbeiten lässt. Und lassen Sie sich nicht durch ihr zartes Aussehen täuschen, sie kann arbeiten wie ein Berserker.
Das Liebesleben der Birke ist nicht besonders leidenschaftlich, dafür ist sie aber in ihren Gefühlen beständig und treu. Sie tut alles nur Denkbare, damit ihr Partner mit ihr glücklich wird. Und nie wird sie eine Wahl bereuen, es sei denn, sie hat es besonders schlecht getroffen. Ihre Intelligenz ist überdurchschnittlich und mit Vorstellungskraft gepaart. Deshalb wird sie unter günstigen Bedingungen immer eher schöpferisch tätig werden.«
Vom Wunder und der Zauberkraft der Birke
Junge Birken, die in Ruinen wachsen, waren oft Anlasss für Sagen, wurden mit zauberhaften Wesen in Verbindung gebracht. Im niederbayrischen Kötzing suchte ein Bauer nachts in der Burgruine seine entlaufene Kuh. Dabei traf er eine weiße Frau, die ihn um Erlösung bat: »Denn erlöst du mich nicht, so muss ich wandern, bis aus jenem Birkenzweig ein Baum wird, bis aus dem Baum Bretter geschnitten, aus den Brettern eine Wiege gemacht, in der Wiege ein Knabe gewiegt und dieser zwanzig Jahre alt ist.«