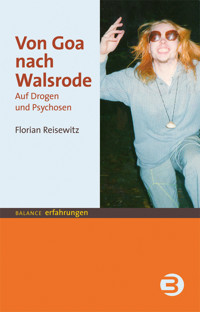
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BALANCE Buch + Medien Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: BALANCE erfahrungen
- Sprache: Deutsch
Mit 18 Jahren kommt Florian Reisewitz in Berührung mit der Goa-Szene – einer Musik-Szene, die wie kaum eine zweite mit dem Konsum von psychedelischen Drogen verknüpft ist. Eine Tatsache, die nicht ohne Folgen bleibt. Mitreißend und ehrlich beschreibt der Autor, wie sich schleichend eine Psychose nähert, die ihn mehr als einmal in die Psychiatrie nach Walsrode führt. Ein Erfahrungsbuch – und mehr als das: ein Insiderbericht über eine besondere Partylandschaft, eine eindrückliche Schilderung von wahnhaftem Erleben und ein empathischer Blick auf das hartnäckige Engagement, aber auch auf die zeitweilige Hilflosigkeit von Helfenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von Pilzen und Psychosen
»Im Grunde ist es egal, ob jener Texaner mir nun etwas in den Drink gemixt hat oder nicht. Ich habe natürlich immer wieder darüber nachgedacht. Aber ändern konnte ich es nicht mehr, und vielleicht wäre die ganze Geschichte auch ohne diesen Menschen früher oder später ins Rollen gekommen.«
Florian Reisewitz
Von Goa nach Walsrode
Auf Drogen und Psychosen
B A L A N C E erfahrungen
Florian Reisewitz
Von Goa nach Walsrode
Auf Drogen und Psychosen
BALANCE erfahrungen
1. Auflage 2019
ISBN-Print: 978-3-86739-124-5
ISBN-PDF: 978-3-86739-927-2
ISBN-ePub: 978-3-86739-928-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
In diesem Buch werden stellenweise die Wirkungen einzelner Medikamenten beschrieben. Die Handelsnamen der besprochenen Medikamente sind mit dem Zeichen ® gekennzeichnet. Aus dem Fehlen dieser Kennzeichnung darf aber nicht auf die freie Verwendbarkeit eines Medikamentennamens geschlossen werden, es kann sich um gesetzlich geschützte Warenzeichen handeln, die nicht ohne Weiteres benutzt werden dürfen. In der Geschichte werden auch Suizidversuche thematisiert. Wenn Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie – auch anonym – mit anderen Menschen über Ihre Gedanken sprechen können. Das geht telefonisch, im Chat, per E-Mail oder persönlich. Eine Übersicht gibt die Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de. Am Ende dieses Buches finden Sie hilfreiche Anlaufstellen.
© BALANCE buch + medien verlag, Köln 2019
Der BALANCE buch + medien verlag ist ein Imprint der Psychiatrie Verlag GmbH, Köln. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
Umschlagkonzeption und -gestaltung: GRAFIKSCHMITZ, Köln, unter Verwendung eines Bildes aus einer Privatsammlung
Lektorat: Katrin Klünter, Köln
Typografiekonzeption und Grafiken: Iga Bielejec, Nierstein
Satz: BALANCE buch + medien verlag, Köln
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
Für Torben Beitzel
Vorwort
Dies ist die Geschichte einer psychischen Erkrankung, meiner Erkrankung. Sie erzählt, wie eine Psychose bei mir ausbrechen konnte, wie sie sich festgesetzt hat und wie ich sie erlebt habe. Ich werde hier sowohl über die manischen als auch die depressiven Phasen berichten, so gut ich mich daran erinnern kann. Und ich kann mich an einiges erinnern, obwohl ich gerade in den akut psychotischen Phasen sehr weit weg von einer normalen Sicht auf die Realität war. So lustig oder amüsant sich manche Ereignisse lesen werden, so möchte ich doch an dieser Stelle betonen, dass ein psychotischer Schub eine unglaubliche Belastung für Körper und Geist ist und ich mich in solchen Phasen meist extrem unwohl gefühlt habe. Ich hatte keine Möglichkeit, aus mir selbst heraus den Gedanken und den Eingebungen, die mich bestürmten, zu entfliehen.
Andere Ereignisse sind dagegen weniger amüsant zu lesen. So gehören zu meiner Geschichte auch mehrere, teilweise krasse Suizidversuche, die glücklicherweise immer gut ausgingen. Aber die negativen Gedanken können sehr mächtig sein und zu dramatischen Fehlentscheidungen führen. Falls Sie selbst oder Menschen aus Ihrem Umfeld unter solchen Suizidgedanken leiden: Bitte, suchen Sie sich Hilfe! Bleiben Sie nicht allein mit Ihren Gedanken! Am Ende dieses Buches sind gute erste Anlaufpunkte aufgelistet. In diesem Text beschreibe ich stellenweise auch die Wirkungen unterschiedlicher Neuroleptika. Hier stelle ich allerdings meine ganz persönlichen Erfahrungen dar. Neuroleptika wirken bei jedem Menschen anders: Was mir geholfen hat, kann anderen wenig nützen oder gar schaden. Daher gibt es kein Allgemeinrezept, keinen »goldenen Weg«.
Dieser Text möchte den Konsum von Drogen in keiner Weise verharmlosen oder gar verherrlichen. Ich beschränke mich in meinen Beschreibungen auf die Dinge im jeweiligen Moment und halte mich mit Kommentaren oder Bewertungen eher zurück. Hier gehe ich einerseits meinem ursprünglichen Schreibimpuls nach, das Erlebte zu verarbeiten, andererseits möchte ich Sie möglichst unvermittelt und plastisch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Wenn der Text dazu führt, dass der ein oder andere eine eher lockere Einstellung gegenüber Partydrogen relativiert, dann wäre für mich ein wichtiges Ziel erreicht.
Ein weiteres Ziel meines Textes ist es, dazu beizutragen, dass sich Unkenntnis über psychische Erkrankungen und Angst vor psychisch Erkrankten verringern. Eine solche Erkrankung ist in unserer Gesellschaft immer noch mit einem Stigma verbunden, wird verdrängt und tabuisiert. Ein offenerer Umgang mit Betroffenen und eine realistische Sicht auf die Erkrankung tun not.
Mein erster psychotischer Schub liegt mittlerweile über zwanzig Jahre zurück. Ich bin mir heute bewusst, dass ich wahrscheinlich mein ganzes restliches Leben auf Medikamente angewiesen sein werde, um im sogenannten »normalen« Leben einigermaßen bestehen zu können. Das bedeutet auch, zahlreiche Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Aber auch trotz des relativen Schutzes, den mir diese Medikamente geben, muss ich gleichzeitig immer darauf achten, mich psychisch nicht zu sehr zu belasten. Besonders übermäßiger Stress oder eine Vielzahl an intensiven Eindrücken kann zu einem erneuten Ausbruch der Krankheit führen. Und deswegen sind gewisse schützende Rahmenbedingungen für meinen Alltag und mein Leben von elementarer Wichtigkeit.
Die Namen meiner Freunde und Bekannten sowie aller anderen Menschen, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen, habe ich aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen abgeändert. Ebenso habe ich manche Ortsnamen und Bezeichnungen von Örtlichkeiten verfremdet oder bewusst ausgelassen.
Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre. Und ganz egal, wo Sie gerade im Leben stehen, ob Sie selbst Betroffene oder Angehöriger sind, ob Sie aus beruflichem oder aus privatem Interesse zu meinem Buch greifen: Ich bitte um Mitgefühl für alle auftretenden Menschen. Und ich hoffe, dass Ihnen meine Geschichte Mut macht. Wie ausweglos das Leben manchmal scheinen mag, es hat doch so viele schöne Seiten. Und es lohnt sich, zu kämpfen.
Sozialisierung zum Kiffer
Das erste Mal kam ich mit sechzehn Jahren in Kontakt mit illegalen Drogen. Ich war mit meinem besten Freund Benjamin auf ein Festival an der Grenze zu den Niederlanden gefahren. Wir waren beide noch sehr unerfahren und unbedarft. Beim Auftritt von Midnight Oil standen wir sehr nah an der Bühne. Rechts von uns stand ein Pärchen, das um die dreißig war. Sie hatte ein langes Blättchen in der Hand, auf dem schon Tabak verteilt war. Er hielt einen braunen Klumpen, den er mit einem Feuerzeug erwärmte, um dann kleine Bröckchen der braunen Masse auf den Tabak zu streuen. Schließlich rauchten sie das Ganze, es roch süßlich. Wir hatten keinen blassen Schimmer, was da vor sich ging, vermuteten aber, dass es sich um Heroin handelte.
Ein paar Monate später feierten wir eine kleine Party mit unseren Klassenkameraden. Es wurde viel getrunken und zu lauter Musik getanzt. Einige wenige entfernten sich immer wieder von der Gruppe – mit verschwörerischer Miene –, um nach etwa einer Viertelstunde wiederaufzutauchen.
»Was treibt ihr denn so?«, fragte ich neugierig ein Mädchen aus dieser Gruppe.
»Wir kiffen«, sagte sie geradeheraus. »Hast du nicht auch Lust? Ich hab’ gehört, du bist interessiert.«
»Wie kommst du denn auf so was!?«, lehnte ich entschieden ab. Ich blieb an diesem Abend beim Alkohol. Kiffen war illegal und mir außerdem deutlich zu unheimlich, denn ich wusste nicht, was da mit einem passiert.
Einige Monate später war es dann aber doch so weit. Benjamin und ich waren gerade siebzehn Jahre alt geworden und besuchten ein kleines Festival in der Lüneburger Heide, in unserer Heimat. Hier wollten wir das erste Mal selbst kiffen. Ein Neuer war wenige Wochen zuvor zu unserem Freundeskreis gestoßen. Oliver war zwei Jahre jünger als wir, aber schon ein wilder und kompromissloser Bursche, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Ein gekonnter Skater, der die gefährlichsten Tricks auf seinem Board ausprobierte, der uns einführte in die Punkmusik und auf dem Weg war, selbst ein Punk zu werden. Ein Outlaw.
Oliver hatte uns schon mehrfach von der Wirkung von Canna- bis vorgeschwärmt und uns so langsam den Mund wässrig geredet. Er erzählte davon, dass man sich bekifft unheimlich gut entspannen könne und dass es vor allem unheimlich witzig sei. Unsere Neugier war geweckt, wir wollten es nun endlich selbst erfahren! Mit etwas Haschisch setzten wir uns abseits vom Getriebe auf einen Hügel und Oliver baute den Joint. Wir waren nicht allein, drei Freunde von Oliver hatten sich uns angeschlossen. Eine Erfahrung, die wir in nächster Zeit öfter machen sollten: Kaum packte jemand auf einer Party sein Haschisch aus, war er umringt von mindestens fünf Leuten, die mitrauchen wollten. Zu jener Zeit, Anfang der Neunzigerjahre, in einem kleinen Kaff in Niedersachsen war es schwer, an den Stoff zu kommen, besonders wenn man jung war und noch nicht die richtigen Kontakte hatte.
Wir rauchten unseren ersten Joint. Die Erwartungshaltung war riesig, entsprechend groß die Enttäuschung. Eigentlich passierte nichts Besonderes mit uns. Wir waren nur etwas kicherig und hatten Angst, dass wir auffallen würden. Später erfuhren wir, dass es nicht ungewöhnlich sei, beim ersten Joint oder den ersten Malen nichts oder nicht viel zu merken. Wir experimentierten also munter weiter, wann immer sich die Gelegenheit ergab. Und bald stellte sich auch die erhoffte Wirkung ein. Es war eine kleine Offenbarung. Wir lachten sehr viel, hatten lustige Assoziationen, waren angenehm entspannt und locker.
Den ersten Joint hatten wir im Mai geraucht. Im August desselben Jahres machten Benjamin und ich uns ins europäische Mekka der Kiffer auf: Amsterdam! Mit dem Zug fuhren wir bis zur Grenze und von dort ging es mit dem Fahrrad weiter. Nach drei Tagen erreichten wir unser Ziel und schlugen unser Zelt auf dem Campingplatz auf. Um uns herum Gleichgesinnte aus ganz Europa. Überall wurden Joints oder Bongs herumgereicht. Wir hatten uns bereits selbst eine kleine Acrylbong besorgt. Die folgende Woche wurde zu einem einzigen Exzess. Wir besuchten unzählige Coffeeshops und probierten uns durch das reichhaltige Angebot. Ob Gras oder Haschisch – die Qualität war unglaublich und wir dauerbreit. Nach dieser Woche war der Bann endgültig gebrochen: Wir waren überzeugte Kiffer geworden.
Zurück in Deutschland wurde aus dem gelegentlichen Konsum erst ein regelmäßiges Hobby, dann eine Leidenschaft. Schritt für Schritt gelangten wir in Kreise, die etwas älter waren und auch regelmäßig kifften. Bei unseren neuen Freunden begannen wir, aus Glasbongs statt aus Acrylbongs zu rauchen – die »edlere« Variante, da sie im Gegensatz zu Acrylbongs nicht den Geschmack beeinflussten und nicht nach Plastik schmeckten. Diese Bongs nahmen mit der Zeit enorme Größen an, sowohl was die Fassungsmenge an Wasser und Rauch betraf als auch die Größe der Köpfchen, in die wir die »Mische« taten, das Gras oder Haschisch vermengt mit Tabak. Bald saßen wir fast jeden Abend mit ein paar Leuten zusammen, kifften, entspannten und schauten fern. Es war, auf eine gewisse Art, eine unschuldige und glückliche Zeit. Nichts hätte geändert werden müssen. So, wie es war, war es perfekt.
Aber schon damals zogen die ersten dunklen Wolken am Horizont auf. Ich begann, nicht nur positive Effekte beim Kiffen zu erleben. Es stellten sich auch die ersten Anzeichen von Paranoia ein. So hatte ich oft, wenn ich sehr berauscht war, das Gefühl, dass die anderen in der Runde meine Gedanken lesen könnten. Oder dass sie sich hinter meinem Rücken über mich lustig machten, ein Zeichen meiner damaligen Unsicherheit. Ich versuchte, diese negativen Aspekte des Kiffens zu ignorieren und mich auf das zu konzentrieren, was bisher das Schöne war: das Lachen, die Entspannung, das Gefühl von Losgelöstheit und dass aktuelle Probleme und Sorgen nichtig wurden. Eine ganze Weile ging das gut, trotz der leichten Paranoiaanfälle blieb ich ein überzeugter Kiffer.
Hedonistisches Manifest
Meine Schulzeit neigte sich dem Ende entgegen. Den Wehrdienst wollte ich verweigern und den Zivildienst in Hamburg ableisten. Eine Zivildienststelle, ein Kindergarten, war bereits gefunden, ebenso eine Wohnung, die ich gemeinsam mit Benjamin beziehen würde. Doch dann, völlig überraschend für uns beide, überlagerte ein Streit zwischen meiner und seiner Familie unsere Freundschaft. Wir versuchten, uns da herauszuhalten, aber es blieb nicht aus, dass auch wir jeweils Position bezogen und ebenfalls in Streit verfielen. Unsere Freundschaft, die uns durch die gesamte Zeit am Gymnasium begleitet hatte, zerbrach.
Ich empfand dies als einen extrem heftigen Bruch. Benjamin war nicht nur irgendein Freund, nicht nur mein bester Freund. In jenen sensiblen Teenagerjahren, in denen ich mich vom Kind zum halbwegs Erwachsenen entwickelte, war er immer an meiner Seite gewesen. Er ersetzte mir teilweise Familie, ja sogar fast eine Partnerin. Wir waren ein verschworenes Gespann, konnten uns über alles unterhalten und wurden von den anderen immer als Team gesehen. Dieser Halt, diese Stütze brach für mich nun weg. Ich beschloss, in meiner Heimatstadt zu bleiben und erst zum Studium nach Hamburg zu ziehen. In letzter Minute ergatterte ich einen Zivildienstplatz in einer Behinderteneinrichtung vor Ort. Auch das Schulende war ein heftiger Einschnitt für mich. Erst Jahre später wurde mir klar, dass mir in der Zeit danach etwas fehlte: die Anerkennung der Lehrer für meine schulischen Leistungen und die Bestätigung durch gute Noten. Durch diese beiden Veränderungen war mein Leben nahezu auf den Kopf gestellt. Ich musste mich neu definieren.
Zur selben Zeit begann ich, öfter auf sogenannte Goa-Partys zu gehen. Ein Mädchen aus meiner Klasse hatte mitbekommen, dass ich die elektronische Musik für mich entdeckte. Wir waren nicht wirklich befreundet; ich wusste aus zweiter Hand, dass sie zum Feiern eher nach Hamburg fuhr, statt wie wir in die Dorfdiskothek Welcome. Angeblich hatte sie mit harten Drogen zu tun, Kokain vielleicht. Es waren Gerüchte, Genaueres wusste man nicht. Eines Tages sprach mich Susanne an und schwärmte mir von diesen Goa-Partys vor. Dass die Leute dort alle supernett seien, man auf Teppichen und im Sommer barfuß auf der Wiese tanze und überhaupt alles viel besser sei als auf den Raves, die ich bisher mitgemacht hatte.
»Lass uns doch mal zusammen auf eine Party gehen«, schlug sie vor.
Im Winter, kurz vor den schriftlichen Abiturprüfungen, war es dann so weit. Ich bekam das Auto meiner Eltern, holte Susanne und eine Freundin von ihr ab und wir fuhren nach Hamburg auf die Reeperbahn. Der Klub hieß Powerhouse und befand sich in einer dunklen Nebenstraße des Kiezes. Als Erstes fiel mir die Beleuchtung auf: Überall an der Decke hingen Schwarzlichtröhren, die alles in ein unwirkliches Licht tauchten. Die Wände waren übersät mit Tüchern, bedruckt mit indischen oder psychedelischen Motiven, die im Schwarzlicht satt leuchteten. Der Bass im Viervierteltakt rollte durch den Saal und es gab kaum Leute, die nicht tanzten. Zum ersten Mal hörte ich den Goa-Sound, Psychedelic Trance! Ich wusste es damals noch nicht, aber musikalisch sollte dies meine neue Heimat werden und bis heute bleiben.
Susanne teilte mir mit, dass sie und ihre Freundin nun Ecstasy nehmen würden. Sie bot es mir nicht an, sie wollte nur, dass ich Bescheid wusste. Ich rauchte einen Joint und beobachtete sie interessiert. Zunächst passierte nichts Besonderes. Eine halbe Stunde später bemerkte ich eine sehr drastische Veränderung an beiden Mädchen. Sie richteten sich auf, schienen von innen her zu leuchten und tanzten mit einer Hingabe, wie ich es nie zuvor erlebt hatte. Sie strahlten dabei über das ganze Gesicht. Dies alles beeindruckte mich tief.
Im darauffolgenden Jahr besuchte ich drei ähnliche Partys in Hamburg. Der Abiturstress erlaubte nicht mehr. Die Zeit nutzte ich aber, um mich auf theoretische Weise dem Phänomen Ecstasy zu nähern. Hierzu lieh ich mir von einem Freund das Buch »E for Ecstasy« von Nicholas Saunders, das erst vor Kurzem erschienen war. Darin berichtet der Autor von eigenen Erfahrungen mit der Droge und von Erfahrungen Dritter, sowohl im Partykontext wie auch im privaten Rahmen und sogar im therapeutischen Bereich. Die ausführlichen Informationen, auch zu negativen Aspekten, die allerdings noch lange nicht ausreichend erforscht waren, faszinierten mich und schreckten mich gleichermaßen ab.
Einerseits ist Ecstasy ein »Herzöffner«, der Stoffwechsel wird praktisch geflutet mit dem körpereigenen Glückshormon Serotonin. Man möchte die ganze Welt umarmen, ist sehr gelöst und unglaublich glücklich. Andererseits unterdrückt Ecstasy die Wahrnehmung von Müdigkeit, Durst und Hunger, sodass man stundenlang tanzen kann. Doch die Langzeitwirkung von regelmäßigem Konsum war noch nicht richtig erforscht. Man vermutete eine Veränderung der Hirnchemie: Die Arbeit der Botenstoffe und die Ausbildung von Synapsen könnte nachhaltig beschädigt werden. Auch von Paranoia und Schizophrenie als Folge war die Rede. Ob Ecstasy abhängig macht, war dagegen heiß umstritten. Die meisten glaubten nicht an eine physische Abhängigkeit, wohl aber, dass die Verbindung aus Ecstasy und Technopartys auf gewisse Weise psychisch abhängig machte. Ich war unsicher, wie ich mich zu dieser Droge positionieren sollte, beschloss dann aber, mich fürs Erste weiter ans Kiffen zu halten.
In dieser Zeit schrieb ich mein »Hedonistisches Manifest«. Es entstand zwei Monate, bevor ich mit Susanne ins Powerhouse auf meine allererste Goa-Party fuhr, und zeigt sehr eindrücklich, wes Geistes Kind ich war:
Auch wenn unser Leben jedem vernünftigen Menschen sinnlos vorkommen muss, lohnt es sich vielleicht, für die glücklichen und angenehmen Momente zu leben. Nach dieser Philosophie kann man sein Leben als Suche auffassen, Wege zu finden, besonders glücklich zu sein. Ich habe unsere menschliche Rasse schon vor Jahren für ihre Vergehen verurteilt, empfinde unsere Zerstörungswut als nicht wiedergutzumachenden Makel, halte unsere Rasse nicht mehr für berechtigt, zu leben, den anderen Lebewesen das Leben und die Lebensgrundlagen zu nehmen. Eigentlich finde ich, dass es besser für die Erde wäre, wir würden eher heute als morgen von der Bildfläche verschwinden.
Gerade weil ich die Existenz des Lebens für eine Sensation halte, möchte ich unser Geschlecht auslöschen, da wir uns wie ein mutiertes Geschwür anschicken, sämtliches Leben und erst zum Schluss unser eigenes auszulöschen.
Nur der folgende Grund hält mich hier: Was kennen wir denn schon außer diesem Leben, das uns geschenkt wurde? Was wissen wir über die Zeit davor, danach? Da ich nicht glaube, dass mein Ego, meine Persönlichkeit, wie sie heute existiert, irgendwo anders weiter existieren kann, will ich für meine Person in dieser sterbenden Welt noch so viel Spaß und Freude mit herausnehmen, wie es geht, um eine möglichst schöne Zeit zu haben. »Herausnehmen« ist wohl eine denkbar schlechte Wortwahl, sagen wir besser »erleben«. Die Probleme werden die Suche nach den Dingen sein, die maximale Freude bringen, und die Grenzen, die der Körper jeden Tag setzt.
Sicherlich, eine ziemlich deutliche Nach-mir-die-Sintflut-Attitüde. Nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen, meine Altersgenossen davon zu überzeugen, dass wir ökologisch auf eine Katastrophe zusteuern, war ich extrem frustriert und resigniert. Wie aber war ich zu dieser Überzeugung gekommen?
Schon sehr früh hatte ich mich für meine Umwelt, für die Natur begeistert. Ich war sehr interessiert daran, möglichst viel über Flora und Fauna zu erfahren. Bei den christlichen Pfadfindern lernte ich außerdem, Respekt für die Natur zu empfinden und sorgsam mit ihr umzugehen. Mein Vater, der meine Faszination für das Thema bemerkte, abonnierte eine relativ neue Zeitschrift für mich, als ich etwa elf oder zwölf Jahre alt war: »Natur – das Umweltmagazin«. Diese Zeitschrift, die Anfang der Achtzigerjahre gegründet worden war, widmete sich sehr kritisch den Themen Artenschutz, Wirtschaftswachstum, Landschaftsverbrauch, Industrie und Ökologie. Jeder Artikel war sorgfältig recherchiert und klärte über Hintergründe und Zusammenhänge auf. Ich verschlang jeden einzelnen Beitrag. Diese Zeitschrift formte mit der Zeit entscheidend mein Weltbild und mein Bild vom Menschen. Ich lernte, dass der Mensch aus purer Profitsucht dabei war, seine eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören, und in diesem irrwitzigen Prozess fast die gesamte Welt der Flora und Fauna gleich mitnahm. Die Artikel legten den Grundstein für meine fortschrittsfeindlichen und zivilisationskritischen Überzeugungen. Für einige Jahre hatte mich die »Natur« begleitet und eindeutig geprägt. Meine Versuche, in der Schule und im Freundeskreis Gleichgesinnte zu finden, liefen allerdings ins Leere. Umgeben von Desinteresse und Ignoranz stand ich mit meiner Meinung ziemlich alleine da.
Ich machte dann nur noch wenige Vorstöße. Im Alter von sechzehn Jahren fuhr ich auf ein Umweltfestival nach Magdeburg. Wochen zuvor hatten zwei ältere Mädchen aus Lüneburg an unserer Schule die Werbetrommel für diese Veranstaltung gerührt. Ich war der Einzige, der zu ihrer Infoveranstaltung kam, und dann auch der Einzige aus unserer Schule, der dort hinfuhr. Auf der einen Seite war ich überwältigt von der Vielfalt und der Freundlichkeit der Ökoszene, die sich in Magdeburg versammelt hatte. Auf der anderen Seite hatte ich große Schwierigkeiten, dort Anschluss zu finden. Ich fühlte mich als Außenseiter, was sicher an meiner schüchternen und zurückhaltenden Art lag. Irgendwie kam ich nicht richtig rein in diese Szene. Ohne wirklich Kontakte geknüpft zu haben, trat ich den Heimweg an.
Im Herbst desselben Jahres fuhr ich mit zwei Freunden nach Gorleben, um mich an einer Demonstration gegen den Castortransport zu beteiligen. Wir demonstrierten direkt vor dem sogenannten Zwischenlager. Als die Polizei uns von der Straße scheuchte, teilweise mit Schlagstöcken vom Pferd herunter, starteten wir eine Sitzblockade in dem Wäldchen, das dem Lager gegenüberlag. Wir saßen in mehreren Reihen hintereinander und hakten uns bei unseren Nebensitzern unter.
Im Chor riefen wir immer wieder: »Keine Gewalt!«
Die Einsatzkräfte der Polizei lösten uns Demonstrierende nacheinander aus der Kette. Auch ich kam irgendwann an die Reihe. Ohne Widerstand ließ ich mich abführen. Ich musste mich gegen einen Baum stellen, die Arme hoch. Ein Polizist tastete mich ab und nahm dann meine Personalien auf. Danach wurde ich zu einem Gefängnisbus geführt und in diese fensterlose Vier-Mann-Zelle gesperrt. Die anderen Plätze waren schon besetzt, wir saßen uns zwei und zwei gegenüber. Eine ganze Weile passierte gar nichts. Schließlich fuhr der Bus los und brachte uns ins zwanzig Kilometer entfernte Lüchow. Wir hatten einen Platzverweis erhalten, entfernt hatte uns die Polizei netterweise gleich selbst, da wir ja so störrisch gewesen waren.
Als wir den Bus verließen, wurden wir sofort von Aktivisten umringt, die einen Rücktransport nach Gorleben organisierten. Doch ich hatte genug gesehen. Ich hatte die Demonstranten als machtlos und den Protest als sinnlos erlebt. Gegen die Übermacht der Staatsmacht war Widerstand zwecklos, »die da oben« würden sowieso durchsetzen, was sie wollten. Frustriert und enttäuscht trampte ich nach Hause.
In den darauffolgenden Jahren verabschiedete ich mich schrittweise von der Idee, etwas bewegen zu können. Ich hätte auch weiterkämpfen können, natürlich, mich der Partei der Grünen oder Greenpeace anschließen können. Aber meine Energie war verpufft, ich glaubte nicht mehr an die Kraft der Veränderung, ich hatte überhaupt den Glauben an die Menschheit verloren. Mein Heil suchte ich nun nur noch in meiner eigenen kleinen Welt. Ich wollte so viel Spaß und Glück wie nur möglich erleben, wenn man mein »Hedonistisches Manifest« zu Ende denkt.
Auch meine Kindheitserfahrungen spielen hier mit rein. Meine Eltern haben beide Pädagogik studiert, mein Vater war viele Jahre Lehrer an einer Hauptschule. Ich war ihr erstes Kind. Bald nach mir folgte meine Schwester Alexandra, die mich gleichsam vom Thron stieß, sodass ich die »Prinzenrolle« praktisch nie richtig erleben konnte. Meine Mutter wurde mit Alexandra schwanger, als ich neun Monate alt war, was schnell Aufmerksamkeit von mir abzog. Als ich dreieinhalb Jahre alt war, kam noch meine jüngste Schwester Anna hinzu. Sobald wir Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, nahmen meine Eltern zusätzlich ein Pflegekind auf. So musste ich früh lernen, zu teilen und meine Bedürfnisse – vor allem nach Aufmerksamkeit – zurückzuschrauben.
Spätestens in der Grundschule stellte sich meine Intelligenz heraus, meine schnelle Auffassungsgabe, mein Sprachtalent. Früh und häufig hörte ich den Satz: »Florian ist was ganz Besonderes, aus dem wird bestimmt mal was ganz Tolles.« Das prägte sich ein. Ich stellte immer höhere Ansprüche an mich selbst, was mit der Zeit zum Hindernis wurde, da ich immer wieder Arbeiten aufschob, aus Angst, meinen eigenen Ansprüchen nicht zu genügen. Ja, sogar eine ausgeprägte Schwellenangst entwickelte sich bei mir, eine gewisse Furcht vor neuen Situationen. Meine jüngere Schwester Alexandra war es, die mich dann öfter an die Hand nahm und mich beschützte. In den Kindergarten ging ich zum Beispiel erst, als Alexandra ebenfalls so weit war. Und in die Schule wollte ich zunächst überhaupt nicht gehen, ich wehrte mich mit Händen und Füßen.
Vom Charakter eher schüchtern und zurückhaltend gewöhnte ich mir an, mich bei Streit und Missstimmung zurückzuziehen. Noch heute fällt es mir schwer, Dinge, die mich stören, offen anzusprechen. Als Kind konnte ich stundenlang schmollen, wenn ich beleidigt war, im Extremfall versteckte ich mich dafür auch schon mal unter meinem Bett, um ganz weit weg zu sein. Ich beobachtete viel lieber die Welt um mich herum, als im Mittelpunkt zu stehen. Und ich konnte sehr gut mit mir alleine sein, ich las dann wie ein Verrückter, verschlang Buch um Buch. Sicher hatte ich auch Freunde, sogar drei sehr gute, mit denen ich den Stadtpark und den nahen Wald unsicher machte. Ich war schon früh ein Kind der Extreme. Entweder ich kam nicht aus meinem Zimmer, weil ein Buch mich so fesselte. Oder ich spielte draußen mit meinen Freunden und fand kein Ende. Meine Eltern sagen noch heute, dass sie mich als Kind manchmal nicht aus meinem Zimmer locken konnten und an anderen Tagen Schwierigkeiten hatten, mich wieder »einzufangen«.
Mein Vater war in den späten Achtzigerjahren krankheitsbedingt als Lehrer in den Vorruhestand gegangen. Direkt im Anschluss machte er sich als Unternehmer selbstständig und gründete eine Vollkornbäckerei. Meine Mutter half im Verkauf aus. Ich war dreizehn Jahre alt und wechselte gerade auf das örtliche Gymnasium. Mitte der Neunziger kam noch ein Cafébetrieb hinzu. Meine Eltern haben es sicher immer gut gemeint, keine Frage. Ich gewöhnte mich aber daran, meine Probleme mit mir selbst auszumachen, denn meine Eltern waren von nun an durch ihre Unternehmungen, ihre Firma, extrem eingebunden. Auf gewisse Weise war mit der Gründung der Bäckerei die Familienzeit vorbei. Meine Kindheit war es auf jeden Fall.
Volle Fahrt nach Goa
Es begann der lange Sommer. Im Juni wurden wir von der Schule entlassen, der Zivildienst sollte erst im September beginnen. Ich nahm so viele Partys mit, wie ich konnte. Der Spirit der in Deutschland noch jungen Goa-Bewegung begeisterte mich vollends. Die Menschen auf den Open Airs achteten aufeinander, reichten sich beim Tanzen gegenseitig die Wasserflaschen und hatten jederzeit und für jeden ein Lächeln parat. Außerdem war die Szene stark verbunden mit den Ideen und Symbolen der 68er-Bewegung. Man vertrat eine lebensbejahende Sichtweise und legte Wert auf Naturverbundenheit. Ich fühlte mich heimisch.
In meiner Heimatstadt bildete sich schnell eine Clique von zehn bis zwanzig Leuten, mit denen ich regelmäßig unterwegs war. Dazu gehörte David, mein alter Freund aus Kindertagen, der sich nun auch für die Goa-Partys begeisterte, und einige jüngere Jungs und Mädchen, die ich durch meine Schwester Alexandra kannte. Wir waren am Wochenende fast immer auf der A24 zwischen Hamburg und Berlin unterwegs, im bevölkerungsarmen Mecklenburg-Vorpommern wurden die meisten Open Airs veranstaltet.
Ende Juli besuchten wir die beiden größten Events in Norddeutschland, die VooV Experience und die Shiva Moon, beide mit jeweils fünftausend Gästen. Auf der VooV blieb ich noch gewissermaßen straight, indem ich nur kiffte. Eine Woche später auf der Shiva Moon sah es dann schon anders aus. Nachdem ich seit über einem Jahr an elektronischen Partys teilgenommen und immer nur gekifft hatte, wurde ich langsam neugierig. Die Grenzen dessen, was gut und richtig sei, verschwammen. Die Mädchen, mit denen ich auf die Party gefahren war, nahmen LSD, was mich zu diesem Zeitpunkt noch sehr abschreckte. Ich selbst probierte allerdings, zusammen mit David, zum ersten Mal Pilze aus, Psylocibin. Es war genauso wie LSD eine psychoaktive Droge, aber sie war natürlicher Herkunft und lange nicht so potent in der Wirkung. Ich fühlte mich mit dieser Droge auf der richtigen Seite, der harmlosen.
Von der Wirkung kann ich nicht mehr viel berichten, wahrscheinlich hatten wir sehr schwache Pilze erwischt. Jedenfalls ist mir von dieser Party nichts Außergewöhnliches im Gedächtnis geblieben. Ich weiß aber noch, dass mir am Sonntagmittag ein Mädchen mit einem bunten Ballon begegnete, das die ganze Zeit am Lachen war, dann zu Boden fiel und weiterlachte. Neugierig geworden erfuhr ich, dass sie mittels des Ballons Lachgas zu sich nahm. Ich durfte es auch ausprobieren, sie ließ mich von ihrem Ballon inhalieren. Der Flash war extrem kurz, aber heftig, ich musste sehr stark lachen und in meinem Kopf fühlte es sich für Momente an, als seien alle Gedanken wie weggeblasen. So erweiterte sich langsam, aber immer schneller, mein Erfahrungshorizont in Bezug auf den Drogenkonsum. Wo war die Grenze?
Zwei Wochen später fuhren wir nach Hannover auf die Zytanien, ein kleineres Open Air auf dem Areal einer Industrieruine. Im Verlaufe der Nacht bat mich Janet, ein Mädchen aus unserer Clique, ihr und zwei weiteren Freundinnen drei Ecstasy zu besorgen. Nachdem ich vergeblich einige Leute angesprochen hatte, wurde ich schließlich fündig. Für fünfzig Mark erhielt ich drei kleine weiße Pillen. Ich war schon sehr bekifft, seit Langem neugierig und in diesem Moment passierte es: Ich warf alle Bedenken über Bord und fragte Janet, ob ich eine halbe Pille haben könnte. Sie teilte mit mir und ich schluckte die halbe Pille, die bitter schmeckte, mit viel Wasser herunter. Dann machte ich mich auf die Suche nach David, den ich schließlich in meinem Auto antraf, zusammen mit seiner Freundin und Janets Freund. Die drei hatten schon mehr Erfahrungen mit chemischen Drogen gemacht und wachten, nachdem ich ihnen von meiner halben Pille berichtet hatte, mit Argusaugen über meinen Zustand, fragten alle fünf Minuten, ob es mir auch noch gut ginge. Ich fand das nett, aber auch etwas übertrieben. Zwar wurde ich auf einmal sehr blass, verspürte aber ansonsten nichts Besonderes.
Nach einer Weile kehrten wir zusammen zur Tanzfläche zurück. Plötzlich überfiel mich heftige Müdigkeit und ich zog mich in den Chill-out, ein Areal mit vielen Teppichen, Sofas und atmosphärischer, entspannender Musik, zurück. Stunden später, gegen neun Uhr morgens, weckte mich ein Mädchen aus meiner Clique.
»Die anderen sind schon alle weg, ich will jetzt auch nach Hause.«
Die ganze Aktion war ein Reinfall gewesen, ich ließ mir in der Nacht Schlaftabletten andrehen! Aber ich hatte eine weitere Grenze überschritten und das nächste Wochenende folgte bald …
Wir waren wieder auf der A24 unterwegs mit Ziel Wittenberge. Zwei Autos vollgepackt mit Goa-Begeisterten. Auf der Party angekommen, besorgte ich mir erst einmal die nächste Pille, diesmal von einem Niederländer, der mir vertrauenswürdig erschien. Ich nahm die Hälfte ein und wir warteten auf die Musik, die um dreiundzwanzig Uhr starten sollte. Nach etwa einer halben Stunde wirkte die Pille, diesmal hatte ich einen besseren Deal gemacht. Die Musik setzte zeitgleich ein und ich begann, zu tanzen. Was ich dann erlebte, war ein sehr harmonischer Flash, ich fühlte mich tatsächlich, als könnte ich die ganze Welt umarmen. Ich war aufgekratzt, aber gleichzeitig entspannt und unendlich glücklich. Im Laufe des Abends legte ich noch ein Viertel der Pille nach. Ich tanzte die ganze Nacht hindurch, bis die Sonne aufging. So etwas Schönes hatte ich noch nie erlebt. Es war klar, dass ich dieses Erlebnis wiederholen wollte.
Zur gleichen Zeit, als mein Zivildienst anfing, endete die Open- Air-Saison. Ich stand vor einer völlig neuen Aufgabe, ja, vor einer neuen Lebenswelt: Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendlichen. Mit großer Neugier und Interesse öffnete ich mich dieser neuen Welt und ließ mich davon auch durch teilweise Erschreckendes und Abstoßendes nicht abhalten. Die Arbeit mit den körperlich und geistig behinderten Menschen machte mir großen Spaß. Natürlich erschütterten mich manche Einzelschicksale, aber ich bekam ständig jede Menge positive Energie, Lebensfreude und Zuneigung von diesen Menschen zurück. Ich fügte mich schnell in das Team ein. Gewissenhaft und konzentriert erledigte ich die mir zugeteilten Aufgaben.
Am Wochenende aber wechselte ich dann in diese andere Welt, die ich in den Monaten zuvor entdeckt hatte. Die Indoor-Saison hatte begonnen, die Partys fanden nun in den einschlägigen Klubs statt. Meist fuhren wir zum Feiern, wie wir es nannten, nach Hamburg, manchmal ins Hamburger Umland, zum Beispiel nach Elmshorn oder nach Lüneburg, seltener einmal auch nach Hannover oder Bremen. Ich gewöhnte mir schnell an, auf jeder dieser Partys Ecstasy zu konsumieren. Meist nur eine Viertel- oder eine halbe Pille, im Einzelfall auch mal eine ganze Pille im Laufe einer Nacht; aber »unterwegs« war ich auf jeden Fall jedes Wochenende.
Der Flash blieb zunächst gleichbleibend und wunderschön. Ich konnte stundenlang tanzen, meist bis in die Mittagsstunden hinein, fühlte mich so gut gelaunt wie noch nie in meinem Leben, war ein kommunikativer Wirbelwind, statt wie früher zurückhaltend und schüchtern in der Ecke zu stehen, und genoss diese Partys in vollen Zügen. Um einen besonders freakigen Eindruck zu machen, kaufte ich mir neongelbe Moonboots, einen bunt gemusterten Wickelrock im indischen Stil und färbte meine schulterlangen Haare orange. Bald kannte ich mich gut aus in der Hamburger Goa-Szene, wusste, welche DJs am angesagtesten waren und bei wem ich welche Drogen kaufen konnte – ich hatte jede Menge neue Bekannte. Schnell setzte auch ein gewisser Mischkonsum ein, denn nachdem ich die Grenze zum Ecstasy überschritten hatte, lagen weitere Designerdrogen auf der Hand. Das ein oder andere Mal kombinierte ich Ecstasy mit Speed oder ersetzte es dadurch ganz. Ein Amphetamin, ähnlich wie Ecstasy, nur ohne die herzöffnende, entaktogene Wirkung. Es macht einfach nur sehr, sehr fit, bewegungsfreudig und kommunikativ.





























