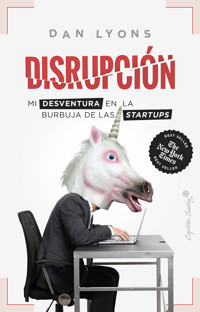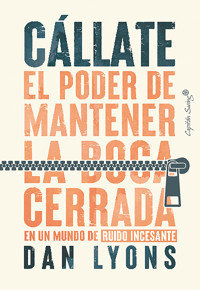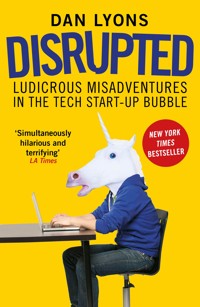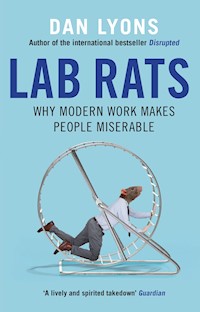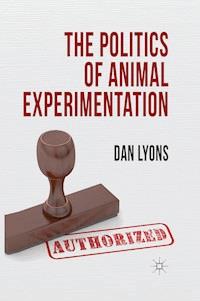Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Er war 25 Jahre lang Journalist, dann stand er von einem Tag auf den anderen auf der Straße: Dan Lyons wurde mit 52 Jahren einfach aus dem Team wegrationalisiert. Was also tun? Da kam das Jobangebot von HubSpot, einem Bostoner Start-up, genau richtig: Sie bieten dem altgedienten Journalisten einen Stapel Aktien für den nicht näher bestimmten Job des »Marketingtypen«. Was soll da schon schiefgehen? Doch es kommt, wie es bei der Konstellation kommen muss: Schnell wird klar, dass bei seinem Job bei HubSpot ungefähr alles schiefläuft, was schieflaufen kann. Seine Kollegen sind im Schnitt halb so alt, statt Bürostühlen gibt es Sitzbälle, Spam wird als »liebenswerter Marketingcontent« bezeichnet und überhaupt erinnert die Atmosphäre bei HubSpot eher an einen immerwährenden Kindergeburtstag. Dass das nicht lange gutgehen kann, ist vorprogrammiert … Dieses Buch bietet einzigartige Einblicke in die Start-up-Welt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
[email protected]
1. Auflage 2016
© 2016 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2016 by Dan Lyons
Die englische Originalausgabe erschien 2016 bei Hachette Books unter dem Titel Disrupted. My Misadventure in the Start-Up Bubble.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Martin Bayer
Redaktion: Dr. Kirsten Reimers, Hamburg
Umschlaggestaltung: Melanie Melzer, München
Umschlagabbildung: furryclown/Shutterstock, Tomacco/Shutterstock, Natalie Chuen/Shutterstock, Novitech/ Shutterstock
Illustration Einhorn: Samuel Bennett
Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print 978-3-86881-650-1
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-925-2
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-924-5
Inhalt
Vorbemerkung des Autors
Prolog: Willkommen in der Content Factory
Kapitel 1: Männlich, weiß, gestrandet
Kapitel 2: Das Quaken der Enten
Kapitel 3: Was ist ein HubSpot?
Kapitel 4: Die fröhliche!!, supertolle!! Start-up-Sekte
Kapitel 5: HubSprech
Kapitel 6: Unser Sektenführer hat einen ganz super Teddybären
Kapitel 7: Das Blog muss noch viel dämlicher werden
Kapitel 8: Die Idiotenexplosion
Kapitel 9: … in dem ich einen großen Fehler mache
Kapitel 10: Im Hexenkessel
Kapitel 11: Huch, die Halloween-Party!!!
Kapitel 12: Schöne neue Arbeitswelt: der Einweg-Mitarbeiter
Kapitel 13: Der Ron Burgundy der Hightech-Branche
Kapitel 14: Gestatten, dein neuer Chef
Kapitel 15: Der Zorn der Grauhaarigen
Kapitel 16: Rehabilitierung durch rituelle Unterwerfung
Kapitel 17: Die Vorstellung wird gestört
Kapitel 18: Ein Kartenhaus?
Kapitel 19: Go West, Old Man
Kapitel 20: Glassholes
Kapitel 21: Entschuldigung, würdest du dich bitte aus unserem Unternehmen verpissen?
Kapitel 22: Inbound und abwärts
Kapitel 23: Fluchtgeschwindigkeit
Kapitel 24: Wenn ich doch nur ein HEART hätte
Kapitel 25: Ich mache meinen Abschluss
Epilog
Über den Autor
Dank
Für das Team Shred: L. S., M. B. & P. B. Die besten Kumpel aller Zeiten
Wohl in der Mitte unsres Lebenswegesgeriet ich tief in einen dunklen Waldso daß vom graden Pfade ich verirrte.
Dante Alighieri*
I used to be with it. But then they changed what »it« was.Now what I’m with isn’t it, and what’s »it« seems weird and scary to me. (Früher hab ich’s kapiert. Dann haben sie »es« geändert. Jetzt ist das, was ich kapiere, nicht mehr »es«, und »es« kommt mir komisch vor und macht mir Angst.)
Grampa Simpson**
* Das Zitat aus Dantes Göttlicher Komödie stammt aus der Übersetzung von Ida und Walther von Wartburg. Zürich: Manesse 1963, S. 47
**Das Zitat von Anton Tschechow stammt aus Gerhard Dicks Übersetzung der Erzählung »Die Stachelbeeren« in: Anton Tschechow: Meistererzählungen, Rütten & Loening 1994, S. 454
Vorbemerkung des Autors
Das vergangene Jahrzehnt habe ich damit verbracht, Satiren über die Hightech-Branche zu schreiben – zuerst auf einem Blog, dann als Roman und schließlich fürs Fernsehen. Aber nichts, was ich mir dafür aus den Fingern gesogen habe, könnte es mit den Absurditäten aufnehmen, denen ich mich gegenübersah, als ich in einer Softwarefirma namens HubSpot dann einen echten Job in der Hightech-Branche antrat. Dieses Buch berichtet von der Zeit, die ich dort verbracht habe, und es ist keine Satire. Alles, was Sie in Von Einhörnern, Nerds und Disruption lesen, ist wirklich so geschehen. Einige Personen tragen ihren echten Namen, aber in den meisten Fällen habe ich ihnen Pseudonyme und Spitznamen gegeben. Einige frühere oder gegenwärtige HubSpotter ließen sich für dieses Buch befragen, aber nur unter der Bedingung, dass ich sie nicht zitiere, und manche lehnten ein Interview auch rundweg ab. Damals hielt ich ihre Vorsicht für übertrieben; wie sich dann herausstellte, war ihre Ängstlichkeit nur zu berechtigt.
Zur Terminologie: Mit dem Begriff Silicon Valley meine ich nicht die Gegend, die so heißt – der 100 Kilometer lange Streifen zwischen San Francisco und San José, in dem die ersten Hightech-Firmen entstanden –, sondern ich gebrauche ihn vielmehr als Metapher für die gesamte Branche, wie man es auch bei Hollywood oder der Wall Street macht. Silicon Valley in diesem Sinne gibt es in Los Angeles, Seattle, New York, Boston und an zahllosen anderen Orten, nicht nur in der Bay Area von San Francisco.
Der Begriff Blase (»bubble«) bezieht sich nicht nur auf die Wirtschaftsblase, als damals die Aktien einiger Hightech-Start-up-Unternehmen so grotesk überbewertet wurden, sondern auch auf die Einstellung und Denkweise der Menschen in solchen Start-ups, den wahren Gläubigen und Kool-Aid-Trinkern, die in ihrer eigenen abgeschirmten Blase leben, vor Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen schier bersten, jeder Kritik unzugänglich und gegen die Realität immun sind – und nicht merken, wie lächerlich sie auf die Außenwelt wirken.
HubSpot, das Start-up-Unternehmen, bei dem ich von April 2013 bis Dezember 2014 angestellt war, war Teil dieser Blase. Die Firma legte im November 2014 einen erfolgreichen Börsengang hin; seitdem ist ihr Marktwert auf nahezu zwei Milliarden US-Dollar gestiegen. In diesem Buch geht es allerdings um mehr als nur um HubSpot; es geht auch darum, wie es sich anfühlt, wenn man sich mit über 50 »neu erfindet« und eine neue Karriere zu starten versucht, und zwar in einer Branche, die allgemein als intolerant gegenüber Älteren gilt; und es geht schließlich darum, wie sehr sich die Arbeitswelt an sich verändert hat und dass manche dieser Firmen, die immer behaupten, die Welt verbessern zu wollen, das genaue Gegenteil tun.
Silicon Valley ist voller Märchen und Legenden. Dieses Buch habe ich geschrieben, um den Lesern einen realistischen Einblick in den Betrieb eines »Einhorn«-Start-ups zu geben und den populären Mythos des visionären Unternehmers zu entlarven. Die Leute an der Spitze von HubSpot waren keine Helden, sondern ein Haufen Marketingscharlatane, die eine gute Geschichte über die magische Verwandlungskraft der Computertechnik draufhatten und Reichtümer scheffelten, indem sie den Leuten Anteile an einem Unternehmen andrehten, das bis heute keinen Gewinn erzielt.
Das Herzstück dieses Buchs ist meine eigene Geschichte – die einer mitunter schmerzlichen und ernüchternden Selbsterkenntnis, die mir nicht erspart blieb, als ich mich von einem Journalisten in einen Marketingprofi bei einer Software-Start-up-Firma verwandeln wollte. Ich wünsche dieser Geschichte, dass sie einen überfälligen Einblick bietet in das Leben hinter den Kulissen einer solchen Firma in einer Zeit, in der die Hightech-Branche zeitweilig den Verstand verloren hatte – und ich, mit allen Konsequenzen, wohl auch.
Kapitel 1Männlich, weiß, gestrandet
Neun Monate zuvor. Sommer 2012, das Leben ist schön. Ich bin 51 Jahre alt, lebe glücklich verheiratet in einem Bostoner Vorort, habe zwei kleine Kinder und liebe meinen Job. Newsweek bezahlt mich dafür, dass ich interessante Leute interviewe und über Themen schreibe, die mich faszinieren: Fusionsreaktoren, Bildungsreform, Supercomputer, künstliche Intelligenz, Robotik, den wachsenden Konkurrenzdruck durch die Chinesen, die globale Bedrohung staatlich gesteuerter Hackerangriffe. Newsweek ist für mich mehr als ein Unternehmen – diese Zeitschrift ist eine Institution, und für eine Zeitschrift zu schreiben ist überhaupt der beste Job der Welt.
Bis eines Tages, ohne Vorwarnung und schlagartig, das Ende kommt, und zwar an einem Freitagvormittag im Juni. Die Kinder sind schon in der Schule und ich sitze gerade mit Sasha, meiner Frau, am Küchentisch. Wir trinken Kaffee und sprechen noch einmal die Planung für die kommende Urlaubsreise durch. Es geht drei Wochen nach Österreich – das können wir uns zwar kaum leisten, aber mit Einsatz aller Vielflieger-Bonusmeilen und Beschränkung auf bescheidene Hotels geht es gerade so. Die Kinder – es sind Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen – werden in ein paar Wochen sieben und sind damit alt genug für so ein Abenteuer. Sasha hat gerade ihre Stelle als Lehrerin aufgegeben, weil sie an chronischer Migräne leidet und viel zu oft deswegen ins Krankenhaus musste. Sie braucht mehr Zeit für sich, um zur Ruhe zu kommen. Einige Wochen in den Alpen sind da genau der richtige Anfang. Ihr Gehalt und ihre erstklassige Sozialversicherung werden uns natürlich fehlen, aber ich kann uns auch über Newsweek ziemlich gut versichern, und neben meinem Redakteursgehalt verdiene ich noch ein bisschen was als Vortragsredner dazu.
Es läuft also alles ganz gut. Wir können eine Fernreise machen, obwohl Sasha gerade aufgehört hat zu arbeiten. Es wird ein großartiger Urlaub, so versichern wir einander, während wir die Webseite für eines unserer Ziele aufrufen, eine Feriensiedlung – Hütten am Hang über einem einsam inmitten der Berge gelegenen Dorf. Es gibt dort Bergführer, die Wanderungen für Touristen und Kletterkurse für Kinder anbieten, und einen Ponyhof, wo uns stämmige kleine Haflinger mit struppigen blonden Mähnen erwarten. In drei Wochen geht’s los.
Mein Smartphone piepst. Eine Mail von Abby, meiner Chefin in der Redaktion. Ob ich wohl ans Telefon kommen könne? Ich rufe sie vom Arbeitszimmer im Obergeschoss aus in New York zurück. Wahrscheinlich will sie mich auf dem Laufenden halten, wie weit wir mit dem neuen Hightech-Blog sind. Leider irre ich mich.
»Schlechte Nachrichten«, erklärt sie. »Es gibt Einsparungen. Deine Stelle gehört auch dazu.«
Ich weiß erst gar nicht, was ich sagen soll. Einerseits sollte mich das nicht überraschen. Newsweek macht seit Jahren Verluste. Vor zwei Jahren hat die Zeitschrift den Besitzer gewechselt; der neue hatte versprochen, sie wieder in die Gewinnzone zu führen. Stattdessen sind die Verluste nur noch gewachsen. Abonnenten und Anzeigenkunden bröckeln weg. Irgendwie habe ich wohl schon gewusst, dass dieser Anruf einmal kommen würde. Aber doch nicht gerade heute.
Abby sagt, es sei nicht ihre Entscheidung gewesen, mich zu feuern. Wessen denn?, frage ich. Sie sagt, sie wisse es nicht, aber irgendjemand irgendwo da oben habe so entschieden, und an ihr bleibe es hängen, es mir beizubringen. Sie könne leider überhaupt nichts machen und es gebe auch niemanden, an den ich mich wenden könne. Das ist natürlich Quatsch. Abby weiß ganz genau, wer mich gefeuert hat. Wahrscheinlich war sie es selbst.
Abby ist ein alter Hase bei Newsweek. Kurz bevor ich dazustieß, hatte sie aufgehört, aber vor drei Monaten ist sie als Chefredakteurin zurückgekommen. Ich habe mich ehrlich gefreut, als ich hörte, dass sie meine Chefin wird. Wir sind alte Freunde, kennen uns seit 20 Jahren. Sobald sie angefangen hatte, waren wir auch schon dabei, diesen neuen Hightech-Blog zu planen, das ich betreuen soll. Ich hatte mir ausgerechnet, dass es etwa ein Jahr dauern würde, es auf die Beine zu stellen und zum Laufen zu bringen – und dass mein Arbeitsplatz zumindest so lange noch sicher wäre. Deshalb sitze ich jetzt hier, starre aus dem Fenster und fühle mich, als hätte ich eins über den Schädel bekommen.
»Sie wollen wohl einfach jüngeres Personal«, meint Abby. »Mit deinem Gehalt alleine können sie fünf Collegeabsolventen bezahlen.«
»Stimmt.« Ich bin nicht einmal wütend, ich bin wie betäubt. »Verstehe ich.«
Draußen brummt ein Rasenmäher. Ich schaue aus dem Fenster; es sind die Leute vom Hausmeisterservice, die unseren Rasen mähen. Ich mache eine Gedankennotiz: Der Rasenmähermann ist eine der kleinen Bequemlichkeiten, auf die wir künftig verzichten müssen. Ein Arbeitsloser kann sich ja wohl kaum leisten, seinen Rasen nicht selbst zu mähen. Ich bin noch nicht einmal ganz gefeuert und überlege schon, wo wir überall sparen können. Sollen wir das Kabelfernseh-Abonnement kündigen? Nicht mehr essen gehen? Was ist mit dem Österreichurlaub?
Abby redet weiter. Sie mag mich wirklich, sagt sie, und dieser Anruf fällt ihr wirklich schwer und sie findet es furchtbar, mir das anzutun, wo wir uns doch so lange kennen, man ruft doch keinen Freund an, um ihm so etwas zu sagen. Ich bekomme richtig Mitleid mit ihr, dabei bin ich es doch, der gerade seinen Arbeitsplatz verliert.
Ich versichere ihr, dass ich verstehe, wie sie sich fühlt. Schließlich bin ich Wirtschaftsjournalist. Ich schreibe dauernd über solche Geschichten – Traditionsunternehmen, die von neuen Technologien bedrängt werden, immer weiter an Boden verlieren und sich mit Entlassungen über Wasser zu halten versuchen. Wenn ich eine Zeitschrift hätte, die Verluste macht, müsste ich auch Kosten einsparen. Ich würde die gut bezahlten alten Leute auf die Straße setzen und dafür eifrige Kids einstellen, die nicht viel kosten. Das ist nur vernünftig.
Als ich diese Stelle angetreten habe, wusste ich schon, dass ich sie wohl nicht bis zur Rente behalten würde. Damals, 2008, bekamen die Newsweek-Veteranen, die entlassen wurden, noch Aufhebungsverträge und die Möglichkeit, in Frührente zu gehen. Es traf ja nicht nur Newsweek. Eine Zeitung, eine Zeitschrift nach der anderen gab auf, weggefegt vom Internet. Newsweek war trotzdem immer noch großartig, und selbst wenn dies die letzten Jahre des Magazins sein sollten, wollte ich dabei sein.
Jetzt also, an diesem sonnigen Freitagvormittag, ist es zu Ende.
Mein letzter Arbeitstag ist in zwei Wochen, erklärt Abby. Ich bekomme keine Abfindung, nur noch den Lohn für die letzten zwei Wochen und meinen Resturlaub ausbezahlt. Die Arbeitgeber-Krankenversicherung laufe dann auch aus, aber die Personalabteilung werde mir dabei helfen, sie auf das staatliche COBRA-Programm umzustellen, damit ich sie behalten kann.
Die Kollegen, die 2010 mit dem Besitzerwechsel entlassen wurden, erhielten noch Abfindungen in Höhe eines Jahresgehalts. Ich hatte erwartet, wenn ich an der Reihe wäre, wenigstens nicht ganz ins Leere zu fallen. Zwei Wochen – das ist ein bisschen hart. Ich versuche zu handeln. Ich frage Abby, ob ich nicht wenigstens noch ein halbes Jahr bleiben kann, um mir in der Zeit eine neue Stelle zu suchen. Damit könnte ich mein Gesicht wahren; es ist immer leichter, etwas Neues zu finden, wenn man noch nicht arbeitslos ist. Sorry, lehnt sie ab, nicht drin. Ich würde auch auf einen Teil meines Gehalts verzichten. Leider auch dann nicht, sagt sie. Ich bestehe auch nicht auf meinem Redakteursposten, flehe ich. Hauptsache, ich bleibe noch auf der Gehaltsliste und behalte die Sozialleistungen, während ich mir etwas Neues suche.
Abby lehnt ab.
»Abby, ich habe Kinder.« Meine Stimme zittert auf einmal. Ich atme tief durch. Ich will nicht klingen, als drehe ich durch. »Ich habe Zwillinge. Sie sind erst sechs.«
Sie meint, es tue ihr furchtbar leid, sie könne mich gut verstehen, aber sie könne nichts machen.
Meine Frau, erzähle ich ihr, hat gerade ihre Stelle als Lehrerin aufgegeben. Ich bin gerade mit dem Papierkram fertig, der unsere Versicherung von Sashas Arbeitgeber auf meinen umstellt. Auf Newsweek. Die Personalabteilung muss das doch wissen, es war das »spezifische Lebensereignis«, das man angeben muss, um die Arbeitgeber-Krankenversicherung von Newsweek außerhalb der jährlichen Anmeldeperiode zu bekommen.
»Schau mal«, bettele ich, »wenn du meinen letzten Arbeitstag nur ein paar Monate nach hinten verschiebst, kann ich wenigstens die Krankenversicherung behalten, und ich verspreche auch, dass ich so schnell wie möglich woanders anfange.«
Aber meine alte Freundin Abby, die ich schon kenne, seit wir beide in den Zwanzigern und noch ganz neu im Nachrichtengeschäft waren, sagt Nein. Sie kann nichts für mich tun. Es bleibt dabei: zwei Wochen.
Ich lege auf, gehe die Treppe hinunter und erzähle Sasha, was gerade passiert ist. Sie ist entsetzt. Habe ich ihr nicht gerade erst versichert, sie könne problemlos aufhören zu arbeiten, weil meine Stelle bei Newsweek sicher sei?
»Ich dachte, Abby ist deine Freundin«, meint sie.
»Dachte ich auch.«
Auf dem Tisch liegt immer noch die Mappe mit den Ferienprospekten, den Flugtickets und den Buchungen für Hotels und Mietwagen.
»Die Reise streichen wir dann wohl lieber«, sagt sie.
Das bringt nichts, meine ich. Wir haben ja schon Geld ausgegeben – Anzahlungen, die bei Stornierung verfallen. »Wir fahren lieber trotzdem«, erkläre ich. »Wir machen unseren Urlaub und nutzen die Zeit, um uns zu überlegen, wie es danach weitergeht. Wir können jetzt machen, was wir wollen, oder? Wir können ganz neu anfangen. Woanders hinziehen. Ein neues Kapitel.«
Vermont fällt mir an. Wir haben doch immer davon geträumt, dort zu wohnen. Freunde von uns haben es getan – alles verkauft und nach Vermont gezogen. Es gefällt ihnen großartig! Oder Boulder. Oder Bozeman. Wir könnten in die Rocky Mountains gehen! Wir stellen am besten eine Liste mit unseren Wunschorten auf, mieten ein großes Wohnmobil und schauen sie uns alle an. Dann entscheiden wir. Wir könnten den ganzen Sommer durchs Land fahren. So bekämen wir auch mal die Nationalparks zu sehen – Grand Canyon, Zion, Yellowstone, Yosemite. Eigentlich ist meine Kündigung eine gute Sache. Jetzt haben wir jede Menge Zeit. So eine Chance bekommen wir nie wieder!
Sasha weiß, dass ich Unsinn plappere; außerdem weiß sie, dass ich gerade panisch werde – so reagiere ich nämlich immer, wenn ich kurz davor bin. Ich rede und rede und rede. Aber während ich noch meine Liste mit fantastischen Bergnestern abspule, in denen ich ungestraft Holzfällerhemden und einen Bart tragen und mit einem Pick-up herumkurven könnte, sieht sie schon die Realität unserer Lage, und die muss sie mir jetzt laut und deutlich erklären, als ob sie die Dinge, indem sie sie beim Namen nennt, wieder unter Kontrolle bekäme.
»Gehen wir doch einfach mal durch, wie wir jetzt dastehen«, sagt sie. Sie gibt sich große Mühe, ruhig zu bleiben. »Fakt ist, dass ich gerade meine Arbeitsstelle aufgegeben habe, und die bekomme ich nicht zurück. Sie ist schon wieder besetzt. Und du bist jetzt gerade gefeuert worden.«
»Gekündigt«, berichtige ich. Es klingt besser.
»So oder so – wir sind beide arbeitslos, wir haben zwei sechsjährige Kinder, keine Krankenversicherung und kein Einkommen. Und wir planen eine teure Urlaubsreise.«
»Na ja – wenn du es so ausdrückst.«
»Wie würdest du es denn ausdrücken?«
Ich fange wieder an, von einem Umzug in die Berge zu reden, aber sie unterbricht mich ungeduldig. Wir wissen beide, dass das Unsinn ist. Wir werden den Sommer nicht auf einer Wohnmobil-Rundreise durch die USA verbringen. Das verrückte Abenteuer findet nicht statt.
»Also gut«, sage ich entschlossen. »Ich mache mich auf die Suche nach einer neuen Stelle. Ich setze mich ans Telefon. Jetzt gleich. Ich maile alle Bekannten an. Ich habe ja noch einen Haufen fest gebuchter Vortragstermine, die halten uns bis zum Herbst über Wasser, und dann kann ich auch noch ein bisschen was als Freelancer hereinholen.«
Ich versuche, möglichst zuversichtlich zu klingen, aber ich bin 51 Jahre alt und habe mir noch nie einen Arbeitsplatz selbst suchen müssen. Ich hatte immer einen und bin dann problemlos auf einen besseren gewechselt. Mir ist es bis jetzt erspart geblieben, meine Freunde anzurufen und sie zu bitten, an mich zu denken, wenn sie von einer offenen Stelle hören. Ich war immer derjenige, der solche Anrufe bekam, und mir taten die Freunde immer leid, die mich wegen so etwas anriefen. Na klar, habe ich ihnen versichert, ich höre mich um. Ich halte die Augen offen. Du findest bestimmt bald was Neues.
Aber natürlich wissen wir alle, wie die Lage ist. Im Journalismus werden die Jobs jedes Jahr weniger. Das ist wie die »Reise nach Jerusalem« – ein Haufen entlassener alter Säcke rennt im Kreis herum und kämpft um die wenigen Stühle, die noch da sind.
Wer über 50 ist, hat es noch schwerer. Es kommt mir wie eine bittere Ironie vor, dass ich zuerst in meiner eigenen Zeitschrift darüber gelesen habe. Newsweek brachte 2011 eine Titelgeschichte mit der treffenden Schlagzeile The Beached White Male (»Männlich, weiß, gestrandet«). Das Cover zeigte einen weißen Anzugträger im mittleren Alter, der mit dem Gesicht nach unten und klatschnass an einem Strand lag – vielleicht nicht gerade tot, aber jedenfalls Strandgut.
Im Artikel dazu ging es um eine ganze Generation ehemals erfolgreicher Männer, die während der Wirtschaftskrise (oder »Menschenkrise«, wie Newsweek sie nannte) ihre Jobs verloren hatten. Jetzt tappten sie zu Hause im Bademantel herum – verstört, die Männlichkeit verloren, seelisch am Boden, vor ihren Frauen und Kindern gedemütigt – und vegetierten wie kastrierte Zombies dahin. In der neuen Arbeitswelt ist 50 das neue 65, hieß es. Wenn du 50 wirst, findet dein Chef schon eine Ausrede, dich loszuwerden, und dann versuch mal, einen neuen Job zu finden. Natürlich kannst du deinen Arbeitgeber wegen Altersdiskriminierung verklagen, aber was soll das bringen? Selbst wenn du den Prozess gewinnst, stellt dich danach erst recht niemand mehr ein.
Ich hatte den Artikel damals gelesen, ihn aber nicht auf mich bezogen. Ich fühlte mich immun gegen diese Bedrohung. Newsweek ging es zwar nicht gerade blendend, aber solange die Zeitschrift nicht direkt pleiteging, würde sie doch bestimmt einen Technologieredakteur brauchen.
Anscheinend doch nicht. Denn mit einem Schlag sitze ich hier an einem schönen sonnigen Junitag in meiner Küche, warte darauf, dass die Kinder aus der Schule kommen, und frage mich, ob ich ihnen die Nachricht beibringen soll, und wenn ja, wie. Die Nachricht lautet: Ich bin nicht mehr Technologieredakteur bei Newsweek, ich bin der Mann auf dem Titel von Newsweek – mit dem Gesicht nach unten an den Strand gespült, klatschnass, vielleicht schon tot. Ich bin männlich, weiß, gestrandet.
Ich habe 1983 angefangen, für Zeitungen zu schreiben. Während ich noch auf dem College war. Nach dem Abschluss ist mir dann nichts Besseres eingefallen und ich bin Zeitungsmann geblieben. Ich habe kurz daran gedacht, ein Studium dranzuhängen – Jura oder BWL –, hatte dann aber weder für das eine noch für das andere den Mumm. Eigentlich hatte ich mal Arzt werden wollen, aber das hatte ich irgendwie aus den Augen verloren, und auf einmal war es ein bisschen spät, damit anzufangen. Journalismus war für mich eigentlich kein Beruf, eher eine Zwischenlösung, bis ich einen Beruf gefunden hatte. Ein befreundeter Reporter, Engländer mit Fleet-Street-Erfahrung, hat es so ausgedrückt: »Immer noch besser als arbeiten.« Irgendwann war ich dann so lange Reporter, dass ich mir eingestand, ich sei wohl doch Journalist von Beruf. Ich bin da einfach reingerutscht.
Ein Bekannter überredete mich 1987, mit ihm zu einer Zeitschrift namens PC Week zu gehen, die auf die Computerbranche als Leser zielte. Damals gab es in Boston noch ziemlich viele Hightech-Unternehmen. Von Computern hatte ich keine Ahnung, aber das ging damals allen so. Personal Computer waren noch eine neue Sache, und wir stiegen sozusagen im Erdgeschoss in einen riesigen neuen Zukunftsmarkt ein.
Silicon-Valley-Technologiefirmen waren in den 1980ern sehr langweilig. In öden Gewerbeparks saßen Softwareentwickler und Elektroniker in ihren Büros, schrieben Programme, entwarfen Halbleiter und Platinen und konstruierten Netzwerkrouter. Außer Steve Jobs bei Apple gab es in dieser Branche keine Stars, und selbst Steve war damals noch nicht so furchtbar berühmt. Anfang der 1990er kam dann das Internet, und Silicon Valley verwandelte sich. Hightech-Unternehmen waren jetzt wacklige Gebilde aus Hype, großen Ambitionen und dem Versprechen atemberaubender Gewinne über Nacht. Nach der Dotcom-Blase der späten 1990er-Jahre kam bekanntlich das Platzen der Dotcom-Blase, und danach lag Silicon Valley wie eine Geisterstadt da. Nur langsam erhob sich eine neue Generation Internetunternehmen aus der Asche. Der zweite Boom war keine direkte Kopie des ersten, aber es gab beunruhigende Ähnlichkeiten, vor allem die, dass keines dieser Unternehmen jemals Profit zu machen schien. Sie verfeuerten ständig Kapital, oft in schockierenden Mengen – manche mehrere Milliarden US-Dollar –, aber es schien niemanden zu stören.
Über die erste Dotcom-Blase und ihr Platzen hatte ich für Forbes berichtet. Im Nachhinein sieht man, was für ein Goldenes Zeitalter das damals war, nicht nur für Forbes, sondern für die Zeitschriftenbranche allgemein. Als Zeitschriftenredakteur wurde man nicht reich, aber das Gehalt war ganz anständig und die Spesen unschlagbar. Wir reisten in der ganzen Welt herum, übernachteten in Luxushotels und feierten auf der Highlander, Malcolm Forbes’ Superjacht, Partys mit Rockstars und Staatsoberhäuptern. Während meiner Zeit bei Forbes lernte ich meine zukünftige Frau Sasha kennen, und 2005 kamen dann die Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Nachdem ich in meinen Zwanzigern und Dreißigern unstet wie ein Nomade gelebt hatte, wurde es jetzt, als 40-Jähriger, Zeit für mich, für meine neue Familie ein geregeltes Leben mit einem guten Job zu führen.
2006 fing ich dann ein Blog mit dem Namen The Secret Diary of Steve Jobs (»Das geheime Tagebuch des Steve Jobs«) an, das ich unter dem Pseudonym Fake Steve Jobs schrieb. Es ging mir nicht nur um eine Satire auf Jobs, sondern auf ganz Silicon Valley. Meinen richtigen Namen gab ich nicht preis, und die mysteriöse Anonymität des Autors machte das Blog noch attraktiver. Bald hatte es anderthalb Millionen Leser jeden Monat.
Ich stellte Jobs als nervtötenden, unsicheren Größenwahnsinnigen hin, der sich selbst zum Führer einer durchgedrehten Elektroniksekte ausgerufen hatte. Jobs meckerte und zeterte über jeden in seiner Reichweite; er fuhr mit Bono zusammen betrunken Auto und rammte andere Fahrer von der Straße; er übergoss eine leidgeprüfte Sekretärin mit brühheißem Tee; er bekam Ärger mit der Börsenaufsicht und belog die Ermittler; er besichtigte chinesische Sweatshops, in denen iPhones in Kinderarbeit hergestellt wurden, und stilisierte sich selbst zum Opfer. Mit Sting zusammen reiste er in den peruanischen Regenwald, wo beide einen Ayahuascatrip einwarfen und sich schluchzend auf dem Lehmboden einer Hütte umarmten. Mit seinem besten Freund Larry Ellison, dem CEO von Oracle, besuchte er das San Franciscoer Vergnügungsviertel Tenderloin und schoss mit Wasserpistolen auf Transvestiten-Prostituierte. Die beiden vergnügten sich außerdem mit Telefonstreichen, bei denen sie bei Thai-Restaurants »Penissoße« und bei einem Heimwerkergeschäft im Castro-Viertel San Franciscos Silikon-Dichtungsmasse bestellten.
Schließlich flog ich doch auf. Ein Reporter der New York Times reimte sich zusammen, wer hinter Fake Steve steckte, und konfrontierte mich mit der Beschuldigung. Ich gestand alles. Daraufhin erschienen eine Menge Artikel über mich, von der New York Times bis zum deutschen Spiegel und der spanischen El Mundo, und ich bekam haufenweise Einladungen als Vortragsredner zu Tagungen. Dann erhielt ich die Stelle als Redakteur bei Newsweek, was noch mehr Vortragsengagements nach sich zog, und war auch ziemlich viel im Fernsehen zu sehen, wo ich auf Fox Business, CNBC oder Al Jazeera meine Meinung zum Besten gab. Ich schob noch einen Fake-Steve-Roman nach, verkaufte die Filmrechte an eine Produktionsfirma aus Hollywood und fand mich auf einmal in Los Angeles wieder, wo ich neben meiner Arbeit für Newsweek auch noch eine Comedyserie fürs Kabelfernsehen entwickelte.
Dann ging es bergab. Die Fernsehserie starb, bevor die erste Folge gedreht war. Newsweek wurde von der Washington Post, der das Magazin seit 1961 gehörte, verkauft. Der neue Eigentümer legte es mit einer Webseite namens The Daily Beast zusammen, deren geniale, aber wahnsinnige Herausgeberin Tina Brown dadurch Herausgeberin von Newsweek wurde. Die meisten Kollegen gingen von selbst oder wurden gefeuert. Ich konnte mich halten, aber in der Redaktion herrschte Chaos, ein ständiges Kommen und Gehen. In den folgenden zwei Jahren hatte ich ein halbes Dutzend Chefredakteure. Manchmal hatte ich auch gar keinen, schwebte im Leeren und versuchte, meine Geschichten unterzubringen. Es machte keinen Spaß, aber ich gab die Hoffnung nicht auf.
Im März 2012 wendete sich dann die Lage scheinbar zum Besseren. Meine alte Freundin Abby kam zurück und war jetzt meine Chefredakteurin. Mein Job, der unter den neuen Eigentümern ziemlich prekär gewesen war, kam mir wieder sicherer vor. Endlich hatte ich in New York jemanden, der auf meiner Seite war – dachte ich. Aber da hatte ich mich geirrt.
Kapitel 2Das Quaken der Enten
Nachdem ich gefeuert worden war, verliere ich zuerst völlig den Halt. Oberflächlich merkt man mir nichts an, jedenfalls gebe ich mir große Mühe. Innerlich bin ich kurz vor dem Durchdrehen, trotz meiner täglichen Dosis Lorazepam. »Du fällst schon wieder auf die Füße«, höre ich überall, und ich möchte es gerne glauben, aber nach und nach bin ich mir nicht mehr so sicher. Da war das katastrophale Vorstellungsgespräch bei einer großen PR-Agentur, deren Vizepräsident mich nach New York kommen ließ, eine Stunde zu spät zum Termin erschien und mir dann sagte, er stelle eigentlich keine Journalisten ein. Bei Forbes hat mir ein Redakteur, der mich noch vor weniger als einem Jahr von Newsweek hatte abwerben wollen, einen Vertrag als freier Mitarbeiter angeboten – 32 000 US-Dollar pro Jahr, keine Sozialleistungen. Nachts liege ich schlaflos im Bett und kämpfe gegen die geheime Angst, für immer arbeitslos zu bleiben.
Die Newsweek-Geschichte über die »Gestrandeten« war ja nur allzu wahr. Ich kenne Altersgenossen, deren Karriere vorbei ist. Sie sind jetzt Anfang 50, hatten sich bis auf Führungspositionen hochgearbeitet, wurden »eingespart« und mussten entdecken, dass niemand sie mehr braucht. Sie haben all die Phasen durchlaufen, durch die ich jetzt auch gehe – zuerst, direkt nach der Kündigung, macht man sich noch Hoffnungen und eilt von einem Vorstellungsgespräch zum nächsten. Aber ein halbes Jahr vergeht, dann ein ganzes, und irgendwann ruft einen niemand mehr zurück. So schlimm ist es bei mir zum Glück noch nicht. Ich habe ein paar Aufträge als Freelancer bekommen, meine Vorträge werfen noch ein bisschen Geld ab und mein Agent hat versprochen, mir diese Quelle möglichst zu erhalten, aber er hat mich auch gewarnt, dass ohne den Zusatz »Newsweek« hinter meinem Namen meine Tage als Vortragsredner wahrscheinlich gezählt sind. Was dann? Klar, wir haben ein paar Ersparnisse, aber die reichen nicht ewig. Vorerst sparen wir, wo wir nur können.
Die Kinder wissen Bescheid. Wir reden zwar nicht viel darüber, wenn sie dabei sind, aber wir schweigen es auch nicht tot. Ich weiß nicht, ob das die Sache schlimmer macht oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie verunsichert sind, besonders mein Sohn. Er ist sehr sensibel. Eines Abends, als ich ihn ins Bett bringe, sehe ich in seinen Augen etwas, das mir neu ist – nicht, dass er Angst hat, aber er weiß, was ich durchmache, und er hat Mitleid mit mir. Das ist fast nicht auszuhalten. »Komm her, Großer«, sage ich, umarme ihn fest und versuche, ihn zum Lachen zu bringen. Er lacht auch wirklich, und ich lache auch, aber gleichzeitig muss ich die Tränen zurückhalten. Mir wird klar, dass ich mich in seinen Augen verändert habe. Diesen Ausdruck des Mitgefühls in seinen Augen werde ich nie vergessen. Er verfolgt mich. Ich brauche einen Job, irgendeinen Job.
Und ich bekomme auch einen. Im September 2012 bin ich wieder in Lohn und Brot. Es ist kein toller Job, nicht mal ein besonders guter. Er hat seine Nachteile, besonders den, dass er mich zum Wochenendpendler macht, aber ich zögere nicht, sondern greife entschlossen zu. Auf einmal bin ich der Herausgeber der Webseite ReadWrite, ein winziges Technologie-Nachrichtenblog, dessen Redaktion aus drei Vollzeitangestellten und einem halben Dutzend jämmerlich unterbezahlter freier Mitarbeiter besteht. ReadWrite hat sein Büro in San Francisco. Das bedeutet, ich fliege montags an die Westküste und komme am Donnerstag oder Freitag mit einem Nachtflug zurück. Wenn ich nicht in San Francisco bin, muss ich nach New York zum Sitz der Betreiberfirma von ReadWrite oder in irgendeine Stadt dazwischen, wo ich als Vertreter neue Anzeigenkunden gewinnen soll. Es macht keinen Spaß, aber ich verdiene wieder regelmäßig und kann mich schon mal nach einem besseren Posten umschauen.
Das ReadWrite-Büro liegt in der Townsend Street, im Viertel South of Market, wo auch alle angesagten Hightech-Start-ups ihren Sitz haben – Twitter, Uber, Dropbox, Airbnb. Der Rest des Landes leckt immer noch seine Wunden und versucht, sich von der schlimmsten Wirtschaftskrise seit fast 100 Jahren zu erholen, aber hier brummt der Laden. Man fällt fast über die Start-ups und sie haben kein Problem, Kapital einzuwerben.
Nach dem Börsencrash von 2008 war es für Unternehmen ein paar Jahre lang fast unmöglich, neu an die Börse zu gehen, weil niemand Aktien kaufte. Ohne Börsengang aber konnten die Risikokapitalgeber, die Start-ups finanzieren, keine Rendite auf ihre Investitionen erwarten, also gab es auch kein Risikokapital mehr. Jetzt bessert sich die Lage wieder. LinkedIn, ein soziales Netzwerk, ging im Mai 2011 an die Börse und verdoppelte den Wert seiner Aktien bereits am ersten Handelstag. Noch im selben Jahr folgten die IPOs von Groupon und Zynga, die Größten seit dem Börsengang Googles 2004, und im Mai 2014 dann Facebook. Das war der größte Börsengang in der Geschichte der Hightech-Branche, und das soziale Netzwerk, das Mark Zuckerberg acht Jahre zuvor spontan in seinem Studentenwohnheimzimmer in Harvard aufgezogen hatte, war plötzlich über 100 Milliarden US-Dollar wert.
Jetzt lauern die Investoren auf das nächste Facebook, und eine neue Hightech-Blase baut sich langsam auf. Sogar drüben an der Ostküste, wo ich meine Wochenenden verbringe, bekommt man mit, dass sich in der Bay Area etwas Aufregendes tut. Hier in San Francisco ist es unübersehbar. Das Geld wird einem geradezu nachgeworfen. Jeder Collegeabbrecher mit Kapuzensweatshirt, der eine halb gare Idee laut werden lässt, zieht Investoren an. Motorrollervermietungen, überbackener Käsetoast, eine Firma, die ihren Abonnenten jeden Monat ein Überraschungspaket mit Hundezubehör schickt – für all das gibt es Startkapital. Blue Bottle Coffee, eine Kaffeekioskkette, die bei den Kids in San Francisco gerade in ist, hat bereits 20 Millionen US-Dollar eingeworben (und wird in den nächsten zwei Jahren noch weitere 100 Millionen bekommen) und braut Kaffee mit Profiautomaten aus Japan, die 20 000 US-Dollar pro Stück kosten. Die Tasse Kaffee bei Blue Bottle kostet sieben US-Dollar, aber es gibt immer eine Warteschlange.
Dadurch haben in San Francisco plötzlich eine Menge Leute Geld übrig und man kann die verrücktesten Sachen kaufen. Es gibt jetzt Eisdielen, die Eiscreme aus gefrorenem Stickstoff anbieten, und abgedrehte Bäckereien, deren Toast mehr Kunsthandwerk als Brot ist. Jeden Morgen kämpfe ich mich auf dem Weg ins Büro durch einen Strom von Hipstern in hautengen Jeans und klobigen Brillen auf Skateboards – Erwachsene! Auf Skateboards! –, die mit ihrem Becher Fünf-Dollar-Kaffee in der Hand zur Arbeit bei Firmen rasen, deren Namen wie Comicfiguren aus dem Kinderprogramm klingen: Kaggle und Clinkle, Vungle und Gangaroo.
Es erinnert mich alles ein bisschen zu sehr an das Ende der 1990er-Jahre, an die erste Dotcom-Blase. Ich habe das unheimliche Gefühl, dass es auch mit demselben Albtraum enden wird. Damals war ich Technologiereporter bei Forbes