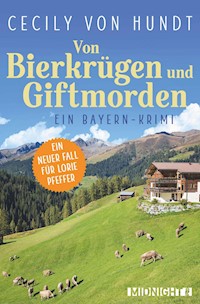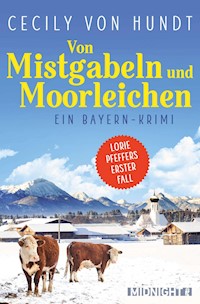Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Cecily von Hundt, geboren 1974, schreibt, reist, studiert Sprachen und das Bibliothekswesen, lebt in Lauterbach/Bayern. "Von Pilzen und anderen Menschen" ist die Geschichte einer jungen Frau, die in einem Sanatorium ihre Kindheits- und Jugendjahre Revue passieren lässt. Zu lesen als Psychogramm einer beschädigten Kindheit, aber auch als Erzählung mit Intuition für das Lebensgefühl der jungen Generation: heiter, ironisch, zynisch und mit wunderbar schwarzem Humor. Ein vielversprechendes Debüt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecily von Hundt
Von Pilzen und anderen Menschen
Erzählung
Alles kommt so, wie es kommen muß.
Ich habe solche Sätze oft in meinem Leben hören müssen. Sie sind wie gute Ratschläge zu sein pflegen und ich habe sie immer für Unsinn gehalten, obwohl sie bei mir heftigste Übelkeit oder unglaublichste Langeweile auslösen konnten. Aber nichts passiert, weil es passieren muß, sondern lediglich, weil man selber die Geschehnisse lenkt.
Es gibt drei Dinge auf dieser Welt, die ich nicht mag. Das eine sind diese guten Ratschläge, das andere mein Bruder Byron, und das dritte ist die Sorte Mensch, die mit guten Ratschlägen bis zum Bersten gefüllt ist und nur darauf wartet, sie los zu werden. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Versionen und manchmal kommt es vor, daß man jahrelang mit ihnen zusammenlebt, ohne es zu merken. Sie können aussehen wie ganz normale Menschen, eines eint sie jedoch auf der ganzen Welt, sie machen einem das Leben schwer und ich mag ihre Weisheiten nicht, genauso wenig wie jede Art von Pilzen. Die habe ich vergessen.
Ich bin seit einer Woche in einem Erholungssanatorium untergebracht und habe eine Menge dieser ungeliebten Geister in meinem Leben genossen. Sie sind um mich herum aus dem Boden gesprossen wie die Pilze. Ich scheine diese Spezies Mensch anzuziehen wie die Motten das Licht. Ich will davon erzählen und eine Lösung anbieten, wie man damit leben kann. Zwar sehe ich sie jetzt nicht mehr, doch manchmal, wenn ich mal wieder ans Kirschkompott gehe, welches Schwester Angela in der Küche für Mittwoch abend zum Nachtisch bereit gestellt hat, und ich mir eine Fingerspitze von dem kalten, süßen Gelee in den Mund schiebe, kommt es vor, daß ich sie noch höre, alle miteinander, wie sie auf mich einreden und mir die Leviten lesen. Dann stecke ich mir wie zum Trotz noch einen zweiten Finger mit Kompott hinein, sehr wohl wissend, daß ich damit Mr. Wings Portion schmälere, aber er ist zu blind, um zu sehen, was auf seinem Teller liegt, und wenn sich eine solche Gelegenheit bietet, muß man sie nutzen.
Ich höre sie, meine Lieben, die eine laut schimpfend, die nächste zieht ihre fein gezupfte Augenbraue hoch und schaut mich tadelnd an, und die dritte, ja die dritte bricht tatsächlich in Tränen aus. Das hatte sie immer getan, wenn es aufregend wurde, damit konnte sie einem wirklich die Laune verderben.
Ich soll aufschreiben, was mir passiert ist. Das sei psychologisch sehr befreiend, haben die Ärzte mir hier versichert. Es solle mir helfen, meinen Schock zu überwinden, bevor wir in die zweite Runde gehen. Die Gesprächswoche, wie sie betulich angekündigt haben.
Ich habe keinen Schock erlitten, im Gegenteil. Und ich bin sehr erleichtert darüber, daß ich hier bin. Ich kann anziehen, was ich will, mich ganz frei bewegen, und ach ja, ich brauche keine Pilze zu essen. Wenn ich mich erholt habe, gehe ich wieder nach Hause. Darauf freue ich mich, denn obwohl mir dort häßliche Dinge und häßliche Menschen begegnet sind, liebe ich mein Haus!
1
Unser Haus war alt, weißgetüncht, mit grünen Fensterläden, und lag in der Nähe von London. Meine Mutter deklarierte es gerne als Schloß. Aufgefordert oder unaufgefordert, da gab sie sich ganz unbefangen. Um ehrlich zu sein, wurde ihre Beschreibung seinen tatsächlichen Ausmaßen nicht wirklich gerecht, man könnte es als ein großes Herrenhaus bezeichnen, nicht mehr und nicht weniger. Meine Mutter hatte Findungsschwierigkeiten, auch was den Inneneinrichtungsstil betraf. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, es wäre der Einrichtung eines Schlößchens in der Toskana recht ähnlich. Jeder ungläubige Besucher, der zwischen den gefälschten Botticelli-Gemälden eher auf den klassischen, englischen Stil bestand, wurde von ihr eines Besseren belehrt. Sie konnte sehr hartnäckig sein, wenn sie wollte. Obwohl es kein Schlößchen war, weder ein italienisches, noch ein englisches, liebte ich das Haus sehr, mehr als ich seine Bewohner liebte. Wenn ich zurückdenke und überlege, war es vor allem der Garten, der es mir besonders angetan hatte. Er war wunderschön geraten, da mein Vater ihn unter seinen Schutz genommen hatte. Im Gegensatz zu Mama besaß mein Vater einen tatsächlichen Stammbaum. Das sah, merkte, roch, ja schmeckte man förmlich. Mama gab sich verzweifelte Mühe, nicht aufzufallen, die Kleidung war teuer, die Schuhe waren neu, die Diamanten glitzerten und funkelten, aber das Maß stimmte nicht. Mit einem untrüglichen Instinkt nahm sie vom Falschen zuviel und vom Richtigen zuwenig. Mein Vater litt darunter erbärmlich. Er war ein echter Ästhet, und in seiner Verzweiflung suchte er sich all die Jahre hindurch einen treuen Freund, klassisch, von eleganter Gestalt, wohlschmeckend und beruhigend, und im Gegensatz zu Mamas durchdringender Stimme still und genügsam. Mein Vater war ein Säufer aus wahrer Überzeugung.
Seine konservative Einstellung hinderte ihn daran, sich seiner geliebten Frau zu entledigen; so schwieg er wie ein Gentleman und genoß seine Karaffe schweren Cognacs. Er trank sich die Welt bunt und heiter, seine Frau schön und sein Haus stilvoll, aber in einem Punkt hielt er die Hand schützend über sein Eigentum: der Garten lag ihm am Herzen. Mamas Versuche, glitzernde Glaskugeln in die Rosenbeete zu rammen, große grobschlächtige Kunstwerke aus Stein über den Rasen zu verteilen und schilfbewachsene Teiche über die Anlage zu streuen, verhinderte er mit ungewohnter Energie. So egal ihm das Haus war, im Park war mein Vater der Herr.
So kam es dazu, daß der Garten, sogar bei näherem Hinsehen, Geschmack bewies. Jede nüchterne Stunde, die sich bei Papa zwischenzeitlich einschlich, verwandte er auf seine Planung. Es gab einen exotischen Teil mit Palmen, Kakteen und fremdartigen Blumen, einen englischen Obstgarten mit Cox Orange und saftigen Birnen, und im französischen Garten, wie er ihn nannte, schlängelten sich durch wilde Rotdornbüsche weiße Kieselwege an kleinen Tümpeln vorbei. In der Mitte lag ein großer Weiher mit saftigen Seerosen und schattigen Trauerweiden. Das war der unberührte Teil, den ich besonders liebte. Der zweite Grund, warum es mich ins Grüne zog, war der, daß ich dort meine Ruhe hatte. Abgesehen von Papa, bevorzugte meine Familie die warmen, weichen Sessel im Haus. Sie mochten keine frische Luft oder duftende Blumen. Die Frösche im Teich ekelten sie, der Staub auf den Wegen machte ihre Schuhe schmutzig und abgesehen davon benahmen sich die kleinen Tierchen alle miteinander ungehörig und fügten ihnen rote Schwellungen zu, die kratzten und juckten. Ich nahm ihnen das nicht weiter übel. Hatte meine Mutter oder später Josephine das Gefühl, sie müßten etwas für ihren Teint tun, wies ich sie auf ihre von der Sonne ausgebleichten Haare hin. Das genügte im Normalfall schon, und ich war sie los. Als Kind verbrachte ich die meiste Zeit auf dem Balkon, der zum Garten hinaus lag. Ich versteckte mich hinter den Gitterstäben, von wo aus man den ganzen Park überblicken konnte, die dunkelgrünen, fleischigen Rhododendronrabatten, die sich an das Haus schmiegten und die scharf gemähten Rasenflächen, die an jeder Ecke mit feisten, weißen Putti bestückt waren. Ich sah auf Aline, das junge, schwarze Kindermädchen aus Seattle, und zählte, wie oft sie um das Haus lief, um mich zu suchen, und jedes Mal, wenn sie in mein Blickfeld kam, malte ich mit Mamas Lippenstift einen Strich auf den Balkonboden. An guten Tagen kam ich auf achtzehn.
„Miss Emma, Sie werden schon sehen, was Sie davon haben, wenn Sie jetzt nicht sofort zum Vorschein kommen.“ Das sagte sie immer und sie wußte, daß es mich nicht beeindruckte. Doch beide wußten wir, daß sie mich nicht fangen würde, ich war zu jung und zu flink, und sie zu faul und zu dick. Ich wartete so lange, bis sie um die Ecke gekeucht war, und schlüpfte dann leise in das kühle Treppenhaus. Auf dem geschwungenen, schmiedeeisernen Treppengeländer konnte man perfekt rutschen. Als kleines Kind brach ich mir dabei den linken Fuß, doch da niemand Notiz davon nahm, rutschte ich weiter, bis ich verheiratet war. Wichtig war, so schnell zu rutschen, daß man mit dem linken Fuß die Balance in der Luft halten konnte und sich mit dem rechten am Geländer entlang gleiten ließ; wurde man ängstlich und zögerte, fiel man zwangsläufig. Ich war jedoch so gut, daß ich Zeit meines Lebens bedauere, daß es für Treppengeländerrutschen keinen Wettbewerb gibt. Ich wußte, keiner hätte mich schlagen können. Beim Aufkommen mußte der dunkelbraune, polierte Treppenabsatz genau getroffen werden. Schnell, mit nackten Füßen über den kalten Marmorfußboden und raschem Blick in den Spiegel im Vorzimmer, ob Mama oder Papa mich entdecken würden, floh ich mit gesenktem Kopf nach draußen ins Freie. Hatte ich diesen Gang geschafft, kletterte ich die große Hängebuche hinauf, die hundert Meter vom Haus entfernt stand. Von dort aus hatte man den besten Ausblick auf unser prächtiges, verleugnetes, englisches Herrenhaus mit seinen spitzen Giebeln und dem Efeu, der sich um die großen Fenster rankte. Ich liebte ihn, aber Mama sagte, er müsse weg, er zerstöre den Stein. Doch ich wußte, für solche praktische Dinge war sie zu vergeßlich.
Wenn ich an meine Mutter denke, dann denke ich vor allem an ihre Krankheiten, die sie regelmäßig befielen und zu ihren hervorstechendsten Eigenschaften gehörten.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie meine schöne Mutter in ihrem großen, weißen Holzbett lag, dessen Kopf- und Fußende mit blauem Damast bespannt waren. Die Wände des Schlafzimmers waren weiß gestrichen, mit Stuck abgesetzt und die dunkelroten Samtvorhänge die meiste Zeit des Tages zugezogen.
Ich durfte nicht laut mit ihr reden, sie war sehr empfindlich in bezug auf Geräusche und vor allem in bezug auf mich.
„Du klingst wie ein Reibeisen, Emma“, sagte sie immer. „Sprich so wenig wie möglich.“ So wußte ich nicht genau, was ich in ihrem Krankenzimmer sollte, wenn Aline mich in diesen Tagen gegen die Mittagszeit an der Hand nahm und mich zu ihr führte. Ich saß an ihrem Bett und hörte ihr ergeben zu, wie sie mir Ratschläge gab. Sie waren immer von der gleichen Art: ich solle mich nicht schmutzig machen, höflich gegenüber Aline und den anderen Angestellten sein, nicht auf die Hängebuche klettern und fleißig zum lieben Gott beten, daß er mich später hübsch werden läßt. Ich protestierte nicht. Nachdem sie geendet hatte, küßte ich sie auf ihre weiße, kühle Wange und nutzte die Gelegenheit, wenn Aline nicht in der Nähe war, mir beim Hinausgehen einen ihrer Lippenstifte von der Kommode zu angeln, um meine Vorräte auf dem Balkon aufzufrischen. Ich war eine ordentliche Person. Es waren der Dienstag und der Donnerstag, an denen ich ihr entkommen konnte. Noch heute sind diese Tage irgendwie die schönsten Tage in der Woche. Dann kamen die Wilson-Schwestern. Sie kamen nicht wirklich zu Besuch. Sie waren anders als die hell gekleideten, blassen Freundinnen meiner Mutter, und sie hatten keine Angst vor meinen schmutzigen Fingern. In ihrer Gesellschaft, bei ihren roten Haaren und teigigen Gesichtern fühlte ich mich wohl. Anette, die ältere von beiden, hatte das ganze Gesicht mit Sommersprossen übersät, und beide hatten sie große schiefe Nasen, die immer glänzten, selbst an den trübsten, dunkelsten Herbsttagen.
„Die kleine Emma wird hübsch werden“, sagten sie regelmäßig, wenn sie mich sahen, und sie taten so, als wäre das verwunderlich.
„Natürlich werde ich das.“
„Deine Mutter sagt etwas anderes.“
Das wußte ich, aber es trübte meine Überzeugung nicht. Es war klar, daß ich eine schöne Frau werden würde. Denn das brauchte man, damit man geliebt wurde, das hatte ich schnell begriffen. „Sie sieht nicht gut“, erklärte ich ernsthaft, „sie hat von Geburt an sehr schlechte Augen, das weiß nur niemand.“
„Ach wirklich?“ Annie, die zweite Schwester, mit zwei unterschiedlich großen Brüsten, starrte mich erstaunt an.
„Wie schlecht?“
„Sehr schlecht. Ich muß ihr immer vorher Bescheid sagen, wer Sie sind, sie würde Sie sonst nicht erkennen. Außerdem hat sie Angst vor Ihnen.“
Das stimmte. Es war für Mama eine entsetzliche Vorstellung, es käme zufällig jemand vorbei, wenn die Wilsons da waren.
„Sie braucht sich nicht vor uns zu fürchten, kleine Emma. Wir sind ihre Freunde.“
Sie wurden regelmäßig von Dorfpfarrer Mr. Cook geschickt, um meine Mutter zu bekehren, aber jeder im Dorf wußte, daß sie nicht in die Kirche ging. Mit Ausnahme von mir. Mama sagte den häßlichen Wilson-Schwestern immer, ihr würde die Messe in Chesterfield mehr zusagen, sie verabscheue die Katholiken, erklärte sie, sie seien alle Verbrecher. Wie der Zufall es wollte, wurde ich von der Schule in Pfarrer Hockins Firmunterricht geschickt, und als er mir erzählte, er hielte schon lange keine Messen mehr, des bösen Rheumas wegen, wurde mir klar, daß man mich belogen hatte, und daß meine Mutter eine Sünderin war. Die schweren Tage meiner Kindheit waren jedoch diejenigen, an denen meine liebe Mutter auf der Höhe war, wie sie zu sagen pflegte.
An diesen Tagen floh ich vor ihr und ihrer Stimme, die sonst weinerlich und schwach aus den hellblauen Wolken ihres Kissens emporstieg, aber einen durchdringenden und schneidenden Tonfall bekam, den ich über den frisch gemähten Rasen bis hinauf in mein Versteck in der Hängebuche hören konnte, und die mich rief.
Und dann begann die Jagd um den ganzen Park herum. Ich flüchtete vor Aline, die auf dicken Beinen mich zu fangen versuchte, und vor Mama, die wie eine Drohne drohend auf der Terrasse saß und uns beide durch die Anlagen hetzte. Erwischte sie mich, wurde ich auf den alten Speicher gesperrt, auf den ich alleine nicht gehen durfte, da meine Eltern Angst hatten, ich könnte mich an den rostigen Nägeln und alten, blinden Spiegeln verletzen. Mit der Angst um meine Person war es nicht mehr weit her, wenn es darum ging, daß ich von der Bildfläche verschwinden sollte. Ich freute mich, denn ich liebte diesen Ort mit den großen, alten Schränken, vollgestopft mit verbogenen Schuhen, mottenzerfressenen Kleidern, alten Büchern und Lampenschirmen. Im Winter war es warm und trocken, und im Sommer kletterte ich durch eine kleine Luke auf das Dach und konnte die Sterne beobachten.