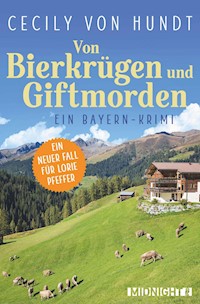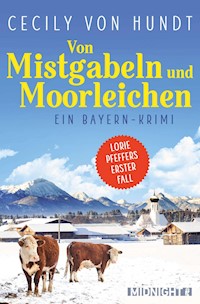4,99 €
Mehr erfahren.
Haddenford – ein behüteter englischer Ort, so meint man. Doch ein Ereignis überschattet die Geschichte des Dorfes: In den Zwanzigerjahren kamen bei einem Brand unzählige Bewohner ums Leben, der Fall wurde nie aufgeklärt. Als Jahrzehnte später neue Indizien auftauchen, nimmt sich Kommissar Mortimer Eisenhout dem Fall an – die Spuren führen in die Cavendish-Villa zu den Schwestern Alice und Florence, die damals alleine mit ihrem kleinen Bruder in dem Haus lebten. Ihre Mutter war eine Außenseiterin im Dorf, sie wohnte in der Irrenanstalt – weil sie beschuldigt wurde, auf einem Fest ihre eigenen Gäste vergiftet zu haben. Gibt es einen Zusammenhang mit dem Brand? Was haben die Cavendish-Schwestern damit zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Die AutorinCecily von Hundt wurde 1974 in Düsseldorf geboren. Sie studierte Bibliothekswesen in Potsdam und arbeitete als freie Journalistin für BILD Berlin und die Süddeutsche Zeitung. 2004 eröffnete sie in Berlin Mitte den Buchladen Hundt, Hammer Stein und sie lebt heute mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in der Nähe von München. Bei MIDNIGHT erschien bereits ihr Roman Das letzte Geständnis.
Das BuchHaddenford – ein behüteter englischer Ort, so meint man. Doch ein Ereignis überschattet die Geschichte des Dorfes: In den Zwanzigerjahren kamen bei einem Brand unzählige Bewohner ums Leben, der Fall wurde nie aufgeklärt. Als Jahrzehnte später neue Indizien auftauchen, nimmt sich Kommissar Mortimer Eisenhout dem Fall an – die Spuren führen in die Cavendish-Villa zu den Schwestern Alice und Florence, die damals alleine mit ihrem kleinen Bruder in dem Haus lebten. Ihre Mutter war eine Außenseiterin im Dorf, sie wohnte in der Irrenanstalt – weil sie beschuldigt wurde, auf einem Fest ihre eigenen Gäste vergiftet zu haben. Gibt es einen Zusammenhang mit dem Brand? Was haben die Cavendish-Schwestern damit zu tun?
Cecily von Hundt
Die Cavendish-Villa
Roman
Midnight by Ullsteinmidnight.ullstein.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Originalausgabe bei Midnight Midnight ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Februar 2016 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016 Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © privat ISBN 978-3-95819-063-4 Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Prolog
Es ist nicht so, dass ich mir den Job ausgesucht habe. Bis zu meiner Pensionierung sind es noch genau 224 Tage und ich zähle jeden einzelnen von ihnen. Aber ich bin nun mal Polizist, ich bin es mein Leben lang gewesen und schon mein Vater und mein Großvater sind es gewesen. Und eines kann man mir sicherlich nicht vorwerfen, und das ist mangelndes Pflichtbewusstsein. Ann hat gesagt, ich solle den Auftrag nicht annehmen – irgendetwas mit der Hüfte oder dem Rücken, Dr. Barnes, Julian würde es schon ausstellen, schließlich sind wir seit mehr als 40 Jahren zusammen im Vorsitz des Angelvereins. Aber ich habe gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Eisenhouts machen so etwas nicht. Zusammen mit mir, meinem Vater und meinem Großvater sind wir in der elften Generation Polizisten. Nicht dass in unserem ländlichen Dorf besonders viele Verbrechen geschehen wären. Um ehrlich zu sein, lässt es sich in dem schmalen Ordner abheften, der im linken Fach des verstaubten Aktenschrankes steht. Ich spreche jetzt von richtigen Verbrechen und damit meine ich Mord. So etwas gibt es nur alle Jubeljahre mal bei uns. Der Ordner umfasst eine einzige Akte, über die quer mit einem Permanentmarker geschrieben »Cavendish« steht, und damit ist die Großgrundfamilie gemeint, die wir hier bei uns haben. Den Cavendishs gehört das große Haus am Ende der Allee. Ein prachtvoller Bau aus der Jahrhundertwende, der vor zwanzig Jahren von den Schwestern wieder instand gesetzt wurde, da er drohte, langsam aber sicher zu verfallen. Wir können das Haus von der Straße aus nicht sehen, ein verwilderter Wald zieht sich um das Grundstück, und die Mauer, die den Wald umschließt, ist mindestens drei Meter hoch. Die Geschichte, die mit dieser Familie und mit diesem Haus zusammenhängt, ist eine lange Geschichte, und sie geschah kurz nachdem ich geboren wurde. Mein Großvater Eisenhout war damals Polizist in unserem Dorf, kurz vor seiner Pensionierung, genau wie ich es heute bin, hier in dem kleinen, kuscheligen Haddenford mit seinen knapp 250 Einwohnern, kurz vor der Grenze zu Schottland. So lange es auch her sein mag, er hat sich von dem, was hier passiert ist, niemals erholt. Es heißt, niemand hätte sich davon erholt, als damals im Sommer die Frauen aus unserem Dorf verschwanden, aber davon will ich später erzählen, eins nach dem anderen.
Vor mir auf meinem Schreibtisch liegt ein funkelnagelneuer Ordner, er ist aus grünem Plastik und hat rote Ecken, und ich habe mir nicht verkneifen können, wieder mit einem schwarzen Stift darüber zu schreiben, es schien mir irgendwie angebracht. Es ist wieder ein Name, der dort steht und er lautet wieder Cavendish. Ich kenne zwei Familienmitglieder der Familie, obwohl kennen etwas übertrieben sein mag, sagen wir, ich bin ihnen begegnet. Einmal Alice Cavendish, obwohl ich mich an diese Begegnung kaum erinnern kann und dann Florence Cavendish, ihre jüngere Schwester.. Ich habe sie in meinem Leben zweimal gesehen. Eigentlich dreimal, aber wie ich schon sagte, eins nach dem anderen. Das eine Mal war an Heiligabend, als der Strom im Dorf ausfiel und sie vormittags einen Karton mit 64 Kerzen im Laden gekauft hatte, und ein weiteres Mal habe ich sie gesehen, als ihre Schwester Alice starb, was nun sechs Jahre her ist. .
Miss Florence Cavendish ist eine schlanke, hoch aufgeschossene Dame mit dichten, dunklen Augenbrauen und einem scharfen Blick. Damals, als die Geschichte passiert ist, war sie knapp 14 Jahre alt, und ich denke oft darüber nach, wie sie wohl heute aussehen mag. Ellen sagt, ihr Körper sei gebrechlich geworden, aber ihrem Gesicht sehe man ihr hohes Alter kaum an. Sie wirke, als sei sie unberührt von den profanen Dingen dieser Welt durch ihr Leben gewandert. Wo andere Menschen eine Landkarte ihrer Erfahrungen, ihres Schmerzes und ihrer Emotionen im Gesicht tragen, sei Florence Cavendish so unberührt wie eine Sphinx. Mord in 26 Fällen wird ihr vorgeworfen, und ich werde derjenige sein, der die Ermittlungen führen wird. Sie hat mir im Vorfeld ein schmales Paket und einen kurzen Brief in ihrer engen, sorgfältigen Handschrift zukommen lassen. In dem Paket befand sich ein Tagebuch, jede Seite ist gleichmäßig mit dieser altmodischen Schrift bedeckt. Ich solle das Tagebuch lesen, stand in ihrem Brief. Das Geschriebene würde einiges erklären.
Ann hat den Kopf geschüttelt und leise vor sich hin geschimpft, aber das tut sie immer, wenn sie sich Sorgen um mich und meine Gesundheit macht. Sie ist der Meinung, ich solle mich nicht überarbeiten.
Ich habe mir ein Bier gegönnt und das Feuer im Kamin angemacht. Ann schläft bereits und ich bin für ein paar Stunden Herr in meinem Haus, und diese Zeit werde ich nutzen, um mich dieser seltsamen Geschichte zu nähern.
*
Florence‘ Tagebuch
26. Juli 1924
Ich habe meine Kindheit in diesem großen Haus verbracht, versteckt hinter einem Wald aus dichten Laubbäumen, einer hohen, undurchdringlichen Hecke und der festen Überzeugung, dass hinter dem Wald die Hexen hausten.
Wir angelten unsere Fische in dem kleinen Tümpel hinter dem Haus, in dem Seerosen wucherten, und pflückten unsere Äpfel im eigenen Garten. In dem Winter, in dem die Wege zum Dorf so zugefroren waren, dass wir mit unseren dünnen Seidenkleidern, mit denen wir in der klirrenden Kälte erbärmlich froren, den Weg nicht schaffen konnten, aßen wir die Katze, die seit Jahren durch unseren Garten streunte. Sie tat uns ein wenig leid, aber um nichts in der Welt hätten wir den alten Berill gebeten, den Weg zu uns heraus mit dem Lastwagen zu nehmen, um uns Fleisch und Eier zu bringen. Nein, eher wären wir elendig zugrunde gegangen.
Als unsere Eltern noch bei uns waren, war das anders gewesen. Wir hatten gebügelte weiße Kleider getragen. Mein Bruder liebte das hellblaue Hemd, das am Kragen ein wenig ausgewaschen war, auch wenn Mum schimpfte, er sehe damit aus wie ein Leichtmatrose. Aber sie war machtlos gegen ihn, das war schon immer so gewesen.
Als Mum und Dad noch da waren, waren wir sogar manchmal im Dorf unterwegs. Wir gingen in den Krämerladen, Mum kaufte uns Kindern einen klebrigen Zuckerkringel mit bunten Zuckerstreuseln, während sie selbst einen starken Kaffee mit einem Schuss Sahne trank. Am Abend saßen wir nach dem Essen am Kamin, und Dad schwenkte sein Cognacglas und sagte immer wieder »Kinder, es ist Zeit, schlafen zu gehen«, aber er sagte es mit einem Lächeln in der Stimme und wir wussten, wir hatten noch ein wenig Zeit, seinen Geschichten zu lauschen.
In dem Sommer, in dem es passierte, flogen die Schwalben tiefer, als es jemals der Fall gewesen war, und von da an war alles anders.
Die Beeren sind reif. Sie sind besonders süß diesen Sommer, als hätten sie sich extra für uns angestrengt. Ich werde Marmelade daraus kochen und wenn noch ein paar übrigbleiben, bekommt Lenny sie. Er mag sie am liebsten frisch gepflückt und noch warm von der Sonne.
Mrs Oterbury wird heute zum Tee kommen. Das muss sie. Einmal im Monat schicken sie jemanden von der Behörde, und Alice steht dann auf und zieht sich an. Sie braucht dafür eine Weile, aber das macht nichts, wir haben ja Zeit. Ich stelle das Schälchen mit den Beeren auf die Treppenstufe vor Lennys Zimmer, er macht um diese Zeit immer sein Mittagsschläfchen und mag es gar nicht, wenn man ihn dabei stört.
»Schläfst du noch, Liebes?«
Ich ziehe die Vorhänge in Alices Zimmer ein klein wenig zur Seite, damit die Sonne sie nicht stört, sie ist furchtbar empfindlich an den Augen.
»Hm.«
»Ich fürchte, du musst aufstehen, Liebes. Die alte Schachtel wird in einer halben Stunde da sein.«
»O Gott.« Alice öffnet die Augen und sieht mich an. Ein breites Lächeln huscht über ihr Gesicht. »Wie hübsch du aussiehst! Du hast Farbe bekommen.«
»Ich war Himbeeren pflücken.«
Ich ziehe die Bettdecke zur Seite und fasse Alice vorsichtig um die Taille. Sie ist so zerbrechlich, fast wie ein Kind.
»Ein bisschen mitmachen, wenn ich bitten darf!«
Alice lächelt und setzt sich vorsichtig auf, sie fasst sich an die Schläfe und seufzt leise.
»Kann es sein, dass schon wieder ein Monat rum ist?«
»Ja, leider.«
Sie schlingt den Morgenmantel fester um die Taille und sieht zum Fenster hinaus.
»Ich rieche den Herbst«, sagt sie. »Riechst du ihn auch?«
»Unsinn.«
»Doch, ganz sicher. Er liegt in der Luft. Es riecht nach Tod.«
»Du übertreibst.«
Alice legt ihre weiche Hand an meine Wange und lächelt mich an.
»Ist schon in Ordnung, Flory. Weiter schaff‹ ich es allein.«
»Sicher?«
»Ganz sicher.«
Sie klingt entschlossen, und wenn sie so klingt, weiß ich, dass es ein guter Tag wird.
»Gut. Komm runter, wenn du soweit bist. Aber trödele nicht zu lange.«
Ich schließe die Tür hinter mir und laufe die Treppe hinunter. Der alte, weiche Teppich schluckt meine Schritte. Dad hatte ihn auswechseln wollen, aber ich war dagegen gewesen, und so haben wir hin und her überlegt, aber schließlich haben wir ihn gelassen, wo er ist. So wie wir es immer machen. Wir hängen nun einmal an diesem Haus und wir mögen es nicht, wenn sich etwas verändert. Keiner von uns.
Kapitel 1
Vielleicht ist es ein Wink des Schicksals gewesen, dass der alte Ruben genau 223 Tage vor meiner Pensionierung den Löffel abgegeben hat. Wenn ich die Füße hochlege, wird Clarke die Polizeizentrale übernehmen. Er ist ein guter Junge, zwar nicht die hellste Kerze im Leuchter, aber wenn er Glück hat, wird er sich in seiner Amtszeit ausschließlich mit gestohlenen Kühen und vom Sturm umgerissenen Bäumen beschäftigen müssen – so wie ich es eigentlich für mich geplant hatte. Aber so funktioniert das Leben eben nicht. Nicht für uns Eisenhouts, und da die Linie vermutlich mit mir aussterben wird, kommt es halt mir zu, dieses Geheimnis unseres Dorfes zu lüften.
Ruben ist keinen sehr ehrenvollen Tod gestorben. Wir haben ihn auf dem Lokus seines alten, völlig verwahrlosten Hauses gefunden, mit offener Hose und in der Hand eine seiner alten, stinkenden Maiszigaretten. Daneben die aktuelle Tageszeitung vom 2.7.1980. Die Schlagzeile lautete damals »Viertägige Eskimo-Konferenz in Grönland beendet«. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Information ihn aus der Fassung gebracht haben konnte, aber sein schwaches Herz hatte einfach aufgehört zu schlagen. Die letzten Jahre hat es schlimm um ihn gestanden. Gesoffen hat er schon immer, aber seitdem die alte Alice Cavendish gestorben war, war es steil abwärts mit ihm gegangen. Niemand hatte gewusst, dass er die alte Frau so sehr geliebt hatte. Überall im Haus haben wir Spuren der Cavendish-Familie gefunden. Fotos, auf denen sie zu sehen waren: Alice, hoch gewachsen, blass und schmal, die kleine Florence mit wilden Haaren und einem düsteren Blick, auf ihrem Schoß der schwachsinnige Bruder Lenny, und dahinter Ruben. Überall verteilt standen diese und ähnliche Bilder, und in den Regalen haben wir hinter Unmengen von Büchern Gegenstände aus dem Herrenhaus gefunden, die die Schwestern ihm geschenkt hatten. Alte, perlmutterne Kämme mit Initialen, Perlen, eine Glaskugel mit London, in der es schneite, wenn man sie schüttelte, und kistenweise weiteren Plunder. Und dazu den Brief. Genauer gesagt hat Clarke ihn gefunden, der Brief war auf die Rückseite eines der Fotos gepinnt, das die Geschwister auf ihrer Terrasse zeigte. Ruben hatte wohl angenommen, es würde mit all dem anderen Krempel verbrannt werden, so wie es in seinem Testament stand, einem Fetzen Papier, mit Kugelschreiber in wenigen Worten hingeschmiert.
Clarke hatte den Bilderrahmen mit dem Foto fallenlassen, das Glas war in tausend Stücke zersprungen, und hinter dem Foto war der Brief zum Vorschein gekommen. Es war genau dieselbe Schrift, die ich mittlerweile so gut kenne. Eng, leicht schräg gestellt und gestochen scharf. Er enthielt nur wenige Zeilen und es war klar, dass er niemals für die Augen von jemand anderem bestimmt sein würde als Rubens, und der alte Junge würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass der Brief nun fein säuberlich aufgereiht neben den zahllosen Fotografien und Florence Cavendishs Tagebuch auf meinem Schreibtisch liegt. Aber wie ich schon sagte, das Schicksal geht manchmal sehr seltsame Wege.
*
An einem verschneiten Wintertag 1922, vor zwei Jahren, hatten sie uns das Haus wegnehmen wollen. Sie waren zu fünft gekommen, mit einem großen, schwarzen Wagen und zwei Hunden. Sie hatten wie Schläger ausgesehen und der Hass war ihnen regelrecht aus den Augen gespritzt, als sie bei uns unten im Flur gestanden hatten. Ihre groben Stiefel hatten unsere Fliesen mit Wasser vollgetropft, der Bürgermeister hatte eine Schrotflinte geschultert. Eine Schrotflinte! Wie albern! Dabei waren wir doch nichts anderes als ein Haufen wehrloser Kinder!
Alice hatte ihnen Tee serviert. Sie hatte sogar den guten Baumkuchen angeschnitten, den sie extra für Lennys Geburtstag gebacken hatte, und Lenny war traurig gewesen deswegen, aber als alles vorbei war, hatte sie ihm mit ihrer warmen, schmalen Hand über den Kopf gestrichen, um ihn zu trösten. »Manchmal muss man Opfer bringen, Lenny«, hatte sie ihm erklärt. »Und du hast uns heute sehr stolz gemacht.«
Alice war auf ihren leichten Schuhen zwischen den Männern hergehuscht, ihnen dabei lächelnd zugenickt und mit dem Kopf in Richtung Wohnzimmer gedeutet.
»Kommen Sie doch herein, meine Herren«, hatte sie leise und freundlich gesagt. »Ich sehe, Sie haben etwas auf dem Herzen, aber seien Sie doch so gut und legen Sie die Waffen beiseite. Sie könnten meinen Geschwistern Angst machen und sie sind noch so klein. Sie verstehen bestimmt? Ja? Ich danke Ihnen.«
Die einfältigen Männer mit ihren kuhäugigen Gesichtern hatten Alice angestarrt, als wäre sie ein Wesen von einem anderen Stern.
Kyle, der Schlachter, der immer nach Blut und Eingeweiden stank, der Officer Mr Eisenhout, der seine Frau schlug, wann immer ihm danach war, und die vier anderen, Mr.Oterbury, der Bürgermeister, Mr Welsh, der Schwager von Mrs Oterbury, fett und kurzatmig und mit kleinen, feisten Fingern, und die Brüder Cowelsh. Dumm wie Bohnenstroh und zurückgeblieben wohnten sie noch bei ihrer Mutter und fraßen nur Blutklöße und eingelegten Fisch. Sie alle starrten meiner wunderschönen, elfengleichen Schwester hinterher und ich spürte, wie das Lachen in meiner Kehle emporstieg
»Sie sind alle Missgeburten«, hatte meine Mutter immer gesagt. »Inzucht überall. Jeder ist hier mit jedem verwandt, aber sie denken, sie seien ganz normal. Nicht zu fassen.« Dann hatte sie sich zu uns heruntergebeugt und uns einen Kuss auf die Stirn gehaucht. »Eure Mummy erfindet Geschichten, die Männer tun niemandem etwas zuleide. Erzählt Dad nicht, dass ich das gesagt habe, ja? Das bleibt unser kleines Geheimnis.«
Wie unrecht sie damit gehabt hatte. Und wie sie uns etwas zuleide hatten tun wollen, als sie da standen und unseren wunderschönen Flur mit ihren derben Stiefeln besudelten.
»Meine Herren«, Alice stellte das Porzellan und das gute Kristall auf den Tisch. Es klirrte leise und der Glanz des Glases brach sich in den Türen der alten Mahagonischränke. Bei uns ist es immer schön sauber, darauf achten wir, wir mögen das sehr. »Bitte folgen Sie mir doch.« Wie eine Schar dummer Gänse trampelten sie hinter ihr her und kniffen die Augen zusammen, das helle Licht der Leuchter im Salon blendete sie.
»Und nun ganz von vorne, was können wir für Sie tun?« Alice machte eine einladende Bewegung in Richtung des Sofas und der Stühle, und ich betete innerlich, sie würden ihre unförmigen Hinterteile und ihre groben Körper nicht auf unsere filigranen Kirschholzmöbel wuchten.
»Ähm.« Der Bürgermeister räusperte sich und blickte sich hilflos und suchend um, aber niemand kam ihm zu Hilfe.
»Ähm, nun ja, wir waren unterwegs und hätten hier bei Ihnen etwas zu erledigen gehabt.«
»Hier? In unserem Garten?«
»Ja, nein, also sozusagen auf Ihrem Gelände.«
»Und was genau war so dringend, dass Sie Ihre Waffen haben mitnehmen müssen? Sind wir etwa in Gefahr?«
Alice lachte ihr silberhelles Lachen, das wir viel zu selten zu hören bekommen, und es wärmte mich von innen wie ein helles Feuer und minderte beinahe den Gestank und die Feigheit, die den Männern aus allen Poren drang. Die Miene des Bürgermeisters verriet nicht, ob er gemerkt hatte, dass sie ihn auslachte.
»Ähm, entschuldigen Sie, Miss«, stotterte er, »entschuldigen Sie, dass wir einfach so hier eingedrungen sind, eine Kuh ist uns entlaufen.«
»Ach.« Alice setzte sich aufrecht hin und faltete die Hände im Schoß. «Und da dachten Sie, Sie würden sie in unserem Wohnzimmer finden?« Sie lächelte.
»Ja, nein, das war wohl ein Missverständnis.« Er räusperte sich erneut. »Entschuldigen Sie, Miss, wir wollen Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen.«
Er hatte sich auf dem Absatz umgedreht, hatte Kyle am Arm gepackt und ihn Richtung Flur gestoßen, Richtung Tür, hinaus in die Dunkelheit. Einer nach dem anderen waren sie hinaus gestolpert, als wäre nichts gewesen. Als hätten sie nicht noch ein paar Minuten zuvor vor unserem Haus gestanden, die Arme in die Luft gereckt und hasserfüllt gebrüllt, dass sie uns verjagen würden von unserem Grund und Boden. Sie hatten lauthals behauptet, dass wir Abschaum wären, Unheil, das mit der Wurzel ausgerissen werden müsste, für immer und ewig.
An diesem Abend schmiegten wir uns alle drei dicht unter der Bettdecke aneinander. Sie würden fürs Erste nicht wiederkommen, das wussten wir. Aber irgendetwas würde geschehen. Der Wind hatte sich gedreht.
Kapitel 2
Das Papier ist aus einem alten Küchenkalender herausgerissen worden. An einer Ecke ist noch die Maßangabe für die Zutaten für einen Kuchen zu erkennen, ohne dass ich sagen kann, was für eine Art Kuchen es war. »Ein Teelöffel Zucker, eine Messerspitze Salz, vier Eier«, steht dort, und oben links ist eine Margerite aufgedruckt, ein sommerliches Motiv, es kann also ein Apfelkuchen gewesen sein oder ein Beerenkuchen. Die Cavendish-Mädchen sollen vorzügliche Köchinnen gewesen sein, obwohl natürlich nie wieder jemand im Dorf – mit Ausnahme der alten Oterbury, Gott hab' sie selig – einen Happs zu essen oder zu trinken aus dem Herrenhaus angerührt hat.
Der Text ist kurz:
Mein liebster Ruben. Nun ist es soweit. Wir werden es ihnen heimzahlen, ihnen allesamt, der dreckigen Bande. Sollte es schief gehen, wissen wir, dass Lenny es gut haben wird bei Dir. Vertragt Euch. Er ist nicht einfach, das weiß ich doch. Du bist dann alles, was er hat.
In Liebe, Florence
Um ehrlich zu sein, hätte ich den Zettel am liebsten einfach mit all dem Plunder, den wir in Rubens Haus gefunden haben, in den großen Container geworfen, den sie vor dem Haus aufgestellt und schließlich abtransportiert haben. Niemand hätte danach gefragt. Keine alten Wunden wären aufgerissen worden und eine alte Dame hätte in Würde sterben können. Aber ich konnte es nicht, Clarke hatte den Zettel aufgehoben, und seine weichen, runden Wangen hatten sich hektisch rot verfärbt, als er ihn laut, mit kurzen Unterbrechungen, vorgelesen hatte. Und ich habe mich verflucht, dass ich nicht schneller gewesen war und das Stück Papier zuerst gefunden hatte, aber mein Rücken macht einfach nicht mehr so richtig mit. Jetzt haben wir den Salat und ich bereite mich innerlich schon auf das Gespräch mit Miss Cavendish vor. Es mag albern klingen, aber ich habe Ann darum gebeten, mir das gute Hemd und die dunkelblaue Hose herauszulegen. Dabei weiß ich noch gar nicht, wann oder wo ich die alte Dame treffen werde. Aber um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig aufgeregt. Das mag mit unserem dritten Zusammentreffen zusammenhängen, dem Zusammentreffen von dem ich noch keiner Menschenseele erzählt habe, nicht einmal meiner guten, alten Ann. Wenn ich daran denke, schießt mir noch heute die Schamesröte in die Wangen und ich bete innerlich, dass, wenn wir wieder aufeinandertreffen, sie sich nicht daran erinnern wird. Wie auch immer. Ich will einer vornehmen Dame anständig gekleidet gegenübertreten, ganz egal, was sie getan hat oder eben nicht, so habe ich es gelernt.
Sie wird nicht zu uns ins Präsidium kommen. Das Angebot, dass ich zu ihr komme, hat sie freundlich und energisch am Telefon bejaht. Dabei hatte sie diese kleine Spitze in der Stimme, als sei es selbstverständlich, dass ich mich auf den Weg zu ihr und ins große Haus machen würde und nicht umgekehrt. Und ich muss gestehen, ich war ein klein wenig aufgeregt. Seit Jahrzehnten hat keiner von uns, mit Ausnahme von Ellen, das Herrenhaus von innen gesehen, und ich wäre dumm, wenn ich dazu Nein gesagt hätte.
Draußen duftet schon der erste Flieder in den Hecken. Ich liebe diese Jahreszeit, sie kündet von Neubeginn und tut meinem Rücken so gut.
*
Mrs Oterbury stand der Schweiß auf der Stirn. Gott, wie ich sie hasste. Wie ich alles hasste, was unsere kleine Idylle störte. Sie hatte etwas auf dem Herzen, ihr mächtiger Busen bebte, und das goldene Medaillon hüpfte auf und ab. Mir wurde schlecht, wenn ich nur hinsah.
»Mrs Oterbury, einen heißen Tee?«
Alice war ein wenig blass. Das mochte an der Bluse mit den hellblauen Rüschen um den Kragen liegen. Sie stand ihr nicht besonders gut, aber ich würde es niemals über das Herz bringen, es ihr zu sagen. Meine Schwester war trotz allem die schönste Frau der Welt.
»Ähm, ja, gerne, ach nein, ich meinte, nein danke. Danke nein.« Sie war nervös. Über die Maßen nervös. Eine hektische Röte hatte sich über ihren Kragen den Hals hinauf ausgebreitet. Die Sache versprach, amüsant zu werden.
»Also nein.« Alice lächelte und ich merkte, dass sie leicht schwankte, aber sie hielt sich gut.
»Ein Stück Kuchen?« Ich griff über den Tisch und reichte ihr das Tablett mit meinen selbstgebackenen Lebkuchen. Sie sahen scheußlich aus. »Selbstgemacht, ich weiß doch, Sie lieben Lebkuchen.«
Mrs Oterbury zögerte leicht und griff dann beherzt zu. »Danke, das ist reizend von dir. Danke sehr.«
»Mrs Oterbury, was können wir für Sie tun?«
»Nun ja.« Die Dicke stellte den Teller mit den Lebkuchen schnell wieder ab, holte tief Luft und sah mir in die Augen. »Nun ja, es geht um Lenny.«
»Ja, selbstverständlich, deshalb sind Sie ja hier, richtig?«
»Richtig, Florence, richtig. Ich habe mich gefragt, wie es ihm geht.«
»Er schläft.«
»Es geht ihm gut, nicht wahr, Liebes?«, sagte Alice sanft und legte ihre Hand auf meinen Arm. Die federleichte Berührung beruhigte mich sofort.
»Ja«, bestätigte ich, »es geht ihm ausgezeichnet.«
»Kann ich ihn sehen?«
Mrs Oterburys Augen verengten sich zu Schlitzen. Wie ein Habicht sieht sie aus, dachte ich. Wie ein gieriger Habicht, kurz vor‘m Zustoßen auf das hilflose Opfer.
»Selbstverständlich können Sie ihn sehen, Mrs Oterbury, jederzeit. Das ist schließlich Ihr Job, nicht wahr?«
Alice führte ihre Tasse an die Lippen und trank einen Schluck.
»So ist es.« Mrs Oterbury fummelte ein Taschentuch aus ihrer kleinen, ledernen Handtasche, die prall und rund wie eine Kröte auf ihren mächtigen Schenkeln hockte, und schnaubte hinein.
Noch ein Jahr, vier Monate und elf Tage, dachte ich, während ich mich erhob und Alice zunickte. Noch ein Jahr, vier Monate und elf Tage, und dann ist Alice 18. Dann können sie uns endlich nicht mehr tyrannisieren und quälen. Lieber Gott, lass die Zeit doch schnell vergehen.
»Ich hole ihn«, sagte ich und schenkte Mrs Oterbury mein breitestes Grinsen, mein breitestes, teuflischstes Werwolfgrinsen, und freute mich über ihr Gesicht.
»Entschuldigt mich bitte.«
Er war schon wach, ich konnte es durch die Wände hindurch fühlen. Lenny konnte mir nichts vormachen. Das war ihm noch nie gelungen. Selbst als er in der Wiege gelegen hatte, klein und beinahe durchsichtig, so weiß und zart war er, hatte ich seine Bösartigkeit gespürt, die hin und wieder aus ihm heraustrat wie Eiter aus einer alten Wunde. Ich war seine Wächterin. Ich war dafür da, dass niemand auf der Welt Lenny etwas zuleide tat, und auch dafür, dass Lenny niemandem schadete. Denn trotz allem war Lenny mein Bruder.
Er starrte mich aus seinem Bettchen heraus an. »Will raus«, sagte er mit seiner hohen, fisteligen Stimme, und verfolgte jede meiner Bewegungen mit seinen Blicken.
»Ich hol‹ dich raus, Lenny«, sagte ich und setzte mich an seine Bettkante.
Sein verkrüppelter Arm schaute unter der Bettdecke hervor. Seine Fingernägel waren schmutzig und zu lang. »Wir müssen das nur kurz machen, Lenny«, sagte ich, nahm die Schere vom Nachttisch und sammelte die abgeschnittenen Fingernägel von den beiden Händen ein. Danach tauchte ich den Schwamm in das lauwarme Wasser, das noch vom Baden auf der Kommode stand, und rieb damit seine Finger sauber.
»Du musst mir jetzt genau zuhören, Lenny, ja?«
Er nickte und legte den Kopf schief, lauernd.
»Mrs Oterbury ist unten. Sie will dich sehen. Du musst nett zu ihr sein, hörst du?«
Er nickte wieder.
»Wenn du dich schlecht benimmst, so wie letztes Mal, dann können sie dich uns wegnehmen, und dann, Lenny, kommst du wieder in das Heim, und sie werden nicht so nett zu dir sein, wie wir es sind. Hast du mich verstanden, Lenny?«
»Ja«, sagte er und legte den Kopf auf die andere Seite. Wie eine kleine Taube, dachte ich.
Ich beugte mich vor und küsste ihn auf die Stirn. Er roch ein klein wenig nach Fisch. Als er geboren wurde, war er blau wie ein Aal. Er wollte und wollte nicht schreien, die Hebamme klopfte ihm auf den Rücken, aber er hielt die lila Lippen trotzig und wütend aufeinandergepresst. Ich hatte ihn der Hebamme aus den Händen gerissen, sein kleiner Körper war kühl und schleimig gewesen, und als ich ihn berührt hatte, hatte er den kleinen Mund geöffnet und einen wütenden Schrei von sich gegeben. Er hatte seine winzigen Füße gegen meinen Bauch gestemmt. Alles an ihm war ein einziger Protest.
»Ich glaube, er will nicht hier sein«, hatte meine Mutter gesagt, und ihre Stimme war schläfrig und schwach gewesen. Sie hatte seltsam abwesend geklungen, so als hätte sie genau gewusst, wovon sie sprach. In dem Moment hatte Lenny seine Augen geöffnet und sie waren zwar so hässlich gewesen, aber auch so abweisend und zugleich zutiefst verängstigt, dass ich nicht anders konnte und ihn sofort bedingungslos und aus ganzem Herzen liebte.
»Ich hab‹ dich lieb, Lenny«, sagte ich und setzte ihn in seinen kleinen Rollstuhl. »Tu mir jetzt einen Gefallen und sei ein lieber Junge.«
Kapitel 3
Ich habe mir eine Liste gemacht von den Personen, die ich befragen kann und sie lässt mich verzweifeln. Vier Namen stehen darauf. Ruben, Geraldine Berill, Mrs Kerry (die Tochter von Mrs Oterbury) und natürlich Florence Cavendish. Ich habe sogar schon meine Zeit damit vergeudet, sie in den Computer einzugeben, den man mir hier hingestellt hat, obwohl er mir eher unheimlich ist, aber das ist noch immer besser, als nicht zu wissen, wo ich anfangen soll. Theoretisch müssten fünf Leute auf meiner Liste stehen, schließlich lebt Lenny auch noch, er ist sogar sehr rüstig, aber er ist mittlerweile so verrückt, heißt es, dass der einzige Mensch, den er zu sich lässt, seine Schwester Florence ist. Er hat nie wieder laufen gelernt. Die Zeit in Mrs Oterburys Waisenhaus hat ihn so gezeichnet, dass er von da an nur noch im Rollstuhl sitzen konnte. Clarkes Frau Ellen arbeitet täglich ein paar Stunden im großen Cavendish-Haus. Sie kocht für die alten Herrschaften und kümmert sich um Lenny. Er soll reizend zu ihr sein. Einmal hat sie ihn in der Badewanne gefunden, um sich herum eine Armada von Spielzeugenten, mit denen er sich besprochen hat. Sie hätten eine Palastrevolution geplant, er sei es leid, sich von seiner Schwester herumkommandieren zu lassen, hatte er Ellen erklärt. Aber nach einem Glas heißer Milch mit Honig war alles wieder vergessen. Das war die einzige Geschichte, die Ellen jemals aus dem großen Haus erzählt hat. Aber der Anblick des alten Jungen hatte sie, ganz entgegen ihrer Art, so aus der Fassung gebracht, dass sie ihr Herz erleichtern musste. Manchmal denke ich, sie mag den verrückten Kerl.
Clarke und Ellen haben sonst keine Berührungspunkte mit dem Cavendish-Haus. Sie sind Zugezogene. Clarke ist aus der Stadt von der Polizeiakademie zu uns versetzt worden. Nach einer Woche mit ihm war mir klar, warum. Die Clarkes sind herzensgute und anständige Leute, die recht einfach gestrickt und nicht besonders belesen sind.
Die kurze Liste auf meinem Schreibtisch scheint mich zu verhöhnen. Aber es nützt alles nichts, ich werde mich an das halten müssen, was ich zur Verfügung habe. Aber das ist nicht das, was mir Kopfschmerzen bereitet. Unsere Tochter Coraline hat uns einen Brief geschrieben. Ann ist daraufhin den ganzen Tag wie ein Geist durchs Haus gewandert. Sie hat sich die Augen ausgeweint, zwar hat sie versucht, es zu verstecken, aber wir sind nicht umsonst seit 36 Jahren verheiratet. Da entgeht einem nichts. Das beraubt einen einerseits aller Illusionen, andererseits gibt es einem ein warmes und gutes Gefühl. Es ist das Gefühl, jemanden wirklich zu kennen und ganz und gar zu ihm zu gehören. Dieses Gefühl habe ich mit Ann. Auch wenn wir in unserer Ehe nicht alles richtig gemacht haben. Es gab Zeiten, in denen wir einander nicht so sicher waren, und es gab auch Zeiten, in denen wir das Gefühl hatten, es lohnt sich nicht. Die Streitereien, die Unsicherheiten und schließlich das, was uns beinahe vollständig auseinander gebracht hat: Coraline. Ich habe ihren Brief gar nicht erst zu Ende gelesen. Vielleicht hätte ich es tun sollen, vielleicht hätte sie noch etwas Nettes, Versöhnliches geschrieben, etwas, das ein Vaterherz erfreut oder mit Stolz erfüllt, aber weil ich Angst davor hatte, dass es nicht kommen würde, habe ich den Brief nach der Hälfte beiseitegelegt. Und Anns Gesichtsausdruck bestätigt mich in meiner Entscheidung. Coraline braucht Geld. Natürlich braucht sie Geld, unsere Tochter braucht immer Geld. Sie benötigt Geld, um damit ihren Lebensstil zu finanzieren. Nur ihre Vorwürfe und ihre Ablehnung kriegen wir frei Haus.
Sie war ein Wunschkind, ein absolutes Wunschkind, und obwohl wir das Gefühl hatten, alles richtig zu machen, ist die Rechnung nicht aufgegangen. Zumindest nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und wenn ich genau überlege, kann ich gar nicht sagen, wann ich unsere Tochter das letzte Mal glücklich gesehen habe. Als sich herausstellte, dass wir keine eigenen Kinder haben können, hat Ann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um einen Termin beim Jugendamt zu bekommen. Wir waren nicht mehr die Jüngsten, und die Aussicht, einen Säugling adoptieren zu können, waren gleich null. Nächtelang haben wir zusammengesessen und diskutiert, ob wir die Richtigen wären, um ein Pflegekind aufzunehmen, ob wir es aushalten würden und wie wir reagieren würden, wenn die leiblichen Eltern plötzlich Anspruch auf das Kind erheben würden, oder wie das Kind wohl von seinen ersten Erfahrungen in der eigenen Familie geprägt sein würde. Ann war sich ganz sicher gewesen. Ich war es nicht. Vielleicht hätte ich mich durchsetzen müssen, aber ihr Wunsch nach einem Kind war so stark gewesen, und mein Wunsch, meine Frau glücklich zu machen, war es ebenfalls. Als der Anruf kam und damit die ersten Fotos von Coraline, diesem bildhübschen Kind mit den goldenen Locken und den wasserblauen Augen, da war die Entscheidung längst gefallen. Sie war drei, als sie zu uns kam. Damit war sie auch alt genug, um durch die Hölle gegangen zu sein und tiefe Narben auf ihrer Kinderseele zu tragen.
Aber warum erzähle ich das alles eigentlich? Ich bin vom Thema abgekommen. Vielleicht, weil schlussendlich alles mit der eigenen Familie zusammenhängt. Woher wir kommen, wohin wir gehen, mit wem und warum. Wenn ich die Geschichte von Florence Cavendish lese, wird mir klar, dass sie ihre Familie über alles geliebt hat und mit all ihrer Kraft verteidigen würde. Und wer würde das nicht? Ich werde mich nach dem Abendessen hinsetzen und diese Liste machen, und ich werde die alten Briefe und Aufzeichnungen meines Vaters durchgehen. Vielleicht finde ich etwas Brauchbares darunter, etwas, das mich dem, was geschehen ist, hoffentlich näherbringt. Und dann werde ich die Tränen meiner Frau trocknen, soweit mir das gegeben ist.
*
Die schlauen Leute sagen immer, dass sie die Dinge haben kommen sehen. Sie legen dann die Stirn in Falten, neigen den Kopf zur Seite und sagen mit dieser tragenden und triefenden Stimme: »Ja, ja, das hab‹ ich schon immer gewusst. Ich habe es ja kommen sehen und ich hab‹ es euch immer gesagt. Wenn ihr nur mal auf mich gehört hättet.«
Schlaue Leute, wie gesagt, und witzigerweise sind die anderen immer noch ein wenig schlauer als man selbst.