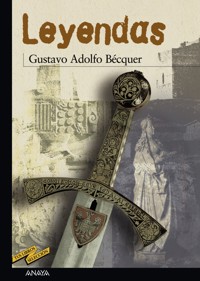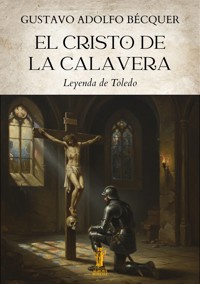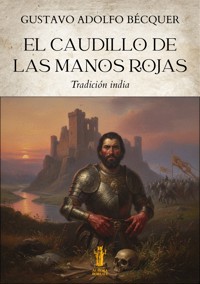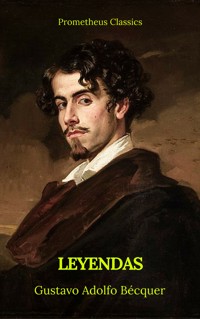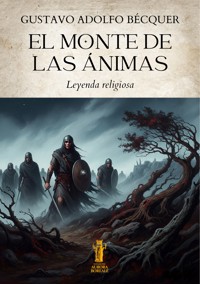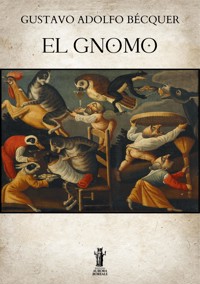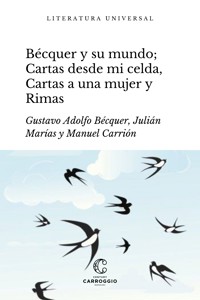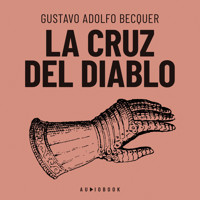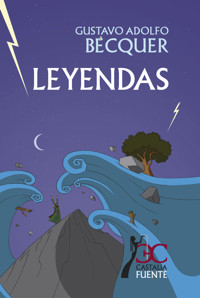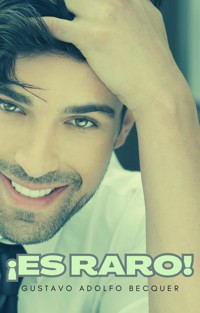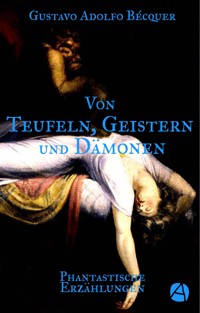
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
“Von Teufeln, Geistern und Dämonen” ist eine Sammlung von postromantischen phantastischen Erzählungen, die von Gustavo Adolfo Bécquer verfasst und zwischen 1858 und 1865 veröffentlicht wurden. Diese Erzählungen haben einen intimen Charakter, der die historische Vergangenheit heraufbeschwört, und zeichnen sich durch eine plausible Handlung mit der Einführung pantastischer oder ungewöhnlicher Elemente aus. Hinter Bécquers Werk steht sein Engagement für die Kultur der Vergangenheit, das in den “Briefen aus meiner Zelle” und in seinen “Legenden” zum Ausdruck kommt. Hier ist seine innere Welt übervoll, die historische oder legendäre Vergangenheit weckt seine Träume und die Natur schafft eine geheimnisvolle Atmosphäre. Unvergessliche Texte zum Lesen und Vortragen. Bécquer, ob Prosaiker oder Lyriker, ob Dichter oder Prosaist, erweist sich stets als kompletter und zeitloser Künstler. Das Erscheinen seiner phantastischen postromantischen Erzählungen, deren literarische Werte denen seiner Vorgänger und Zeitgenossen deutlich überlegen sind, stellt den Höhepunkt, die Überschreitung und die Vernichtung eines Genres dar. Das literarische Rohmaterial wird von Bécquer nach seinen eigenen ästhetischen Parametern bearbeitet, die ihm das Siegel seines persönlichen Mikrokosmos und den identifizierenden Stempel seiner poetischen Sprache aufdrücken. Illustrierte Ausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gustavo Adolfo Becquer
Von Teufeln, Geistern und Dämonen
Phantastische Erzählungen
Neuausgabe
der Übertragung
aus dem Spanischen
von
Hans Krüger-Welf
Mit 11 Illustrationen
von
Paul Haase
VON TEUFELN, GEISTERN UND DÄMONEN wurde zuerst veröffentlicht vom Georg Müller Verlag, München 1922.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2023
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-578-0
Buchherstellung & Gestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Alle Rechte vorbehalten.
© apebook 2023
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
Inhaltsverzeichnis
Von Teufeln, Geistern und Dämonen
Impressum
Zur Einführung
Des Dichters Vorwort
Meister Perez, der Organist
Das Teufelskreuz
Glaubet an Gott!
Die Höhle der Maurin
Das Miserere
Das weiße Reh
Die grünen Augen
Der Geisterberg
Der Mondenstrahl
Kobold
Das Kruzifix mit dem Totenschädel
Das Gelöbnis
Die Passionsblume
Das goldene Armband
Der Kuß
Der Tod der alten Kaska
Die Zauberburg
Die Hexen von Trasmoz
Wie sah G. A. Becquer aus!
Bibliographie
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
Gustavo Adolfo Becquer
Zur Einführung
Im Maria-Luisenpark zu Sevilla, draußen vor den Toren der Stadt, steht das weiße Marmordenkmal Gustav Adolf Becquers. In Form einer Rundbank umschließt es den Stamm einer gewaltigen Zeder, deren weitgezweigte Krone sich zu einem grünen Thronhimmel wölbt. Ein schlanker hoher Sockel trägt die Büste des Dichters. Ihm zur Rechten, hingestreckt auf die Bank, eine Bronzefigur: ein sterbender Genius mit dem Speer im Rücken und dem leeren Köcher, aus dem alle Pfeile verschossen sind. Flehend streckt er die Hand zum Dichter empor: Erwecke du mich zu neuem Leben – mich, die sterbende Dichtkunst! Und Becquer weist auf den ebenfalls bronzenen Kupido zu seiner Linken und auf die drei marmornen Mädchengestalten, zu denen der Liebesgott sich hinabneigt, und erwidert:
Solang es eine schöne Frau noch gibt,gibt's auch Poesie! –
Das Denkmal ist eine Anspielung auf das in Spanien sehr bekannte Gedicht Becquers: La rima eterna (Das unsterbliche Lied). Zählt es auch gewiß nicht zu seinen stärksten, so ist es doch von Bedeutung wegen seines programmatischen Inhalts. Es beginnt mit den Versen:
Sagt nicht, weil eure Stoffe sich erschöpften,verstummte auch der Leier Melodie!Mag sein, daß Dichter fehlen, aber allzeitgibt es Poesie.
Becquer richtet sich an die Dichter oder Literaten seiner überaus prosaischen, von politischen Wirren zerrissenen Zeit. Er verweist sie, die einerseits, verleitet vom wieder zu Ehren gelangten realistischen Prosaroman, der poetischen Kunst das Todesurteil sprachen, andererseits aber, soweit sie selbst Verse schrieben, tönende Worte für Lyrik und flache Rhetorik für Dichtkunst ausgaben, auf die immer wiederkehrenden Regungen in der Menschenbrust, auf die ewigen Wunder und Geheimnisse in der Natur:
Solang die Wissenschaft sich müht, den Urquelldes Lebens zu erfassen,und Meerestiefen, Himmelsweiten sichnoch nicht berechnen lassen;solang die Menschheit rastlos vorwärtsstrebt,nicht weiß wohin und wie –solang es ein Geheimnis für uns gibt,gibt's auch Poesie.
Das Becquerdenkmal im Park zu Sevilla
Vor diesen Wundern der Natur, vor den ewigen Rätseln des Lebens beugt sich Becquer in Ehrfurcht und Demut, und aus solcher Ehrfurcht vor dem großen Unbekannten, aus dem Erschauern vor dem Nichtwissen des Woher und Wohin wächst ihm die hohe Begeisterung, wächst ihm die Ekstase, ohne die Kunst nicht sein kann. An Stelle des unfruchtbaren Skeptizismus und Rationalismus seiner Zeit setzt Becquer, der nicht mehr gläubige Katholik und nicht mehr katholische Gläubige, eine neue, nicht dogmatische Frömmigkeit und stellt der objektiven, meist noch dazu tendenziös gefärbten Deklamationspoesie den schlichten Ausdruck subjektiven Empfindens entgegen.
Durch diesen stark betonten Subjektivismus, den es in Spanien bisher nur in der religiösen Lyrik des sechzehnten Jahrhunderts gegeben hatte, durch eine Verinnerlichung, wie sie auch unsere Tage nicht intensiver aufweisen – die aber für die damalige Zeit Unerhörtes bedeutete, wurde Becquer Anreger und Neubeleber der spanischen Lyrik. – Zwar hat er weder Richtungen nach sich gezogen noch Dichterschulen gegründet, und ebenso eifrig, wie er verehrt wurde, hat man auch versucht, ihn in den Jahren, wo sein Ruhm allzu mächtig aufloderte, herabzuwürdigen und zu verkleinern ... Ja, es gab sogar eine Zeit, wo man in literarischen Kreisen über ihn lächelte und ihn unmodern fand! Das war, als die seichte Flut seiner Nachahmer, von denen heute auch nicht mehr der Name übriggeblieben ist, einen Strudel erzeugte, der auch ihn mitriß ... Aber – als sie verebbt war, die Flut, stand einsam auf verlassenem Strand: Gustav Adolf Becquer. Und da erst begann man zu ihm aufzuschauen und von ihm zu lernen.
Einsam thront Becquer auch heute noch in der spanischen Literatur; denn zwischen ihm und der Generation, von der sich Brücken schlagen lassen, klaffen mehr denn dreißig Jahre. Geringe Einflüsse allerdings lassen sich schon früher nachweisen, so in Salvador Rueda und dem großen Eklektiker Ruben Dario. Aber Gedichte als denkbar stärksten Ausdruck für ein Gefühl oder Erlebnis, Gedichte, die äußerste Kondensierung von Phantasie, Empfinden und Denken sind, verinnerlichte Verse wie die, welche Becquer geschrieben: solche finden sich in der spanischen Literatur erst unter den Dichtern des zwanzigsten Jahrhunderts wieder!
Becquer blieb unbekannt, solange er lebte. Er wurde schwärmerisch geliebt, nachdem er tot war. Aber erst einer jungen Generation sollte es beschieden sein, seiner reif zu werden und in ihm den »größten aller spanischen Lyriker« zu erkennen, den »subjektivsten, spanischsten und reinsten Lyriker, den es je in Spanien gegeben hat«. – So lautet das Urteil des spanischen Literaturhistorikers und Kritikers Julio Cejador, und nicht anders wird auch die Meinung derjenigen gewesen sein, die ihm im Jahre 1911 das sinnvolle Denkmal im Park von Sevilla setzten.
* * *
Wie das Denkmal zustande gekommen ist, erzählt der alte biedere Parkwärter, den man als Hüter bestellt hat, einem jeden Fremden, der Neigung bezeugt, es zu hören. Und der Gesprächigkeit dieses alten Parkwärters ist es zu verdanken, daß an einem Novembertage des Jahres 1916 zwei Deutsche, deren jeden ein besonderes Geschick nach Spanien verschlagen hatte, mit Bewunderung für den sevillaner Dichter erfüllt wurden und eine Neuverdeutschung seiner Prosawerke beschlossen. Diese beiden Deutschen waren der Herausgeber dieser Sammlung, Hanns Heinz Ewers, und ich.
Ich glaube, wir hatten uns gerade über den wienerischen Eindruck unterhalten, den das Denkmal mit den drei Mädchengestalten und dem blumenumrankten Sockel auf uns machte ... oder uns gewundert, daß der Kopf des Dichters, der doch der Enkel eines aus Deutschland eingewanderten Uhrmachers sein sollte, auch nicht die geringsten Kennzeichen seiner deutschen Abstammung aufwies, – als der alte Wärter an uns herantrat und uns aus einer Zigarrenkiste, die er unterm Arm trug, ein paar Ansichtskarten zum Kauf anbot.
Es waren Lichtbildaufnahmen vom Denkmal in recht guter Ausführung; und so taten wir dem Alten den Gefallen und nahmen ihm einige ab. Auf der Rückseite der Karten entdeckten wir in ganz kleinem Druck, so daß wir Mühe hatten, es zu entziffern, die Worte: Gustav Adolf Becquer-Denkmal, Original von Lorenzo Coullaut Valera, errichtet von dem Ertrage der »Rima eterna«, Komödie der Brüder Alvarez Quintero.
Hierdurch neugierig geworden, baten wir den Alten um Aufklärung.
»Die Herren kennen doch die Brüder Alvarez Quintero?« begann der Alte, während er sich eine von unseren Zigaretten ansteckte. »Sind sevillaner Kinder wie ich ... zu ihrer Mutter bin ich früher viel gekommen ... ich wohnte nämlich damals ...« Und nun folgte eine langatmige, bis ins kleinste gehende Erklärung, woher und warum und wieso unser guter Alter die beiden Lustspieldichter schon von klein auf gekannt hatte.
»Freilich, jetzt sind sie noble Herren,« fuhr er fort, »verdienen viel Geld mit ihren Theaterstücken, wohnen fein in Madrid, und wenn sie mal nach Sevilla kommen, sind sie von unseren jungen Herren aus dem Athenäum umschwärmt wie ein Stück Zucker von Fliegen. – Also, die Alvarez Quintero hatten schon immer zu einem Denkmal für Gustav Adolf gesammelt ... und es war auch schon allerhand in der Kasse, aber noch lange nicht genug, daß man etwas Ordentliches dafür hätte anschaffen können. Und da setzten sie sich hin und schrieben eigens zu dem Zweck ein Theaterstück, betitelt La Rima eterna – nach dem gleichnamigen Gedicht Becquers, das in der Komödie übrigens selbst vorkommt und von der eigentlichen Handlung umgeben wird, wie hier die alte Zeder von dem neuen Denkmal ... Na, und alles, was dies Stück einbrachte, floß in die Denkmalskasse, die davon so voll wurde, daß man sich den schönsten weißen Marmor kommen lassen und überdies noch die Bronze zu den beiden Engeln davon bezahlen konnte!«
Auf unsere Frage, ob der Schöpfer des Denkmals etwa in Wien studiert habe, wußte uns der Alte nicht so genaue Auskunft zu geben.
»Möglich ist es,« meinte er, »daß Don Lorenzo so weit in der Welt herumgekommen ist. Sein Oheim Don Juan, der Bruder seiner Mutter – Sie kennen doch Juan Valera, der den Roman Pepita Jimenez geschrieben hat? – war ja auch allerwegens. Ich weiß nur, daß Don Lorenzo geborener Sevillaner ist und bei unserem Meister Antonio Susillo das Bildhauern gelernt hat. Und weil Don Antonio nun leider nicht mehr am Leben war, ist seinem Schüler die Ausführung des Denkmals übertragen worden. – Und hat er nicht ein Kunstwerk zuwege gebracht, wie es auf der Welt kein zweites gibt? Oh, das haben mir schon Herrschaften aus allen Ländern versichert: so was Schönes von Denkmal hätten sie noch nirgends gesehen! ... Dabei hat sich Don Lorenzo nicht einen Zentimo dafür bezahlen lassen! Alles umsonst! Alles aus Liebe zu Gustav Adolf! – ›Ich müßte mich ja noch im Grabe schämen‹, soll Don Lorenzo entgegnet haben, als man ihm von einer Honorierung seiner Arbeit sprach, ›wenn ich dafür Geld annähme! Hat sich etwa Gustav Adolf von mir seine Verse bezahlen lassen, deren Genuß ich die schönsten Stunden meines Lebens verdanke?«
In dieser Weise fortfahrend – nicht viel anders als die sevillaner Lokalzeitung, die Becquer in seiner Erzählung vom Organisten Perez auftreten läßt – trug uns der alte Parkwärter nach und nach die ganze Entstehungsgeschichte des Denkmals vor. Unterrichtet war er über alles auf das genaueste, denn er hatte seit fünf Jahren tagaus tagein beim Denkmal Wache gestanden, dabei sämtliche Koryphäen Spaniens kennengelernt und sich mit ihnen über seinen geliebten Gustav Adolf unterhalten. Er wußte nicht allein über das ihm anvertraute Denkmal Bescheid, – er erzählte uns auch von der Gedenktafel an Becquers Geburtshaus, von der Überführung der Leichen der beiden Brüder Becquer aus Madrid und ihrer feierlichen Beisetzung in der Universitätskapelle in Sevilla und endigte damit, daß er uns mit begeistertem Pathos das Schwalbenlied und noch einige andere Gedichte Becquers vordeklamierte und uns angelegentlichst die Lektüre seiner Werke empfahl.
Noch ganz unter dem Eindruck dieses Collegium publicum besprachen Hanns Heinz Ewers und ich die Neuübertragung der Becquerschen Erzählungen. Und zwar waren wir beide damals noch im Glauben, Becquer sei der direkte Nachkomme einer in Spanien eingewanderten deutschen Familie, wie es in allen bisherigen Becquerverdeutschungen (und wo sonst von diesem Dichter die Rede ist) zu lesen steht. Infolgedessen empfanden wir einen nicht geringen Stolz, auf spanischem Boden vor dem Denkmal eines so hochverehrten deutschen Dichters zu stehen, der nur zufällig in spanischer Sprache geschrieben hatte ... Und wir waren von vornherein überzeugt, daß wir in Becquers Dichtung ein vielleicht etwas südlich gefärbtes Abbild deutscher Spätromantik finden würden, durch dessen Aufzeigung gleichzeitig äußerst wichtige Einflüsse deutschen Geistes auf die Entwicklung der neueren spanischen Dichtkunst nachgewiesen werden könnten.
Quellenforschung und eingehende Beschäftigung mit Becquers Leben und Schaffen haben mich bald diese Annahme als gefährlichen Irrtum erkennen lassen. In einer Reihe von Aufsätzen, die ich vor drei Jahren in einer deutschen Zeitschrift in Barcelona erscheinen ließ, habe ich bereits betont, daß die paar Tropfen deutschen Blutes, die Becquers Ahnen möglicherweise auf ihn vererbten, ohne jede Bedeutung für seine Dichtungen gewesen sind. An derselben Stelle habe ich auch an zahlreichen Beispielen zu zeigen versucht, daß Becquers angebliche Verwandtschaft mit gewissen deutschen Dichtern nur eine scheinbare ist, daß seine lyrischen Gedichte aufs innigste mit dem andalusischen Volkslied, seine Prosawerke mit spanischen Volkssagen verknüpft sind. Von der deutschen Literatur, von den Schöpfungen unserer romantischen und sogenannten realistischen Perioden, hat Becquer nur sehr flüchtige Kenntnisse besessen, da er, des Deutschen nicht mächtig, auf die wenigen und recht mangelhaften Übersetzungen angewiesen war. Wenn es dennoch eine Zeit gegeben hat, wo man ihn selbst in seiner Heimat einer Nachahmerschaft Heines und Hoffmanns zieh, so sind derartige, durch nichts gerechtfertigte und nirgends bewiesene Verdächtigungen teils auf böswillige Absicht zurückzuführen – teils aber nur auf die Gewissenlosigkeit einer eitlen Kritik, die, um ihre Belesenheit kundzutun, bei jeder sich bietenden Gelegenheit ein paar Namen ausländischer Dichter aufzählt.
Aus ganz anderen – zugegeben: aus edleren Motiven haben sich die bisherigen deutschen Übersetzer dazu verleiten lassen, in ihren einleitenden Bemerkungen Becquer ausschließlich als Deutschen zu kennzeichnen und das typisch Spanische und Andalusische in ihm zu übersehen, zu verschweigen oder umzudeuten in ein »ererbtes Germanentum«. Die bisherige Lügenhaftigkeit des biographischen Materials und die schon frühzeitig entstandene Fabel von dem deutschen Uhrmacher als Becquers Großvater oder Urgroßvater mögen in vielen Fällen die Entstehung der irrigen Ansichten, der Fehlgriffe und Mißdeutungen erklären und begreiflich machen. Wenn aber, wie bei Otto Hauser, die Bemühungen, den germanischen Ursprung des Dichters nachzuweisen, in eine Beweisführung ausarten, die mit Becquers »unbewußter Hinneigung zum reineren Typus« und einer »im Blute mitgebrachten Geistigkeit seiner protestantischen Vorfahren« arbeitet, so läßt sich hier die tendenziöse Umfärbung einer gewissen Blondheitsromamik nicht verkennen. Am weitesten in dieser Richtung geht Ottokar Stauf von der March, der zu Schlüssen gelangt, die an Kühnheit unübertrefflich sind. »So sehr auch Gustav Adolf Becquer mit Mund und Kopf ein Spanier ist,« ruft er aus, »– mit Herz und Seele bleibt er doch allimmer ein Deutscher ...« Denn »auch der begabteste Romane von Geburt vermöchte die bezwingende Macht eines Waldsees, die Poesie der Einsamkeit, die Suggestion des nächtlichen Waldes, das Leben und Weben der Natur nicht so zu schildern, wie es der romanisierte Deutsche (!) Becquer tut.«
Es mag dahingestellt bleiben, ob diese Art Deutschbewußtsein dazu beiträgt, deutschem Schrifttum in der Welt Achtung und Geltung zu verschaffen, wenn Stauf von der March die romanische Literatur wirklich nicht besser kennen sollte, so wird er doch angesichts der hier zusammengetragenen biographischen Tatsachen zugeben müssen, daß zum wenigsten ein Romane das alles vermocht hat – nämlich Gustav Adolf Becquer, der ein Spanier war durch Blut und Erziehung.
* * *
Das Kapellengitter der Heiligen Justa und Rufina in der Kathedrale zu Sevilla trägt die Inschrift: »Diese Kapelle ist die Begräbnisstätte des MIGUEL ADAM BECQUER, seiner Brüder, Erben und Nachkommen. Er starb im Jahre 1622.«
Wie Stanislaus, ein Bruder des Dichters, vor einigen Jahren einem sevillaner Chronisten gegenüber geäußert hat, ist dieser Miguel Adam Becquer – oder Becker, wie er sich damals noch schrieb – gegen Ende des sechzehnten oder zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts aus Flandern eingewandert und hat sich in Sevilla niedergelassen. Aus der Inschrift des Kapellengitters ist zu schließen, daß er auch Brüder in Sevilla besaß und ein geachteter und vermögender Mann war, als er starb.
Seine Nachkommen zählten zu den ersten Kreisen Sevillas. Ein Enkel oder Urenkel von ihm, namens Martin Becquer, gehörte um das Jahr 1700 herum zum Senatorenrat der vierundzwanzig von Sevilla – ein Amt, das nur der Aristokratie zugänglich zu sein pflegte. Die Tochter dieses Senators, Mencia Becquer y Diez de Tejada, verheiratete sich mit einem gewissen Julian Dominguez und wurde die Urgroßmutter des Dichters.
Gustav Adolf war der vierte unter acht Brüdern und wurde am 17. Februar 1836 in der Breiten Straße von Sankt Laurentius, der heutigen Graf von Barajasstraße, zu Sevilla geboren. Sein Vater, Joseph Dominguez Insausti y Becquer, oder, wie er sich kurz nannte: Joseph Dominguez Becquer, war ein angesehener Bürger der Stadt, als Maler aber ziemlich unbedeutend, der seine zahlreiche Familie schlecht und recht durch den Verkauf seiner Bilder aus dem sevillaner Volksleben ernährte. Die Mutter war eine geborene Bastida y Vargas, so daß also die Söhne, der spanischen Sitte gemäß, mit vollem Familiennamen Dominguez Bastida hießen. Aber ebenso wie der Vater fügten auch sie ihrem väterlichen Namen den ihrer urgroßmütterlichen Vorfahren Becquer hinzu – vielleicht, um dadurch das Andenken an ihre aristokratischen Ahnen wachzuhalten. Gustav Adolf und sein älterer Bruder Valerian, ein sehr geschätzter Maler und Illustrator, ließen später den Vaternamen ganz fort und nannten sich nur noch Becquer. Auch schon in einem Dokument aus dem Jahre 1846 wird der kleine Gustav Adolf kurzweg als »Gustav Becquer« aufgeführt. –
Als Gustav Adolf noch nicht sechs Jahre zählte, starb sein Vater, im Alter von sechsunddreißig Jahren. Vermögen war nicht vorhanden, von dem die Mutter und ihre acht unmündigen Kinder hätten leben können. Ein wohlhabender Verwandter mütterlicherseits, Juan de Vargas, übernahm es, für die Waisen zu sorgen und ihre Erziehung zu leiten.
Dieser dumpfe Druck verschämter Armut, der über Gustav Adolfs Kindheit lag, wird schon frühzeitig seine Neigung zur Melancholie begünstigt haben. Schon im Alter von sieben oder acht Jahren, als er, ein blasser, lang aufgeschossener Bursche, das Colegio de San Antonio Abad besuchte, soll er Hang zu schwermütigem Sinnen gezeigt haben ...
Zu Beginn des Jahres 1846 gelang es den Bemühungen der Mutter, für ihn eine Freistelle in der staatlichen Navigationsschule, dem Colegio de San telmo in Sevilla, zu erwirken. Die Aufnahme war nur armen und verwaisten Knaben aus vornehmer Familie gestattet; auch für Becquer mußte ein diesbezüglicher Nachweis erbracht werden. Das Genehmigungsschreiben des Reichsmarineamtes an den Leiter der Schule, sowie dessen Bericht über die erfolgte Aufnahme an die Verwaltungsbehörden wurden 1913 in der Zeitung »El Liberal de Sevilla« veröffentlicht. Bezeichnend für den Zustand, in dem sich die Anstalt schon damals befand, ist, daß ausdrücklich zur Bedingung gemacht wurde, »Gustav Becquer« müsse seine Eintrittsuniform selbst beschaffen und dürfe keinen Anspruch auf Entschädigung erheben, falls die Anstalt etwa aufgehoben werde sollte. Im übrigen wurde ihm Kost und Unterricht unentgeltlich gewährt.
Am 1. März des Jahres 1846 trat er dort als interner Zögling ein. Einer seiner Mitschüler war der ebenfalls als Dichter bekannt gewordene Narciso Campillo, mit dem ihn lebenslängliche treue Freundschaft verband. Wie Campillo 1886 in der »Ilustración Artistica« erzählt, schrieben die beiden Freunde damals zusammen ein Drama, »Die Verschworenen«, das von den Mitschülern aufgeführt wurde. Auch seine ersten dichterischen versuche entstanden hier, und Campillo und er begannen gemeinsam einen Roman in der Art Walter Scotts zu schreiben.
Becquer war also auf dem besten Wege, seinem frühgesichteten Lebensziel entgegenzureifen. Er hatte hier guten Unterricht und mancherlei Anregung und durfte in dem großen schönen Park – demselben Park, in dem heute das Becquerdenkmal steht, der damals aber noch in seiner ganzen Ausdehnung zum Santelmopalaste gehörte und sich weit am Guadalquivir entlangzog, nach Herzenslust umherwandeln und seinen Träumen nachhängen.
Leider war diese glückliche Zeit nur von kurzer Dauer. Der Unstern, der über Becquers Leben stand, flimmerte schon in den Nächten seiner frühesten Jugend ... Die junge Königin Isabella wollte die Staatsausgaben einschränken und ließ am 7. Juli 1847 das Santelmoinstitut schließen. – Elf Jahre war Becquer alt, als er die Schule für immer verließ!
Seine Lage war eine doppelt traurige, denn inzwischen hatte er auch seine Mutter verloren. Die Brüder waren an verschiedene Verwandte und Freunde der Familie verteilt worden, und das gleiche Schicksal erwartete jetzt auch Gustav Adolf. Eine wohlhabende und kinderlose Patin, Frau Manuela Monahay, bei der er schon als kleiner Knabe häufig gespielt harte, nahm sich liebevoll des Obdachlosen an. Sie soll von einer gewissen Bildung gewesen sein und den hübschen Jungen mit den braunen Ringellocken von Herzen gern gehabt haben. Sie versprach sogar, ihn zum Erben ihrer gesamten Habe einzusetzen, knüpfte aber daran gewisse Bedingungen ... Und als sich diese nicht erfüllten, änderte sie ihre Absicht und entzog ihrem Schützling mehr und mehr ihre Gunst.
Wie Becquers Freund und späterer Biograph Correa erzählt, wünschte die Taufpatin aus dem Jungen einen »ehrbaren Kaufmann« zu machen. Gustav Adolf aber, der eher zeichnen gelernt hatte als schreiben, der schon im Alter von zehn Jahren mit seinen Gedichten und Dramen Bewunderung bei seinen Kameraden erwarb, dem die Pflegemutter den Weg zum Bücherschrank versperren mußte – aus Furcht, sein ungestümer Lesedrang möchte seiner Gesundheit unzuträglich sein: – Gustav Adolf weigerte sich so energisch gegen die Zumutung, in eine Kaufmannslehre geschickt zu werden, daß die Patin wohl oder übel von diesem Plan Abstand nehmen mußte.
Vor eine Entscheidung gestellt, wählte Gustav Adolf im Jahre 1850 den Beruf seines Vaters. Sehr glücklich wird Frau Manuela darüber nicht gewesen sein. Sie war eine praktische Frau und war erfahren genug, um zu wissen, daß jede Künstlerlaufbahn ein zweifelhaftes Lotteriespiel ist. Nur widerstrebend wird sie sich in des Jungen Wahl gefügt haben. Sie tröstete sich damit, daß Bilder andalusischer Volksszenen immer recht guten Absatz fanden – besonders bei Ausländern, wenn sie eine Osterreise nach Sevilla machten.
Sie brachte den vierzehnjährigen Knaben zu Meister Cabral Bejarano, einem Landschaftsmaler von Ruf, und ließ ihn in dessen Atelier zwei Jahre lang studieren. Danach übernahm Gustav Adolfs Oheim, bei dem auch seine Brüder Valerian und Luzian sich ausbildeten, die weitere Führung. Aber nur für kurze Zeit ... denn der Dichter in ihm rang sich mehr und mehr durch, bis es schließlich kein Halten mehr gab und Gustav Adolf den Pinsel in die Ecke warf.
Und nun geschah das Ungeheuerliche – das, was man sich mit einer warmherzigen Frau, die ihren Schützling wahrhaftig liebt, nur schwer zusammenzureimen vermag:
Als Frau Manuela davon hörte, daß Gustav Adolf die Malerei aufgeben und um jeden Preis Schriftsteller werden wollte, widersetzte sie sich dem auf das entschiedenste. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen und schließlich zum völligen Bruch zwischen Pflegemutter und Pflegesohn.
Zum völligen Bruch! Den achtzehnjährigen Jüngling, der sieben Jahre in ihrem Hause gelebt hatte, ließ sie ohne einen Heller in der Tasche hinaus in die Fremde ziehen!
– Es gibt Biographen, welche die alte Dame entschuldigen. Sie sagen: der zarte Gesundheitszustand Gustav Adolfs und sein unpraktisches Wesen waren ihr nur zu gut bekannt, als daß sie zu einem so aufreibenden Beruf ihre Zustimmung hätte geben können. Durch die äußersten Mittel hoffte sie ihn von seinem Plan abzubringen ... Als lebenserfahrene Frau sah sie die madrider Erlebnisse voraus ...
Aber die madrider Erlebnisse wären ganz anders ausgefallen, wenn Frau Manuela ihrem Pflegesohn auch fernerhin mit Rat und Tat beigestanden hätte. Das erbärmliche Hungerleben, die journalistische Kuliarbeit, wohl auch die schweren Krankheiten und der frühzeitige Tod wären dem Dichter erspart geblieben, wenn die Pflegemutter, die ihm einst ihr ganzes Vermögen hatte zuwenden wollen, ihm nur für die ersten drei Jahre eine geringe monatliche Unterstützung ausgesetzt hätte!
Handelt so eine Frau, die einen Blick in die Seele ihres Zöglings geworfen hat, die ihn liebt und begreift, wie eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Vermag überhaupt eine Frau so unerbittlich, so unversöhnlich zu sein, wenn sie ihren Sohn oder Pflegesohn auch nur in einem einzigen Zug seines Wesens tief und wahr erfaßt hat?
Nein, Doña Manuela liebte ihn nicht mit der alles verstehenden und daher auch alles verzeihenden Mutterliebe, die den Schritten ihres Sohnes durch alle Nebeltage folgt und wie ein warmer Sonnenstrahl auf feine einsamen Wege fällt. Doña Manuela liebte den kleinen Gustav Adolf wegen der schönen, langherabfallenden Locken und der großen träumerischen Augen. Sie liebte ihn, wie die Mädchen eine allerliebste Puppe lieben, die ihrem Leben einen Inhalt gibt, wie ein hübsches Ding zum Spielen liebte sie ihr Pflegesöhnchen – aber nur solange es schüchtern war und bescheiden ...
Wäre Gustav Adolf ein folgsamer Knabe gewesen, so hätte es sich die Pflegemutter zweifellos noch einigen Unterricht in Kopfrechnen und italienischer Buchführung kosten lassen. Auch Kenntnisse in fremden Sprachen würden ihm dann von Nutzen gewesen sein. Denn ein Junge, der mit elf Jahren die Schule für immer verlassen hatte, besaß auch nach damaliger Ansicht noch keine ausreichende Vorbildung fürs Leben. Aber da er sich ja für den Farbentopf entschieden hatte, schienen ihr die praktischen Fertigkeiten, die ihm Meister Cabral Bejarano beibrachte, völlig ausreichend. Und hätte nicht in Gustav Adolf selbst ein Durst nach Wissen gebrannt, eine Sehnsucht, die auch über tiefe Schluchten Brücken baut; hätte er nicht noch beizeiten den Steuermann gefunden, der sein Schiff hinauslenkte in den Ozean: so würden wir wohl schwerlich das klare Wissen und die meisterhafte Sprache bewundern können, die alle seine Werke auszeichnet.
Dieser Steuermann zur rechten Zeit, diese leitende Hand, deren jedes Genie so dringend bedarf, um sich Bahn zu brechen, um sich nicht in der Wahl seines Weges zu irren, ist sein Oheim für ihn geworden. Er war ein offener und gerader Mann, ein Künstler durch und durch, dem das Leben ein Grab ehrgeiziger Träume gewesen. Er erkannte bald die wahren Fähigkeiten seines Neffen, sagte ihm rückhaltlos die Wahrheit und bemühte sich, ihn seinem eigentlichen, angeborenen Berufe entgegenzuführen. Aus dem Oheim und Lehrer wurde ein treuer Freund und Berater.
Was dieser Oheim für ihn getan hat, pflegt nur ein Vater für seinen eigenen Sohn zu tun. Wenn man schon der Pflegemutter das Prädikat »vortrefflich« zuerteilt, so sind für diesen Mann die stärksten Superlative noch viel zu schwach.
Es muß jeden, der sich mit Becquers Jugendgeschichte befaßt hat, seltsam berühren, wie nebensächlich alle Biographen die Existenz des Oheims behandeln. Viele übergehen sie ganz, geschweige denn, daß sie seinen Namen anführen. Und doch verdient gerade dieser mit goldenen Lettern in den weißen Marmor eingegraben zu werden, der sich als Becquerdenkmal um die hohe Zeder im Park von Sevilla schließt ...
Dem Oheim ist es zu verdanken, daß sich Gustav Adolf trotz der kurzen Schulzeit eine gründliche Kenntnis der Geschichte, Literatur und der bildenden Künste seines Landes erwarb, daß er ausgerüstet mit guten Grundlagen in Madrid ankam und schon zwei Jahre darauf ein so tiefes Werk zu schreiben vermochte wie die »Geschichte der spanischen Kirchen«.
Dem Oheim wurden auch die ersten dichterischen Versuche vorgelegt, und obwohl er selbst wenig Sinn hatte für die Kunst der Worte, übte er strenge Kritik, um des jungen Dichters Urteil zu schärfen und zur Selbständigkeit zu erziehen.
Er ließ es sich angelegen sein, die Bildung des Neffen zu erweitern. Und weil die Pflegemutter nicht dafür zu gewinnen war, bezahlte er selbst – er, ein armer, bedürftiger Maler, der sich mühsam mit seiner Kunst durchs Leben half! – bezahlte er die Studien seines lernbegierigen Neffen.
Und dann: als im achtzehnjährigen Jüngling das Genie durchzubrechen begann und ihn zu dem Entschluß trieb, als Literat nach Madrid zu gehen; als es in ihm gärte und stürmte von hochfliegenden Plänen und kühnen Zielen; als die Reise an dem Widerstand der Pflegemutter zu scheitern drohte – da gab er, der Oheim und Lehrer, sein Letztes hin: ganze dreißig Taler – des Poeten Reisegeld. – Joachim Dominguez Becquer hieß dieser Mann.
* * *
Es war im Herbst des Jahres 1854, als Becquer in Madrid ankam. Mit den achtzehn Talern, die ihm nach Abzug der Reisekosten noch blieben, mietete er sich in einer billigen Studentenpension ein, wo er für volle Rost sechs Realen (anderthalb Franken) täglich bezahlte.
Seine Stube war erbärmlich: eng und niedrig, hatte sie nur ein Fenster nach einem kleinen Lichthof und war auf das bescheidenste eingerichtet. Nicht einmal ein richtiges Bett befand sich in dem Raum – nur eine Matratze, die auf einem zusammenklappbaren Holzgestell, einem sogenannten »Catre«, lag, und davor ein Stuhl, der als Nachttisch diente ...
Man wird sich danach den Eindruck vorstellen können, den Becquer in seiner neuen Umgebung empfing. Nach dem stillen herrschaftlichen Hause, das er in dem vornehmen, sonnigen Sevilla bewohnt hatte, – diese halbdunkle Höhle einer Mietskaserne ... in einer Stadt, die man damals allgemein einen »Kuhstall« nannte! Dies nämlich war die ärgste Enttäuschung für den jungen Dichter: daß die ganze Stadt zu seiner Wohnung im gleichen Verhältnis stand! Überall Schmutz und Unrat auf den Straßen; Kranke in allen Häusern; das Trinkwasser schlecht und verpestet. Eine ständige Brutstätte aller möglichen Seuchen – selbst der Cholera, die schon ein Jahr später die Bevölkerung dezimierte. Ein Asyl für Bettler und Abenteurer. Eine trostlose, ärmliche Scheunenstadt unter einem trüben, kalten Himmel: das war das ersehnte Madrid, die Stadt der Dichter und großen Männer! Das war der Gegenstand seiner Träume, um dessentwillen er alles geopfert hatte!
Sollte etwa seine Pflegemutter doch recht gehabt haben, als sie sich so energisch seinen Reiseplänen widersetzte?
Ja, was wollte er denn überhaupt in Madrid? War er mit bestimmten Ideen, mit bestimmten Plänen gekommen, die er zu verwirklichen gedachte?
Wohl kaum. Es war wohl mehr ein unbestimmbares Träumen, das ihn getrieben hatte, – ein unbewußter Willensdrang, wie er künstlerisch veranlagten Menschen eigen ist. Er fühlte: ich muß heraus aus dem engen Heimatkreis, der mich einschränkt, der mich verkrüppelt, der mir eine Harmonie aufzwingen will, die nicht meinem Wesen entspricht ... ich muß in die Hauptstadt, in das Kulturzentrum meines Landes, um mich abzuschleifen, um mich zu läutern, – um eben das aus mir herauszubilden, was in mir ist ...
Hätte Becquer nicht so tief und ernst empfunden: er wäre zweifellos wieder nach Sevilla zurückgekehrt. Es gab mehr in ihm als lyrische Jugendschwärmerei. Es war eine strenge, starke Kunst, die nach Ausdruck in ihm rang, – und ein Ringen nach Form und Ausdruck ist sein ganzes Leben geworden. wenn er dies damals auch noch nicht bewußt und klar erkannte, so scheint er es doch schon empfunden – und aus diesem Empfinden die Kraft geschöpft zu haben, die ungewohnten Entbehrungen und immer wiederkehrenden Enttäuschungen zu ertragen.
Das wechselvolle Getriebe der Großstadt wurde für ihn das Scheidewasser, das alles Unechte von dem Echten in ihm trennte.
* * *
Zusammen mit seinem Schulfreunde Narciso Lampillo und dem jungen Nombela aus Madrid, der sich vorübergehend in Sevilla aufhielt und vom Schauspieler zum Schriftsteller umgesattelt war, hatte er in seinem letzten sevillaner Jahre eine Anzahl Gedichte verfaßt, welche die drei Freunde gemeinschaftlich herausgeben wollten. In der Art siebzehnjähriger Jünglinge hatten sie damals ihre Verse sehr hoch eingeschätzt und sich schon reich und berühmt geträumt. Aber als Becquer etwas später in Madrid seine Gedichte wieder vornahm, hatte sich sein kritischer Sinn schon verfeinert. Seine Idee von Lyrik war eine andere geworden. Er prüfte die Gedichte auf ihre Ehrlichkeit, und das Ergebnis war, daß er eins nach dem andern vernichtete.
Nicht mit einem Male vernichtete er sie, sondern nach und nach. Es geschah also nicht in einer verzweifelten Stunde, nicht aus Entmutigung: es geschah nach kühlem Erwägen, es war ein nachdenkliches Verwerfen. Er fühlte wohl: hier ist ein Weg – aber noch nicht das Ziel. Es ist noch zuviel Suchen und Wollen in meinen Versen ... noch nicht der Ausdruck dessen, was ich gesucht habe ... Ich halte noch nicht die Schlüssel in meiner Hand, die mein Ich mir erschließen. Noch bin ich eine Frucht mit grüner Schale – wie also könnte ich schon meinen Kern erkennen?
vielleicht war es dies, was ihn warten hieß, warten, um auszureifen. Man kann es nur erraten: Anhaltspunkte bestehen nicht. Man weiß so gut wie nichts über das innere Leben seiner ersten Jahre in Madrid – man weiß schon wenig genug über sein äußeres. Er war viel zu verschlossen, viel zu verschämt, um seine Freunde an den Kämpfen seines Innern teilnehmen zu lassen. Aber der Weg, den er von seinen Jugendversen bis zu dem Auftauchen der ersten »Rimas« zurückgelegt hat, zeigt, daß er unterwegs nicht viel rastete.
Seine Freunde scheinen allerdings nicht so recht mit ihm zufrieden gewesen zu sein. Sie fanden ihn zu verträumt, zu wenig aktiv nach außen hin, – begriffen nicht die intensive Tätigkeit des einsamen Lebens, das er innerhalb seiner vier Wände führte. Nach ihrer Meinung hatte die Laufbahn eines Literaten am Redaktionstisch zu beginnen. Die Politik war das gegebene Uebungsfeld für die Schärfe seines Geistes, die Kaffeehausecke eine Vorschule der agitatorischen Beredsamkeit. Becquer aber, dessen Genialität wohl von ihnen geahnt, dessen vornehmer Geist von allen geachtet wurde, verbrachte seine Tage mit Lesen und Zeichnen, saß stundenlang neben dem Piano seines Freundes Zamora und bestand darauf, daß er sich mit seiner reinen, tendenzlosen Kunst durchsetzen müsse.
Das kleine Vermögen, das er von Sevilla mitgebracht hatte, war natürlich längst verbraucht. Er zog von einer Wohnung in die andere, lebte hier als Gast und dort auf Kosten seiner Freunde – wurde auch wohl hin und wieder von seinem Bruder Valerian unterstützt, der seit 1855 in den nördlichen Provinzen Heiligenbilder malte und für Zeitschriften zeichnete. Jedenfalls ertrug Becquer sein Elend ohne zu klagen und half sich durch, so gut es ging – immer sein großes Ziel vor Augen. Er lieferte kleine Beiträge für Modeblätter, gründete in Gemeinschaft mit seinen Freunden verschiedene Zeitungen, die nichts einbrachten, Zeitschriften, die infolge Geldmangels niemals erschienen, schrieb Biographien der Deputierten für einundzwanzig Peseten Wochenlohn und verarbeitete Hugos »Notre-Dame de Paris« zu einem Drama namens »Esmeralda«, das von der Zensur verboten wurde ...
An dieser »Esmeralda« war (neben Nombela und Luna als literarische Mitarbeiter) auch ein gewisser Juan de la Puerta Vizcaino beteiligt, – ein etwas dunkler Ehrenmann, der nach dem Prinzip zu teilen pflegte, daß den anderen zwar der Ruhm, ihm aber der pekuniäre Verdienst zufiel. Mit dem Scharfblick, den derartige Leute zu haben pflegen, erkannte er, daß Becquer nichts Alltägliches sei, und forderte ihn zu weiteren gemeinschaftlichen Unternehmungen auf. Und dieser, der allzeit Ideenreiche, der nur auf eine Gelegenheit wartete, um ein fünfbändiges und großerdachtes Werk erstehen zu lassen, nahm einen solchen Vorschlag natürlich freudig an.
Dies Werk, mit dessen Idee er sich schon seit einiger Zeit getragen hatte, sollte eine umfassende Geschichte der spanischen Kirchen werden – ein großartiges Denkmal der Vergangenheit, wie es größer vielleicht niemand erträumt hat. Er plante nämlich keineswegs nur eine Geschichte der Baukunst: auch völkergeschichtliche Beziehungen sollten dabei ausgezeichnet und alte Sagen und Gebräuche damit in Verbindung gebracht werden. Es war seine Absicht, das »letzte Wort einer fliehenden Epoche« festzuhalten ...
Im Jahre 1857 erschien denn auch wirklich der erste (und einzige) Band dieser » Geschichte der spanischen Kirchen« in Lexikonformat. Ungefähr der zehnte Teil des Inhaltes bestand allein aus Beiträgen Becquers. – Ein Bruchstück dieser Arbeiten ist unter den Titeln »Erinnerungen einer Kunstreise« und »Die arabische Architektur in Toledo« in der spanischen Ausgabe seiner Werke zu finden.
Und der pekuniäre Erfolg dieses Buches?
Er ist leicht zu erraten. Becquer nahm zusammen mit seinem Freunde Correa eine schlechtbezahlte Schreiberstelle in der Domänenverwaltung an und hat nie wieder den Namen seines Mitherausgebers erwähnt, noch jemals von seiner mißglückten Kirchengeschichte gesprochen. Und nachdem man ihn dort entlassen hatte, weil ihn der Direktor dabei ertappte, wie er in den Amtsstunden Shakespeare las und Ophelia zeichnete, folgte für ihn eine Zeit, die wohl die dunkelste, elendeste seines ganzen Lebens war.
Als Becquer die Schreiberstelle verlor, kam auch Correa als treuer Kamerad um seine Entlassung ein. Während aber dieser noch im selben Jahre (1857) in der Redaktion der »Cronica« eine Beschäftigung erhielt, konnte sich Becquer nicht dazu entschließen, sich in das Joch einer Parteipresse spannen zu lassen. Er wußte, daß er alles Große und Edle opfern müsse, wenn er sich in die Politik mischte.
Becquer war keine Journalistennatur – keiner von denen, die für eine Sache eintreten können, ohne daran wirklich teilzunehmen. Die mit einigen geistreichen und klingenden Phrasen über alles schreiben können, ohne sich zu erregen und eine ernsthafte Kenntnis der Materie zu besitzen. Zweifellos ist dies eine beneidenswerte Fertigkeit: die Fertigkeit des sprachgewandten Artisten, dem die Worte nur so aus dem Munde strömen, der seine Ansichten aus dem Aermel schüttelt ... Diese Fertigkeit hat Becquer nie besessen – er ist niemals Artist gewesen: er war immer Dichter. Was er sagte, kam aus der Tiefe seines Innern. Worüber er sprechen wollte – das mußte er erst ehrlich verarbeitet haben. Sein Erleben war stark auch in Kleinigkeiten. Er ging stets voll auf in den Stoffen, kämpfte und litt mit den Ideen, durchfieberte sie mit allen Fibern seines Geistes. »Anläufe und saures Ringen, Verzweiflung und Entmutigung« hat jede Zeile, jeder Satz Becquers gekostet, und er, der einst davon träumte, als Dichter von seinen Versen leben zu können, hat bald lernen müssen, daß seine Verse von dem Dichter lebten ...
Die Politik wäre Becquers künstlerischer Untergang geworden. Weil er dies voraussah, versuchte er auch jetzt wieder, wo alle Quellen verstopft waren, sich mit seiner reinen Kunst durchzuschlagen. Daneben bemühte er sich auf andere Art und Weise Geld zu verdienen – so im Palaste der Marqueses de Remisa, wo er, besoldet von einem Dekorationsmaler (der selbst keine Figuren zu malen verstand), die Wände mit Fresken schmückte.
In die Wintermonate 1857/58 fallen die schlimmsten Entbehrungen, die Becquer je durchgemacht, die ihn mehr als einmal an den Rand der Verzweiflung gebracht haben mögen. In einem seiner Gedichte sagt er, vermutlich auf diese Zeit sich beziehend:
»Es kam die Nacht: nicht eine Zuflucht fand ich,und hatte Durst! ... Nur meine Tränen trank ich.Und hatte Hunger! Die geschwollnen Augen –ich schloß sie, um zu sterben.«
Es ist anzunehmen, daß er nicht nur den ärgsten Hunger kennengelernt hat, sondern auch viele kalte Winternächte obdachlos in Madrid umhergeirrt ist – zu vornehm, um seinen Freunden lästig zu werden, zu stolz, um ihr Mitleid zu erregen.
Jm Juni 1858 überfiel ihn eine schwere Krankheit, von der man glaubte, daß er sie nicht überstehen würde. Zwei Monate lang war er ans Bett gefesselt, und als er endlich aufstehen konnte, glich er einem lebenden Leichnam. Sein Körper hatte das Letzte hergegeben, das ihm nach den vielen Entbehrungen und Hungertagen noch an Kraft geblieben war; niemals gewann er wieder die alte Frische. Langsam nur, sehr langsam ging die Genesung vor sich – mit müden, vorsichtigen Spaziergängen am Arm seiner Freunde, mit sonnigen Ruhepausen im schönen Retiropark ...
Und auf diesen Spaziergängen zeigte er sich redseliger als früher, plauderte über allerlei literarische Ideen und sprach mit großer Zuversicht von seinen Plänen. Sein Geist hatte Ruhe gehabt während der Fieberwochen und war ausgereift. Mit der Genesung begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Auf die schwere Krankheit, der er beinahe unterlegen war, folgte eine geistige Auferstehung, folgte sein dichterischer Frühling – seine Schaffenszeit.
* * *
Sie währte nicht mehr als ein Lustrum – fünf kurze Jahre, etwa vom Herbst des Jahres 1858 an gerechnet. Dann schon erlahmten seine schöpferischen Kräfte, und die Wirren und Zufälligkeiten der letzten Jahre seines rasch verblühten Lebens schenkten ihm keinen zweiten Lenz ...
Aber in jenen fünf Jahren, die seiner Krankheit folgten, schuf er Werke von Ewigkeitsdauer. In diesen Jahren, in denen er alle Wonnen und Leiden durchkostete, die einem Menschendasein beschieden sind, in denen er jünglingshaft schwärmte und mannhaft liebte, hoffend, sehnend sich begeisterte und müde, tief enttäuscht mit der Verzweiflung rang: in diesen fünf Jahren entstanden die Gedichte und Erzählungen, die nach seinem Tode, als sie gesammelt erschienen, seinen Namen in das Buch der Unsterblichkeit eintrugen.
Von seinen Gedichten, den »Rimas«, F1 sind nur ganz wenige schon bei Lebzeiten des Dichters an die Öffentlichkeit gelangt – und auch diese wenigen erst mehrere Jahre nach ihrer Entstehung. Eine Datierung gibt es nicht, und so ist es trotz der Ungleichheit und Verschiedenwertigkeit der Gedichte untereinander sehr mühsam, den Entwicklungsgang des Dichters an ihnen nachzuweisen. Der äußeren Form nach haben alle diese Verse und Strophen schon ihresgleichen in der spanischen Lyrik; oft sind es Variationen im fortbildenden Sinne der spanischen wie überhaupt der romanischen Verskunst. Nur durch die Kürze, durch die geringe Strophenzahl sind sie auffällig. Statt des Reimes bedient er sich gern der altspanischen Assonanzen, die wie leise Reime empfunden werden. Sein Vers ist der klassische Hendekasyllabus, der Elfsilber, den er mit Siebensilbern wechselt, von denen er drei in einen Siebensilber oder Fünfsilber ausklingen läßt. Innerhalb dieses althergebrachten Rahmens aber revolutionierte er die Lyrik ... denn er war Formsucher, war »so sehr Dichter, daß ihm noch niemals die Formen genügt hatten, in denen er seine Gedanken hätte ausdrücken können,« wie es im »Mondenstrahl« heißt. Er entwickelte die Form organisch aus der Idee – verlieh einem jeden Vers seine besondere Gestalt, seine besondere Musik, seine besondere Färbung. Er war hierin seiner Zeit um Jahrzehnte voraus! So sehr voraus, daß seine Zeitgenossen nicht einmal begriffen, was Becquer mit einem unauffälligen Wechsel des Rhythmus, durch Einschieben einer Zäsur, durch Klangfärbung der Vokale und Halbkonsonanten zum Ausdruck bringen wollte! Daß sie ihm an den Fingern vorzählten, wo er eine Silbe zuwenig oder zuviel gesetzt, daß sie ihm Dissonanzen und Prosaismen vorwarfen! ... Becquer lebte nicht mehr, als dies geschah, und so konnte er sich nicht verteidigen. Heute, nach Auftreten Ruben Darios und anderer Verlainianer, sind derartige Vorwürfe längst entkräftet worden. Und es darf als bewiesen betrachtet werden, daß es in der ganzen spanischen Lyrik niemand gibt noch gegeben hat, der in scheinbar so nachlässiger Weise den Hendekasyllabus aufzulockern versteht, der das Wachsen und Sinken der Leidenschaft, das Pochen des Herzens und Stocken des Atems, das Überstürzen und Stottern der Rede, ja selbst die leisesten Schwingungen des Empfindens rhythmisch und phonetisch so fein wiederzugeben vermag – wie Becquer!
Auf seine eigentliche Bedeutung: die starke Subjektivität seiner Lyrik ist schon eingangs hingewiesen worden. Diese vor allem war das Neuartige, das Epochemachende an seinen Versen; denn Lyrik in unserem Sinne, persönliche, also wirkliche Lyrik hatte es vor Becquer in der spanischen Literatur nicht gegeben, – abgesehen von der Volkspoesie, die aber nicht als »Literatur« geachtet wurde. Diese Volkspoesie – kurze Lieder, die gesungen wurden – war allerdings immer schon stark subjektivistisch gewesen, und die anonymen Dichter dieser Lieder hatten sich nicht gescheut, ihre Erlebnisse und Empfindungen, ihre Freuden und Leiden, ihre Hoffnungen und Enttäuschungen – kurz, alle derartigen persönlichen, höchst unsachlichen Angelegenheiten zu besingen, welche ein Poet von Gottes Gnaden als »unpoetisch« ablehnte ...
Gerade an diese Volkspoesie knüpfte nun Becquer an. In einem 1860 erschienenen Artikel über einen Gedichtband seines Freundes August Ferran bezeichnet er sogar die Volksdichtung, die volkstümliche Dichtung, als Synthese aller Dichtung überhaupt! Ausgehend von der andalusischen Copla, faßt er alles in den Begriff Volksdichtung zusammen, was ihm als Lyrik, als subjektive Lyrik, vorschwebt, was er aus der ursprünglichen, schmucklos-primitiven Form des Volksliedes zu einer neuen, hochstehenden Kunstgattung heranbilden möchte. – Also nicht Nachahmung der Volkspoesie forderte Becquer – sondern Fortbildung! Er begriff den wahren Sinn jener großen folklorischen Welle, die, von Deutschland und England ausgehend, die Liebe zur heimatlichen Scholle weckte und die Augen für das Einfache, Zunächstliegende öffnete. Seine Empfindsamkeit war bräutliche Erde für die wenigen Samenkörner, die gegen Ende der fünfziger Jahre der Wind nach Spanien trug. Er wurde Ideenträger, Lebenserwecker, Selbstschaffender! Im Boden seiner Heimat wühlte er, grub die vergessenen, verachteten Lieder des Volkes hervor, und auf diesem Acker ließ er – geradeso wie andere in Deutschland – eine neue Dichtungsart ersprießen.
Auch stofflich ist die Verwandtschaft der Becquerschen Gedichte mit dem andalusischen Volkslied unverkennbar. Die andalusische Copla (um nur diese zu nennen) singt von Liebe und Liebessehnen, von Enttäuschung und Lebensüberdruß; wegen ihrer ergreifenden Melancholie ist sie bekannt. Und melancholisch – herb-melancholisch, nicht sentimental! – sind auch die meisten der » Rimas«. Ihr Thema ist Liebe – von der ersten aufkeimenden Leidenschaft eines Jünglings bis zu den bittersten, schmerzhaftesten Erfahrungen, die ein Mann in der Liebe überhaupt zu erleben imstande ist ...
Niedergeschrieben hat Becquer sie als eine Art konzentrierte Tagebuchnoten, ohne an eine etwaige spätere Veröffentlichung zu denken. Als eine Aussprache mit sich selbst über Dinge, die er, der Verschlossene, Stolzverschämte, selbst seinem besten Freunde nicht anvertrauen mochte. Sie enthalten (zum größten Teil) nichts anderes als die Geschichte seiner Liebe und seiner Ehe mit Casta Esteban y Navarro, der Tochter eines Wundarztes aus der Gegend von Soria, die der Dichter vermutlich auf einer seiner Studienreisen mit Valerian im Jahre 1860 kennengelernt und am 19. Mai 1861, auf Grund seiner inzwischen erfolgten festen Anstellung in der Redaktion des »Contemporaneo«, geheiratet hat.
Diese Ehe war eine sehr unglückliche, und schon im ersten Ehejahr scheint es zu Zerwürfnissen gekommen zu sein, was eine im November 1861 erschienene Parabel, »Das ist seltsam!« betitelt, erkennen läßt. Sie wirft nämlich die Frage auf, wie ein Mann zu handeln hätte, wenn seine Frau mit einem andern auf und davon ginge ... Ob und wann dies damals wohl nur gesichtete Ereignis eingetreten ist, erzählen die Biographen zwar nicht. Wohl aber wissen sie zu berichten, daß Becquer jahrelang von seiner Frau getrennt gelebt hat. Und daß die Ursache hierzu eine für den Dichter sehr schmerzhafte gewesen ist, bezeugen seine Gedichte, in denen er nicht nur das allmähliche Auseinanderwachsen der beiden Gatten in der ganzen sinnlichen Tragik besingt, wo er auch klar und deutlich von einem unerwartet eingetretenen Geschehnis spricht, das sich ihm wie ein tödliches Eisen in den Leib bohrt, das ihn begreifen lehrt, weshalb man mordet ...
* * *
Mit den Gedichten in viel engerem Zusammenhänge, als man gewöhnlich annimmt, stehen die Prosawerke Becquers. Nicht die schon vor seiner Krankheit entstandenen indischen Sagen »Der Fürst mit den blutigen Händen« und »Die Schöpfung«, in denen Schönheit der Form und vollendete Sprache häufig entschädigen muß für mangelnde Gestaltung und leblose Bilder. Sondern die späteren, reifen Erzählungen, die, aufgebaut auf irgendeiner alten Volkssage, einem Aberglauben, einer geschichtlichen Begebenheit, als Ausdrucksmittel eines persönlichen Erlebnisses oder einer rein künstlerischen Idee dienen – der Idee, die in dem Stoff selbst zum Ausdruck kommt, die den Stoff erst wert erscheinen läßt der künstlerischen Gestaltung ... denn Stoff und Inhalt sind dem Dichter eins. Und da die meisten dieser Erzählungen in denselben Jahren entstanden sind wie die Gedichte, so ist es begreiflich, daß es Verse gibt, die dasselbe Erlebnis zum Gegenstand haben, die gleiche Idee zum Ausdruck bringen. Nur: was im lyrischen Gedicht ohne Umkleidung gesagt wird, präziser, konzentrierter, erscheint in der Erzählung eng mit dem Stoff verwoben, damit auch »denen, die ihren tiefen Sinn nicht erkennen, ein wenig Unterhaltung« geboten wird, wie Becquer im Auftakt zum »Mondenstrahl« sagt ...
»Ein wenig Unterhaltung« zu bieten war natürlich niemals Becquers ernstliche Absicht – auch dort nicht, wo die eigentliche Idee nicht scharf herausgearbeitet hervortritt, wie im »Teufelskreuz«, im Spielmannslied »Glaubet an Gott!«, in den Hexengeschichten und anderen. Auch hier finden sich versteckte Brücken, die sich seine Phantasie von den Dingen des Alltags ins Reich der Kunst geschlagen hat. Was ihm früher schon, bei seiner Geschichte der spanischen Kirchen, vorgeschwebt und was er angefangen hatte, mehr geschichtschreibend als wirklich künstlerisch zu lösen – nämlich den Schatz zu heben, den die Bewohner entlegener Gegenden in Sitten und Gebräuchen, in Aberglauben und Ueberlieferungen noch aus früheren Jahrhunderten bewahrten – das entzauberte er als Dichter. Jede entzifferte Inschrift wird ihm zum Ereignis. Verlassene Ruinen beleben sich unter seinem weckenden Blick. Tote entsteigen den Gräbern, sobald er sie ruft, erzählen ihm von den Sünden der Menschheit, von ihrem Wollen und Irren, wo er auch wandelt mit seiner Wünschelrute: überall entdeckt er einen Quell alter Sagen und läßt ihn lebendig hervorsprudeln aus dem Schoß der Erde.
Doch gestaltete er nicht, wie vor ihm die Romantiker, in willkürlichem Rausch der Phantasie. Becquer hatte das strenge Gewissen eines Chronisten – aber eines Chronisten, der zugleich ein Dichter ist. Er studierte genau den geschichtlichen Untergrund, beobachtete den Charakter der jeweiligen Landschaft, die Sitten und Eigenheiten ihrer Bewohner. Und in ihrer Auffassung vervollständigte er die aufgelesenen Bruchstücke, erfand dazu und setzte alles zusammen – nicht nur mit dem Geschick eines Renners, vielmehr mit der umschmelzenden, neuzeugenden schöpferischen Kraft des Künstlers, getreu im Charakter des Volkes, aus dessen Munde er die Sage oder den Kern der Sage vernommen.
Aber Becquer trug auch eine eigene Welt in sich – einen Garten voll blühender Sehnsucht und einen Friedhof begrabener Hoffnungen ... und von dieser Welt mußte er singen und sagen, diese Welt mußte er bekennen, hinausschreien, wenn er nicht daran ersticken wollte. Und so geschah es, daß der Stoff, indem er sich in ihn hineinlebte, nur Mittel wurde zur Darstellung – nicht Zweck an sich. Daß seine Helden, mit denen er verwuchs, indem er sie zeugte, litten und empfanden, wie er litt und empfand; daß sie mit seinem Munde sprachen und seine Erlebnisse und seine geheimsten Träume bekannten. Solche Selbstbekenntnisse sind vor allem » Der Geisterberg«, » Die grünen Augen« und » Der Mondenstrahl«, als Ausdruck eines persönlichen Erlebnisses gekennzeichnet schon durch die vorangeschickten einleitenden Worte des Dichters. Aber auch ohne diese würde die subtile Durchsichtigkeit der äußeren Handlung auf die verborgene Symbolik hinweisen. – Biographisch bemerkenswert ist, daß diese drei Geschichten, deren Helden alle deutlich die Züge des Dichters tragen, in den Wintermonaten 1861/62, also noch in seinem ersten Ehejahr, entstanden sind. »Lieder, Frauen, Ehre, Ruhm: alles Lüge, eitle Trugbilder unserer Phantasie« – so spricht Becquer als Fünfundzwanzigjähriger, ein gestürzter König, ein aus den Wolken gefallener Träumer! ...
In demselben Winter, nämlich in den letzten Dezembertagen des Jahres 1861, erschien im »Contemporaneo« auch die farbige, humorvolle Geschichte » Meister Perez, der Organist«, eine der besten Erzählungen, die Becquer geschrieben hat. Sie spielt in Sevilla zur Zeit Philipps des Fünften – und zwar an drei verschiedenen Weihnachtsabenden in der Klosterkirche zum heiligen Geist (in der Erzählung Sankt Agnes genannt, aber durch die Beschreibung der Lage und die Nähe des Palastes des Herzogs von Alba genau bestimmt). Die äußere Handlung veranschaulicht drei jener mitternächtlichen Hahnenschreimetten, wie sie heute noch alljährlich zur Feier von Christi Geburt abgehalten werden – wenn auch nicht mehr mit dem großen Aufwand und der ungehinderten Beteiligung des Volkes wie früher.
Der Reiz dieser Erzählung liegt einmal in der lebendigen Darstellung und der humoristischen Färbung, die der Dichter der Hauptsprecherin verleiht, sodann aber in der hohen, transzendentalen Idee dieser wundersamen Geschichte: – Ein mäßiger Musiker, vom Geiste des seligen alten Meisters inspiriert, bringt einmal ein Kunstwerk zustande, fällt jedoch in seine Nichtigkeit zurück, als er selbständig, ohne diese Inspiration, zu spielen versucht.
Es gibt wenige unter den Erzählungen Becquers, die dem »Meister Perez« an Wert gleichzustellen sind, und nur eine, die ihn überragt: das ist » Das Miserere« – das Stärkste und Reifste, was er geschaffen.
Der Schauplatz der Handlung ist das Bad Fitero im südlichen Navarra, wo Becquer (vermutlich im Herbst 1862) zur Erholung weilte. Motive aus dem »Teufelskreuz« und dem »Geisterberg« scheinen sich mit dem Eindruck verbunden zu habe», den die Aufführung des Miserere von Eslava im Dom zu Sevilla auf ihn in der Jugend gemacht hat.
Die Idee, die diese Geschichte zum Ausdruck bringt, ist der des »Meister Perez« nicht unähnlich: – Nur aus der göttlichen Eingebung, aus der Inspiration heraus, entsteht ein wirkliches Kunstwerk; das zu unrechter Stunde erzwungene Schaffen, bloße Verstandesarbeit, erzeugt Stückwerk, Scheinkunst ...
Daneben erzählt diese Geschichte von der Nervenspannung des im Rausch der Eingebung fiebernden Künstlers, von seinem Ringen mit Stoff und Darstellungsmitteln, von seinem heißen Bemühn, die Bilder des Urdenkens in Worte und Noten, in Farben und Formen umzubilden. Sie läßt erraten, wie Becquer mit seinen Gestalten gelitten, sich mit der spröden, unzulänglichen Sprache geplagt hat, um das wiederzugeben, was ihm ursprünglich visionär vorschwebte, – wie er geduldig gewartet, um die rechte, beseelte Stunde nicht zu verpassen. –
Mit diesem vermutlich gegen Ende des Jahres 1862 entstandenen Werke stand Becquer auf dem Gipfel seines Schaffens. Die Kraftlosigkeit seines unterernährten, schwächlichen Körpers hinderte ihn am weiteren Aufstieg. Dazu gesellte sich die pekuniäre Not, die ihn zwang, im »Contemporaneo« auch bescheidene Redaktionsarbeiten zu übernehmen und Reporterdienste zu leisten. Im Jahre 1863 war er daneben noch Mitarbeiter von drei weiteren, ebenso angesehenen Blättern. In diesen veröffentlichte er eine ganze Reihe von Aufsätzen und Skizzen und die Erzählungen » Der Kobold«, » Das weiße Reh«, » Das Gelöbnis« und » Der Kuß«. Außerdem übersetzte er aus dem Italienischen den Text zu Beethovens »Fidelio« und Aubers »Fra Diavolo« und soll Singspiele für eine Volksbühne der Atochastraße in Madrid geschrieben haben.
Die Folge davon war, daß er sich überarbeitete und krank wurde. Im Frühling 1864 ging er, von seiner Frau und seinem Bruder Valerian begleitet, wieder in das Moncayogebirge und verbrachte hier, in dem früheren Kloster Veruela, die Sommermonate. Die frische Luft der Berge wirkte auf ihn belebend. Noch einmal rafft er sich auf zu einer größeren dichterischen Leistung und schreibt hier für den »Contemporaneo« die » Briefe aus meiner Zelle«, die an Kraft und Schönheit der Sprache den Erzählungen gleichwertig sind und in Spanien nicht weniger geliebt werden wie Becquers Verse.