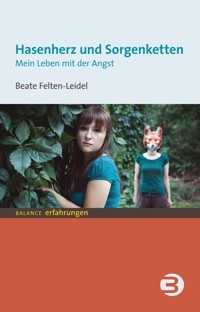Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BALANCE Buch + Medien Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: BALANCE erfahrungen
- Sprache: Deutsch
»Sei doch nicht immer gleich beleidigt! Analysier nicht dauernd alles! Leg dir endlich ein dickeres Fell zu!« – 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind hochsensibel. Hochsensible Menschen haben geringere Reizfilter und leiden mehr unter Stress und Ängsten als ihre Mitmenschen. Sie, wie auch ihre Angehörigen, empfinden Hochsensibilität oft als belastend, irritierend und beängstigend. Dabei ist diese Eigenart auch eine Stärke und ein Geschenk, wie dieser aufschlussreiche Erfahrungsbericht der erfolgreichen Autorin zeigt. Sie ermutigt ihre »Leidensgenossen« und Angehörige z. B. von hochsensiblen und introvertierten Kindern: Hochsensible können sich helfen, sie müssen nur wissen wie!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beate Felten-Leidel
Von wegen Mimose
Wie ich meine Hochsensibilität als Stärke erkannte
Cover
Titel
Widmung
Wie von einem anderen Stern
Chamäleon
Synästhesie und Farbenspiele
Hochsensible Wortklaubereien
Kinderjahre
Rohrstöcke und brüchiges Eis
Bühnenpräsenz und Brandungsfels
Sprachverwirrungen
Atticus Finch und Loriot
Macht der Gedanken
Jagdhundnase und Elefant
Luchsohren und Kopfhörer
Verbenentee und Bitterstoffe
Adleraugen und Sonnenbrille
Aschenputtel und Sandbaby
Der »sechste« Sinn
Der »siebte« Sinn
Bilderfluten und Traumata
Träume und Schäume
Das kleine große Glück
Danke
Literatur
Impressum
Für meine Eltern,
die als Kinder einer dunklen Zeit ihre empfindsame Seite nie als Stärke, sondern nur als Schwäche wahrnehmen konnten.
Wie von einem anderen Stern
»Pfui! Wie das eine Entlein aussieht, das wollen wir durchaus nicht dulden!« Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. »Lass es in Frieden!«, sagte die Mutter, »es tut ja niemand etwas.« »Ja, aber es ist zu groß und ungewöhnlich«, sagte die beißende Ente, »und deshalb muss es gezwackt werden.« »Es sind hübsche Kinder, die uns die Mutter da vorführt«, sagte die alte Ente mit dem Lappen um das Bein, »alle sind sie schön, bis auf das eine, das ist nicht geglückt. Man möchte, dass sie es umarbeiten könnte.«
Hans Christian Andersen, »Das hässliche junge Entlein«
Wer gleichzeitig ängstlich, schüchtern und dünnhäutig ist, merkt meist schon früh, dass mit ihm etwas nicht stimmt, fühlt sich ausgegrenzt und unverstanden, empfindet sich als »falsch« vielleicht sogar als krank. Leider finden das auch die anderen, manchmal sogar die eigenen Eltern. Ratschläge und Tadel gibt es wie Sand am Meer, man kann sie nur nicht umsetzen. Sätze wie »Du fühlst einfach zu viel!«, »Stell dich nicht so an!« oder »Du musst dir ein dickeres Fell zulegen!« sind den meisten zart besaiteten Menschen bereits in der Kindheit wohlvertraut.
»Das ist doch nicht normal!«, sagten auch meine Eltern. »Das Mädchen ist lieber allein als mit anderen Kindern zu spielen.« Ich war tatsächlich am liebsten allein, dann hatte ich wenigstens keinen Stress. Warum war ich bloß so »anders«? Bis zu meiner Erkenntnis, hochsensibel zu sein, hatte ich oft genug das Gefühl, nicht in diese Welt zu passen. Als Kind war es nahezu unerträglich. Meine Angst- und Stresspegel waren chronisch erhöht. Ich war schüchtern und traute mir nichts zu. Ich war extrem verletzlich und sprach offenbar eine Sprache, die kaum jemand verstand. Kam ich etwa von einem anderen Stern? Ich war »nicht geglückt«, genau wie das hässliche junge Entlein, nur dass aus mir bestimmt niemals ein Schwan werden würde.
Das ungute Gefühl, nicht in diese Welt zu passen, hatte ich auch als Erwachsene lange noch. Ich hatte einfach zu viele Macken und Ängste. Ich begriff nicht, warum ich in bestimmten Situationen so viel mehr Stress hatte als andere, warum ich oft so erschöpft und ausgelaugt war, warum ich Einkaufszentren und Kaufhäuser hasste, bei Zeitdruck durchdrehte, in Gruppen verstummte und bestimmte Geräusche und Gerüche kaum ertrug. Gedanken, Bilder, Gefühle, alles klang bei mir viel länger nach als bei anderen. Nach einem Zahnarztbesuch war ich stundenlang fertig. Ein falsches Wort am Morgen, und der Tag war gelaufen. Oft war ich unglücklich mit mir selbst, weil ich mich trotz aller Mühe nicht ändern konnte. Wahrscheinlich wäre mir viel Kummer erspart geblieben, wenn es das Konzept der Hochsensibilität bereits in meiner Kindheit gegeben hätte. Möglicherweise hätte man mich dann nicht so oft als »Mimose«, »Sensibelchen« und »Zimperliese« verspottet. Die Einsicht, dass ich einfach nur besonders feine Antennen habe und es vielen anderen Menschen genauso geht wie mir, hat mir geholfen, meine vermeintlichen »Schwächen« anzunehmen.
Glücklicherweise kann man die vielen negativen elterlichen und gesellschaftlichen Botschaften, falschen Selbstbilder und unklaren Regeln, die man als Kind übernommen hat, als Erwachsener nachträglich noch außer Kraft setzen, indem man mit seinem inneren Kind Kontakt aufnimmt und es tröstet und stärkt. Gerade Hochsensible haben oft einen intuitiven Zugang zur eigenen Seele und verfügen über sehr gute Selbstheilungskräfte. Wer sein inneres Kind liebevoll annimmt, kann alte Wunden schließen und verschüttete Emotionen endlich zulassen und fördern. Oft stellt sich dabei sogar heraus, dass in unseren vermeintlichen Schwächen unsere größten Stärken verborgen liegen. Man braucht nur jemanden, der einem den richtigen Weg zeigt.
Innenblick
Mein erster Wegweiser und Retter in der Not war C. G. Jung mit seinem Konzept von Introversion und Extraversion. Es gab also ein Wort für ruhige, ernste Menschen wie mich! Meine Energie war offenbar stärker nach innen gerichtet als nach außen. Das war nichts Schlimmes, nur eine bestimmte Haltung zur Welt und zu mir selbst. Ich brauchte keine Sensationen und Kicks, ich stürzte mich nicht begeistert und forsch in die Welt, ich stand abseits, beobachtete und versuchte zu verstehen. Nach außen war ich eine stille Tagträumerin, doch in meinem Kopf fanden die aufregendsten Abenteuer statt. Meine Fantasie war überbordend, ich erfand komplizierte Geschichten und konnte Stunden mit Büchern, Zeichenblock und Stiften verbringen. Durch C. G. Jung verstand ich endlich, warum ich so leise sprach, nur langsam auftaute und mein Schneckenhaus immer mit mir herumtrug, um notfalls schnell darin zu verschwinden. Ich war »kopflastig«, ich dachte lieber nach als zu handeln. Ich war nicht langweilig und farblos, wie andere vielleicht dachten, ich war nur introvertiert. Trotzdem war mir nicht richtig wohl in meiner Haut. Es gab noch so vieles an mir, das ich nicht verstand. Am schlimmsten waren meine Ängste und meine Dünnhäutigkeit. Was ich damals nicht wusste: Viele Introvertierte sind gleichzeitig auch hochsensibel.
Alarmanlage
Wie erklärt man jemandem, der noch nie etwas von Hochsensibilität gehört hat, diese Eigenart? Man kann sie sich gut wie eine komplizierte, mit allen Raffinessen ausgestattete innere Alarmanlage vorstellen. Jeder Mensch wird sozusagen mit einem individuellen Krisenmelder geboren, der vor Bedrohungen warnt. Die Normalversion ist solide, stabil und zuverlässig, reagiert nur bei Gefahr und ist wenig störanfällig. Wenn sie Alarm schlägt, steht ein Einbrecher vor der Tür, droht ein Herzinfarkt, steckt man in einer Beziehungskrise oder hat Megastress im Büro.
Die empfindliche Hochleistungsversion dagegen ist mit unzähligen komplizierten Zusatzsensoren, Rauchmeldern, Fühlern, Mikrofonen und Kameras ausgestattet. Die Sirenen schrillen bereits, wenn ein Mäuschen vorbeihuscht, das Herz zu schnell schlägt, der Partner ein falsches Wort sagt oder die Chefin komisch guckt. Manchmal reicht es sogar schon, wenn jemand in der Nähe lediglich hörbar kaut oder atmet. Die Riesenanlage macht unglaublich viel Lärm um nichts, und kaum jemand kommt auf Anhieb mit ihr klar. Irgendwann hadert der überforderte Anlagebesitzer mit sich und der Welt. Warum ist ausgerechnet er mit diesem Ungetüm geschlagen? Warum kann er damit nicht umgehen? Alle anderen schaffen es doch mit ihren Anlagen auch. Auf Verständnis kann er nicht hoffen. »Stell das Ding doch ab! Hör nicht hin, wenn die Sirenen heulen. Markerschütternd? Ohrenbetäubend? Komisch, ich höre nichts. Leg dir doch eine andere Anlage zu!« Wenn es nur so einfach wäre. Man hat sich das zickige Supermodell schließlich nicht selbst ausgesucht. Früher oder später schämt sich der arme Besitzer nur noch in Grund und Boden und kann sich selbst nicht mehr leiden. Fatal! Für Schwankungen des Selbstwertgefühls gibt es einen Zusatzsensor, der mit giftigen Stressdämpfen reagiert.
Was tun? Hoffnung naht! Seit einigen Jahren gibt es nämlich »Gebrauchsanweisungen« für die komplizierte Anlage, die genau erklären, wie sie funktioniert und wie man sie warten, umprogrammieren oder zumindest so einstellen kann, dass sie nicht ständig stört. Bereits das Lesen führt zu sofortiger Entspannung. Es hilft, wenn man endlich versteht, dass sie bestimmten Mustern folgt, die allerdings bei jedem anders sein können. Vielleicht reagiert sie besonders heftig, wenn man ein Kaufhaus betritt, Hunger verspürt, oder das Thermometer 30 Grad übersteigt?
Aber das Beste kommt noch. Wenn man sich liebevoll mit ihr beschäftigt, offenbart die Anlage ihre wahren Qualitäten, und schon hat man das faszinierendste Lebensverfeinerungssystem, das man sich vorstellen kann: eine Anlage, die sämtliche Sinneseindrücke und Gefühle genau aufzeichnet und verstärkt, eindrucksvolle Bilder, Erinnerungen und Träume produziert und es sogar schafft, dass man die Welt um sich herum komplett vergisst und ganz in dem aufgeht, was man gerade erlebt oder tut. Diesen wunderbaren Zustand frei von Stress und Angst nennt man »Flow«.
Elaine Aron
Die Entdeckung und Erforschung der Hochsensibilität verdanken wir der amerikanischen Psychotherapeutin Dr.Elaine Aron, die Ende der 1990er-Jahre die erste »Gebrauchsanweisung« zu diesem Thema veröffentlichte. Was kann man tun, fragte sie, wenn man so empfindsam ist, dass die Welt einen förmlich erschlägt? Ihr Ratgeber »The Highly Sensitive Person« stieß in den USA sofort auf riesiges Interesse. Zum ersten Mal beschrieb jemand ausführlich und einfühlsam ein Phänomen, das die meisten »Betroffenen« bisher fast nur als irritierend, beängstigend oder belastend empfunden hatten. Aron ist es zu verdanken, dass auch die Stärken dieser Eigenheit entdeckt wurden. Hochsensitivität ist genauso wenig ein Modethema wie einst das Internet, und ich bin davon überzeugt, dass Arons Konzept für viele Menschen, die mit sich hadern oder sich gar für krank und gestört halten, geradezu lebensrettend sein kann. Viele Patienten, die unter starken psychosomatischen Beschwerden leiden oder wegen Angststörungen und Depressionen behandelt werden, sind möglicherweise nur hochsensibel und könnten sich mit diesem Wissen selbst helfen. Der neue Blick lässt die Vergangenheit oft in völlig neuem Licht erscheinen. Das Leben bekommt einen anderen Bezugsrahmen. Diese Neubewertung nennt man »Reframing«. Sie kann Fehldeutungen zurechtrücken, alte Wunden heilen oder zumindest erklären, wie es dazu gekommen ist.
»Betroffene« können nach der Lektüre von Arons Büchern tatsächlich ihre Kindheit und große Teile ihres bisherigen Lebens umschreiben. Man sieht sich mit anderen Augen. Die Inschrift am Apollotempel in Delphi fällt mir dazu ein: »Erkenne dich selbst.« Eigentlich hatte ich genau das mein Leben lang bereits versucht, doch ich war mir selbst oft genug ein Rätsel. Erst seit ich meine Introvertiertheit und meine übergroße Sensibilität »richtig« erkannt habe, kann ich sie auch genießen und als Gabe nutzen.
Reizaufnahme und Augenöffner
Inzwischen gibt es eine Fülle von Fachliteratur zur Hochsensibilität und auch immer mehr Coaches und Therapeuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Experten nehmen an, dass etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind, und verstehen Hochsensibilität als eine möglicherweise genetisch bedingte Veranlagung, bei der die Filter für äußere und innere Reize anders funktionieren als bei anderen Menschen: Sie sind sehr viel durchlässiger. Das hoch reaktive Nervensystem läuft ständig auf Hochtouren. »Highly Sensitive Persons« oder HSP, wie Elaine Aron sie nennt, nehmen Geräusche, Gerüche, Lichtreize, Berührungen, Körpersymptome und Schmerzen, ihre eigenen Gedanken und Gefühle und sogar die Stimmungen und Gemütsregungen anderer Menschen überdurchschnittlich intensiv wahr. Ihre Antennen sind ständig ausgefahren, in ihrem Kopf brennt Tag und Nacht analytisches Licht. Sie stehen daher oft unter Dauerstress und müssen vermehrt auf sich achten, um nicht von Reizen und Emotionen überflutet zu werden. Sie brauchen mehr Zeit, um Erlebtes und Wahrgenommenes zu verarbeiten und einzuordnen. Vor allem negative Erlebnisse hallen lange nach.
Oft müssen Hochsensible erst mühsam lernen, ihre Grenzen zu ziehen, sich gegen Übergriffe zu schützen und ihren persönlichen Wohlfühlabstand, ihre optimale Reizschwelle, ihre individuellen Ruheoasen, ihre inneren und äußeren Kraftorte und »Druckventile« zu finden. Viele Hochsensible lassen sich leicht verunsichern, wittern überall Gefahr, neigen zu Selbstzweifeln, Weltschmerz und Schüchternheit, sehnen sich nach Harmonie und Ruhe. Zudem sind sie anfällig für Allergien und Unverträglichkeiten, aber auch für Stress, Depressionen, Sorgen und Ängste, vor allem sozialer Art. Gelingt es ihnen nicht, mit ihrer Eigenart konstruktiv umzugehen, kann ihre »Gabe« zu ernsthaften psychischen und psychosomatischen Symptomen und Erkrankungen führen, insbesondere zu Angststörungen und Depressionen. Unterdrückt und geleugnet macht Hochsensibilität einsam und unglücklich. Dabei haben Hochsensible einen starken Gerechtigkeitssinn und setzen sich gern für Schwächere ein. Freundschaften sind ihnen sehr wichtig, allerdings haben sie meist nur wenige, dafür aber ausgesprochen enge Freunde.
Ich entdeckte Elaine Arons Bücher erst, nachdem ich als lebenslanger Angstmensch bereits mehrere Therapien hinter mir hatte. Woher meine auffällige Anfälligkeit für Ängste und Panik kam, war mir bis dahin ein Rätsel. Ich wusste zwar, dass ich nicht nur ein »Angsthase«, sondern auch ein »Kräutlein-rühr-mich-nicht-an« und eine »Prinzessin auf der Erbse« war, dachte aber, die Angst habe mich so sensibel gemacht. In gewisser Weise konnte ich meine Ängstlichkeit und Introvertiertheit leichter annehmen als meine Empfindsamkeit, die so viele meiner Ängste auslöste und steigerte. Die Angst verstand ich, auch wenn ich sie oft übertrieben fand. Sie war ein Gefühl, sie kam von innen, gehörte zu mir, war meine persönliche Eigenart. Mit ihr lernte ich umzugehen. Die Reizempfindlichkeit fühlte sich fremd an, wie eine aufgezwungene Schwäche und Behinderung, der ich wehrlos ausgeliefert war.
Als ich begriff, was bei mir »anders« war, fiel die negative Selbstbewertung weg, und ich konnte den Umgang mit Reizüberflutung und Stressempfindlichkeit nach und nach ändern. Ich weiß zwar auch heute nicht genau, wie mein Körper in belastenden Situationen reagieren wird, aber ich kann einiges tun, um mich vorher zu stärken, währenddessen zu beruhigen und anschließend zu erholen, aber vor allem hadere ich nicht mehr mit mir selbst. Es gibt viele Tricks und Alltagshilfen gegen Stress und Überstimulation. Es tut gut, sie zu kennen und gezielt einzusetzen. Ich habe für mich etliche Filterverstärker und Reizminderer, Kräftigungsmittel und Notfallmaßnahmen gefunden. Hochsensibilität ist keine Krankheit, aber bei starkem Leidensdruck oder Traumatisierung sollten auch Hochsensible nicht zögern, sich professionelle Hilfe zu suchen, wenn sie immer wieder an die Grenzen ihrer Kraft stoßen oder über die eigenen Grenzen hinausgehen.
Elaine Arons Test »Sind Sie hochsensibel?« war für mich eine unerwartete Erleuchtung. Ich hatte mir das gleichnamige Buch spontan gekauft, weil mich der Titel ansprach, und las es mit wachsender Faszination. Nie hätte ich erwartet, dass so viele Eigenheiten, die mich von klein auf belastet hatten, aber auch meine größten Stärken zusammen ein sinnvolles Ganzes bilden könnten. Besonders beruhigend fand ich, dass es noch mehr Menschen gibt, die so sind wie ich. In Arons Test konnte ich alles, aber auch absolut alles, ankreuzen. Die Reizempfindlichkeit, die Schmerzempfindlichkeit, die starke Wirkung von Koffein, die Gereiztheit bei Stress und Zeitdruck, die Schreckhaftigkeit, die Empfindlichkeit für Licht, Geräusche, Gerüche, Berührungen, das Vermeiden von belastenden Situationen, selbst der merkwürdige Hungerreiz, für den ich so oft spöttische Bemerkungen erntete. Ich machte ein Häkchen nach dem anderen. Ich war so überwältigt, dass ich meinen Mann rief und ihm das aufgeschlagene Buch in die Hand drückte. »Guck dir das mal an! Ist das nicht unglaublich?«
Mein Mann las sich den Test durch und meinte: »Aber das ist doch ziemlich allgemein, findest du nicht? Wer setzt sich schon gern lauten Geräuschen aus? Und Musik und Kunst genieße ich schließlich auch.«
Laute Geräusche? Alle Geräusche! Ich fand seine Reaktion enttäuschend. Es fühlte sich an, als hätte er einen Eimer Eiswasser über meine Begeisterung gekippt. Sah er denn nicht, dass hier jemand all das aufgelistet hatte, was mir mein Leben lang Riesenprobleme gemacht hatte? »Schmerzempfindlichkeit? Reizüberflutung? Angst vor Veränderungen? Schüchternheit? Das hast du doch alles nicht! Du drehst nicht durch, wenn du viel zu erledigen hast, du empfindest das sogar als Herausforderung. Du läufst bei Zeitdruck zu Hochformen auf. Für mich ist das nur Stress! Das weißt du doch!« Mein Mann war immer noch nicht sonderlich beeindruckt. Heute denke ich, dass seine Reaktion normal war. Er ist halt nicht hochsensibel.
Offenbar wirken Fragebögen zur Hochsensibilität nur auf »Betroffene« so befreiend und augenöffnend. Sie erkennen sich darin erleichtert und überrascht wieder und spüren förmlich, wie ihnen ganze Gebirge von der Seele poltern, weil sie endlich jemand versteht, während Normalsensible nur schulterzuckend dastehen und nicht begreifen, was denn an dem komischen Test so besonders sein soll. Inzwischen habe ich es übrigens trotz des suboptimalen Starts geschafft, meinen Mann vom Konzept der Hochsensibilität zu überzeugen. Er sieht, wie sehr mir die Beschäftigung damit geholfen hat und immer noch hilft. Ich bin wie verwandelt. Mit vielen Situationen, die mich früher in den Ausnahmezustand versetzten, werde ich heute souverän fertig. Nun weiß ich ja, woran es liegt und kann es einordnen. Auch mein Umgang mit mir selbst ist entspannter geworden, und das betrifft sogar einige hartnäckige alte Ängste, die sich merkwürdigerweise in Luft auflösten, weil sie gar keine Ängste waren, sondern »nur« Stressreaktionen aufgrund der Hochsensibilität. Als ich sie enttarnte, verpufften sie auf Nimmerwiedersehen.
Launen und Stimmungen
Schon die Assoziationen zu den einzelnen Selbsttest-Sätzen sehen bei Hochsensiblen komplett anders aus. Ich habe dazu mehrere Versuche mit nichts ahnenden Testpersonen durchgeführt. Es passiert jedes Mal dasselbe. Nehmen wir den Satz: »Die Launen anderer machen mir etwas aus.« Mir ist völlig klar, was gemeint ist. Normalsensible schnauben nur verächtlich. »Was soll das? Natürlich merke ich, wenn mein Chef miese Laune hat. Klar macht mir das was aus! Dazu braucht man wirklich nicht sensibel zu sein.« Was sie nicht wissen: Der Übersetzer hat bei der Übertragung nicht aufgepasst. Im Originaltext steht »moods«, was nicht »Launen« bedeutet, sondern »Stimmungen«. In anderen Büchern hat man den Fehler inzwischen verbessert, in Arons Buch steht er noch. Als Hochsensibler versteht man den Satz trotz des Übersetzungsfehlers intuitiv richtig, und sogleich passieren die unzähligen Situationen Revue, in denen man die Stimmungen und Befindlichkeiten anderer Menschen so hautnah spürte, als wären es die eigenen, vor allem die negativen: Traurigkeit, Angst, Sorge, Niedergeschlagenheit, Spannung, Frust, Verunsicherung, Enttäuschung, Ärger, Zorn, Stress. Und man spürte sie nicht nur körperlich und seelisch, sie nahmen einen so sehr mit, dass man davon überflutet wurde und die eigene Zentrierung verlor. Fünf Minuten Kontakt mit einem Problemfall, und der restliche Tag stand unter einem Unstern.
Die extreme Identifikation mit anderen Menschen beginnt bereits in der Kindheit. Alle Kinder sehen die Welt zunächst durch die Augen ihrer Bezugspersonen, doch bei hochsensiblen Kindern scheint diese Einfühlung besonders stark zu sein. Manche bleiben gar ein Leben lang in dieser Phase stecken und können sich von ihren Eltern oder ihnen nahestehenden Menschen nur mit großer Mühe oder gar nicht lösen.
Die Stimmungen meiner Eltern setzten mir als Kind so zu, dass ich mich innerlich fast auflöste. Dass beide psychische Probleme hatten, machte es nur noch schlimmer. Gleichzeitig war ich übermäßig schüchtern. Das für Kleinkinder typische »Fremdeln« war bei mir keine vorübergehende Phase, sondern ein verunsichernder Dauerzustand. Fremde Menschen, die mir zu nahe kamen, versetzten mich auch als größeres Kind noch in Angst. Aufmunternde Sätze wie »Na komm schon, ich beiß dich nicht« oder wohlmeinende Abhärtungsversuche von Verwandten und Bekannten katapultierten mich unweigerlich ins innere Aus. Manchmal schaffte ich es vor lauter Scheu nicht einmal, Blickkontakt zu halten. Sensible Kinder sind stark auf ihre Bezugspersonen fixiert, spüren am eigenen Leib, wie ihre Eltern gestimmt sind, ob Papa bedrückt, Mama enttäuscht oder die Lehrerin nicht gut drauf ist, Opa Schmerzen oder die große Schwester Liebeskummer hat. Sie wissen nicht, warum es den anderen schlecht geht, beziehen es auf sich selbst oder fühlen sich automatisch verantwortlich und schuldig. Sie reagieren so gut sie können, versuchen zu trösten, besonders lieb zu sein, abzulenken oder Witze zu machen. Manche fühlen sich auch überfordert, fangen an zu weinen oder ziehen sich stumm in sich selbst zurück.
Leider werden positive Gefühle von den meisten Hochsensiblen nicht automatisch mit derselben Intensität wahrgenommen. Doch das kann man üben, denn auch Glück, Zufriedenheit, Ruhe und Entspannung können überspringen und »anstecken«. Es tut gut, sich zur Abwechslung auch einmal von angenehmen Fremdgefühlen überfluten zu lassen.
Viele Hochsensible werden offenbar als Altruisten geboren und müssen regelrecht lernen, an sich selbst zu denken, für sich selbst zu sorgen und bei sich selbst zu bleiben. Meist bürden sie sich zu viel auf, denn sie sind ideale Seelenmülldeponien und Schuldabladestellen. Oft grübeln sie lange über fremde Probleme nach und zerbrechen sich den Kopf darüber, wie sie wohl helfen können, während die Grübelauslöser und Dampfablasser längst wieder zur Tagesordnung übergegangen sind. Sie haben ihre Last ja erfolgreich abgeladen! Weil Hochsensible selbst anders empfinden, ahnen sie davon oft gar nichts. Fremdstimmungen lassen sich nur schwer abschütteln. Die fehlenden oder fragilen Grenzen sind wohl einer der größten Schwachpunkte der Hochsensibilität. Sie machen einen noch dünnhäutiger und unsicherer als man ohnehin ist.
Ganz früh schon habe ich die Stimmungen meiner Eltern gespürt, weil hier die Grenzen auf meiner Seite immer sehr dünn waren. Ich kann weit zurückgehen in meiner Erinnerung. Zuerst sehe ich nur Momentaufnahmen, Gesichter, Räume, Möbel, die steile Treppe, den dämmrigen Speicher, die Nachbarin mit ihren Katzen, aber bald schon kurze Szenen.
Ich bin etwa drei Jahre alt, wir wohnen noch im Haus meiner Großtanten. Meine Mutter hat mich die vielen Treppen nach unten getragen. Ich lasse ihre Hand los und laufe meinem Vater im Nachthemd auf der Straße entgegen. Das Nachthemd flattert. Ich habe Angst zu fallen, aber ich laufe weiter. Papa kommt von der Arbeit nach Hause. Er sieht müde aus. Aber da ist noch etwas. Es geht ihm nicht gut. Ich weiß nicht, warum. Er nimmt mich auf den Arm und gibt mir einen Kuss. Ich möchte, dass er froh ist. Ich sage den Satz, den ich als kleines Kind so oft zu ihm gesagt habe: »Nich’ traurig sein, Papa. Du hast doch die Be-a-te!«.
Mein Vater war häufig bedrückt, der Krieg saß ihm in den Knochen. Heute weiß ich, dass er in dieser Zeit auch schwerwiegende berufliche Probleme hatte. Diese Szene ist sicher häufiger passiert, sonst hätte sie sich nicht so tief verankert. Es gibt noch eine weitere Erinnerung aus dieser Zeit, diesmal eine Abschiedsszene.
Ich bin auf dem Arm meines Vaters, wir wollen zum Kirmesplatz gehen. Meine Mutter kommt nicht mit. Warum nicht? Ein leiser Wortwechsel, den ich nicht verstehe. Ist sie böse auf Papa? Auf mich? Sie bleibt an der Haustür stehen, ich kann sie vom Nacken meines Vaters aus noch bis ans Ende der Straße sehen. Weint sie etwa? Sie winkt uns nach. Sie ist traurig. Das spüre ich, aber ich kenne den Grund nicht. Etwas Dunkles, Schweres überschwemmt mich. Wird sie noch da sein, wenn wir zurückkommen? Geht sie fort? Ohne mich? Passiert ihr etwas, wenn ich nicht bei ihr bin? Ein verstörendes Dilemma: Ich möchte bei beiden bleiben, bei meinem Vater und bei meiner Mutter. Es ist der erste Loyalitätskonflikt, an den ich mich erinnere. Der erste von unzähligen. Ich fühle mich zerrissen zwischen meinen Eltern. Ich muss wählen und bleibe bei meinem Vater. Wie auch später so oft. Aber ich fühle mich schuldig, wenn man das bei einem so kleinen Kind überhaupt sagen kann.
An meine tröstenden Kindersätze konnten sich meine Eltern gut erinnern, an die Abschiedsszene nicht. »Unsinn. Das bildest du dir nur ein.« Ich glaube meinem Gedächtnis. Meine Erinnerung ist klar. Ich blicke vom Arm meines Vaters in das bedrückte Gesicht meiner Mutter. Auch heute noch.
Chamäleon
Meine Empfänglichkeit für die Signale anderer ging oft so weit, dass ich mir vorkam wie ein Chamäleon, das ständig seine Farbe ändert und irgendwann nicht mehr weiß, welche von all den Farben die eigene ist. Ich brauche nur einen Blick in meine alten Schulhefte zu werfen, schon sehe ich das Dilemma: meine ständig wechselnde Handschrift. Ich imitierte wieder und wieder unbewusst die Schrift der Mitschülerin, die gerade neben mir saß. Da ist alles vertreten, eine extrem nach rechts oder links geneigte Schrift, breite Buchstaben, die akkurat auf den Linien kleben, dünne Spinnenwörter, riesige Anfangsbuchstaben und voluminöse Unterlängen. Kein Wunder, meine Banknachbarinnen wechselten ja dauernd. Jede fremde Schrift erschien mir so schön und überzeugend, dass ich sie sofort übernahm. Mir tut das unsichere kleine Mädchen von damals leid, denn es war nicht nur die Schrift. Wenn ich in meinen frühen Tagebüchern lese, höre ich oft meine Eltern und Lehrer sprechen. Das Einzige, was ich schon früh als Teil von mir selbst erkenne, ist mein Humor. Erst mit Anfang zwanzig beginnt sich meine eigene, unverwechselbare Schrift auszubilden.
Die Abgrenzung von anderen fiel mir sehr schwer. Lange blieb ich ein Chamäleon. Als Studentin dolmetschte ich mehrere Tage auf einem Stottererkongress und fing schon am ersten Tag ebenfalls an zu stottern und zu stammeln, was mir extrem peinlich war. Es passierte automatisch. An der Uni entwickelte ich im Unterricht einer schottischen Dozentin bald einen unverkennbar schottischen Akzent. MrsMacgregor war felsenfest davon überzeugt, ich würde mich über sie lustig machen. Weit gefehlt. Es war nur hochsensible Mimikry.
Woody Allens Film »Zelig« treibt mir Tränen des Mitleids in die Augen. Der arme Zelig ist so unsicher, schüchtern und ungeerdet, dass er sich als menschliches Chamäleon vollkommen an die Menschen seiner Umgebung anpasst. Er sieht immer haargenau aus wie die anderen. Neben Schwarzen wird er schwarz, neben Dicken dick, zwischen Psychoanalytikern verwandelt er sich ebenfalls in einen Psychoanalytiker und kann mit ihnen sogar endlose Fachgespräche führen.
Glücklicherweise bringt die Angleichungsfähigkeit oft eine ausgeprägte Sprachbegabung und Beobachtungsgabe mit sich. Viele Hochsensible haben ein ausgezeichnetes musikalisches Gehör und sind geschickt darin, Dialektfärbungen, Stimmlagen und Akzente zu erlauschen oder nachzuahmen. Ich habe schon als Kind meine Verwandten damit unterhalten, dass ich andere Dorfbewohner und Familienmitglieder imitierte. Es machte mir in diesen Situationen ausnahmsweise auch nichts aus, dass ich plötzlich im Mittelpunkt stand. Sie lachten ja nicht über mich, sondern mit mir. Imitieren macht mir heute noch Spaß. Wahrscheinlich ist es auch der Grund dafür, dass ich Sprachen studiert habe. Meine besondere Spezialität ist übrigens Kätzisch. Ich teile mein Leben mit mehreren redegewandten Maine Coons und habe mit meinen Äußerungen schon etliche Samtpfoten verblüfft. Fremde Kater reagieren auf den miauenden Dosenöffner manchmal sogar empört. Ich fürchte, ich sage tatsächlich etwas Katerfeindliches. Coonish hat mir vor allem meine Elaine beigebracht, und die hasst Kater.
Räusperzwang und Feldhasen
Einmal saß ich bei einem Kongress neben einer Frau, die ich nur flüchtig kannte, und versuchte verzweifelt, einem interessanten Vortrag zu folgen, auf den ich mich schon lange gefreut hatte. Die Frau saß neben einem Herrn, den sie zwar bestens kannte, aber nicht sonderlich mochte. Das war mir schon in der Hotellobby aufgefallen. Jetzt flüsterte der Begleiter dauernd auf die Bedauernswerte ein und störte empfindlich beim Zuhören. Ich bemühte mich, die beiden zu ignorieren, spürte jedoch, wie sich meine Nachbarin immer mehr verkrampfte, obwohl ich sie bewusst nicht ansah. Ich nahm es trotzdem »irgendwie« wahr und verspannte mich mit, obwohl ich dazu überhaupt keine Lust hatte und mir ihre Beziehungsprobleme mit der Nervensäge herzlich egal waren. Mein innerer Widerstand verstärkte den Stress zusätzlich. Plötzlich begann die Frau sich zu räuspern und »hart zu schlucken«, wie es in amerikanischen Krimis oft so schön heißt. Wie schrecklich. Die Arme! Es wurde immer schlimmer, kurz darauf bekam sie offenbar auch noch einen trockenen Hals und fing an zu hüsteln. Ihre Spannung führte in Nullkommanichts dazu, dass ich erst einen trockenen Hals, dann einen Schluckzwang und schließlich einen so heftigen Hustenanfall bekam, dass ich den Vortragssaal verlassen musste. Hustend rannte ich zur nächsten Toilette und hängte mich unter den Kaltwasserhahn. Vom Vortrag hatte ich nur die ersten Sätze mitbekommen. Die waren hervorragend und gaben Anlass zu großen Hoffnungen auf den Rest. Trotzdem blieb ich dem weiteren Vortrag fern. Ich ärgerte mich, weil ich wieder mal die Bodenhaftung verloren und es nicht geschafft hatte, mich gegen die Negativwellen einer nahezu wildfremden Person abzuschirmen.
Das ist nun einige Jahre her. Hätte ich damals schon von meiner Hochsensibilität gewusst, wäre mir die Schluckkrise wohl erspart geblieben. Inzwischen kann ich ganz gut meditieren und meine Aufmerksamkeit besser lenken. Heute würde ich mich einfach auf meinen Atem konzentrieren, in Gedanken einen Spaziergang machen, die Störsender ausblenden oder der Nervensäge einen vernichtenden Blick schenken, den sogar ein Hochunsensibler wie er richtig interpretieren würde.
Stimmungsübersprünge können mir zwar immer noch passieren, aber wenigstens weiß ich nun, woher es kommt. Ich kenne einen hochsensiblen Mann, der in meiner Gegenwart stumm wie ein Fisch und starr wie ein Feldhase in höchster Gefahr wird. Das setzt mich auf der Stelle schachmatt. Sofort erstarre und verstumme auch ich, und mein Hals verfärbt sich rot. Nicht weiter schlimm, meinem Gegenüber geht es genauso. Bei ihm verfärbt sich allerdings das Gesicht. Woody Allen könnte daraus wahrscheinlich eine schöne Stadtneurotiker-Szene machen. Vincent hat übrigens keine Ahnung, dass er hochsensibel ist, weil er keine Ratgeber liest und kaum mit mir spricht. Weniger komplizierte Menschen wären gewiss in der Lage, unser Problem zu lösen, indem sie ein entspanntes Gespräch anfingen. Wir würden sicher bald auftauen. Entspanntheit kann schließlich auch überspringen, wenn auch nicht so leicht wie Verkrampfung und Hemmung. Es gibt etliche Menschen, in deren Gegenwart ich mich sofort wohlfühle. Neulich habe ich beobachtet, wie sich der schüchterne Vincent angeregt mit anderen unterhielt. Ich schaffe das bei ihm nicht. Unsere Hochsensibilität verdoppelt die Verlegenheit. Wenn Vincent im selben Zimmer ist wie ich, spüre ich deutlich, wie er mich beobachtet. Ich beobachte ihn auch. Automatisch. Dazu muss ich ihn nicht mal ansehen. Die Zeit hat unser Problem nicht lindern können. Wir kennen uns schon seit über zehn Jahren. Seine Frau ist nicht hochsensibel und kann ihn mühelos zum Sprechen bringen. Er soll sogar einen ausgeprägten Sinn für Humor haben.
Bei einschüchternden Artgenossen passierte lange Zeit noch Schrecklicheres. Ich mutierte in Nullkommanichts zum Kleinkind, redete Unsinn und wurde rot. Auch hier sprang nicht etwa die Fremdstärke über, was ja eigentlich fair wäre, nein, das Dominanzverhalten aktivierte nur meine Schüchternheit. Mein einziger Halt waren Gläser, Tassen, Armlehnen oder Tischkanten, die ich eisern umklammert hielt. Es gibt diese Situationen auch heute noch.
Mein absoluter Horror sind Vorstellungsgespräche oder Vertragsverhandlungen, bei denen mich mehrere streng blickende Personen begutachten. Ich habe auch Probleme mit Gruppenarbeit, Teamprojekten oder gemeinsamem Brainstorming. Für gute Ideen muss ich entspannt sein. Entspannen kann ich aber nur, wenn ich allein bin und mich keiner dominiert oder sonst wie meine Kreativität blockiert. An der Uni war ich bei Teamwork jedes Mal diejenige, die wenig sagte und alles tippen musste. Dabei hatte ich eigentlich ganz gute Ideen, ich konnte sie nur nicht äußern. Ich habe schon früh die Notbremse gezogen und bin Freiberuflerin geworden. Die finanziellen Einbußen sind zwar beträchtlich, aber der Kontakt mit dominanten Chefs und nervigen Kollegen hält sich sehr in Grenzen, und mit Verlagslektoren und Mitübersetzern komme ich gut klar. Fast alle Literaturübersetzer, die ich kenne, sind überaus sensibel, sonst hätten sie diesen Beruf nicht gewählt. Hoffentlich schaffe ich es eines Tages, dominanten Cheftypen die kühle Stirn zu bieten. Vielleicht würde es schon genügen, kurz die Sprachebene zu wechseln. Bei einschüchternden Personen, denen ich nur einmal und nie wieder begegne, könnte ich mich als Engländerin oder Französin tarnen. Was mich stört, würde ich nicht verstehen. »Tut misch leid! Bitte erklären Sie misch das.« Mit englischem Akzent werde ich höflich distanziert, mit französischem Akzent entwaffnend charmant. Dominante Alphawölfe sind bestimmt netter zu komischen Ausländerinnen als zu deutschen Hasenherzen. Wenn gar nichts geht, verstumme ich. Gelegentlich läuft auch alles wunderbar und ich kann unerwartet entspannen. Neulich ist es mir passiert, dass ich in Anwesenheit von lauter Beschwipsten selbst beschwipst wurde, obwohl ich völlig nüchtern war. Hochsensible Anpassungsfähigkeit macht glücklicherweise fast alles möglich.
Szenen einer Ehe
Fremde Schwingungen können sehr verstören. Neulich waren wir bei Bekannten zum Abendessen. Mein Mann unterhielt sich hervorragend mit den Gastgebern, genoss das gute Essen und den französischen Wein und fühlte sich sichtlich wohl. Mir ging es völlig anders. Es gab unangenehme Schwingungen zwischen dem Gastgeberpaar, die beiden sahen einander komisch an und tauschten subtile Sticheleien aus. Ich hörte, sah und fühlte ihre Disharmonie. Meine Warnlampen standen auf Dunkelrot, die Alarmanlage lief auf Hochtouren, mein Magen wurde zu Stein, mein Mund zum Trockenraum. Ich begann zu schwitzen, mein Puls raste. Übrigens alles auch Angstsymptome, weshalb ich fälschlicherweise in derartigen Situationen früher nur Angst wahrnahm. Ich verkrampfte mich so sehr, dass ich weder plaudern noch essen konnte. Trinken konnte ich wegen meiner Alkoholunverträglichkeit ohnehin nur Mineralwasser. Die negative Energie schwappte mit Macht über. Ich wies mich selbst zurecht. Das bildest du dir bloß ein! Das ist nur ein harmloses Abendessen! Trotzdem war ich erleichtert, als wir endlich aufbrachen. Mein Mann war betroffen, als er hörte, wie unwohl ich mich fühlte. »Ich fand den Abend sehr harmonisch!«, konstatierte er. Ich nicht. Wahrscheinlich habe ich überreagiert. Es gibt keinen richtigen Beweis für mein Bauchgefühl, aber für mich sind die beiden umgeben von negativen Energiewolken. Man munkelt, dass die Gattin sich mit dem Gedanken trägt, allein zum Wintersport zu fahren. Aber das sind nur Gerüchte.
Synästhesie und Farbenspiele
Möglicherweise ist Hochsensitivität mit dem Wahrnehmungsphänomen der Synästhesie verwandt, das erst seit den 1980er-Jahren genauer erforscht wird, obwohl es dafür schon seit einigen Jahrhunderten Hinweise gibt. Synästhesie betrifft etwa vier Prozent aller Menschen und galt lange als Anomalie, Halluzination oder gar Geistesstörung. Wer die Welt nur mit normalen Sinnen wahrnimmt, hat für derartig merkwürdige Abweichungen natürlich kaum Verständnis. Bei Synästhetikern sind nämlich zwei oder sogar noch mehr verschiedene Sinnesempfindungen miteinander gekoppelt, am häufigsten Gesichts- und Hörsinn. So können manche Synästhetiker Farben auch als Töne hören oder Töne gleichzeitig auch als Farben sehen oder sie sogar schmecken oder tasten.
Im Prinzip sind Verbindungen zwischen allen Sinnen möglich, die Eigenheit ist bei jedem Synästhetiker anders ausgeprägt und nicht beeinflussbar. Wer als Kind zu seinem Banknachbarn sagt, dass für ihn die Sieben goldgelb strahlt oder sich wie ein Trompetenstoß anhört, dass ein Wort nach Erdbeeren duftet oder das Pausenbrot heute kreisförmig schmeckt und nicht rautenförmig wie sonst, wird mit Sicherheit irritiertes Kopfschütteln oder Schlimmeres ernten. Er wird sich die ablehnende Reaktion merken und seine merkwürdigen Sinneskoppelungen in Zukunft lieber für sich behalten. Wer gilt schon gern als verschroben oder übergeschnappt?
Unter Synästhetikern gibt es offenbar besonders viele Künstler, vor allem Maler und Komponisten. Von Franz Liszt wird berichtet, dass er bei einer Orchesterprobe die Musiker zurechtwies, weil sie einen bestimmten Ton rosa statt violett spielten. Auch Wassily Kandinsky gilt als Synästhesist und konnte Farben anscheinend gleichzeitig auch hören. Im Drogenrausch kann es übrigens selbst bei Nicht-Synästhetikern zu »Mehrsinnigkeiten« kommen, etwa beim Hören von Musik.