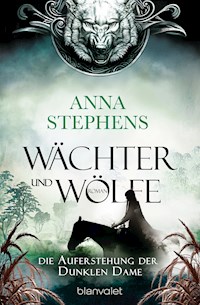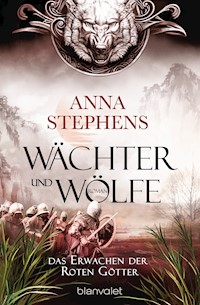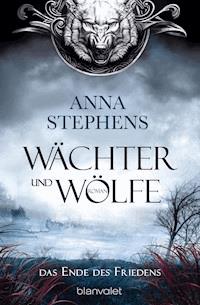
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wächter und Wölfe
- Sprache: Deutsch
Krieg wird kommen, Verrat wird lähmen, Tod wird herrschen …
Dom ist ein Seher, doch seine Gabe ist mehr Fluch als Segen, denn seine Visionen sind ungenau und körperlich auszehrend. Da begegnet er der geflohenen Sklavin Rillirin. Sie warnt ihn und sein Volk vor einer Invasion der Barbaren. Aber kaum jemand glaubt ihr. Da ereilt Dom eine Vision von erschreckender Klarheit. Er muss Rillirin vertrauen und den Klan der Wächter und Wölfe auf den Krieg vorbereiten, sonst wird nicht nur er sterben, sondern sein ganzes Volk.
Die »Wächter und Wölfe«-Trilogie:
Band 1: Das Ende des Friedens
Band 2: Das Erwachen der Roten Götter
Band 3: Die Auferstehung der Dunklen Dame
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ANNA STEPHENS
WÄCHTER UND WÖLFE
DAS ENDE DES FRIEDENS
Roman
Deutsch von Michaela Link
Buch
Dom ist ein Seher, doch seine Gabe ist mehr Fluch als Segen, denn seine Visionen sind ungenau und körperlich auszehrend. Da begegnet er der geflohenen Sklavin Rillirin. Sie warnt ihn und sein Volk vor einer Invasion der Barbaren. Aber kaum jemand glaubt ihr. Da ereilt Dom eine Vision von erschreckender Klarheit. Er muss Rillirin vertrauen und den Klan der Wächter und Wölfe auf den Krieg vorbereiten, sonst wird nicht nur er sterben, sondern sein ganzes Volk.
Autorin
Anna Stephens hat einen Abschluss in Literaturwissenschaft der Open University und arbeitet heute in der PR-Abteilung einer großen internationalen Kanzlei. Sie hat einen schwarzen Gürtel in Karate, und ihrer Ansicht nach ist es eine große Hilfe zu wissen, wie es ist, einen Schlag ins Gesicht zu bekommen, wenn man Kampfszenen schreibt. Sie lebt mit ihrem Mann in Birmingham.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Für meine Onkel, David und Graham.Ich wünschte, ihr könntet das hier sehen.
RILLIRIN
Elfter Monat, Jahr 994 seit der Verbannung der Roten GötterHöhlentempel, Adlerhöhe, Gilgorasgebirge
Rillirin stand hinten bei den anderen Sklaven. Sie drängten sich alle dicht zusammen, und die Masse ihrer Leiber wirkte wie eine kümmerliche Faust. Vor einigen Tagen hatte sich die Nachricht verbreitet, dass sämtliche Kriegshäuptlinge der Mirak aus den Dörfern am Himmelspfad in den Hauptort kommen sollten, um die Gesegnete der Roten Götter zu hören. Was immer sie ihr gesagt hatten – es war wichtig genug, um die Kriegshäuptlinge zu Beginn des Winters auf die Adlerhöhe zu rufen.
Rillirin warf der Gesegneten einen raschen Blick zu, verzog unwillkürlich die Lippen und senkte schnell den Kopf. Die Hohepriesterin der Dunklen Dame und von Gosfath, dem Gott des Blutes und spirituellem Führer der Mirak, schien weit entrückt, abwechselnd beleuchtet und verborgen von den flackernden Fackeln, ihre blaue Robe dunkel wie Rauch in der Finsternis, das Gesicht so verschlossen und schön wie der Berg Gil, der schroff und unpassierbar über der Adlerhöhe aufragte.
Der Altar war voller schwarzer Flecken, und im Tempel stank es nach altem Blut. Die meisten Predigten der Gesegneten endeten mit einem Opfer, mit einem Sklaven, der sich auf dem Altarstein wand. Rillirin machte sich so klein wie möglich und starrte auf den Boden zwischen ihren Stiefeln. Sie verspürte keinerlei Verlangen, dieser Sklave zu sein.
»Mit dem nächsten Mond beginnt das neunhundertfünfundneunzigste Jahr unseres Exils«, sagte die Gesegnete mit strenger Stimme, während sie wie eine Bergkatze vor der Versammlung auf und ab ging.
König Liris stand mit seinen Kriegshäuptlingen vorn, aber sie sprach in den hinteren Teil des Tempels, sodass ihre Worte zwischen den Stalaktiten widerhallten, die wie steinerne Speere über ihren Köpfen hingen. In dieser Nacht würden alle sie hören.
»Es ist fast ein Jahrtausend vergangen, seit wir und unsere mächtigen Götter aus der Welt von Gilgoras mit seinen warmen und blühenden Ländern verstoßen wurden, um hier in Eis und Fels unser Dasein zu fristen. Vertrieben aus Rilpor, davongehetzt aus Listre, verbannt aus Krike.« Ihr kalter Blick schweifte über die Krieger und Kriegshäuptlinge zu ihren Füßen, während sie die Länder aufzählte, in denen die Roten Götter einst geherrscht hatten. »Und was habt ihr in all diesen Jahren erreicht?«
Ihre Stimme knallte wie eine Peitsche, und die Männer zuckten zusammen und duckten sich vor dem Zorn, der so plötzlich aufgekommen war wie ein Sturm im späten Frühjahr.
»Nichts«, zischte die Gesegnete. »Belanglose Überfälle, gestohlenes Vieh, gestohlener Weizen. Ein paar tote Wölfe. Jämmerlich.« Ihre Zähne knirschten, als sie das letzte Wort ausstieß. Sie hob die linke Hand und streckte den Zeigefinger aus. Er rief knisternde Furcht bei den Mirak und gleichermaßen bei den Sklaven hervor, während sie ihn zuerst hierhin richtete, dann dorthin. Sie schaute nicht in die Richtung, in die sie zeigte, als würde der Finger nicht zu ihr gehören, als würde er von einem anderen Willen als dem ihren gelenkt, einem göttlichen Willen.
Der Auswahlfinger. Der Todesfinger. Wie viele Male hatte Rillirins Nerven das Vorgefühl gestreift, ob dies jetzt der Zeitpunkt ihres Todes war? Der Finger kam plötzlich zum Stillstand, seine Spitze zeigte direkt auf sie, und Rillirins Gesichtsfeld verengte sich auf diesen Finger. Ihr stockte der Atem. Ihr Magen verkrampfte sich, ihre Augen tränten, und sie zwang sich, an dem Finger vorbei der Gesegneten in die Augen zu schauen, und sah deren berechnenden Blick.
Sie wird es nicht wagen. Liris würde es nicht zulassen. Oder?
Der Finger bewegte sich weiter.
»Ihr seid anderer Meinung?«, fragte die Gesegnete, als Liris es wagte, den Blick zu heben und sie anzusehen. In ihren Augen blitzte Kampfgeist auf, sie schob das Kinn vor, und der König der Mirak hielt ihrem Blick weniger als eine Sekunde lang stand. »Nein, das seid Ihr nicht. Ihr könnt es nicht sein. Jedes Jahr leistet Ihr den Roten Göttern Euren Eid, geheiligt mit Eurem eigenen Blut, und Ihr versprecht ihnen Ruhm und die Rückkehr in die warmen Ebenen, schwört ihnen, dass Ihr ihnen die rechtmäßige Herrschaft über alle Seelen in Gilgoras zurückgeben werdet. Und jedes Jahr versagt Ihr.« Ihr Tonfall wurde zu einem sanften Flüstern. »Und so haben die Götter das Werkzeug ihrer Rückkehr erwählt.«
Liris schwitzte. »Das habt Ihr gesehen?«, brachte er heraus.
»Die Dunkle Dame selbst hat es mir gesagt«, bestätigte die Gesegnete mit einem leicht grausamen Lächeln. »Es gibt Menschen in Rilpor, die ihr von größerem Nutzen sind als jeder einzelne Mann hier.« Sie ließ den Finger über die Menge gleiten, und alle wichen davor zurück. »Es gibt Menschen in Rilpor, die uns hassen und fürchten und die doch mehr für unsere Sache tun als ihr.«
Sie unterstrich die Worte mit dem Finger, und für eine Sekunde zeigte er auf Liris’ Herz. Die Drohung war klar, und Männer rückten von ihm ab, als habe er die Pest. Das heilige Blau ihrer Hemden war dumpf im Licht der Fackeln und färbte sich schwarz vom Angstschweiß im Angesicht der Todesnähe.
Rillirin spürte Furcht und Schrecken so heftig in sich aufwallen, dass ihr übel wurde. Was würde mit ihr geschehen, wenn sie nicht mehr Liris’ dürftigen Schutz genoss? Ich werde herrenlos sein. Sie hasste Liris, verabscheute ihn mit jeder Faser, doch er bewahrte sie vor den Quälereien der anderen Männer. Behielt sie für sich selbst.
Liris straffte die Schultern und richtete sich auf, um seinem Schicksal ins Auge zu sehen, aber dann ruckte der Finger weiter, inmitten wachsenden Lärms. Rillirin atmete erleichtert aus und war im gleichen Moment angewidert von dieser Reaktion.
Die Gesegnete zischte und lenkte alle Blicke wieder auf sich. »Unsere Götter können wie wir die Grenzen von Gilgoras nicht überschreiten, aber sie verrichten ihre heilige Arbeit dennoch innerhalb von dessen Grenzen. Mit der Hilfe meines Hohepriesters Gull, der sich mitten im Herzen von Rilpor verborgen hält, ziehen sie sich jemanden heran, der endlich dafür sorgen wird, dass ihre Wünsche erfüllt werden.« Sie bleckte die Zähne. »Wisset dies jetzt und frohlockt in dem Wissen. Die Pläne der Götter sind mir offenbart worden und werden bald genug auch euch offenbar werden. Beginnt mit den Vorbereitungen und macht eure Sache gut. Ab dem Frühling unternehmen wir keine Überfälle mehr. Ab dem Frühling erobern wir. Und bis Mittsommer werden wir nicht nur über Rilpor gesiegt haben, sondern auch über deren sogenannte Götter des Lichts.« Sie streckte beide Arme dem Tempeldach entgegen. »Der Schleier kann nur durch Blut zerrissen werden: Seen und Flüsse von Blut. Wir werden es alle vergießen, wenn wir unsere Götter nach Gilgoras zurückführen. Unser Blut und heidnisches Blut, vermischt, um den Boden zu ehren, damit er ihrer heiligen Existenz würdig ist. Wir werden siegen, ihr und ich«, rief sie, »und die Roten Götter, die wahren Götter, werden sehr zufrieden sein.«
Rillirin drängte nach vorn und versuchte, Liris ins Gesicht zu sehen, um herauszufinden, ob er so viel wusste, wie die Gesegnete zu wissen schien. Sie werden Krieg gegen Rilpor führen? Man wird sie niedermetzeln. Die Schatten in den Bäumen werden sie erledigen, oder die Westtruppe wird es tun. Sie verzog den Mund zu etwas, das ein Lächeln hätte sein können, wenn sie sich daran erinnert hätte, wie sich ein Lächeln anfühlte.
Inmitten des Jubels und der begeisterten Rufe zu den Göttern ließ die Gesegnete die Arme sinken, bevor sie den linken wieder erhob, gelenkt von diesem tänzelnden, allzeit in Bewegung befindlichen Finger.
»Du.« Es war ein einziges Wort, gewispert inmitten des Tumults, aber das Schweigen fiel schneller herab als ein Stein. Alle schauten in die Richtung, in die sie zeigte, nicht zu den Sklaven, sondern zu den Kriegern und Frauen der Mirak, geboren und aufgewachsen in der blutigen Umarmung der Götter. »Die Dunkle Dame verlangt das Blut von Mirak im Gegenzug für Miraks Versagen. Sie verlangt ein Versprechen, dass wir zusammen mit unserem neuen Verbündeten zu dem Ruhm der Götter stehen, dass wir für ihre Rückkehr bluten und sterben werden. Ein Versprechen, das wir – das ihr – nicht abermals brechen werdet. Die Götter haben dich erwählt. Komm her und begegne ihnen.«
Liris’ Königin erhob sich und zog die Lippen zurück. Sie schlängelte sich mit kleinen, stolpernden Schritten durch die Menge, und in dem orangefarbenen Licht hallte ihr Atem rau wider. Maßlos erleichtert beobachtete Rillirin sie. Du armes Miststück, dachte sie, bevor sie versuchte, das Mitleid mit Hass auszubrennen. Rillirin rieb sich ihre schmerzenden Augen und schluckte die Übelkeit herunter. Bana war eine Mirak, und sie verdiente es zu sterben. Sie alle verdienten es. Jeder Einzelne von ihnen, angefangen mit Liris und der Gesegneten. Es freute sie, dass Bana geopfert wurde.
»Euer Wille, Gesegnete«, sagte Liris, als die Mutter seiner Kinder den Altar erreichte und zu ihm hinüberschaute, vielleicht in der Hoffnung auf ein freundliches Wort oder die Forderung nach ihrer Freilassung. Ihr Gesicht verfiel, als sie keins von beidem bekam.
Die Gesegnete lächelte, riss der Frau das Kleid vorn herunter und drückte sie rücklings auf den Altarstein. Der weiche, faltige Bauch der Königin wogte, während sie hechelte.
»Meine Füße sind auf dem Pfad«, kreischte Bana, und das Messer der Gesegneten blitzte golden auf, als sie es ihr in den Bauch rammte.
Mögen die Götter deine Seele in ihre Obhut nehmen, dachte Rillirin unwillkürlich und ballte die Fäuste, als die Schreie erklangen. Doch sie wusste nicht länger, zu welchen Göttern sie betete, zu jenen des Blutes oder jenen des Lichts. Keiner von ihnen tat irgendetwas, um ihr zu helfen. Sie wandte den Blick ab, als die Gesegnete Bana mit dem Messer quer den Bauch aufschnitt, während sie sie mit der anderen Hand auf der Brust festhielt. Die Luft war erfüllt von Banas Schreien, und die Mirak fielen anbetend auf die Knie.
Die Sklaven knieten sich ebenfalls hin, und einer von ihnen zog Rillirin auf den Stein hinab. »Bist du verrückt?«, zischte er. »Knie nieder oder stirb.« Rillirin kniete nieder.
Liris’ Gesicht blieb steinern und verschlossen, bis Bana die letzten Augenblicke ihres Lebens herausgeschrien hatte. Sobald es vorüber war und die Gesegnete das Dankgebet vollendet hatte, stand er auf. Doch noch immer floss Blut, und seine Kriegshäuptlinge knieten noch immer im Gebet da, als er sich durch seine Soldaten drängte. Bevor Rillirin entkommen konnte, streckte er eine verschwitzte Pranke aus und packte sie an den Haaren.
Nein nein nein nein nein nein.
»Komm, Füchsin«, knurrte er ihr ins Ohr und zerrte sie zum Ausgang. Die Sklaven wichen vor ihnen zurück wie Schnee im Frühling. Die Augen leer oder berechnend – Rillirins vermeintliche Macht war etwas, das viele von ihnen begehrten –, und im Tempel hallte Liris’ keuchender, zorniger Atem wider, das Tropfen von Blut, Rillirins gedämpftes Wimmern.
Rillirin stolperte die glitschigen, steinernen Stufen des Tempels hinauf, prallte in Liris’ Schlepptau gegen die Wände, und als sie oben ankamen, schüttelte Liris sie, bis sie kreischte. Er schlug ihr ins Gesicht und zerrte sie durch das Langhaus bis ins Gemach des Königs, warf sie aufs Bett und verriegelte die Tür.
»Herr, das dürft Ihr nicht«, flehte Rillirin auf den Knien, eine Hand auf ihren brennenden Schädel gepresst. »Die Gesegnete hat gesagt, dass Ihr mich nicht anrühren sollt, noch drei Tage lang nicht. Ich bin immer noch krank.«
Liris warf sein Bärenfell auf den Boden und lachte durchdringend. »Du hast einen Polei-Minztee getrunken, um meinen Samen aus deinem Bauch zu spülen, weil du kein Kind von mir verdienst. Du bist eine Sklavin, keine Gemahlin, und du wirst tun, was man dir sagt.«
»Verehrter, bitte«, flehte Rillirin, als er näher kam. Sie kroch auf Händen und Knien weg, aber sie war so schwach, dass sie nur langsam vorankam. Er kann nicht. Bana ist noch warm, er kann doch nicht wollen … Liris zog sie auf die Füße und riss ihr den Rock hoch, seine groben Finger hart auf ihrem Oberschenkel. Der Gestank seines Atems ließ sie würgen. Es war klar, dass er sehr wohl wollte.
Rillirin wand sich und schlug um sich, aber er war zu groß, zu stark. War es immer gewesen. »Nein!«, schrie sie ihm ins Gesicht. »Nein!«
Liris wich überrascht zurück, die Schweinsäuglein schmal, und er schnappte entrüstet nach Luft. Rillirin verkrampfte die Kiefer und kniff die Augen zusammen. Dumm. Dumm!
Sie war davon überzeugt, dass der Faustschlag ihr den Kiefer gebrochen hatte, und der Aufprall auf dem steinernen Boden verursachte glühenden Schmerz in ihrer Schulter. Schwarze Sterne tanzten vor ihren Augen, und ihr Mund war voller Blut.
Liris zog sie hoch und schmetterte sie gegen die Wand, eine Hand um ihr Kinn gelegt, und bohrte ihren Hinterkopf in das Holz. »Miststück«, flüsterte er. »Normalerweise genieße ich unsere kleinen Spielchen, aber heute Nacht bin ich nicht in der Stimmung für deine Boshaftigkeit. Du gibst mir keine Widerworte, hörst du? Du. Gibst. Mir. Keine. Widerworte.« Er betonte jedes Wort, indem er ihren Schädel gegen die Wand krachen ließ. »Du lebst, weil ich es so will, und du wirst sterben, wenn ich es beschließe. Vielleicht heute Nacht, wenn du mir kein Vergnügen bereitest. Oder auf dem Altar, um unseren Erfolg im kommenden Krieg sicherzustellen. Oder nachdem ich dich den Kriegshäuptlingen ausgeliefert habe, damit sie ihren Spaß mit dir haben. Wenn ich es beschließe, verstanden? Du gehörst mir. Jetzt halt deine verdammte Zunge hinter deinen Zähnen und spreiz diese Oberschenkel. Ich habe ein Bedürfnis.«
Die Tränen kamen, und Rillirin hielt sie mit aller Macht zurück. Stattdessen funkelte sie ihn mit einem seelenverzehrenden Hass an. Ein wilder, selbstmörderischer Mut durchflutete sie. »Scheiß auf dich«, keuchte sie.
Liris’ Mund sprang auf, dann lehnte er sich zurück und lachte in einem gewaltigen Ausbruch von Heiterkeit. »Ich werde dich zerbrechen, Füchsin«, versprach er und riss erneut mit seiner freien Hand an ihren Röcken.
Rillirin schloss die Finger um den Griff des Messers, der sich in ihre Seite bohrte, zog es Liri aus dem Gürtel, während er ihre Beine auseinanderzwang, und rammte es ihm seitlich in den Hals. Er sah sie ungläubig an, seine Hände fielen schlaff herunter, und Rillirin drückte das Messer weiter mit aller Kraft in sein Fleisch.
Blut spritzte über ihre Hand, den Arm, das Gesicht, den Hals und die Brust, große, warme, plätschernde Wellen überfluteten sie, bis Liris’ Knie unter ihm nachgaben und er zu Boden ging. Sie ging mit ihm, stach wieder und wieder mit dem Messer zu, weit über das Erforderliche hinaus, weit über seinen letzten röchelnden Atemzug hinaus, bis sein Gesicht, sein Hals und sein Torso eine Masse aus Blut und zerfetztem Fleisch waren.
Rot von Blut, rot wie Rache, spuckte Rillirin auf seinen Leichnam und wartete auf die Dunkelheit.
CORVUS
Elfter Monat, Jahr 994 seit der Verbannung der Roten GötterLanghaus, Adlerhöhe, Gilgorasgebirge
Corvus, Kriegshäuptling des Krähenfelsens, ging unter dem Podium auf und ab. Lanta, die Gesegnete und Stimme der Götter, saß in königlicher Pracht neben dem verwaisten Thron. Die anderen Kriegshäuptlinge rutschten auf ihren Hockern und Bänken herum.
Die Gesegnete wollte nicht mehr vom Plan der Götter enthüllen, bis der König zugegen war, und der König war kein Mann unnötiger Eile. Die Sonne stand trotz der späten Jahreszeit noch hoch, und Corvus hätte gewettet, dass Lanta genauso ungeduldig war wie er. Ein Einmarsch in großem Stil und nur ein Monat Zeit für die Vorbereitung; ein Verbündeter innerhalb Rilpors, den sie zu ihrem Vorteil nutzen konnten. Bei der Vorstellung wurde ihm warm. Einmarsch. Eroberung. Eine Gelegenheit, Ruhm zu erlangen, wie es noch nie eine gegeben hatte, eine Gelegenheit für Corvus, seinen Namen und den des Krähenfelsens für jeden Mirak und Rilpori unvergesslich zu machen. Und dennoch suhlte sich Liris in seinem stinkenden Lager wie ein Tier.
Am anderen Ende des Langhauses drängten sich die Krieger und beklagten sich bitter über den heftigen Wind, der hereingeweht war. Sklaven duckten sich und versahen huschend ihre Pflichten, und Corvus verzog angewidert die Lippen, als ein alter Mann stolperte und sein Tablett mit Schüsseln auf dem Boden landete. Sofort waren Hunde zur Stelle und kämpften um die Beute, wühlten sich durch die ausgefransten Felle, die aufgetürmt worden waren, um die Kälte fernzuhalten.
Corvus ging weiter auf und ab, die Fäuste hinterm Rücken geballt, mit bemüht geduldigem Gesichtsausdruck. Er schaute zu Lanta hinüber, die unnahbar dasaß wie die Berge selbst, und er kämpfte gegen den Drang, die Information aus ihr herauszuschütteln, aus ihr herauszuprügeln. Die Gesegnete ist nicht wie andere Frauen, rief er sich ins Gedächtnis. Sie wird mir die Eingeweide mit einem Stock herausreißen, wenn ich sie anrühre. Trotz seiner eigenen Warnung betrachtete er sie mit einer Mischung aus Ärger und Hunger. Sie ließ sich nicht dazu herab, seinem Blick zu begegnen.
»Die Götter warten auf niemanden. Auch nicht auf einen König.« Lantas Stimme war Honig und Gift, und Corvus bemerkte, dass die anderen Kriegshäuptlinge bei ihrem Klang erstarrten. »Es gibt viel zu besprechen.«
Edwin, Liris’ Stellvertreter, sprang auf. »Ich werde gehen, Gesegnete«, sagte er und huschte das Langhaus hinunter zum Gemach des Königs, seine Erleichterung mit Händen zu greifen. Sie alle wollten dies hinter sich bringen und sich aus dem Blickfeld der Gesegneten entfernen. Banas Tod hing in der Luft wie der Geruch von Blut.
Corvus war noch zweimal vor dem Podium auf und ab marschiert, als das Gebrüll einsetzte. Bevor die anderen sich hochgerappelt hatten, war er mit gezücktem Schwert an Lantas Seite, bereit, sie zu verteidigen.
»Der König!«, schrie Edwin, als er zurück ins Langhaus stürmte. Seine Hände waren blutig. »Der König ist ermordet worden! Liris ist tot!«
Für einen Moment bekam Lantas Gelassenheit Risse, und Corvus hätte es übersehen, wenn er nicht zu ihr hinübergeschaut hätte statt zu Edwin, der gackerte wie ein Huhn auf dem Hackblock. Aber dann war die Maske wieder an ihrem Platz. Corvus ließ seine Schwertspitze auf das Podium sinken, während Edwins Worte zu ihm durchdrangen. Corvus öffnete den Mund, schloss ihn wieder und betrachtete die Männer, die sich wie eine Schar verängstigter Kinder vor ihm versammelt hatten, den Rücken dem Podium zugewandt, den Blick auf die gegenüberliegende Tür gerichtet. Ihre Fragen an Edwin überschlugen sich, aber keiner schien erpicht darauf zu sein, sich ihm zu nähern.
Lanta raffte ihre Röcke und stolzierte durch das Langhaus, stürmte durch die Tür zum königlichen Gemach und schlug sie hinter sich zu, bevor irgendjemand einen Blick hineinwerfen konnte. Edwin stand davor und starrte ungläubig auf seine Hände hinab.
Liris ist tot, und die Gesegnete ist bei dem Leichnam. Die Adlerhöhe hat keinen König mehr. Die Adlerhöhe ist verwundbar.
»Gosfath, Gott des Blutes, Dunkle Dame des Todes, ich danke Euch«, flüsterte Corvus. »Ich schwöre, mich dieser Gelegenheit, die Ihr mir geboten habt, würdig zu erweisen. Alles, was ich tue, tue ich zu Euren Ehren.« Einer der Häuptlinge drehte sich beim Klang seiner Stimme um, und sein Mund stand vor Staunen weit offen.
»Meine Füße sind auf dem Pfad«, vollendete Corvus das Gebet. Er machte drei Schritte vorwärts, hob sein Schwert und begann zu töten. Der König war tot. Lang lebe der König.
CRYS
Elfter Monat, siebzehntes Jahr der Herrschaft von König RastothNordhafen, Rilporin, Weizenland
Ihr sollt wissen, dass ich der vertrauenswürdigste Mann in ganz Rilporin bin. Nein, nicht nur in der Hauptstadt, in ganz Rilpor. Und diese Karten sind nagelneu, gerade vor einer Stunde in einem Laden im Kaufmannsviertel gekauft. Untersucht sie, meine Herren, haltet sie in den Händen, schaut sie Euch genau an. Nicht markiert, nicht erhöht, gleichmäßig gefärbt, gleich schwer. Also, wollen wir spielen? Eine Flasche, Maid.«
Crys schnippte mit den Fingern und winkte das hübsche Mädchen heran, das er im Augenwinkel sah, dann setzte er ein breites Grinsen auf. Er hatte diese beiden während der letzten Stunde beobachtet, und jetzt waren sie gerade betrunken genug, um Wachs in seinen Händen zu sein.
Die Männer beobachteten argwöhnisch, wie er die Karten abhob und mischte. Die schnellen Bewegungen seiner Finger schienen zu einem Nebel zu verschwimmen, und er teilte die Karten mit einer geschickten Drehung des Handgelenks aus. Der einzige Schönheitsfehler war der Umstand, dass nicht wenige davon durch eine Bierpfütze rutschten oder gleich im vergossenen Bier liegen blieben. Nach dem Spiel würden sie ruiniert sein, aber er konnte einfach neue kaufen. Welchen Sinn hatte es zu spielen, wenn er das Geld, das er gewann, nicht wieder ausgab? Er klatschte den Rest des Kartenstapels mitten auf den Tisch, nahm seine Karten auf, betrachtete sie, schluckte Bier, um seine Schadenfreude zu verbergen, und hauchte seinen Dank an den Fuchsgott, den Gauner, den Schutzheiligen der Glücksspieler, Diebe und Soldaten. Er war all dies, ab und zu.
Die Gesichter seiner Mitspieler waren so hölzern, dass Crys seinen Namen in sie hätte einritzen können, aber der Mann zu seiner Linken klopfte mit dem Fuß auf den Boden. Der Mann zu seiner Rechten? Keine eindeutige Reaktion. Nein, halt, er drehte den Messingring an seinem Daumen. Ausgezeichnet. Er hatte die Karten richtig ausgegeben.
»Fünf, nein, sechs Buben.« Crys eröffnete das Spiel und klimperte mit den Kupfermünzen neben dem Kartenstapel. Er lächelte und trank.
»Sechs von mir«, sagte Fußklopfer.
Ringdreher tat es ihm gleich. »Und von mir.«
Crys machte viel Aufhebens darum, wieder in seine Karten zu schauen, dann betrachtete er blinzelnd den Tisch und seine Gegner. »Noch zwei.« Er vergrößerte das Häufchen mit zur Schau gestellter Tapferkeit. Dann beugte er sich auf seinem Stuhl vor und kratzte sich mit den Fingernägeln die Bartstoppeln an seiner Wange. Er sollte sich besser rasieren vor dem Treffen morgen. Er sollte besser genug Geld gewinnen, um sich eine Rasierklinge zu kaufen.
»Also, seid Ihr frisch aus einer Garnison hier, Hauptmann? Aus dem Westen vielleicht?«, fragte Fußklopfer.
Crys verbarg eine Grimasse hinter seinem Becher: immer der Westen. Städter waren besessen vom Westen, von Geschichten über Mirak und Wächter und Grenzscharmützel. Die verrückten Wölfe – nichts weiter als Zivilisten – waren Wächter, die zu den Waffen griffen, um die Vorhügel vor Plünderern zu bewahren und die Gläubigen der Götter des Lichts vor der Zerstörung der verdammten Roten Götter zu beschützen.
Crys vermutete, dass die Hälfte der Geschichten nicht der Wahrheit entsprach und die andere Hälfte immer weiter ausgeschmückt worden war, bis die Wächter und die Wölfe mehr Mythos als Mensch waren und jeder Soldat der Westtruppe als Held galt. Sie sind Soldaten, die zwei Jahre lang eine Linie auf einer Landkarte bewachen, unterbrochen von kurzen Scharmützeln gegen ein paar Hundert Männer. Ja. Helden.
Crys schnaubte. »Tatsächlich komme ich aus dem Norden«, antwortete er und schluckte seine Frustration herunter. »Habe meinen Turnus dort beendet. Als Nächstes kommt die Palastgarnison.«
»Palast, hm? Dann stehen Euch also zwei behagliche Jahre bevor? Muss eine Erleichterung sein. Ich bin Poe, und das ist Jud.«
Crys nickte beiden Männern zu. »Hauptmann Crys Tailorson.«
»Hauptmann der Palastgarnison? Ich bin mir sicher, dass niemand es mehr verdient. Ich kann mir vorstellen, dass König Rastoth in den sichersten Händen ist, jetzt, da Ihr hier seid, Hauptmann.« Poe beobachtete ihn genau und hielt Ausschau nach verräterischen Zeichen. Crys befingerte demonstrativ mehrfach eine Karte. Verdient? Es war wohl eher so, dass er sich zwei Jahre lang zu Tode gelangweilt hatte. Allerdings gab es hier wahrscheinlich viel mehr Idioten, die bereit waren, ihr Geld zu verlieren, als in der Nordtruppe und deren Umgebung. Gegen Ende des Turnus hatten es nur noch wenige Männer gewagt, mit ihm zu spielen. Ganz zu schweigen davon, dass Rilporin hübschere Mädchen hervorbrachte.
Jud lachte bellend. »Habt Ihr von diesen Wächtern gehört? Seid Ihr jemals einem begegnet? Ich höre, die Männer stechen einander. Habt Ihr das jemals gesehen?«
»Ich habe noch nicht in der Westgarnison gedient«, erwiderte Crys unbehaglich. Das war alles, worüber die Menschen in letzter Zeit redeten, die Gerüchte, die aus dem Westen kamen; dass General Make Koridam, Sohn von Durdil Koridam, dem Fürstgeneral und Oberkommandierenden aller Truppen Rilpors, verstärkt patrouillieren ließ und sowohl Waffen als auch Proviant hortete. »Und derartige Dinge verstoßen gegen die Gesetze des Königs«, fügte er hinzu.
»Seltsame Leute, diese Wächter. Sie sind Zivilisten, nicht wahr? Nehmen es auf sich, an der Grenze zu patrouillieren. Warum? Sie werden dafür nicht bezahlt, oder? Warum dein Leben riskieren, wenn die Westgarnison da ist, um dich zu beschützen?«, fragte Poe. Er schien es nicht eilig zu haben weiterzuspielen. »Ich meine, die Garnison im Westen ist die beste, so heißt es jedenfalls«, ergänzte er mit einem unerwarteten Anflug von Bosheit.
»Ich weiß, warum.« Jud lachte abermals. »Es liegt daran, dass ihre Frauen alle so verdammt hässlich sind. Deshalb kämpfen sie, und deshalb stechen sie sich auch. Es gibt dort nichts anderes zu tun.«
»Wölfe kämpfen, Wächter kämpfen nicht«, erklärte Crys. Jud runzelte die Stirn. »Sie stammen alle aus Wachstadt, es ist nur so, dass sie ihre Kriegerkaste Wölfe nennen und dass die Wölfe wenig oder gar keine Rücksicht auf die Gesetze Rilpors nehmen. Wie Ihr gesagt habt, sie nehmen es auf sich zu kämpfen. Und es gibt auch Wolfsfrauen, wie ich höre«, fügte Crys hinzu, während er mit seinen Karten ein kleines Kunststückchen vollführte und so kurz die Maske des glücklich Betrunkenen fallen ließ. Die im Westen ist die Beste? Vielleicht brauchst du nicht all diese Münzen, die dich niederdrücken, Poe. »Wild und genauso gut wie die Männer«, fügte er hinzu.
»Bärinnen. Und ungefähr genauso hübsch, heißt es.« Jud leerte seinen Becher und bediente sich aufs Neue, während Crys ihn beäugte. »Sie stehen alle am Rande des Wahnsinns, diese Wächter. Kämpfen ohne Lohn und lassen ihre Frauen kämpfen. Frauen! Könnt Ihr Euch das vorstellen? Was würdet Ihr tun, wenn Ihr gegen eine Frau kämpfen müsstet, Hauptmann?«
Crys fuhr sich mit der Zunge über die Zähne. »Versuchen, nicht zu verlieren«, antwortete er. »Denn das würde sich schlecht auf die nächste Beförderung auswirken.«
Poe lachte und schlug auf den Tisch, aber Jud hatte seinen Sinn für Humor urplötzlich verloren. »Sieh dir seine Augen an«, zischte er, deutete mit dem Finger auf Crys und berührte Poe am Arm.
Scheiße, und es war alles so gut gelaufen. Crys legte die Handflächen auf den klebrigen Tisch und beugte sich vor, dann riss er die Augen auf und starrte beide Männer nacheinander an. »Eins blau, eins braun, ja. Sehr scharfsichtig.«
Er lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust, die durchweichten Karten sorgfältig in der Achselhöhle verborgen, wo man sie nicht sehen konnte. Alte Gewohnheit. »Aber ich dachte, Ihr wärt wohlhabende, kultivierte Kaufleute aus dieser Stadt und als solche nicht anfällig für den Aberglauben ländlicher Narren. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht habe ich heute Abend hier meine Zeit verschwendet.«
Jud und Poe sahen einander sichtlich unbehaglich an. Sie waren nichts dergleichen, und sie alle wussten es.
Poe klopfte mit dem Fuß auf den Boden und brachte ein lässiges Grinsen zustande. »Nichts für ungut. Es sieht eben interessant aus. Ihr müsst es bei der Truppe oft zu hören bekommen, nicht wahr?« Er leerte seinen Becher und bestellte eine neue Flasche. Wurde auch langsam Zeit.
Crys schlug einen ruhigen Ton an, der so gar nicht zu dem Ärger passte, den eine Bemerkung über seine Augen stets bei ihm hervorrief. Gespaltene Seele, verflucht, vom Unglück verfolgt. Er kannte sie alle. »Ja, das stimmt, Herr. Männer kleben entweder wie Kletten an mir und denken, ich sei ein Glückspilz, oder sie weigern sich, mir zu nahe zu kommen. Es ist wirklich nervtötend und hat mich mein Leben lang verfolgt.« Poe schnalzte mitfühlend mit der Zunge. »Aber was kann ein Mann schon tun?«
»Sich eins davon ausstechen?«, gackerte Jud, lachte in seinen Becher und bespritzte Crys mit Schaum. Crys verkrampfte sich und beobachtete ihn genau.
Poe schlug ihm auf den Arm. »Verzeiht meinem Freund, Hauptmann. Zu viel Bier. Er hat ein Schwert, du verdammter Idiot«, zischte er Jud zu, der seinen Arm umklammerte und jaulte.
Crys zögerte noch einen Augenblick und sagte dann: »In Ordnung, lasst uns spielen.«
Poe sackte vor Erleichterung in sich zusammen und boxte Jud als Dreingabe noch einmal. »Du hast den guten Hauptmann gehört. Spiel.«
»Zwei«, sagte Jud schmollend.
Ausgezeichnet. Und es wurde verdammt noch mal auch Zeit. »Ich will sehen«, verlangte Crys und legte seine Karten auf den Tisch, während er die anderen dabei beobachtete. Er hatte dutzendfach verloren, wie erwartet. Poe war der Gewinner und schob Münzen und Bier auf seine Seite des Tisches, wobei er gelbe, abgebrochene und vorstehende Zähne zeigte und den Mund zu etwas verzog, das ein Lächeln hätte sein können. Bei einem Bären.
Crys stöhnte und trank und füllte mit fatalistisch guter Laune die Becher seiner Gefährten auf. Poe sammelte die Karten ein, und Crys beobachtete, wie er mischte: Er versuchte nicht einmal, die bereits gespielten Karten im Stapel zu verteilen. Er gab aus, und Crys wusste, dass er ein schlechtes Blatt haben würde. Egal, er war noch nicht bereit zu gewinnen.
Götter, diese Mahlzeit war schwer, dachte er, als er sein erstes Spiel eröffnete, aber das Essen erfüllte seinen Zweck und saugte das Bier auf. Jud war rot im Gesicht und kicherte, sein Aberglaube vergessen bei der Aussicht darauf, Crys’ Geld zu gewinnen. Er war der Erste, der nachlässig wurde, und Crys und Poe hätten ihn binnen weniger Runden ausnehmen können. Doch dann würden sie einen neuen Dritten brauchen. Nein, es war besser, ein Weilchen länger zu bieten und dann beiden etwas abzuknöpfen – aber nicht alles. Crys konnte an seinem ersten Tag in Rilporin keinen Feind gebrauchen, und manche Männer zogen es vor, wenn es um Karten ging, die Schuld dem Gegenspieler zuzuweisen statt ihrem Pech.
Nachdem sein Plan stand, trank Crys noch etwas Bier und schickte sich an, drei weitere Runden zu verlieren.
Irgendwann hatte Crys eine Glückssträhne. Seltsam, wie sein Glück sich so plötzlich gewendet hatte. Er hatte das meiste von dem zurückgewonnen, was er verloren hatte, lag aber immer noch ein ganzes Stück hinter den anderen. Trotzdem, es lief alles glatt …
»Ich habe Euch beobachtet. Ihr betrügt.«
Crys erhob sich schwankend von seinem Stuhl und tastete nach seinem Schwert, während Poe und Jud die Augen aufrissen und in trunkener Entrüstung die Mienen verzogen. Das Licht fiel auf den Sprecher, und Crys schnappte nach Luft, ließ den Griff seines Schwertes los und sank auf ein Knie. »Majestät. Vergebt mir, Euer Hoheit. Ihr habt mich erschreckt, und ich – ich habe einfach reagiert. Ich bitte um Verzeihung.«
Poe und Jud schnappten sich ihre Münzen und flohen, ohne zurückzublicken. Sie überließen Crys der Gnade der Krone und schienen froh darüber zu sein.
»Haltet den Mund, steht auf und schenkt mir ein Glas ein.«
»Ja, Euer Hoheit.«
»Herr oder Fürst wird genügen, Soldat.« Crys richtete sich auf, und Prinz Rivil nahm den dargebotenen Becher, nippte daran, verzog das Gesicht und nippte abermals. »Grässlich. Ich stelle fest, dass du meinen Vorwurf nicht bestritten hast.«
Crys’ Knie knickten abermals ein, aber er hievte sich wieder hoch. »Euer Ho … Mein Fürst können sagen und denken, was Ihm beliebt, Herr«, stieß er hastig hervor und vermied es, Rivil ins Gesicht zu sehen. Stattdessen starrte er ihm auf den Schritt. Er errötete, als es ihm auffiel, straffte sich und nahm militärische Haltung an. Dann sah er über die linke Schulter des Prinzen hinweg den Mann hinter ihm, einäugig, gut gekleidet, ein Adliger, wenn Crys das auch nur ansatzweise beurteilen konnte.
»Ach, Scheiße, Mann, lass das bleiben. Denkst du, ich wäre in einer Hafenkneipe, wenn ich Pomp und Zeremoniell wollte? Setz dich verdammt noch mal hin und trink etwas. Ich bin hier, um mich zu entspannen, nicht um mir den Hintern küssen zu lassen.«
»Ich – ja, Euer … Herr.«
Rivil zwängte seine langen Beine unter den niedrigen Tisch und beugte sich vor, ohne auf das Bier zu achten, das die Ärmel seines Samtmantels befleckte. »Das da ist Galtas Morellis, Herr des Stummen Wassers«, stellte er den Mann vor, der jetzt neben ihm Platz nahm.
Crys schwirrte der Kopf. Galtas, Rivils Trinkkumpan und persönlicher Leibwächter. Crys steckte bis zum Hals in der Scheiße, und sie roch nicht besonders süß.
»Bring mir bei, wie du beim Kartenspiel betrügst«, verlangte Rivil abrupt. »Deinen Trick kenne ich noch nicht.«
Oh, Mist. Ein Bett und eine Rasierklinge, das war alles, was er gewollt hatte. Na schön, vielleicht noch eine Frau, aber war das so viel verlangt, wenn man die letzten beiden Jahre in der Nordgarnison verbracht und Grenzverträge ausgehandelt hatte?
Crys nahm einen Schluck Bier, befeuchtete seine Kehle, um Zeit zum Nachdenken zu gewinnen. Nicht dass er einen Ausweg gesehen hätte. »Es wäre mir eine Ehre, Herr. Wollt Ihr meine Karten benutzen?«
Crys’ Münzstapel schwand schnell dahin. Wenn das so weiterging, würde er in der Gosse schlafen und sich am nächsten Morgen mit seinem Schwert rasieren. Oder sich einfach damit die Kehle aufschlitzen; der Fürstgeneral ließ nichts als Ausrede gelten, nicht einmal ein Treffen mit einem Prinzen.
»He, Geldsack. Ihr betrügt, zum Henker. Ich habe Euch beobachtet, Ihr schlaksiger Bastard. Ihr bringt unseren wackeren Soldaten um seinen hart verdienten Sold. Er riskiert an den wilden Grenzen sein Leben und kommt hierher, um ein wenig Ruhe und Frieden zu finden, und Ihr nehmt ihm sein Geld, als hättet Ihr nicht bereits genug davon? Scheiß Adel.«
Crys war plötzlich vollkommen nüchtern. Galtas hatte sich auf seinem Stuhl umgedreht und sich dann erhoben. Rivil blieb sitzen, den Rücken dem Sprecher zugewandt, seinen kühlen Blick auf Crys gerichtet. Die Botschaft war klar: Heb deinen Hintern und hilf, Crys Tailorson. Crys hob den Hintern.
»Herr, ich versichere Euch, dass hier nichts Unziemliches vor sich geht. Ich habe lediglich Pech mit den Karten. Es kommt vor – eine Lektion des Fuchsgottes. Eure Sorge ist rührend …«
»Keine Bange, Soldat, wir regeln das für dich. Diese verdammten Adligen kommen hierher und bescheißen uns anständige, hart arbeitende Männer. Ehrlich, du tust uns allen einen Gefallen, wenn du ihn uns überlässt.«
»Wirklich, ich habe nicht …«, unterbrach Crys das lastende Schweigen von Dutzenden Männern, die sich auf eine Schlägerei vorbereiteten.
Der Mann holte bereits aus, um einen Faustschlag auf Rivils ungeschützten Kopf zu landen, und Crys konnte nichts anderes tun, als den Mund zu halten und einen verzweifelten Satz über den Tisch zu machen. Aber da hatte Galtas den Angreifer schon am Handgelenk abgefangen, ihm die Hand verdreht und ihn zurück in die Menge gestoßen. Er zückte sein Schwert, nutzlos in dem Gedränge, aber ein wirksames Abschreckungsmittel für unbewaffnete Männer.
»Die Stadtwache rückt an, Scarper«, erklang eine Stimme, bevor jemand die Chance hatte zu reagieren. Rivil warf Crys einen prüfenden Blick zu. Die Angreifer verschwanden in der Menge, und der Rest der Gäste nahm wieder Platz. Bald darauf war geschäftiges Gemurmel zu hören. Viele Männer schlüpften hinaus, nicht erpicht darauf, der Wache zu begegnen. Crys setzte sich wieder hin und leerte seinen Becher.
Galtas blieb stehen und schaute sich lange im Raum um, dann setzte auch er sich. Rivil drehte ruckartig den Kopf in Crys’ Richtung. »Du warst das? Diese Worte? Wie?«
»Eine Gabe«, antwortete Crys. »Ich kann meine Stimme so klingen lassen, als käme sie von anderswo.«
»Hört sich wie Hexerei an. Und bei solchen Augen überrascht mich das nicht«, frotzelte Rivil. Galtas runzelte die Stirn, und in seiner Hand erschien ein Dolch.
»Nein. Nur eine Gabe, wie ich gesagt habe.« Crys legte beide Handflächen auf den Tisch, um so harmlos zu wirken wie möglich. Rivil kratzte all seine Gewinne und auch die von Galtas zusammen und schob sie auf Crys’ Seite des Tisches.
»Meinen Dank«, sagte Rivil. »Aber wozu die Mühe? Ich bin nicht gerade beliebt bei der Truppe. Warum hast du nicht zugelassen, dass dieser Mann mich windelweich prügelt?«
»Ihr seid mein Prinz, Herr«, antwortete Crys und ließ die Münzen in seinen Beutel fallen. »Selbst wenn Ihr ein besserer Betrüger seid als ich. Niemand schlägt den Prinzen windelweich, solange ich bei ihm bin.«
»Es freut mich, das zu hören. Komm morgen zu mir, wenn du dienstfrei hast. Ich habe vielleicht Verwendung für dich.«
DURDIL
Elfter Monat, siebzehntes Jahr der Herrschaft von König RastothPalast, Rilporin, Weizenland
Wo sind Seine Majestät?«, fragte Durdil. Der Thronsaal war verlassen bis auf einige Wachen, und der Audienzsaal war ebenfalls leer.
»Im Flügel der Königin, Fürstgeneral«, antwortete Questrel Chamberlain mit einem schmierigen Lächeln, und Durdil zog die Mundwinkel herunter. Das dritte Mal in diesem Monat.
Durdils Atem dampfte, als er aus dem Thronsaal in einen Innenhof trat, um eine Abkürzung durch die Dienstbotengänge zu nehmen. Der Winter brach in diesem Jahr früh herein, und die Vorbereitungen für das Julfest schritten rasch voran.
Diener pressten sich flach gegen die rauen Steinmauern, wenn er vorbeiging, und zogen respektvoll den Kopf ein. Er nickte ihnen allen zu. Durdil kannte jeden Dienstboten im Palast; das machte es viel leichter, Außenseiter zu identifizieren, mögliche Bedrohungen für seinen König.
Ein Wachposten stand schweigend vor dem Gemach der Königin.
Durdil blieb stehen, zog sich die Uniform zurecht und fuhr sich über das eisengraue, kurz geschorene Haar.
»Leutnant Weaverson, ist der König dort drin?«
»Ja, Herr.«
»Hat er mit Euch gesprochen?«
Weaverson war so teilnahmslos, wie nur ein Wachposten es sein konnte. »Nicht mit mir, Herr. Er hat sich mit der Königin unterhalten.«
Durdil zögerte und kaute auf der Innenseite seiner Wange. Hübsch ausgedrückt, ohne eine Spur von Spott. »Danke, Leutnant. Weitermachen.«
»Herr«, erwiderte Weaverson und klopfte mit seiner Pike auf den Teppich.
Durdil ging an ihm vorbei und drückte die Tür zu den Privatgemächern der Königin auf. Auf der Schwelle zögerte er, wappnete sich, trat dann ein und zog die Tür hinter sich zu. Rastoth stand im Schlafzimmer der Königin und schaute verwirrt auf das leere Bett.
»Euer Majestät, Ihr solltet nicht hier sein«, sagte Durdil leise, und Rastoth blickte über seine Schulter, seine Augen groß und wässrig. Durdil fiel auf, wie hager er war. Wo waren seine Muskeln und sein Fett geblieben, seine gute Laune? Dieser Mann war nur noch ein Schatten seiner selbst.
»Wo ist Marisa, Durdil? Wo ist meine Königin?«, fragte Rastoth klagend. »Ich habe eben erst mit ihr gesprochen. Sie war genau hier.« Er machte eine vage Geste, und zwischen seinen Brauen bildeten sich Falten. »Aber das stimmt nicht, oder?«, flüsterte er. Er strich wieder und wieder über die Bettdecke, der Stoff dünn und kalt in dem eisigen Raum. Kein Feuer brannte, keine Gobelins hingen mehr an den Wänden. Nicht einmal mehr Teppiche lagen auf dem Boden.
Durdil trat auf ihn zu. »Nein, Majestät, es stimmt nicht«, bestätigte er mit leiser Stimme. »Marisa ist fort, mein alter Freund. Eure Königin ist tot. Seit fast einem Jahr.«
Ein Laut wie der Schrei einer Möwe drang aus den Tiefen von Rastoths Brust. Er brach auf dem Bett zusammen und verbarg das Gesicht in den Händen, die zu schwach waren, um die Ringe an jedem Finger zu tragen. »Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.« Er richtete sich plötzlich auf, die Augen leuchtend vor Schmerz und Begreifen. »Ermordet. Entstellt. Besudelt hier, in eben diesem Raum«, stieß er hervor, seine Stimme rau und gebrochen und dann zornig. »Meine Königin. Meine Gemahlin. Und ihre Mörder sind immer noch auf freiem Fuß. Oder, Fürstgeneral? Trotz Eurer Versprechen. Trotz jedes einzelnen Eurer Versprechen?« Er spie die Worte förmlich aus.
Durdil atmete mit bebenden Nasenflügeln ein und kniete vor Rastoth nieder. Seine Knochen protestierten gegen den kalten Stein. Keine Teppiche, weil sie von Blut durchtränkt gewesen waren. Keine Wandbehänge, weil sie von den Wänden gerissen worden waren und die Königin bedeckt hatten, während ihre Mörder durch den Stoff in ihren Körper gehackt hatten. Als hätten nicht einmal die Meuchelmörder es ertragen, sich anzusehen, was sie getan hatten, bevor sie sie getötet hatten, die Zerstörung, die sie ihrem Körper und ihrem Gesicht zugefügt hatten.
Kein zerschmetterter Türriegel, erinnert Ihr Euch? Marisa hat ihren Mördern die Tür geöffnet, hat sie hereingelassen. Ihre Wachen haben tot auf der Schwelle gelegen, sie schauten tot in den Raum hinein, nicht aus ihm heraus. Es ging Durdil wie eine Litanei durch den Kopf. Die Königin kannte ihre Mörder. Ihre Wachen kannten sie, hatten sie nicht daran gehindert einzutreten, sie erst auf dem Weg hinaus versucht aufzuhalten, nachdem die Tat vollbracht war. Durdil schluckte die Gedanken herunter. »Ja, Majestät. Es ist mir nicht gelungen, die Mörder Eurer Königin zu finden. Ich habe Euch enttäuscht.« Er riskierte einen Blick nach oben. »Aber ich habe nicht aufgehört zu suchen, mein Lehnsherr. Ich werde niemals aufhören zu suchen. Ich werde sie finden. Und wir werden sie der gerechten Strafe zuführen.«
Aber Rastoth hörte ihm nicht zu. »Seht, da ist sie. Mein kleiner Spatz, versteckt sich hinter ihrem Webstuhl.« Er rappelte sich mühsam hoch, stolperte über den Saum seines Umhangs und schlug mit dem Knie gegen Durdils Schulter. Dann torkelte er vorbei, und Durdil hievte sich hoch, jedes einzelne seiner sechsundfünfzig Jahre ein Amboss auf seinem Rücken.
Rastoth hatte sich hinter dem Webstuhl am Fenster geduckt. »Wo versteckst du dich jetzt schon wieder, meine Hübsche?«, rief er. »Marisa? Marisa, meine Liebste.«
Durdil zuckte zusammen. »Euer Majestät, wir müssen in Eure Gemächer zurückkehren. Es ist schon spät. Lassen wir der Königin ihre Ruhe. Es war ein langer Tag.«
Rastoth richtete sich auf und sah Durdil durch die Fäden des Webstuhls an; auf dem Rahmen von Marisas halb vollendetem Wandgemälde sammelte sich Staub. Er hatte dies schon früher versucht, und Rastoth hatte einen Wutanfall bekommen. Durdil hatte keine Ahnung, was sich diesmal daraus entwickeln würde.
»Ihr habt natürlich recht, Durdil. Sie ist müde. Ich bin müde.« Er blickte voller Zuneigung auf das Bett. »Schlaf gut, meine Schöne«, sagte er und schlich auf Zehenspitzen zur Tür. Dann zischte er Durdil zu, das Gleiche zu tun, als die Absätze seiner Stiefel über die Steinplatten klackten.
Durdil verzog das Gesicht, stellte sich auf die Zehenspitzen, und gemeinsam stahlen sie sich zur Tür des leeren Raums und zwängten sich hindurch. Weaverson schaute nicht einmal in ihre Richtung, aber Durdil blieb überrascht stehen, als er Prinz Rivil bemerkte.
»Wir müssen sie ruhen lassen, Fürstgeneral«, murmelte Rastoth und zog die Tür zu. »Vielleicht wird meine Gemahlin sich morgen gut genug fühlen, um sich wieder bei Hof sehen zu lassen, was denkt Ihr?«
Rivil trat vor, und Durdil überließ ihm den Platz an der Seite des Königs. »Ich bin mir sicher, dass es Mutter bald wieder gut gehen wird.« Er griff nach Rastoths Arm. »Im Moment bist du derjenige, um den ich mir Sorgen mache. Du solltest so spät in der Nacht nicht in der Kälte herumwandern.«
Durdil schaute zu Weaverson hinüber, dann folgte er seinem König und seinem Prinzen und lauschte Rivils bedächtiger Stimme, beobachtete seine feste Hand auf dem Ellbogen seines Vaters.
»Komm, Vater, du solltest zu Bett gehen«, fügte Rivil mit einem Nicken in Durdils Richtung hinzu.
Durdil erwiderte das Nicken und zwang sich für den Prinzen zu einem Lächeln.
Rastoths Anfälle wurden immer schlimmer, und Durdil konnte nichts dagegen tun. Sein Freund und König verlor den Bezug zur Wirklichkeit, wurde langsam zum Gespött. Durdil bezweifelte, dass Rastoth gesund werden würde, selbst wenn sie Marisas Mörder jetzt finden würden. Nicht dass er auch nur eine einzige Spur gehabt hätte. Er rieb sich die Augen und blickte wieder zu Weaverson. Dann folgte er seinem König.
DOM
Elfter Monat, siebzehntes Jahr der Herrschaft von König RastothDorf der Wächter, Wolfsland, rilporische Grenze
Diesmal hab ich dich, alter Mistkerl«, murmelte Dom. Er stand bis zu den Knien in einem Fluss, der hoch oben im Gilgorasgebirge entsprang und in den Gil mündete, den mächtigsten Strom Rilpors. Seine nackten Füße waren taub, die Luft roch nach Schnee, und er hatte den Hecht in die Enge getrieben. Dom tastete mit den Zehen danach, den Fischspeer stoßbereit.
Der Hecht schlug mit dem Schwanz, und Dom grinste, als er sich näher heranschob. Er hatte hinter sich das Netz ausgelegt – für alle Fälle –, aber eigentlich war nur ein Treffer mit dem Speer akzeptabel. Alles andere käme langsam einem Verlust seiner Ehre als Fischer gleich. Beim nächsten Zucken reagierte Dom blitzartig und stach ins Trübe.
Der Hecht schoss los und wand sich an dem Speer vorbei. Dom wirbelte herum, rutschte auf einem Stein aus und fiel auf ein Knie. Die Kälte ließ ihn aufkeuchen, aber der Hecht war nicht im Netz, daher sprang er wieder auf die Füße und suchte in der kleinen Bucht, die er mit dem Netz abgesperrt hatte.
»Kleines Fischchen, komm heraus«, sang er, »komm heraus und sei mein Schmaus.«
Stattdessen kam die Sonne hervor, spiegelte sich auf dem Wasser und blendete ihn, und Dom blinzelte. Das grelle Licht blieb in seinen Augen wie glühende Kohle, die explodierte und zu einem Flächenbrand wurde.
Dom stöhnte, als das Bild von Feuer sich in seinen Augen ausbreitete. Er ließ den Speer fallen und watete keuchend und spritzend ans Ufer. »Nein«, ächzte er mit schwerer Zunge, »nein, nein, nein«, aber es war zu spät. Er war einen Schritt vom Land entfernt, als die Offenbarung kam, und er warf sich verzweifelt in Richtung des trockenen Bodens, bevor die Bilder ihn ergriffen.
Er prallte mit der Brust in den Schlamm, und seine Umgebung verschwand, bis lediglich die Nachricht von den Göttern des Lichts übrig blieb, die seinen Geist mit Feuer, Schmerz und Wahrheit füllte.
»Als Fischer bist du wirklich eine Katastrophe, Templeson«, sagte Sarilla lachend, als er in der Abenddämmerung ins Lager zurücktaumelte. Sie deutete mit ihrem Bogen auf ihn. »Warum kannst du nicht einfach – ah, verdammt. Lim! Lim, es ist Dom.«
Sarilla schlang sich Doms Arm über die Schultern und stützte ihn. Sie führte ihn zum nächsten Feuer und setzte ihn so dicht davor, dass die Hitze auf seinem Gesicht brannte. Er wandte sich ab, nicht bereit, in die Flammen zu schauen, und Sarilla rieb seine Hände zwischen ihren; dann zog sie ihm sein Wams aus und warf ihm ihren Umhang um die Schultern.
Lim kam angelaufen, aber Dom hob die Hand, bevor Lim etwas sagen konnte. »Lass mich zuerst warm werden«, krächzte er. »Ich habe den ganzen Nachmittag wie tot in diesem verfluchten Fluss gelegen.« Vielleicht ist es nicht das, was ich denke. Fuchsgott, ich hoffe, es ist nicht das, was ich denke.
Sie zogen ihn aus, wickelten ihn in Decken und flößten ihm warmen Met ein, bis die Farbe in sein Gesicht zurückkehrte und er endlich aufhörte zu zittern. Feltith, ihre Heilerin, erklärte, er sei gesund und ein Idiot. Dom hatte weder die Energie noch den Wunsch zu widersprechen. Er konnte nicht ins Feuer schauen, aber er sah den anderen der Reihe nach in die Augen.
»Ich muss zum Lager der Kundschafter gehen, und zwar allein.« Er wartete ihre Proteste ab, den Blick nach innen gerichtet, während er darum rang, die Bedeutung der Worte der Tänzerin zu enträtseln. Dann deutete er mit der Hand vage nach Westen. »Es kommt von den Bergen. Ich muss es holen. Den Schlüssel holen. Die Botschaft. Den Herold?« Doms Gesicht zuckte, und er unterbrach Lims erneute Klagen. »Weiß ich nicht. Noch nicht. Es ist, als … es ist, als würde sich dort oben ein Sturm zusammenbrauen. Es wird eine Warnung geben, bevor der Sturm losbricht, aber nur, wenn ich rechtzeitig dort bin.« Er ächzte frustriert. »Ich weiß nicht … es ergibt keinen Sinn. Mittsommer.«
»Mittsommer? Was ist mit der Botschaft?«, fragte Sarilla.
»Das auch. Scheiße, warum ist es so schwer?« Dom stöhnte und rieb sein rechtes Auge, das heftig schmerzte. Sarilla schlug seine Hand weg. »Wenn die Tänzerin und der Fuchsgott wollen, dass ich etwas erfahre, warum sagen sie es mir dann nicht einfach?«
»Das tun sie doch. Wir haben nur nicht die Fähigkeit, sie zu verstehen«, erwiderte Sarilla, und diesmal schwang in ihrem Ton kein Spott mit. »Sie sind Götter, Dom. Du kannst nicht erwarten, dass sie so sind wie wir.«
»Sarilla hat recht, die Offenbarungen ergeben zunächst meist keinen Sinn«, besänftigte ihn Lim. »Aber Mittsommer? Wir haben noch nicht einmal das Julfest gefeiert. Wir haben Zeit, Dom. Überstürze nichts; es wird schon kommen. Es besteht keine unmittelbare Gefahr«, stellte er klar.
»Es ist fast tausend Jahre her, seit der Schleier herabgelassen wurde«, sagte Dom plötzlich. Er hatte keine Ahnung, woher die Worte kamen, aber Jahre der Offenbarung hatten ihn gelehrt, sich zu entspannen und sich von seiner Stimme erklären zu lassen, was er noch nicht verstand. »Jetzt wird er schwächer. Die Roten Götter werden mächtiger, und das Licht nimmt ab. Blut wallt auf. Finde den Herold; dämme die Flut ein.«
Dom konzentrierte sich auf den lehmigen Schlamm zwischen seinen Stiefeln, und seine Brust hob und senkte sich, als hätte er einen Hirsch zu Tode gehetzt. Er schluckte Galle. Die Qualen schwollen an und verebbten dann zu einem Dauerschmerz, der sein Gesichtsfeld an den Rändern farbig pulsieren ließ. Das ist es. Ich denke, es fängt an. Nach all diesen Jahren kommt es.
Ich brauche mehr Zeit.
Lim, Sarilla und Feltith schwiegen, warteten auf mehr. Dom schob sich die Hände in die Achselhöhlen, um ihr Zittern zu verbergen. Es hatte keinen Sinn, sie zu ängstigen, bevor es sein musste. Warum nicht? Ich habe Angst. Verdammt, ich habe furchtbare Angst. Aber er war der Calestar, im Guten wie im Schlechten, und die Offenbarungen bedeuteten Pflicht. Pflicht? Wohl eher Opfer. Mein Opfer. Pflicht, ermahnte er sich streng und brachte die innere Stimme zum Schweigen.
»Alles ist im Fluss, aber es gibt immer eine Gefahr«, erklärte er schließlich an Lim gewandt. »Ich werde heute Nacht hinaufgehen.«
»Ruh dich noch ein Weilchen aus; ich werde Vorräte einpacken«, sagte Lim.
»Ich muss allein gehen«, beharrte Dom.
»Du darfst nicht allein gehen«, widersprach Sarilla leise. »Wenn du dort oben eine weitere Offenbarung hast, auf dem Gebiet der Mirak, wirst du hilflos sein. Nicht einmal ich will, dass du erfrierst oder von Bären gefressen wirst. Oder von Mirak gefangen.«
Lim sah Sarilla an. »Schick einen Boten nach Wachstadt und einen anderen zur Westgarnison. Du weißt, wie viel Wahrheit du einem jeden von ihnen zumuten kannst. Wir haben noch keine Ahnung, worauf wir uns vorbereiten, also keine Panik.« Er zeigte nach Westen, in die Richtung, in die Dom gezeigt hatte. »Aber von diesen Bergen ist noch niemals etwas Gutes gekommen. Sei auf der Hut.«
DIE GESEGNETE
Elfter Monat, Jahr 994 seit der Verbannung der Roten GötterLanghaus, Adlerhöhe, Gilgorasgebirge
Blut und Tod waren, wenn sie den Göttern Opfer brachte, Lantas tägliches Geschäft. Aber Liris’ Leiche kündete von etwas anderem – einer schmutzigen, wilden Tat. Einem rasenden, besinnungslosen Angriff, unbeherrscht und unzivilisiert.
Edwin hatte alle durchgezählt und meldete eine Sklavin als vermisst; außerdem waren verschiedene Männer in ihrem oder dem Auftrag des Königs unterwegs. Er hatte bereits einen Trupp Krieger mit Hunden zusammengestellt, um die Sklavin zu verfolgen. Der Raum stank nach Blut und Furcht, eine Fährte, der die Hunde in der klaren Bergluft leicht folgen konnten.
Lantas Gedanken kreisten um ihr Dilemma. Eine verschwundene Sklavin war leicht zu ersetzen. Ein gefügiger König jedoch war nicht so einfach zu finden. Von den Kriegshäuptlingen wäre Mata …
Sie hielt auf halbem Weg durch das Langhaus inne und versuchte zu begreifen, was sie sah. »Was hat das zu bedeuten?«
Corvus saß auf dem Thron und ließ sich kurz in der Betrachtung seiner Stiefel stören, die ebenso blutbesudelt waren wie seine Hände. »Dies, Gesegnete, ist eine Thronfolge. Ich dachte, nach Liris’ verfrühtem Tod wäre ein nahtloser Übergang das Beste für unser Volk.« Corvus würdigte sie eines kurzen Lächelns und kratzte getrocknetes Blut unter einem Daumennagel hervor.
Er hat es nicht getan. Er würde so etwas nicht tun, nicht ohne meine Zustimmung. Ihr Blick flackerte zu den Leichen am Fuß des Podestes. Und doch hat er es getan. Sie ging seine Worte noch einmal durch, während sie um Gleichmut rang. »Unser Volk?« Sie zog eine Augenbraue hoch. »Darf ich Euch daran erinnern, Corvus vom Krähenfels, dass Ihr vor nicht allzu vielen Jahren als Sklave aus Rilpor geholt worden seid? Ihr wart damals Madoc vom See der Tänzerin, geboren und großgezogen als Heide. Also ist dies mein Volk, und ich entscheide, was das Beste für es ist.«
Corvus funkelte sie an. »Bin ich nicht ein guter Sohn der Dunklen Dame? Ich zahle meine Blutschulden, ich plündere in ihrem Namen, ich huldige ihr und ihrem Bruder, dem heiligen Gosfath, dem Gott des Blutes. Ich bin Mirak, in Blut und Feuer geweiht, Kriegshäuptling des Krähenfelsens und jetzt König der Mirak. Das ist alles, was Ihr über meine Abstammung zu wissen braucht.«
So schnell fordert er mich heraus. So schnell schaltet er alle aus, die sich ihm entgegenstellen würden. Und natürlich gibt es noch Rillirin, die Liris nach Banas heiligem Opfer in sein Gemach geschleppt hat. Und Rillirin … interessiert mich.
»Ein solch hastiger Übergang, Corvus«, sagte Lanta mit leiser Stimme, während sie durch das schweigende Publikum stolzierte und sich einen Weg durch die Masse von Leichen unterhalb des Podiums bahnte. Sklaven mit vor Panik geweiteten Augen drängten sich im hinteren Teil des Langhauses zusammen wie ein Schwarm Hühner vor dem Wolf. »Mit wessen Befugnis erhebt Ihr Anspruch auf den Thron? Ich bin nicht zurate gezogen worden.«
Corvus legte die Fingerspitzen vor den Lippen aneinander. »Mit meiner eigenen Befugnis. Aber Ihr könnt die anderen Kriegshäuptlinge zurate ziehen, wenn Ihr das möchtet. Doch ich bin mir nicht sicher, wie viel Ihr von ihnen zu hören bekommt.«
Lanta hielt inne und ging dann weiter, würdevoll, raubtierhaft. Also kommt die Herausforderung jetzt, bevor sein Hintern den Thron auch nur erwärmt hat. Dann mögen die Götter entscheiden.
»Was die Macht betrifft, so verlange ich sie kraft des Eroberungsrechts für mich, wie Liris es getan hat.« Corvus hatte die Stimme erhoben, damit sie bis ans Ende des Langhauses drang, um Krieger anzulocken. Sie scharten sich hinter Lantas Rücken zusammen.
»Ich stehe neben dem Thron, und meine Stimme ist die zweite nach dem …«, begann Lanta, als sie auf das Podium trat. Corvus sprang vom Thron und drängte sie entschlossen, aber höflich rückwärts die hölzernen Stufen hinunter. Lanta schwankte, steif und rot vor Zorn, hinab auf den Boden zum Gesindel.
»Ich habe Euch nicht eingeladen, Euch zu mir zu gesellen«, sagte Corvus laut. »Wenn ich es tue, wird Euch ein Platz hinter mir zur Verfügung stehen, und ich werde um den Rat der Dunklen Dame bitten« – er betonte den Ehrentitel – »und zwar dann, wenn ich ihn brauche.«
»Die Roten Götter werden es nicht tolerieren, wenn ich misshandelt werde«, schrie Lanta, ihr Zorn wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Unverschämtes, arrogantes Kind! Er denkt, wenn er Männern einen Dolch in den Rücken rammt, gibt ihm das Macht über die Götter? Über mich?
Männer schraken vor ihrer Wut zurück, aber Corvus lächelte nur spöttisch. Er ging wieder zu seinem Thron, bevor er antwortete, zog den Moment in die Länge, zwang Lanta und die anderen zu warten.
»Wo ist Eure Ehrerbietung, Gesegnete?«
Lanta starrte ihn an, und die Fassungslosigkeit stand ihr ins Gesicht geschrieben. »Was habt Ihr gesagt?«, flüsterte sie.
»Liris war schwach – Ihr habt diese Schwäche ausgenutzt, um Euch mehr Macht zu verschaffen, als Eure Position verlangte. Ich stelle das Gleichgewicht wieder her. Ihr mögt keinen neuen König ermächtigt haben, aber die Dunkle Dame hat es getan. Also, kniet nieder. Oder sterbt. Mir ist es gleich.«
»Ich kenne den Willen der Dunklen Dame«, rief Lanta. »Ich bin die Gesegnete. Sie redet mit mir, nicht mit Euch.« Ihre Fäuste waren geballt, ihr Gesicht heiß vor Entrüstung und Zorn. Eine Herausforderung nicht nur ihrer Macht, sondern auch der göttlichen? Für diesen Frevel wird er sich unter meinem Messer winden.
Corvus spreizte seine roten Hände. »Dann werdet Ihr wissen, dass es ihr Wille war, dass ich meine Rivalen besiegt habe. Wenn sie mich nicht auf dem Thron wollte, hätten sie mich getötet.«
Ein Raunen ging durch die Reihen, und Lanta spürte die Veränderung im Raum. Er hatte recht, und alle wussten es. Dann also die Taktik ändern. »König Corvus«, hob sie zu sprechen an, und er grinste, »dies ist nicht der Zeitpunkt für einen Wechsel in der Führung. Vielleicht …«
»Nun, solange Ihr keinen Mann von den Toten zurückholen könnt, hat es sich damit wohl«, erklärte er, und es folgte gedämpftes Gelächter, das schnell verstummte.
Lanta bleckte die Zähne. Es war Jahre her, seit irgendjemand es gewagt hatte, sie zu unterbrechen. Sie stellte fest, wie wenig es ihr gefiel. »Ich meinte nur, vielleicht würden unsere Leute eine gemeinsame Führung vorziehen, bis ihr Euch in Eure neue Stellung eingefunden habt. Es gibt viele Dinge, bei denen ich Euch beraten kann. Wenn Ihr es erlauben würdet?«
»Nein.«
Lantas Wangen brannten. Die Luft zwischen ihnen knisterte, als Corvus ihr in die Augen schaute, ganz abgeklärt und erheitert. Er forderte sie förmlich dazu heraus, den Blick abzuwenden.
Sie lächelte. Es gab viele Methoden, dieses Spiel zu spielen, und sie hatte weit mehr Erfahrung darin als er. Trotzdem, er erzürnte sie. »Vielleicht wird jemand zum Krähenfelsen geschickt, um Eure Gemahlin herzuholen«, zischte sie. Viele der hinter ihr Stehenden hielten die Luft an. Hatte sie wirklich gerade dem König gedroht? Corvus machte eine wegwerfende Geste mit den Fingern, sein Gesichtsausdruck unbeteiligt. Als hätte sie gar nicht gesprochen. Lanta sog scharf die Luft ein.
»Vielleicht solltet Ihr Euch lieber darauf konzentrieren, Liris’ Mörder zu finden«, erwiderte er.
»Oh, macht Euch darüber keine Sorgen«, sagte sie. »Man wird den Mörder finden und zur Verurteilung vor Euch schleifen. Ich frage mich, welche Art von König Ihr dann sein werdet, wenn Ihr die Person vor Euch habt, die Euch den Thron beschert hat.«
Lanta war niemals verwegen; die Götter hatten zu viele Pläne, und für all diese Pläne war sie zu wichtig. Doch dieses unbefangene Lächeln, diese aufreizenden blauen Augen weckten in ihr den verzweifelten Wunsch, ihm wehzutun, aber statt dass ihre Widerhaken in sein Fleisch drangen, prallte alles, was sie sagte, einfach an ihm ab, als würde er diese lächerliche rilporische Plattenrüstung tragen.
»Seid vorsichtig, Gesegnete«, riet ihr Corvus mit bedrohlich leiser Stimme. »Ihr habt keine Ahnung, mit wem Ihr es zu tun habt.« Er hielt inne und lächelte, freundlich, offen. »Aber ich kann es Euch zeigen, falls Ihr mich oder die meinen jemals wieder bedrohen solltet.«
Vielleicht war sie zu voreilig gewesen, dachte sie bei sich, während sie Corvus und seine blutigen Hände und Stiefel betrachtete. Sein rotblondes Haar war wild und verschwitzt vom Kampf, und sie senkte den Blick, um die Leichen zu betrachten. Hinterrücks erstochen. Sie schnaubte schwach. Er hatte nicht einmal den Mumm gehabt, es richtig zu machen.
Aber es war geschehen. Während sie im Raum nebenan Liris’ zerfetzten und blutverschmierten Leichnam betrachtet hatte, hatte sie alles verloren. Die Wünsche der Götter den Begierden und Launen eines Mannes untergeordnet. Nein, schwor sie sich im Stillen, nicht zu meinen Lebzeiten. Nicht solange ich noch etwas Macht habe.
»Tröstlich zu hören, dass Ihr Liris’ Mörder nicht ungestraft davonkommen lassen werdet. Führt unbedingt Eure eigene Untersuchung durch; ich werde die Dunkle Dame um Rat ersuchen. Liris hatte vor seiner Ermordung eine Hure in seinem Schlafgemach; sie ist in dem Chaos geflohen, aber ich habe bereits Männer hinter ihr hergeschickt. Es ist gut möglich, dass sie den Mörder gesehen hat und wir mit ihrer Hilfe den Mann dingfest machen können«, sagte Lanta, die Rillirins Identität absichtlich für sich behielt. Sie konnte jedes noch so kleine Druckmittel gebrauchen.