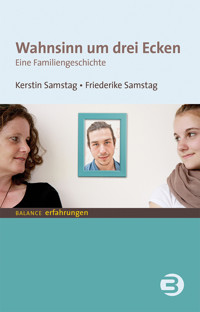
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BALANCE Buch + Medien Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: BALANCE erfahrungen
- Sprache: Deutsch
Die Mutter eines psychisch erkrankten Sohnes und seine Schwester erzählen gemeinsam von den Erschütterungen durch die psychischen Krisen ihres Sohns beziehungsweise Bruders. In Briefwechseln und kurzen Texten erfahren wir vom Gefühl, selbst verloren zu gehen, vom Sichkümmern, vom Herumsitzen auf psychiatrischen Stationen, von unterschwelligen Vorwürfen der Pflegekräfte, vom Schrecken und der Sprachlosigkeit angesichts der Suizidgefahr. Ein ganzes Familiengefüge bricht auseinander und wird doch wieder eins. Ein literarischer, ehrlicher Einblick in das seelische Erleben von Angehörigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wenn Angehörige zu Betroffenen werden
»Die Krise des Bruders und Sohnes wurde zur Krise für jede von uns, zur Krise für unsere Beziehung und zur Krise für uns als Familie.«
Kerstin Samstag, Friederike Samstag
Wahnsinn um drei Ecken
Eine Familiengeschichte
BALANCE erfahrungen
Kerstin Samstag, Friederike Samstag
Wahnsinn um drei Ecken
Eine Familiengeschichte
Kerstin Samstag, Friederike Samstag
Wahnsinn um drei Ecken
Eine Familiengeschichte
Balance erfahrungen
1. Auflage 2018
ISBN-Print: 978-3-86739-171-9
ISBN-PDF: 978-3-86739-904-3
ISBN-ePub: 978-3-86739-908-1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Weitere Ratgeber, Selbsthilfe-Bücher und Erfahrungsberichte unter
www.balance-verlag.de
© BALANCE buch + medien verlag, Köln 2018
Der BALANCE buch + medien verlag ist ein Imprint der
Psychiatrie Verlag GmbH, Köln.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne
Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder
verbreitet werden.
Lektorat: Sandra Kieser, Köln
Umschlagkonzeption und -gestaltung: GRAFIKSCHMITZ, Köln
unter Verwendung von Bildern von Pla2na / shutterstock.com,
Mr. Nico / photocase.com und Rein Van Oyen / photocase.com
Typografiekonzeption und Layout: Iga Bielejec, Nierstein
E-Book-Herstellung: Zeilenwert Gmbh 2017
Vorwort
Einleitung
Erstes Kapitel: Schock und Ohnmacht
Verschwunden sein [Schwester]
Station [Mutter]
Station [Schwester]
Profis 1 [Mutter]
Profis 2 [Mutter]
Rufe [Schwester]
Ohne Raum und Zeit [Mutter]
Aufpassen [Schwester]
Verantwortung abgeben? [Mutter]
Da und nicht da [Schwester]
Angst und Verzweiflung [Mutter]
Solche Leute [Schwester]
Spaziergang 1 [Mutter]
Traumdeutungen 1 [Mutter]
Schweigen [Schwester]
Wenn der Himmel fällt [Mutter]
Zweites Kapitel: Isolation und Rückzug
Gebraucht und missachtet [Mutter]
Tänzer [Schwester]
Das Loch [Mutter]
Am Feld [Schwester]
Weihnachten [Mutter + Schwester]
Ostern [Mutter + Schwester]
Wohin mit der Wut [Mutter]
Ratschläge 1 [Schwester]
Ratschläge 1 [Mutter]
Profis 3 [Mutter]
Ratschläge 2 [Schwester]
Ratschläge 2 [Mutter]
Traumdeutungen 2 [Mutter]
Ankunft [Schwester]
Profis 4 [Mutter]
Profis [Schwester]
Der Ort und die Macht [Mutter]
Drei Tage, drei Nächte, vier Stunden [Schwester]
Geisterstadt [Schwester]
Einsam und bedingungslos [Mutter]
Spaziergang 2 [Mutter]
Opfer sein [Mutter]
Rettungsversuche [Schwester]
Die alten Maßstäbe [Mutter]
Spaziergang 3 [Mutter]
Die Welt der Normalität [Mutter]
Lieblingswitz [Schwester]
Spaziergang 4 [Mutter]
Wochenenden [Mutter]
Vor Weihnachten [Schwester]
Der Druck in meiner Stimme [Mutter]
Die Heiligen Drei Könige [Mutter]
Drittes Kapitel: Den eigenen Ort finden
Verlorene Nähe [Mutter]
Viele Anfänge [Schwester]
Tretminen [Mutter]
»Meine Seele ist gelöscht!« [Mutter]
Dieser Schluss [Schwester]
Wut aushalten [Mutter]
Andere Sichtweisen [Schwester]
Umstellen [Mutter]
Nicht mehr nur dir zuliebe [Mutter]
Da sein und nicht da sein [Mutter]
Es geht nicht mehr [Schwester]
Nebeneinander existieren [Mutter]
Aushalten [Mutter]
Der Schwindel [Schwester]
Muss ich das mit ihm durchmachen? [Mutter]
Er erreicht mein Herz [Mutter]
Jetzt verstehe ich [Schwester]
Mein Sohn [Mutter]
Die Verwandlung [Schwester]
Heute [Schwester]
Was ich gelernt habe [Mutter]
Im Nachhinein [Mutter]
Für mich [Schwester]
Anhang
Hilfreiche Lektüre [Mutter]
Blicke zurück – Interviews mit mir selbst [Schwester]
Was helfen kann und was nicht [Mutter]
Über die Autorinnen
Vorwort
Dies ist kein Buch über einen Kranken oder über eine psychische Krankheit. Es ist ein Buch über sogenannte »Angehörige« und über das, was geschieht, wenn ein nahestehender Mensch zum sogenannten »Betroffenen« wird: »Angehörige« sind auch »Betroffene«.
Wir versuchen in diesem Buch zu schildern, wie die Krise des Bruders und Sohnes zur Krise für jede von uns, zur Krise für unsere Beziehung und zur Krise für uns als Familie wurde.
Unser Anliegen ist, dass dieses Buch auch anderen »Angehörigen« eine Hilfe sein kann, dass »psychiatrische Profis« einen anderen Blick auf »Angehörige« und familiäre Zusammenhänge gewinnen und dass Außenstehende einen Einblick erhalten.
Einleitung
Franz Kafka hat eine neue Textform erfunden, sagen die Literaturwissenschaftler: kurze Erzählungen, die seelisches Erleben schlaglichtartig vermitteln. Er konnte seine Erfahrungen nicht mehr in eine fortlaufende Geschichte einordnen, seine Erfahrungen von brüchigen menschlichen Beziehungen waren nur noch in Momentaufnahmen vermittelbar. Uns ist dies ähnlich ergangen. Wir haben nicht darüber nachgedacht, es hat sich so ergeben: Was für uns in den Krisen nicht auszuhalten war, konnten wir nur in kurzen Texten beschreiben, die sich im späteren Verlauf aufeinander bezogen haben.
Wir versuchen in diesem Buch, als Mutter bzw. Tochter und Schwester Erfahrungen zu vermitteln und zu beschreiben, die uns zunächst unbegreiflich waren. Es lässt sich keine Geschichte daraus basteln. Es lässt sich auch nicht darstellen, wie wir innerlich und miteinander stabile Bezugspunkte verloren haben, indem wir beschreiben, was jeweils passierte, so wie man einen Roman schreiben würde.
Entwicklungslinien fehlten ebenso, sie waren entweder nicht erkennbar oder zu unsicher, wenn sie sich zeigten. Es waren konstruierte Fortschritte, die auf unserer Hoffnung basierten und nicht anhielten.
Gerade die persönliche Erfahrung zu beschreiben, als Angehörige mit einer psychischen Krankheit konfrontiert zu sein, ist unser Anliegen. Wir konnten dies nur mit einem Mosaik von Texten. Sie sind Fragmente einer Gesamtsituation, die für uns nicht anders zu fassen und schwer auszuhalten war.
Mit 18 Jahren brach bei unserem Sohn und Bruder eine Psychose aus, die uns alle wie in einem Strudel mitriss. Seine Selbstmordgedanken, sein Erleben, sein Rückzug und die Konfrontation mit der Psychiatrie lösten bei uns eine heftige Krise aus.
Als er zum ersten Mal in die Psychiatrie eingeliefert wurde, weil wir den Notarzt angerufen hatten, wohnte seine Schwester nicht mehr bei uns, aber sie war in den Semesterferien und zu den Feiertagen da. Sie ist drei Jahre älter als ihr Bruder. Der Vater wohnte in der nahen Stadt, aber es gab seit ein paar Jahren wenig Kontakt zu ihm. Wir waren es seit längerer Zeit gewohnt, zu dritt zu sein.
Seit der ersten Psychose sind jetzt acht Jahre vergangen. Es gab kafkaeske Tage und Wochen. Viele waren schwer auszuhalten, manche gar nicht, sie führten an die Grenzen der eigenen Welt – jede von uns – und darüber hinaus ins Gestaltlose, Traumatische.
Wir erzählen und beschreiben in diesem Buch unser Erleben aus zwei Blickrichtungen, aus der Perspektive der Schwester und der Perspektive der Mutter. In unserem kleinen Familienkosmos wurde die Schwester zunächst fast nur in Bezug auf den Kranken wahrgenommen. Ihr eigenes Befinden geriet, vermutlich ist das typisch, für lange Zeit in den Hintergrund. Alles drehte sich um den Bruder, seine Krankheit, seine Not und den Ort, der nun zuständig war, das psychiatrische Krankenhaus.
Der Ausbruch der psychischen Erkrankung war für uns als Angehörige traumatisch, vergleichbar mit Naturkatastrophen. Man rechnet nicht damit, macht vorher keinen Plan, und wenn es passiert, ist es ganz anders, als man es sich ausdenken würde. In der Krise selbst war es uns kaum möglich, unser Erleben anderen verständlich zu machen, so wie es ihm, dem Betroffenen, offensichtlich auch ging.
Ich als Mutter möchte die Erfahrung vermitteln, wie die psychische Krise meines Sohnes alles infrage gestellt und teilweise zerstört hat, was an Konzepten und Zielen für meine Kinder von mir vorgesehen, gewünscht und als vertrautes, bürgerliches Planspiel vorhanden war. Und wie meine Erfahrungen letztlich zu einer Überwindung von normativen Erwartungen und einem Zuwachs an Echtheit geführt haben. Das gelang mir unter anderem auch dadurch, dass ich eine Zeit lang gegen den Strom der psychiatrischen Behandlungsnormen geschwommen bin.
Ich, die Tochter und Schwester, möchte darstellen, wie weit das eigene Erleben von dem entfernt war, was »man« sich vorher – und zum Teil auch nachher – vorstellen kann. Oft hatte ich das Gefühl, mein Empfinden und meine Reaktionen bewegten sich weit außerhalb all dessen, wofür es Nachsicht, Erklärungen oder Verständnis geben könnte. Ich wäre froh, wenn mein Versuch, meine Erfahrungen zu schildern, für andere in einer ähnlichen Situation eine Unterstützung sein könnte.
Beide Anliegen lassen aus unserer Sicht kaum allgemeine Schlussfolgerungen zu. Es kann nur individuelle Lösungen und unterschiedliche Perspektiven geben. In unserem eigenen Prozess in der Krise hat weniger die Krankheit im Vordergrund gestanden als vielmehr unsere Beziehungen, unsere Liebe und unsere Kämpfe mit- und gegeneinander.
Dass durch leidvolle Erfahrungen die Schönheit und der Wert des Lebens deutlicher erfahren werden, ist eine oft wiederholte Erkenntnis. Wir haben gemerkt, dass uns dies in der Krise nicht geholfen hat. Es war teilweise wie ein Verlust der sicheren Existenz der vertrauten Welt und der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Aber wenn wir heute zurückschauen, können wir das Geschehene als wesentlichen Erfahrungsgewinn und gemeinsame Entwicklung schätzen.
Der Prozess des Schreibens hat uns geholfen, die verstörenden Erfahrungen zu ordnen und eine Brücke zur Mitwelt zu bauen. Der gedachte Leser, die vorgestellte Leserin, das war ein Bezugspunkt zur Welt, die damit noch existierte und der wir uns mitteilen konnten. Durch die Sprache, die Worte, konnten wir manches erst begreifen und verarbeiten, manchmal auch innere Distanz gewinnen, die uns guttat.
Als Mutter und Tochter wollten wir nachvollziehen, wie die andere die Phasen der Krise erlebt hat. Zunächst schrieb jede für sich, und Verletztheit und Wut verhinderten häufig einen Dialog. Erst im weiteren Verlauf halfen uns die Texte auch dabei, unsere Gefühle der anderen zu vermitteln.
Wir selbst haben Texte über das Erleben von Geschwistern und über die Krise der Familienbeziehungen insgesamt vermisst. Wir glauben, solche Texte hätten geholfen, das eigene Erleben einzuordnen und uns weniger allein zu fühlen.
Den Professionellen wollen wir sagen: Respektiert uns Angehörige. Und berücksichtigt, dass wir selbst auch Teil des Geschehens sind. Dem interessierten, nicht betroffenen Leser und der Leserin möchten wir eine fremde, den meisten Menschen Angst machende Erfahrungswelt beschreiben. Und wir möchten Menschen, die eine ähnliche Situation kennen, eine Hilfe anbieten. Wir haben diesen Text auch geschrieben, weil er uns damals geholfen hätte, die eigene Situation besser zu verstehen.
Erstes Kapitel: Schock und Ohnmacht
Verschwunden sein [Schwester]
Die größte und schlimmste Belastung kam nicht von meinem Bruder. Nicht, was er gesagt oder nicht gesagt, getan oder nicht getan hat, war so schwer auszuhalten. Auch nicht das Stigma der Krankheit oder etwa Sorge um die Reaktion »der Leute« waren mir unerträglich. Am schlimmsten war, dass ich selbst verschwand. Beim Telefonieren mit meiner Freundin klaffte in meiner Brust ein riesiges Loch. Es roch wie vermodert. Meine Mitte war schon verschwunden. Ich redete mit ihr über meine Angst. Die Selbstmordgedanken meines Bruders – zu wissen, er hatte Selbstmordgedanken – waren für mich nicht auszuhalten. Beim Atmen musste ich nach Luft schnappen. Es war, als würde die Luft in einen leeren Raum hineingesogen, der den Sauerstoff nicht halten und nicht aufnehmen konnte. In einem dunklen, leeren Loch verschwand alles, was mir Freude oder Kraft hätte geben können. Bald würde ich ganz verschwunden sein. Im Auto lehnte ich mich kraftlos gegen die Scheibe. Wenn ich hier regungslos verharrte, könnte ich das Ganze vielleicht überstehen. Ich versuchte, meine Gedanken anzuhalten. Nicht meine Uni, nicht meine Hausarbeiten, nicht meine Zukunft, nicht meine Pläne für den Abend, nicht mein Besuch bei meinen Freundinnen, nicht den Anruf bei meinem Freund, nicht meine Lieblingsmusik, keine Freude, kein Vergnügen, keinen Schmerz gab es für mich. Nur diesen Blick aus dem Auto. Ich saß auf dem Rücksitz, meine Handflächen aneinandergepresst und zwischen die Beine geklemmt. Mein Bruder, der Beifahrer, hatte seine Kopfhörer in den Ohren und sah wortlos aus dem Fenster. Meine Mutter saß am Steuer.
Station [Mutter]
Ich glaube, er hieß Schulz. Als er mich das erste Mal auf der geschlossenen Station sah, kam er auf mich zu und gab mir die Hand, ohne mich anzuschauen, mit gesenktem Blick. So, wie man eine höher gestellte Person begrüßt. Vermutlich hielt er mich für eine Ärztin. Ich reagierte freundlich, und er setzte schnell seinen Weg durch den halbdunklen Flur fort. Er war etwas kleiner als ich, hatte ein rundes Gesicht, wirkte weich und harmlos.
Beim Rauchen auf dem vergitterten Balkon begegneten wir ihm wieder und ich hörte ihm zu. Er sprach wie ein Wasserfall, fast ohne Luft zu holen, leise und wie eine aufgezogene Spieluhr, die Worte produziert statt Töne. Es waren lustige Aussagen dabei. Dass der Papst wie Donald Duck sei. Man brauche ihn nur anzuschauen bzw. ihm in die Augen zu sehen. Dann sehe man es: Er sei wie Donald Duck. Wann dieser Papst schon jemals einem Menschen geholfen habe, der leide. Man sehe es in seinen Augen, er sei nicht echt.
Er hat diese Sätze oft wiederholt, bis meine Zigarette und die meines Sohnes zu Ende geraucht waren und wir wieder rastlos durch den Flur wanderten. Den Gang hinunter, rechts und links, vorbei an Zwei-, Drei- oder Vierbettzimmern hinter geschlossenen Türen, zwei Toiletten, zwei Arztzimmern, vorbei an der verglasten Pforte gleich beim Eingang links.
Die Pfleger und Schwestern hinter der Glaswand der Pforte beachteten uns nicht. Ich bemühte mich, so zu gehen, als sei alles normal, als könne ich meine Glieder locker bewegen. Als könnte ich meinem Sohn neben mir damit signalisieren, dass das Umherwandern ein Spaziergang sei, der mir nichts ausmachte. Ich wollte nicht, dass man mir meine innere Anspannung anmerkte. Wir bogen wieder links ab, den Gang entlang zurück, rechts und links die Zimmertüren, zwei Toiletten und das Arztzimmer. Und wieder links herum, an der Wachstation, einem Zimmer mit Wachpersonal, vorbei. Und vielleicht war dann, nach zwei Runden, schon wieder Zeit, auf dem Balkon eine Zigarette zu rauchen, einen Schluck Wasser im Vierbettzimmer meines Sohnes zu nehmen oder eine weitere Runde zu drehen.
Ich besuchte meinen Sohn täglich, er schien das zu brauchen wie ein Ertrinkender. Ein paar Tage später war Herr Schulz durch Medikamente »ruhiggestellt«. Die Notwendigkeit dazu sah ich ein, er hatte sich beim Reden aufgeregt und schien es nicht mehr steuern zu können. Er saß jetzt auf einem Stuhl auf dem Balkon und starrte vor sich hin. Es schien kaum Leben in ihm zu sein. Ich konnte ihn nicht mehr anschauen, habe weggeschaut und ihn ausgeblendet, so als wäre er nicht da. Es hätte mir sonst wehgetan.
Als mein Sohn nach einigen Tagen unter Beobachtung in ein Zweibettzimmer verlegt wurde, spielte der Bettnachbar, ein kräftiger Mann, mit seiner Frau auf dem Bett sitzend Karten. Es war eine fremde Welt, in der ich mich hier bewegte. Ich war vorsichtig. »Ich werde morgen verlegt, denn Alkoholiker gehören nicht auf diese Station«, verkündete er laut und fröhlich. Ich nickte mechanisch und wusste nicht, wie ich das einordnen sollte.
Draußen auf dem Flur waren plötzlich laute, aggressive Schreie zu hören. Ich erschrak und mein Inneres zog sich zusammen. Diese Schreie drangen in mich ein, ich war ihnen ausgeliefert und konnte sie nicht aushalten. Als hätte ich nichts mehr, das ich diesen lauten, verzweifelten Schreien entgegensetzen konnte. Als ob sie mich erfassten und in einen Abgrund stießen. Und was machte er, der fröhliche Alkoholiker? Er lachte. Wie man über einen guten Witz lacht, ganz entspannt. Ich sah in sein Gesicht und staunte. Wie war das möglich? Darauf wäre ich nie gekommen, dass man sich in ein Lachen retten konnte! Ich war dankbar für seine Reaktion, die mir wie eine Erlösung vorkam, atmete auf und lachte einfach mit.
Station [Schwester]
Ich sehe ihn an. »Bitte«, flehe ich, »lass mich hier nicht allein!« Der Satz kommt mir überzogen vor, wie aus einem Film. Doch was, wenn es entscheidend ist, ihn jetzt auszusprechen? »Ich will nicht ohne dich leben.« Dann weine ich. Andere Patienten betreten den Aufenthaltsraum, ich starre meinem Bruder noch immer in die Augen. Er wechselt das Thema und wir verlassen den Raum. Ich bin froh, dass ich es ihm gesagt habe.
Ich weiß nur eine Möglichkeit, um meine Empfindungen auszudrücken: schreien. Haltloses und lautes Schreien, so lange, dass die Lungenflügel davon entlüftet würden. Aber wo soll ich schreien?
Meine Mitbewohner reden über Partys und meine Kommilitonen erzählen von ihren Hausarbeiten. Das alles interessiert mich nicht mehr. Was soll ich dazu sagen? Sie sind anders als ich. Ich habe mich verändert und ich kenne keinen Weg zu ihnen zurück. Wie soll ich auch über diese Themen reden, jetzt, wo noch gar nicht alles überwunden ist? Und wie sollte ich es später, wenn ich doch weiß, dass so etwas in jedem Moment wieder passieren kann?
Viel rede ich nicht mehr, aber ich lese und höre Musik. Hier gibt es Menschen, die mich verstehen. Meine Brüder und Schwestern aus vorangegangenen Zeiten sind als Vorbilder und Freunde um mich versammelt. Einige pflichten mir bei, wenn ich zweifle, andere muntern mich auf, wenn ich einsam bin. Bisweilen scheinen sie nicht greifbar, dann wieder sind sie ganz nah. Die meisten von ihnen verstehen mich und allmählich verstehe ich auch sie. Die vier Musiker meiner Lieblingsband haben mir gestern erzählt, dass auch sie dem Tod gegenüberstanden. Dass diese Erfahrung sie bereichert hat. Und dass sie nur dadurch diese Musik schreiben konnten.
Profis 1 [Mutter]
Er isst nicht. Mein Sohn befindet sich auf einer geschlossenen Station. Ich bin mit ihm nachmittags im Auto unterwegs, weil ihn das ablenkt und ihm guttut. Ich mache mir Sorgen, weil er seit ein paar Tagen nichts mehr gegessen hat. Da die zuständige Ärztin gerade Sprechzeit hat, rufe ich sie spontan an. Mein Ziel ist es, sie als Stationsärztin darüber zu informieren, dass mein Sohn seit Tagen nichts isst, und zu erwirken, dass er möglichst bald Astronautennahrung bekommt. Er ist dünn und sieht nicht so aus, als hätte er körperliche Reserven. »Grüß Gott, Frau Dr. W., gut, dass ich Sie erreiche! Ich bin gerade mit meinem Sohn unterwegs, er isst seit ein paar Tagen nichts, auch heute nicht! Ich habe alles versucht, aber es ist nichts zu machen!«
»Dann kaufen Sie ihm etwas, das er mag«, höre ich ihre Stimme am anderen Ende. »Das habe ich schon versucht! Aber er ...« Doch ich werde von ihr unterbrochen: »Dann holen Sie ihm doch etwas von McDonald‘s!« »Er isst sonst vieles von McDonald‘s – normalerweise. Wir waren gerade eben dort, aber er isst einfach nichts!« Meine Stimme klingt jetzt wie ein Flehen. Wie kann ich ihr verständlich machen, dass ich keinen Einfluss darauf habe, dass mein Sohn etwas isst, dass ich machtlos bin? »Dann versuchen Sie etwas, das er mag.« Ich kann es nicht fassen. Hat sie gehört, was ich gesagt habe?
Es kommt nicht bei ihr an, dass ich bereits alles versucht habe. Sie meint, etwas müsse doch zu machen sein, ich solle mir etwas einfallen lassen, etwas Schmackhaftes müsse doch zu finden sein. Was kann ich ihr noch sagen, damit sie meine Ohnmacht und die Dringlichkeit zu handeln versteht? »Das funktioniert nicht!« Ich merke, dass ich lauter werde.
Ihr wird es nun zu viel. Meine Hilflosigkeit kann sie nicht nachvollziehen. Vermutlich hat sie den Eindruck, dass ich übertreibe. Mütter reagieren leicht hysterisch, das kennt man ja. Sie ist nicht bereit, auf mich einzugehen. Als läge das außerhalb ihres ärztlichen Reaktionsschemas. Sie weiß, wie man als Psychiaterin Schizophrene behandelt. Aber was kann sie schon machen, wenn eine besorgte Mutter sich an sie wendet? Jetzt will sie sich nicht weiter mit der Sache befassen und das unnütze Gespräch beenden, es führt ja zu nichts. »Ich habe jetzt keine Zeit mehr, auf Wiederhören!« Ich höre das Klicken, als sie den Hörer auflegt.
Ich starre eine Weile vor mich hin, alleingelassen und hilflos. Ich überlege und suche nach einer Lösung, die innere Aufregung zermürbt mich. Wie kriege ich das Stationspersonal dazu, Ersatznahrung zu besorgen? Wie überzeuge ich sie, dass das notwendig ist? Ist mein Sohn der einzige Patient, der nicht essen kann? Zwei Tage später wird die Ärztin ihm dann doch Trinknahrung gegen weiteren Gewichtsverlust anbieten, und es geht wieder aufwärts.
Profis 2 [Mutter]
Ein paar Jahre später ein erneuter Aufenthalt in der Klinik. An einem Abend in der ersten Woche, nachdem ich mit meinem Sohn fast zwei Stunden unterwegs war, meldet sich Schwester Barbara bei mir, die auf der offenen Station gerade Dienst hat.
Nach einer kurzen Begrüßung kommt sie gleich auf den Punkt: »Könnten Sie bitte Ihren Sohn in Zukunft direkt am Klinikeingang abholen und nicht vorn am Parkplatz? Wir wollen doch gemeinsam nur das Beste für Ihren Sohn.« Ich stimme sofort zu, um das Gespräch kurz zu halten und um eine Diskussion zu vermeiden: »Ja, klar, kein Problem, dann hole ich ihn vor dem Haus ab.« »Er hat nämlich erst Gruppenausgang, und wir sind ja für ihn verantwortlich«, erklärt sie mir.
Ich sehe ein, dass man kontrollieren will, wohin und mit wem mein Sohn sich entfernt, wenn er aus dem Haus geht. Deshalb stimme ich zu und frage nach: »Ja, klar, mache ich. Soll ich dabei auch reinkommen?« Dann würde man mich sehen und sicher sein können, dass mein Sohn abgeholt wird. »Sie können gerne auch reinkommen.«
Das meine ich nicht, ich habe von mir aus kein Bedürfnis, auf die Station zu kommen, denn das könnte zu dem Eindruck beitragen, dass ich meinen Sohn nicht »loslassen« kann, dass ich Präsenz zeigen und mich womöglich aufdrängen will. Also frage ich nochmals nach, ob man möchte, dass ich mich beim Personal melde. »Ich meine, ob ich das soll, ob ich reinkommen soll.« »Sie können gern auch reinkommen, das ist kein Problem.« Sie versteht mich offensichtlich nicht richtig. Ich mache noch einen Versuch und achte darauf, nicht ungehalten zu klingen. Noch immer bin ich freundlich: »Soll ich?«
»Sie können gern ...« So komme ich also nicht weiter. »Ich weiß, aber ich möchte wissen, ob ich das soll!« Das klingt nun schon etwas ungehalten. »Nein, aber Sie können gerne. Nur holen Sie ihn bitte vor dem Haus ab, weil ...« Hält man mich für begriffsstutzig? Für unkooperativ oder besonders halsstarrig?
»Aber ob Ihrem Sohn das nicht zu viel ist, wenn er am Anfang seiner Behandlung hier zwischendurch zu Hause ist?« Habe ich richtig gehört? »Wie, zu Hause? Nein, nein, wir waren spazieren und Eis essen, das machen wir oft so.«
»Ach so. Wir wollen ja gemeinsam das Beste für Ihren Sohn.« Ist in Ordnung, denke ich. In den nächsten Tagen kommt mir diese Äußerung immer wieder in den Sinn, ich kann die Annahme der Schwester, dass ich meinen Sohn am ersten Tag ungefragt mit nach Hause nehme, nicht verdauen, sie liegt mir im Magen und rumort. Unterstellungen machen mich mürbe.
Wir haben scheinbar keine gemeinsame Sprache, das Personal und ich, und die Verständigung ist behindert. Aber wodurch? Was haben die für Vorurteile über mich als Mutter? Wie kann ich diese verändern und ein Klima schaffen, das mich atmen lässt? Scheinbar gar nicht. Ich bin frustriert, allerdings mehr ärgerlich als enttäuscht. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich nichts tue, was meinem Sohn oder dem Ablauf der Station zuwiderlaufen könnte, und dennoch quasi vorverurteilt bin! Kafka fällt mir ein, er hat dieses Gefühl in seinem Roman »Der Prozess« beschrieben. Die Hauptperson erfährt nicht, was sie sich hat zuschulden kommen lassen, und sie wird letztlich dennoch verurteilt. Geht es überhaupt um sie als Person? Das kann scheinbar weder Kafkas Romanfigur von der Institution Gericht noch ich von der Institution Klinik erwarten.
Bevor die Schwester das Gespräch beendet, nutze ich die Gelegenheit und frage nach den Wochenendregeln, damit ich mich danach richten kann. »Sprechen Sie bitte mit Frau Dr. S, die ist seine Bezugstherapeutin.« Das klingt eindeutig nach einem schnellen Ende des Gesprächs. Ich komme mir vor wie eine lästige Fliege.
Rufe [Schwester]
Ich rufe
Nach Antwort
In einen hohlen Raum Rufe ins Dunkel
In Leere
In Weiß
Ein Echo
Schallt
Zu mir zurück
Was war denn
Die Frage?
Ich hab sie vergessen
Ohne Raum und Zeit [Mutter]
Einmal machte ich mit meinem Sohn eine Rauchpause auf einem Parkplatz auf einer Anhöhe am See. Vor mir breitete sich der See aus, begrenzt und umrandet von verschneiten Bergen. Ich wusste, dass dieser Anblick schön ist. Aber ich fühlte nichts. Trotzdem war es wohltuend und entspannend, in die Weite zu schauen in eine harmonisch gestaltete Landschaft und die kalte Winterluft zu atmen. Denn in mir gab es keine Perspektive und keine Harmonie. Und kein freies Atmen.
Aus Versehen kam ich auf den Auslöser, als ich den Ausblick fotografieren wollte. Dabei entstand ein Foto, auf dem der Schnee auf dem Parkplatz, eine Spur von Autoreifen und ein einzelner Fußabdruck zu sehen waren.
Dieses Bild löste weder dort noch später Gefühle in mir aus. Aber es hatte durch Zufall genau meine Stimmung getroffen: der verschneite, kalte Boden, ein Auto als Heimstatt und ein Fuß, der keinen Kompagnon hat, der für sich steht, allein.
Kein Ausblick, keine Farbe, keine Welt, in die er gehört.
Aufpassen [Schwester]
Mein kleiner Bruder.
Sechster Stock.
»Kannst du bitte jetzt sehr, sehr gut auf mich aufpassen?«
Balkon, sechster Stock.
Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr.
Ich will nicht mehr.
Keine Kraft. Nicht die Macht.
Mein ganzes Leben hängt an diesem Moment. Ich kann nicht.
Wenn ich jetzt nicht aufpasse ...
Diese Ohnmacht!
Würde ich hinterherspringen?
Verantwortung abgeben? [Mutter]
Auch die Vorstellung, dass ein Psychiater Hilfe und Unterstützung geben kann in meiner verzweifelten Lage als Mutter, sollte bezweifelt und erschüttert werden. So wie nach und nach fast alles, was ich als Halt und Sicherheit bisher in meinem Kopf gespeichert hatte.
Ich rief ihn als Behandler meines Sohnes in seiner Praxis an, und seine Stimme klang freundlich. Auf die Information, dass mein Sohn sich auf der Geschlossenen befinde, antwortete er in fast freudigem Ton, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, die Verantwortung an die Fachleute abzugeben. Und dass man dies bei körperlich Kranken schließlich auch tun würde.
Nach meinem Gefühl war es genau das Gegenteil. Gerade jetzt, wo mein Sohn anderen anvertraut und gehandicapt war, keinen Vermittler und keinen Sprecher hatte, war ich zuständig, wurde ich von ihm gebraucht. Gerade jetzt, als die Überzeugung in mir zusammenbrach, für meinen Sohn etwas bewirken zu können, brach auch das noch zusammen: die Erwartung, dass ich von einem Experten wie ihm nicht nur seine fachlichen Einschätzungen zu hören bekäme, sondern auch nach meinen gefragt, angehört und in meiner Not unterstützt werden würde.
Was er mir sagte, entspricht der Standardüberzeugung in seinem Fachgebiet. Er war nicht der Einzige, der meinte, dass ich als Mutter die Verantwortung abgeben müsse. Verhält man sich als Angehörige tatsächlich so, wenn es sich um eine körperliche Krankheit handelt? War es denn ein Akt, den ich einseitig vollziehen musste? Und nicht ein Weg mit dem Kranken und den Helfern gemeinsam?
Der Horizont, der sich viel später auftat, als ich ganz langsam wieder auftauchte und mich sammeln konnte, lag in einer anderen Richtung. Dort ist es licht und frei und neben mir gehen andere, die denselben Weg haben, die meine Situation aus eigener Erfahrung kennen.
Und fast wie von selbst und ohne Anlauf entstanden dort in meiner Selbsthilfegruppe Wärme, Verständnis und Verbundenheit. Wie groß und wichtig war doch die Erfahrung, angenommen zu sein und endlich nicht mehr aus der Welt gefallen zu sein, sondern dazuzugehören.
Da und nicht da [Schwester]
Ich hatte meinen Bruder auf eine besondere Art verloren: Er war noch da, aber nicht mehr erreichbar. Es war erleichternd für mich, als jemand dieses Gefühl »Verlust« nannte.
Die Kommunikation mit meinem Bruder war nicht mehr auf die gewohnte Art möglich. Als der Bruder, den ich kannte, war er nicht mehr erreichbar. Er war da und nicht da. Angefühlt hat es sich wie ein Tod.
Angst und Verzweiflung [Mutter]
Ich lag spät abends im Bett und hatte Angst. An Schlafen war nicht zu denken, aber ich setzte mich unter Druck, schlafen zu müssen. Am nächsten Tag musste ich meinen Aufgaben gewachsen sein, die sich wie ein Berg vor mir auftürmten und meine Kräfte zu übersteigen schienen. Ich musste mit der Angst fertig werden, sie besiegen. Meine bisherigen Strategien scheiterten jedoch alle, weder autogenes Training wirkte noch Ablenkung, positive Sätze, Beten oder die Suche nach beruhigenden Einsichten. Alles war ungewiss, und ich fand keinen Halt. Es war wie ein anhaltender Schrecken. Vorstellungen, dass mein Sohn nie wieder gesund wird, dass er vielleicht diese Krise nicht überleben oder in der Klinik mit Medikamenten falsch behandelt werden würde, geisterten durch mein Gehirn.
Mein Körper war angespannt, und Angstgefühle bewirkten in meinem Körper eine Art von Aufregung, die sich wie eine Energie anfühlte, die der Hölle entwichen war und mich quälte. Zwischen den Horrorvorstellungen in meinem Kopf und der Angst, die wie Wellen durch meinen Körper ging, mal die Atmung behinderte, mal ein leichtes Vibrieren verursachte, entstand ein Hin und Her, wie eine Aufschaukelung. Wie kam ich nur aus diesem Zustand heraus?
Schließlich erinnerte ich mich an eine Lebensweisheit, ohne zu wissen, woher ich sie hatte: Wenn du etwas nicht ändern kannst, dann versuche, es zu akzeptieren. Ich lag also im Bett auf dem Rücken und versuchte wahrzunehmen, wie sich die Angst in meinem Körper anfühlte. Ich spürte die Wellen, die als Erregung und Vibrieren durch meinen Körper strömten, ich atmete stärker beim Anschwellen, um dem Strom Raum zu geben.





























