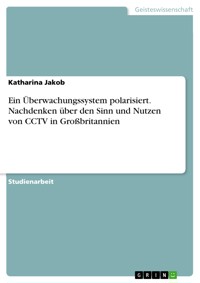9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Orcas, die die Sprache von Delphinen erlernen, oder Erdhörnchen, die näherkommende Menschen mit ihren Pfiffen bis hin zur T-Shirt-Farbe beschreiben: Tiere können denken, planen und kommunizieren, Werkzeuge nutzen und für den eigenen Gebrauch verändern, Nächstenliebe empfinden, sich die Zukunft vorstellen – und manche haben sogar ein Ich-Bewusstsein. Erstaunlich? Aber wahr! Ihre eindrucksvollen Erzählungen aus der unbekannten Welt der Tiere verbindet Katharina Jakob stets mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen – verblüffend und unterhaltsam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Orcas, die die Sprache von Delphinen erlernen, oder Erdhörnchen, die näherkommende Menschen mit ihren Pfiffen bis hin zur T-Shirt-Farbe beschreiben: Tiere können denken, planen und kommunizieren, Werkzeuge nutzen und für den eigenen Gebrauch verändern, Nächstenliebe empfinden, sich die Zukunft vorstellen – und manche haben sogar ein Ich-Bewusstsein. Erstaunlich? Aber wahr! Ihre eindrucksvollen Erzählungen aus der unbekannten Welt der Tiere verbindet Katharina Jakob stets mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen – verblüffend und unterhaltsam.
KATHARINA JAKOB
WARUM WALE FREMDSPRACHEN KÖNNEN
und andere erstaunliche Erkenntnisse über die geheimen Fähigkeiten der Tiere
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Für Quaddle
Inhalt
Vorwort von Randolf Menzel
Einleitung
Das Klassentreffen in Estoril
Große Wale: Die Wissenschaft der Anstrengungen
Hunde: Primus in Menschenkunde
Vögel: Grips mit einem gänzlich anderen Gehirn?
Tauben – geflügelter Beamtenfleiß
Rabenvögel – die gefiederten Affen, Teil eins
Papageien – die gefiederten Affen, Teil zwei
Wirbellose: Von Bienen, Kraken und allerhand Überraschungen
Bienen – haben sie eine innere Welt?
Kraken – die Aliens im Meer
Sprache: Der letzte Rubikon
Präriehunde: Mensch, langsam, groß, blau
Menschenaffen: Was unterscheidet uns?
Zukunftsmusik
Danke!
Publikationen
Vorwort von Randolf Menzel
Wir Menschen fühlen uns (anderen) Tieren weit überlegen. In der Tat komponieren Tiere keine Symphonien oder Schlager, bauen keine Autos, berechnen nicht die Tragfähigkeit von Brücken und denken nicht über ihre Wesenheit nach dem Tod nach. Diese und viele geistige Leistungen des Menschen sind das Ergebnis einer erst 20.000 bis 50.000 Jahre alten kulturellen Evolution, also sehr jungen Datums. Im Verlauf dieser kulturellen Entwicklung haben wir Menschen auch manches Wertvolle verloren. Wir können nicht mehr nach dem Magnetfeld der Erde, dem Sternenhimmel oder den Wellenbewegungen im Meer navigieren – von einigen indigenen Völkern in Australien und im Pazifik abgesehen. Wir kennen nicht mehr die Fülle der Heilmittel der Natur. Wir wissen nichts mehr von den zahllosen hilfreichen Methoden, um den Wettbewerb mit konkurrierenden Bakterien, Pilzen und Tieren im Ackerbau und in der Viehzucht ohne Chemie zu bestehen. Und in allerjüngster Zeit gibt es nur noch ganz wenige Spezialisten, die mechanische Uhren oder Dampfmaschinen reparieren können, ganz abgesehen von alten Handwerken wie dem Schmieden mit Hand- oder Fußblasebalg.
Mit Ausnahme dieser Verluste war die kulturelle Evolution des Menschen eine großartige Geschichte der Erfolge. Diese Errungenschaften verstellen manchmal den Blick auf die Tiere, denn sie sind uns in vieler Hinsicht auch überlegen. Wer von uns Menschen läuft schon so schnell wie ein Gepard? Niemand von uns kann ohne Hilfsmittel das prächtige Muster an polarisiertem Licht des blauen Himmels sehen, wie das die Insekten können. Wir können nicht mit Ultraschall in der Nacht im schnellen Flug nach Motten jagen wie die Fledermäuse. Wer von uns kann schon laufen, schwimmen und fliegen, ohne technische Hilfsmittel wie der Rückenschwimmer Notonecta, ein Käfer. In diesem Buch finden Sie eine Fülle von beeindruckenden Beispielen für Sinnesleistungen und Verhaltensweisen von Tieren, die wir nur bewundern können, wenn wir sie mit den eingeschränkten Fähigkeiten des Menschen vergleichen.
Aber wie steht es mit den geistigen Fähigkeiten von Tieren, ihrem Lernvermögen, ihrem Gedächtnis für lang zurückliegende Ereignisse oder für Regeln, die erst aus einer Vielzahl von Lernereignissen extrahiert werden können? Können denn Tiere auch planen, vorausschauend entscheiden und sich über komplexe Ereignisse in der Umwelt informieren? Haben sie Erwartungen, die über Belohnungslernen hinausgehen? Darwin war sich sicher, dass Tiere über mentale Fähigkeiten verfügen, die sich nicht prinzipiell von denen der Menschen unterscheiden. In seinem Buch Die Abstammung des Menschen und die Auswahl im Verhältnis zur geschlechtlichen Fortpflanzung (The Descent of Man and Selection in Relation to Sex), 1871, schreibt er: »Es gibt keinen fundamentalen Unterschied zwischen Menschen und nicht menschlichen Tieren. … Die niederen Tiere können angenehme Gefühle und Schmerz, Freude und Pein empfinden wie der Mensch.« Aber lassen sich solche sehr pauschalen Urteile experimentell belegen?
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war in der aufblühenden experimentellen Verhaltensforschung geprägt von einer tiefen Skepsis gegenüber vermenschlichenden Beschreibungen und Interpretationen. Seit dem Schock, den die Verhaltensbiologie mit dem Klugen Hans, einem »rechnenden« Pferd, erfahren hat, ist die objektive, ausschließlich beschreibende und nicht interpretierende Datenerfassung verbunden mit einer mathematischen Formalisierung, eine zentrale und schwierige Aufgabe der Verhaltensbiologie. Dieses Bemühen um formalisierte Objektivität hat mancherlei Blüten getrieben: Zum Beispiel wurden Begriffe wie Gedächtnis, Gehirn, Ich-Erlebnis, Absicht, Planen aus dem Sprachgebrauch der experimentellen Psychologen der behavioristischen Schule in den USA verbannt. Auch auf dem Gebiet der individuellen Anpassung des Verhaltens durch Lernen war das blinde Auge der Ethologen, der Verhaltensforscher, eher hinderlich als hilfreich. Die Stärke der Ethologie, die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu studieren und die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Tierarten in die Betrachtung einzubeziehen, wurde durch die Fokussierung auf angeborene Verhaltensweisen eingeschränkt. Dieses Einschränken aber förderte wiederum das Aufdecken der Bedeutung von angeborenen Verhaltensweisen.
Diese historischen Begrenzungen überwand die Wissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten in vorsichtigen Schritten. Manche Verhaltensbiologen sprechen euphorisch von einer kognitiven Wende. Beigetragen haben dazu zwei Entwicklungen: Zum einen die Sammlung einer riesigen Fülle von ganz erstaunlichen Leistungen von Tieren, die über besondere Anpassungen ihrer Sinnesorgane und ihrer Verhaltensmuster hinausgehen. Sie legt den Schluss nahe, dass es sich um kognitive, der entsprechenden Tierart angemessene mentale Leistungen handelt. Dafür finden Sie in diesem Buch eine große Zahl von Beispielen. Lassen Sie sich davon in den Bann ziehen. Die zweite Entwicklung, die diese entscheidende Wende in der Verhaltensbiologie befördert hat, ist der Erfolg der Neurowissenschaft. Die Gehirnforscher finden vielfältige Parallelen bei den Vorgängen, die sich im Hirn von Mensch und Tier abspielen. Und dies beobachten Neurobiologen nicht nur bei Säugetieren und Primaten, die dem Menschen evolutiv recht nahestehen, sondern auch bei Schnecken und Insekten. Bei der Beschreibung der kognitiven Fähigkeiten von Tieren ist es häufig nicht vermeidbar, Begriffe zu verwenden, die den Eindruck erwecken, Tiere würden vermenschlicht. In all diesen Fällen ist es besonders wichtig, die kritische Distanz des aufmerksamen Lesers beizubehalten. Bedenken Sie dabei, dass wir Menschen uns eben nur in einer menschlichen Sprache verständlich machen können. Unsere Sprache hat sich entwickelt, um die detailreiche Verständigung zwischen uns zu ermöglichen, nicht, um die Beziehung der Tiere untereinander zu erklären. Ein vermenschlichend klingender Begriff bedeutet deshalb nicht, dass bei dem betreffenden Tier Gehirnvorgänge angenommen werden müssen, die denen des Menschen entsprechen. Es könnte sehr wohl sein, dass es sich bei dem erstaunlichen Verhalten des Tieres um das Zusammenspiel einfacherer kognitiver Leistungen handelt, als der Begriff – und unsere subjektive Erfahrung – nahelegt. Solche Überlegungen führen dazu, die entsprechenden menschlichen kognitiven Leistungen genauer zu betrachten. Es könnte nämlich sein, dass auch beim Menschen das Denkvermögen, als einheitlich empfundene geistige Fähigkeit, ein Zusammenspiel von recht einfachen kognitiven Teilleistungen ist.
Beschreibungen des Tierverhaltens mit den Begriffen unserer zwischenmenschlichen Verständigung können daher nur der erste Versuch einer Erklärung sein. Worin sich Erwarten, Planen, Entscheiden, Schmerz, Ich-Erlebnis, Empathie, Freude, Aggression, soziale Verständigung bei einer bestimmten Tierart von den entsprechenden kognitiven Fähigkeiten des Menschen oder anderer Tierarten unterscheiden, ist eine offene Frage. Sie verlangt sehr sorgfältiges Experimentieren. Hier kommt uns die Neurowissenschaft zu Hilfe, denn wenn sich zeigt, dass diesen Fähigkeiten das Zusammenspiel von Gehirnarealen zugrunde liegt, die in entsprechender Weise auch bei der untersuchten Tierart zu finden sind, wird eine tragfähige Brücke geschlagen. Diese eröffnet den Zugang zu den Gehirnmechanismen, die allen kognitiven Vorgängen bei Tier und Mensch zugrunde liegen und sich im Verlauf der biologischen Evolution herausgebildet haben. Allerdings ist die Neurowissenschaft noch weit davon entfernt, die nötigen Daten zur Verfügung zu stellen. Erkenntnisse dieser Art ordnen den Menschen dort ein, wo er biologisch steht, in der Evolutionsreihe der Tiere. Der Gewinn einer solchen Betrachtungsweise ist für den Menschen von noch viel größerer Bedeutung als für die Erklärung einer erstaunlichen kognitiven Fähigkeit einer Tierart. Aus diesem Grund ist die vergleichende Betrachtung kognitiver Fähigkeiten bei Tier und Mensch von so grundsätzlicher Bedeutung für das Verständnis von uns selbst. Weder der Mensch wird dabei tierhaft reduziert, noch wird das Tier vermenschlicht.
Die emotionale Beziehung zu einem Tier kann für das Verständnis seiner kognitiven Fähigkeiten gleichzeitig fördernd und hemmend sein. Fördernd in dem Sinne, dass wir uns besonders tief in seine Wahrnehmung, seine Erfahrungsgeschichte und seine nächsten Verhaltensweisen hineindenken können. Für einen erklärenden Ansatz allerdings braucht es auch den nötigen Abstand, sozusagen den neutralen analytischen Blick. Die moderne Verhaltensbiologie sucht nach einer Balance in diesem Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld wird in diesem Buch aus den Beschreibungen der Gespräche mit ausgewählten Forschern deutlich, ihren Denkweisen, ihrem Umgang mit den Problemen und Fragen, denen sie sich stellen, und der Art und Weise, wie sie mit ihren Versuchstieren umgehen. Der Leser wird so zu einem Kumpan in der Forschungslandschaft, die er gemeinsam mit der Autorin und den agierenden Wissenschaftlern durchstreift, und er wird dabei viel Neues entdecken.
Einleitung
Dieses Buch handelt von Tieren. Von ihren erstaunlichen Fähigkeiten, die lange Zeit verborgen geblieben sind und von der Forschung nun in immer kürzeren Abständen aufgedeckt werden.
Aber nicht nur.
Es handelt auch von unserem Blick auf Tiere, der sich innerhalb weniger Jahrzehnte grundlegend verändert hat. Das weiß jeder Hundehalter, der sich heute nicht mehr retten kann vor Wellnessangeboten rund um seinen Vierbeiner. Noch in den Siebzigerjahren lebten viele Hunde hierzulande in Zwingern, und kein Mensch sprach von ihrem seelischen Wohlbefinden.
Wie kommt dieser Wandel zustande? Plötzlich interessieren wir uns für das Innenleben von Insekten. Wir schwimmen mit Delfinen und buchen Whale-Watching-Touren, weil uns der Anblick einer Pottwal-Fluke in Ekstase versetzt. Weiß noch jemand, dass das offizielle Walfangmoratorium erst vor rund 30 Jahren in Kraft trat? Und dass bis dahin das Abschlachten der Meeressäuger gang und gäbe war? Nicht nur betrieben von einzelnen Nationen wie heute.
Was also ist passiert?
Unsere wesentlichen Informationen über Tiere stammen aus der Wissenschaft. Und dort hat sich in den vergangenen Jahrzehnten – von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt – ein Paradigmenwechsel vollzogen, ein grundlegender Wandel der Anschauungen und der Herangehensweise. Noch um 1970 war es für einen Verhaltensforscher undenkbar, von tierischer Intelligenz zu sprechen. Oder von Gefühlen, die ein Tier haben könnte. Für die Wissenschaft waren Tiere vor allem instinktgesteuerte oder konditionierte, also mehr oder weniger dressierte Geschöpfe, die der Mensch turmhoch überragte. Und jetzt?
Jetzt sprechen Biologen und Verhaltensforscher wie selbstverständlich von »nicht menschlichen« und »menschlichen Tieren« – mit Letzteren sind wir gemeint. Sie ordnen uns in die Klasse der Säugetiere ein, sodass wir nicht mehr gesondert dastehen, sondern uns auf Augenhöhe mit anderen Säugern befinden. Das ist eine Zeitenwende in der Wissenschaft, die man gar nicht hoch genug bewerten kann. Sie räumt ein, dass nicht die Tiere beschränkt sind, sondern dass unsere Vorurteile und mitunter dürftigen Untersuchungsmethoden den Blick auf sie verstellt haben. Das ist ein bisschen so, als habe jemand einen Vorhang zur Seite gezogen, und nun strömen Licht und Luft durch weit geöffnete Fenster. Auf einmal lautet die Frage: Was werden wir herausfinden, wenn wir uns keine Denkverbote mehr auferlegen?
Seitdem erreichen uns Forschungsergebnisse, die verblüffend sind. Wir lesen von Tauben, die Rechtschreibregeln begreifen. Von Bienen, die vielleicht träumen können. Und von Kraken mit einem beträchtlichen Lernvermögen. Es zeigt sich bei Tieren aller Klassen – nicht nur bei den Säugetieren, sondern auch bei Fischen, Vögeln und Insekten – immer mehr von dem, was man einst nur Menschen zugetraut hatte. Und das Beruhigende ist, dass dabei keine Esoteriker am Werk sind, sondern ernsthafte Wissenschaftler, die fragen, prüfen, zweifeln, sich gegenseitig kontrollieren. Und die ihre Ergebnisse mehr und mehr zugänglich machen, auf kostenfreien Portalen im Internet.
Das heißt nicht, dass unsere tierischen Mitgeschöpfe genau so sind wie wir. Die Unterschiede sind ganz erheblich. Aber die tierischen Fähigkeiten bekommen nun allmählich den Platz, der ihnen zusteht. Weil sie nicht mehr von vornherein als minderwertig gelten, sondern als das, was sie hauptsächlich sind: anders. Von einer ganz eigenen Komplexität. Der Münsteraner Verhaltensbiologe Norbert Sachser bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: »Wir dürfen nicht erwarten, dass die Emotionen beim Tier eins zu eins dieselben sind wie beim Menschen. Emotionen sind durch die natürliche Selektion hervorgebracht worden, durch die Anpassung an den Lebensraum. Es kann also sein, dass Tiere Emotionen haben, die wir gar nicht kennen.«
Das gilt auch für ihre kognitiven Leistungen. Besonders bei den Mitgeschöpfen, die noch über ganz andere Sinne verfügen als wir. Etwa Fledermäuse, die sich per Echo-Ortung in ihrer Welt orientieren – und damit vielleicht auch kommunizieren, wie die Bioakustikerin Anna Bastian aus Südafrika gerade untersucht. Oder Bienen, die im Gegensatz zu uns das polarisierte Sonnenlicht sehen können. Oder auch Hunde, die vermutlich die Magnetfelder der Erde wahrnehmen.
Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Fragen solcher Art, wie sie als Erster der amerikanische Philosoph Thomas Nagel stellte, kursieren heute unter Verhaltensforschern. Auch wenn sie wissen, dass es darauf keine Antwort gibt, denn Menschen können nicht aus ihrer Haut. Wir werden wohl nie herausfinden, was es heißt, wie eine Fledermaus zu fühlen, zu denken und in der Welt zurechtzukommen. Aber allein diese Frage zeigt, wie sehr sich die wissenschaftliche Haltung gegenüber Tieren verändert hat. Der Mensch als Krone der Schöpfung ist ein wenig demütiger geworden und in seinen Annahmen vorsichtiger. Er blickt nicht mehr von oben auf seine Studienobjekte herab, sondern sucht nach einer wirklichen Annäherung. Und ist damit besser imstande, die tierische Welt zu verstehen.
So wissen wir inzwischen, dass die Natur nicht nach und nach Geschöpfe hervorgebracht hat, die immer klüger wurden, mit dem Giganten Mensch am Ende, sondern dass sie zu unterschiedlichen Zeiten und in vielen Arten ganz unabhängig voneinander das Licht angeknipst hat. Etwa in Vögeln, deren Ast am evolutionären Stammbaum sich schon vor mehr als 300 Millionen Jahren von unserem entfernte und deren Gehirne anders aussehen als unsere. Ihnen fehlt der Cortex, die Hirnrinde, die uns das Denken ermöglicht. Weswegen man in früheren Zeiten dachte, dass sie besonders tumbe Gesellen sein müssten, so etwas wie instinktgelenkte Automaten. Dabei sind einige Vogelarten zu Denkleistungen imstande, die an die von Primaten heranreichen. Das hat ihnen auch einen neuen Beinamen eingetragen: »gefiederte Affen«.
All das hätten wir nicht erfahren, wenn sich die Wissenschaft vom Tier nicht so umfassend gewandelt hätte. Aber Forschung wird immer von Menschen gemacht. Deshalb lohnt es sich, auch einmal einen Blick auf diejenigen zu werfen, die so viel Neues aus der tierischen Welt ans Tageslicht holen. Meistens bekommt man sie ja nicht zu Gesicht, dabei gehören Verhaltenskundler, Biologen und Neurowissenschaftler zu einer bemerkenswerten Spezies. Egal, ob sie leutselig sind oder verschlossen, ob sie ihre Heureka-Momente haben oder jahrzehntelang tapfer vor sich hin gründeln, um einiger weniger Puzzleteile willen: Die meisten betreiben ihre Forschung mit unglaublicher Inbrunst. Sprechen sie von ihren Tieren, vergessen sie die Zeit. In vielen Büros habe ich Stunden zugebracht, ohne dass mein Gegenüber auch nur den Anschein von Müdigkeit gezeigt hätte. Oder mal einen Kaffee gebraucht hätte. Und kommen sie auf einem Branchentreffen zusammen, etwa dem Kongress namens »Behaviour«, der nur alle zwei Jahre stattfindet und von dem gleich noch die Rede sein wird, dann flitzen knapp tausend Forscher – Superstars wie Nachwuchskräfte – im Halbstundentakt von Vortrag zu Vortrag. Eine Woche lang, von frühmorgens bis abends. Oder besser gesagt: bis der Sicherheitsdienst sie sanft zur Tür hinausschiebt.
Begleiten wir sie für einen kurzen Moment. Denn ein Kongress ist der Umschlagplatz schlechthin für alle neuen Informationen aus der Tierforschung. Nirgendwo sonst kommt auf so kleinem Raum so geballtes Wissen zusammen. Manches ist derart neu, dass darüber nicht berichtet werden darf. Anderes ist längst bekannt, nur dass es bislang an Beweisen gefehlt hat. Und jetzt endlich scheinen sie gefunden.
Auf solchen Tagungen werden jedoch nicht nur Forschungsergebnisse geteilt. Sondern auch Positionen bestimmt. Wo steht die Branche derzeit? Ist das Thema tierische Intelligenz, im Fachjargon animal cognition, immer noch ganz oben auf der Hitliste wie seit fast fünfzehn Jahren? Was im Übrigen kein schlechtes Zeichen für ein Fach wäre, in dem Studenten noch Anfang der Achtzigerjahre durch Prüfungen fielen, wenn sie das Wort »Denken« bei Tieren auch nur in den Mund nahmen.
Wer die Forschung vom Tier mitverfolgen will, kommt um ein paar Fachbegriffe nicht herum. Sie mögen sperrig sein, aber man hat es ja auch mit einer Wissenschaft zu tun, die in unbekanntes Terrain vorstößt. Da sind die Wege längst noch nicht ausgeleuchtet, und Landkarten gibt es auch kaum. Umso wichtiger wird eine klare Sprache, die halbwegs von allen verstanden wird. Auf der »Behaviour«, diesem Klassentreffen der Verhaltensforscher, gibt es ausreichend Gelegenheit, sie zu lernen.
Die jüngste Konferenz fand im August 2017 statt, in einem kleinen portugiesischen Küstenort namens Estoril, nahe Lissabon. Sie war eine der größten in der 65-jährigen Geschichte der »Behaviour«. Der erste Kongress dieser Art, der damals noch ganz anders hieß, wurde 1952 in Deutschland abgehalten, direkt bei Konrad Lorenz’ Forschungsstätte, dem Vater der klassischen Verhaltensforschung. Damals kamen etwa 80 Forscher zusammen. Nun waren es rund 950 Teilnehmer aus 45 Ländern.
Was sind das für Leute, woran forschen sie im Augenblick? Und was verbirgt sich hinter den Begriffen wie Theory of Mind, Mental Time Travel oder Episodic-like Memory, die sie nutzen? Ziemlich Aufregendes, selbst für die nüchterne Wissenschaft. Zum Beispiel der Nachweis, dass Rabenvögel wissen, was ein anderer weiß. Oder das Ende vom Gerücht, Hunde hätten kein Zeitgefühl.
Aber sehen Sie selbst.
Das Klassentreffen in Estoril
Eine zierliche Dame fortgeschrittenen Alters geht durch die Eingangshalle des Kongresscenters in Estoril, Portugal. In ihre langen Haare hat sie eine Sonnenbrille geschoben. Sie trägt einen Minirock, dazu einen pinkfarbenen Blazer. An ihren Armen klirren unzählige silberne Reifen. Die Finger sind mit Ringen bestückt, eine große Strassbrosche schimmert am Revers, und auch in den Ohren trägt sie Funkelndes. Irene Pepperberg glitzert wie ein Weihnachtsbaum, mitten im Sommer. Fast meint man, den Graupapagei Alex auf ihrer Schulter sitzen zu sehen. Dabei ist der seit 2007 nicht mehr am Leben. Mit Alex ist die Vogelexpertin aus Harvard weltberühmt geworden, und das zu Recht. Bis zum heutigen Tag ist der Papagei so etwas wie der Wappenvogel der Verhaltensforscher.
Irene Maxine Pepperberg kommt zwei Tage zu spät zum Kongress, aber ihr Alex ist schon da. Er ist Thema in unzähligen Vorträgen. Immer wenn es um Genie-Leistungen von Tieren geht, fällt sein Name zuerst. Selbst Verhaltensforscher, die sich sonst zurückhalten, wenn von tierischer Intelligenz die Rede ist, weil sie der Ansicht sind, das Wort »Intelligenz« müsse den Menschen vorbehalten sein, machen bei Alex eine Ausnahme. »Bis auf diesen verdammten Vogel« ist ein – buchstäblich – geflügeltes Wort. Was so viel heißt wie: Könnte man allen Tieren ihre Denkleistungen absprechen, bei diesem Graupapagei müsste man doch kapitulieren, denn zu bedeutend war alles, was der Kerl draufhatte. Im Kapitel über Papageien wird mehr über ihn zu lesen sein und über seine beiden Nachfolger.
Durchblättert man das dicke Buch des Tagungsprogramms, fällt auf, dass die derzeit kniffligsten Fragen der Verhaltensforschung vor allem an Vögeln durchdekliniert werden. Im April 2016 haben zwei Wissenschaftler – der Biopsychologe Onur Güntürkün aus Bochum und der Biologe Thomas Bugnyar aus Wien – in einer umfangreichen Arbeit zusammengefasst, warum die kognitiven Leistungen von Rabenvögeln und Papageien in vielerlei Hinsicht mit denen von Menschenaffen vergleichbar sind. Das und die Tatsache, dass ihre Haltung sehr viel einfacher ist als die von Primaten, macht die Forschung mit ihnen so vielversprechend. Etwa zur legendären Theory of Mind.
Theory of Mind – die Welt aus den Augen eines anderen sehen
Kaum ein Begriff ist in der Verhaltensforschung so umstritten wie Theory of Mind. Das lässt sich nur etwas lahm übersetzen mit »Theorie des Geistes« oder »Theorie des Bewusstseins«. Damit ist gemeint, dass ein Lebewesen eine Vorstellung hat vom Bewusstsein anderer. Dass es weiß, wie die Welt aus den Augen eines anderen aussieht. Zur Theory of Mind gehört auch, bei anderen ein bestimmtes Wissen zu vermuten, das dann in die eigenen Handlungen miteinbezogen wird.
Selbstredend hat man solche Fähigkeiten früher nur dem Menschen zugeschrieben. Doch beim Verstecken von Futter, wie es Raben und andere Rabenvögel tun, sind sie entscheidend. Die Vögel stehen regelmäßig vor dem Problem, dass ihre Nahrungsdepots von Artgenossen leer geräumt werden. Daher müssen ihre Verstecke gut sein. Aber das allein reicht eben nicht. Da Raben – als nichtbrütende Jungtiere – in Gruppen leben, sind sie meist von ihresgleichen umzingelt. Ein Tier, das seine Beute in Sicherheit bringen will, muss also erkennen: Wenn der andere da oben im Baum hockt, kann er dann aus seinem Blickwinkel sehen, wo ich mein Futter hintrage? Im Rabenkapitel wird sich zeigen, dass es nun einen soliden Nachweis für eine Theory of Mind bei Rabenvögeln gibt. Aber auch, dass es dazu mehrerer Anläufe bedurfte.
Mental Time Travel – die Zeitreise in Gedanken
Dabei geht es um die Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft. Auch das hat man lange nur dem Menschen zugebilligt. Tiere lebten im Hier und Jetzt, hieß es, sie hätten kein Gespür für die Zeit. Was von vornherein eine seltsame Behauptung war. Denn Zeitempfinden ist für viele Tierarten schlicht notwendig, um den Winter zu überstehen. Wer Vorräte anlegt und sie Monate später wiederfindet, kann nicht gänzlich ohne einen Sinn für Zeit sein. Doch wie beweisen?
In einem sommerlich schwingenden Blumenkleid betritt Nicola Clayton die Bühne des Auditoriums im Kongresscenter von Estoril. Die Britin ist Professorin an der Universität von Cambridge und eine weltweit anerkannte Expertin für Rabenvögel. Die 54-Jährige hat ein Talent, sehr einfache und zugleich sehr schlüssige Versuchsanordnungen zu schaffen. Und kommt dadurch zu erstaunlichen Ergebnissen. Clayton arbeitet vorwiegend mit Buschhähern. In mehreren Studien hat sie nachgewiesen, dass diese Vögel tatsächlich ein Gespür für die Zukunft haben, dass sie sich vorstellen können, was passieren wird. Und dass sie ihr Verhalten danach ausrichten. Sie lässt ein Video abspielen, das zwei Buschhäher zeigt, die in einem dreigeteilten Käfig sitzen.
Diese Häher haben sechs Tage in dem Käfig zugebracht und konnten sich in allen Bereichen frei bewegen. Überall lag Futter für sie aus. Zur Nachtruhe wurde jeder in einen der beiden Außenkäfige gesetzt. Und dort passierte Folgendes: Wenn der Morgen anbrach, gab es in einem der Räume ein Frühstück, im anderen nicht. Der Pechvogel, der im Raum ohne Futter saß, musste warten, bis der Vormittag verstrichen war. Dann gingen die Türen wieder auf, und überall war Futter verfügbar. Nur eben nicht in diesem einen Raum, früh am Morgen. Das war der sogenannte »Fastenraum«. Beide Vögel machten nun an jeweils drei Vormittagen die Erfahrung, dass sie Pech oder Glück haben konnten, dass sie hungrig bleiben mussten oder etwas zu fressen bekamen. Und dass der entscheidende Faktor dieser Käfig war, in den sie abends gesperrt wurden. Im Verlauf des Experiments ging jeder Vogel dreimal morgens leer aus, und dreimal durfte er frühstücken.
Nach sechs Tagen erhielten die Buschhäher Körnerfutter, das sie verstecken konnten, wie sie es oft und gern tun. Und genau das setzten sie sofort in die Tat um. Auch wenn keiner der Häher wusste, wo er die kommende Nacht verbringen würde – jeder sorgte für den Fall vor, dass er der Unglücksrabe sein würde, der im Fastenraum landete. Als der Abend anbrach, lag dort fünfmal mehr Körnerfutter als im Frühstücksraum. »Sie haben das nicht durch Versuch und Irrtum gelernt. Auch nicht dadurch, dass man sie fürs Futterverstecken belohnt hat. Sie haben ihre eigenen Schlüsse gezogen«, sagt Clayton, als das Video endet und es im Saal wieder hell wird.
Episodic-like Memory – das episodische Gedächtnis
Ganz ähnliche Versuche hat die Britin durchgeführt, um bei ihren Buschhähern auch ein episodisches Gedächtnis nachzuweisen. Das ist ein Teilaspekt aus dem Bereich von Mental Time Travel und meint die Fähigkeit, sich an Erlebtes zu erinnern. Also gedanklich in die Vergangenheit zurückzugehen und sein Verhalten darauf abzustimmen. Wie Buschhäher es tun. Sie wissen offenbar, wann welches Futter, das sie versteckt haben, so verdorben ist, dass sich die Suche danach nicht mehr lohnt. Maden zum Beispiel, die ein ganz anderes Verfallsdatum haben als Nüsse. Ist ein bestimmter Zeitraum überschritten, suchen Buschhäher ihre Madenverstecke nicht mehr auf, auch wenn Maden sonst zu ihren Lieblingshappen zählen. Nussverstecke hingegen werden weiterhin angesteuert.
Aber auch andere Tiere haben inzwischen sehr eindrücklich ein episodisches Gedächtnis gezeigt. Hunde etwa, wie die Biologin Claudia Fugazza herausgefunden hat. Mehr davon im Kapitel über Hunde.
Die Schwierigkeit der richtigen Frage
Jetzt sitzt Pepperberg im größten Saal des Kongresscenters und hört einer jungen Kollegin aus Spanien zu, die ebenfalls mit Papageien arbeitet. Sie ist der Frage nachgegangen, ob ihre Vögel den Sinn eines Tauschhandels begreifen. Kriegen sie es hin, Symbole gegen Fressbares einzutauschen? Können sie sogar ökonomische Entscheidungen treffen, indem sie den Wert ihres Einsatzes steigern?
Das ist eine hochgradig anspruchsvolle Studie, und vielleicht hat die Forscherin damit zu viel gewollt. Denn zunächst müssen die Papageien Symbole lernen, die für bestimmtes Futter stehen. Die Tiere selbst haben klar erkennbare Vorlieben: Walnüsse sind für sie echtes Super-Food, dafür lassen sie alles stehen und liegen. Sonnenblumenkerne sind auch nicht schlecht, aber längst nicht so begehrt wie die Nuss. Maiskorn hingegen nehmen sie nur, wenn nichts anderes da ist. Es gibt also heiß geliebtes Futter, mittelmäßiges und solches, das nur noch »na ja« ist.
Im nächsten Schritt lernen die Papageien, ihre Vorlieben in Symbole zu übersetzen. Ein Plastikring steht für die Walnuss, also den Jackpot. Ein Haken symbolisiert das mittelprächtige Futter Sonnenblumenkern. Ein u-förmiges Objekt repräsentiert das eher unbeliebte Maiskorn.
Und tatsächlich, so das Ergebnis der Studie, hantieren die Vögel eifrig mit den Symbolen. Sie setzen sie auch zum Tauschen ein, machen sich also nicht sofort über das Futter her, sondern wählen zwischen Fressbarem und Objekten aus. Aber wie?
Manchmal wirkt der Tauschhandel sinnvoll, weil er den Papageien-Vorlieben entspricht. Und manchmal wundert man sich. Da wählt ein Vogel den Plastikring, der die Walnuss symbolisiert, obwohl er auch die echte Nuss hätte haben können.
Am Ende des Vortrags gibt es lang anhaltenden Beifall. Und Fragen.
Etwa von Irene Pepperberg. Ob die Forscherin, will sie wissen, in ihrer Arbeit berücksichtigt habe, wie verspielt Papageien sind? Dass es ihnen häufig gar nicht um die Belohnung geht, sondern um das Spiel an sich? Möglicherweise waren die Tiere mehr in den Tauschhandel vernarrt als in ihre Futterbelohnung.
Damit spricht die Grande Dame der Verhaltensforschung ein heikles Thema an: die Versuchsanordnung. Sie gehört zu den größten Herausforderungen für Verhaltenskundler und ist einer der Gründe, warum die Wissenschaft vom Tier so schwierig ist. Denn wie übersetzt man seine Frage in ein Experiment, das eine Antwort überhaupt ermöglicht? Das nicht irgendwohin abzweigt, wo man sich in einem Informationsgestrüpp verheddert, das mit der Ausgangsfrage nichts mehr zu tun hat? Die große Kunst besteht darin, einen Versuch so aufzubauen, dass er genau das beantworten kann, wonach man gefragt hat.
Der Kluge Hans
Und selbst das reicht nicht aus. Jeder Forscher muss bei seinen Experimenten auch verhindern, dass Tiere ihre Informationen aus ganz anderen Quellen beziehen als beabsichtigt. Bei allem, was Ethologen, sprich Verhaltensforscher, tun, steht eine Kreatur aus früheren Zeiten unsichtbar im Raum und wackelt mit dem Kopf. Es ist das Pferd namens Kluger Hans: Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts zog ein Lehrer mit seinem Trakehnerhengst durch Berlin, der angeblich so schlau war, dass er zählen konnte. Und nicht nur das, er konnte sogar Rechenaufgaben lösen. Fragte man das Pferd, wie viel ist zwei mal zwei, klopfte es viermal mit seinem Huf auf den Boden oder nickte viermal mit dem Kopf. Das Tier war eine Sensation, bis sich herausstellte, worin sein eigentliches Können bestand: Es las aus den Mienen der Umstehenden ab, wann es die richtige Anzahl erreicht hatte, und stellte dann das Klopfen ein. Winzigste Nuancen an Kopf- und Gesichtsbewegungen genügten ihm. Eine Meisterleistung in Menschenkunde – aber keine in Mathematik.
Vor allem bei Hunden ist das immer wieder ein Thema. Die Tiere sind derart fortgeschritten in ihrem Können, Menschen zu lesen, dass bei ihnen ständig der Kluge-Hans-Effekt zuzuschlagen droht.
Mühen und Fallstricke kommen in der Forschung vom Tier also zuhauf vor. Und so gibt der Abschlussredner der »Behaviour«, der indische Insektenforscher Raghavendra Gadagkar, allen Kollegen im Raum eine Mahnung mit auf den Weg: »Wie man Wissenschaft betreibt, ist genauso wichtig wie das, was dabei herauskommt.«
Es ist gut möglich, dass einige der Studien in diesem Buch irgendwann oder in naher Zukunft von anderen Arbeiten widerlegt werden. Das ist Alltag in der Wissenschaft. Was hier vorgestellt wird, ist nichts anderes als der aktuelle Stand der Dinge. Und der kann morgen schon wieder ein anderer sein.
Gadagkar, der mit seinen Wespenstudien weltberühmt wurde, hat vor einiger Zeit noch etwas gesagt, das gut dazu passt – wie auch zum Thema dieses Buches. Das war 2015 in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung: »An einer Theorie festzuhalten, nur weil man sie einmal vertreten hat, ist nicht Wissenschaft.«
Große Wale: Die Wissenschaft der Anstrengungen
Menschen lieben Wale, viele verehren sie geradezu. Dabei ist es noch nicht so lang her, dass die Tiere als blutige Masse auf den Schiffsplanken der Walfänger lagen, um als Margarine oder Lampenöl zu enden. Heute genießen Pottwal, Buckelwal und Blauwal einen fast mystischen Ruf. Dafür haben vor allem die Gesänge der Buckelwale gesorgt. Aber was weiß man wirklich über die gewaltigen Meeressäuger? Und vor allem: Wie kommt dieses Wissen zustande?
Die Wissenschaft vom Wal hat einen verheißungsvollen Klang. Doch statt Abenteuer auf hoher See erwartet die Forscher in erster Linie ein riesiges Geduldsspiel. Eine Art Hunderttausend-Teile-Puzzle aus Fragmenten, die alle gleich aussehen und nur ganz langsam einen Bildausschnitt zeigen. Manch ein Biologe hat Jahrzehnte seines Lebens drangegeben, und am Ende steht ein gucklochkleiner Einblick in die Welt der großen Meeressäuger.
Woran liegt das? Vor allem daran, dass Wale uns so fremd sind. Ihre Welt ist vollständig anders als unsere. Pottwale und Co. kann man nicht in Gefangenschaft halten, ihr Verhalten lässt sich nur mühsam beobachten, da sich ihr Leben unter Wasser abspielt. Oder gar gleich in der Tiefsee.
Hinzu kommen die Weite des Lebensraums und die geschrumpften Bestände vieler Walarten. Bis zum heutigen Tag haben sich etliche von der jahrhundertelangen Jagd kaum erholt. Noch immer erreicht die Population der Blauwale im Antarktischen Ozean nur einen Bruchteil ihrer einstigen Größe. Etwa 2000 Tiere sind es heute, von einstmals um die 350.000. Andere Spezies stehen direkt vor der Ausrottung, wie der Atlantische Nordkaper, dessen Populationen nur noch rund 450 Tiere umfassen.
Die meisten sind unstete Wanderer. Sie ziehen als Nomaden durch die Ozeane, manchmal über den halben Globus. Ihre Routen liegen weitgehend im Verborgenen. So haben Wissenschaftler erst im Jahr 2013 überhaupt eine Ahnung davon bekommen, wohin sich Südliche Minkwale neun Monate im Jahr zurückziehen könnten. Bis dahin waren die Tiere immer nur im australischen Sommer vor dem Great Barrier Reef gesichtet worden. Dann verschwanden sie für ein Dreivierteljahr vollständig von der Bildfläche. Erst als man einzelne Minkwale mit Ortungsgeräten versah, konnten diese von der australischen Marine verfolgt werden – auf ihrem Weg in den Süden, wo sie innerhalb von 30 Tagen rund 3000 Kilometer zurücklegten.
Aber auch Walpopulationen, die man als resident bezeichnet, weil sie ein Habitat vor einer Insel oder einer Küste besiedeln, halten sich dort nicht die ganze Zeit auf. Sie streifen in einem Radius von mehreren Hundert Kilometern durch ihr Gebiet.
Man muss die großen Wale also erst einmal suchen. Und wenn man sie gefunden hat, lassen sie sich nur schwer beobachten. Ihr soziales Leben spielt sich in wenig zugänglichen Bereichen ab. Was bedeutet, dass ihre Erforschung enorm kostspielig ist und längst nicht so umfassend betrieben wird, wie man vielleicht meinen könnte, gemessen an der Popularität der Tiere.
Eine 2012 veröffentlichte Weltkarte macht die Terra incognita der Walforschung sichtbar. Mitarbeiter der Universitäten Freiburg im Breisgau und St. Andrews in Schottland haben Studien ausgewertet, nach denen von 1975 bis 2005 nur in einem Viertel der Meeresfläche überhaupt nach Walen und Delfinen geforscht wurde. Der Großteil der Untersuchungen fand überdies auf der Nordhalbkugel statt, vor den Küsten so finanzkräftiger Staatengemeinschaften wie den USA oder Europa. Die südliche Hemisphäre wies mit Ausnahme der Gewässer um die Antarktis riesige weiße Flecken auf – bis heute unbekanntes Forschungsgebiet. Eine regelmäßige Datenerhebung erfolgte auf gerade mal sechs Prozent der gesamten ozeanischen Fläche.
All das erklärt, warum die Erforschung der großen Wale so langsam vorankommt. Angesichts der Herausforderungen ist es mehr als erstaunlich, was die Untersuchungen von Gesängen, Pfiffen und Klicklauten ans Licht gebracht haben. Sie zeigen, wie hochsozial die gewaltigen Meeressäuger leben. Und dass sie Wesen sind mit einer eigenen Kultur. Dies zumindest behauptet der Pionier der Pottwal-Forschung, Hal Whitehead. Er ist einer dieser leidensfähigen Wissenschaftler, die jahrzehntelang Unterwassermikrofone in die See hinabgleiten lassen – und warten. Die mit Kopfhörern auf ihren Booten hocken und angestrengt lauschen, ob sich in den Weiten der Ozeane etwas regt. Und wenn ja, was. Und die dabei wissen, dass sie etwa 90 Prozent ihrer Aufnahmen später gar nicht verwerten können, weil es sich um Ausschuss handelt.
Aber sie machen unverdrossen weiter. Und manchmal lohnt sich der ganze Aufwand.
Fremde Intelligenzen
April 2017, Halifax. Besuch bei Hal Whitehead im rauen Nova Scotia, einer Halbinsel im äußersten Osten Kanadas, die bis auf eine schmale Landbrücke vom Nordatlantik umschlossen ist. Für einen Walforscher die passende Umgebung, sollte man meinen, vor der Küste liegen mehrere Walgründe. Pottwale allerdings finden sich hier nur selten. Die Tiere, die Whitehead hauptsächlich erforscht, leben in tropischen Gewässern.
Der Biologe gehört zu den führenden Wal-Experten weltweit und lehrt an der Dalhousie-Universität in Halifax. Seit mehr als vier Jahrzehnten treibt er sich auf See herum, um das Verhalten der Meeressäuger zu erforschen. Dabei ist er zu der Überzeugung gelangt: Wale haben eine eigene Kultur. Sie pflegen Traditionen und Rituale, die sie an ihre Nachkommen weitergeben, genau wie wir das tun. Und von diesen kulturellen Leistungen hängt sogar ihr Leben ab.
War Kultur denn nicht immer das, was Menschen von Tieren trennte? Diese These ist nicht mehr haltbar. Und Hal Whitehead soll mir jetzt erklären, warum.
Doch dazu muss ich ihn erst einmal finden. Ich gehe eine lang gezogene Straße entlang, Richtung Dalhousie-Universität. Die Hausnummern sind schon vierstellig. Es ist ein kalter, ruppiger Aprilvormittag, an dem es so stark regnet und stürmt, dass mein Schirm sich immer wieder umstülpt. Doch das ist nicht das Problem. Die Adresse, die mir der Walforscher gegeben hat, stimmt nicht. Wo ein Universitätsgebäude sein sollte, steht nur ein kleines Holzhaus und vor dessen Tür ein Schild: zu mieten.
»Oh, oh sorry«, höre ich durch das Rauschen des Windes hindurch die helle Stimme von Whitehead im Telefon. »Ich hab mich mit der Hausnummer vertan!« Seit 1986 arbeitet er an der Universität, doch wie ich bald noch sehen werde, kommt der Mann an Land weniger gut zurecht als auf See.
Mit halbstündiger Verspätung und nass vom Regen erreiche ich sein Institut. Whitehead ist in bester Stimmung, seine hellen Augen liegen in einem Nest aus Lachfalten. Unter vielen Entschuldigungen reicht er mir die Hand. »Das tut mir so leid mit der Hausnummer«, sagt er und führt mich in sein winziges Büro, das die Menge an Büchern, Buckelwal-Postern, gekritzelten Notizzetteln und Segelfotos kaum fassen kann. Der Mann gibt ein verwegenes Bild ab, so ganz und gar nicht professoral. Er ist 65 Jahre alt, mittelgroß und schlaksig, die Waden stecken in wuchtigen Gummistiefeln, als käme er gerade von Bord. Sein Gesicht ist von einem wolligen Haarschopf umrahmt, der aussieht wie das Vlies eines Schafes. Die Mundpartie halb zugewachsen von einem weiß melierten Vollbart. Im Juli wird er wieder für einige Wochen zur See fahren, den Walen hinterher, wie er das sechs bis acht Wochen im Jahr tut. Er wirkt, als habe er die Expedition schon hinter sich.
Whitehead ist kein Kanadier, sondern stammt ursprünglich aus England. Seine Familie verbrachte ihre Sommerferien meist an der amerikanischen Ostküste, wo er segeln lernte. Das konnte er bald so gut, dass er als junger Student mit Walforschern in Kontakt kam. Er meldete ihnen, wenn er die Meeressäuger gesichtet hatte, machte selbst Aufzeichnungen und infizierte sich unheilbar mit dem Virus »Wal«. Das ließ ihn schließlich umschwenken: von Mathematik zur Biologie. Nach seinem Hochschulabschluss unterrichtete er fünf Jahre lang an der Universität in Neufundland, bevor er 1986 nach Halifax kam, um zu bleiben.
Die Kultur der Wale
Als Whitehead 1982 mit seinen Pottwal-Forschungen begann – zuvor hatte er überwiegend Buckelwale studiert –, fiel ihm bei seinen Expeditionen auf, wie intensiv sich die erwachsenen Tiere um ihren Nachwuchs kümmerten und dass sie das gemeinschaftlich taten. Manchmal gab es in einer Walgruppe nur ein einziges Kalb. Doch es wurde wie in einer Großfamilie von allen umsorgt, nicht nur von seiner Mutter.
Damals existierten nur sehr spärliche Erkenntnisse über das soziale Verhalten der Meeressäuger. Man wusste zum Beispiel noch nicht, wie sehr die Tiere lernen müssen, was sie im Leben brauchen. Wie sehr sie darauf angewiesen sind, dass die Gemeinschaft ihnen alles beibringt – selbst das Tauchen, aber auch das Kommunizieren, wie sich später noch zeigen wird.
Es ist ein Wissen, das von Generation zu Generation weitergetragen wird. Und es ist so existenziell, so unverzichtbar wichtig, dass sich daran das Schicksal einer Art entscheiden kann. Dieses Wal-Wissen nennt Hal Whitehead Kultur.
Das ist im Tierreich bis heute ein hochproblematischer Begriff. Nicht wenige Wissenschaftler, vor allem Anthropologen, ordnen Kultur ausschließlich den Menschen zu. Denn Tiere schreiben keine Bücher und komponieren keine Opern. Aber heißt Kultur auch gleich Hochkultur? Nein, sagen Biologen wie Whitehead. Aus biologischer Sicht gibt es eine ganz andere Definition des Wortes: Da heißt Kultur, voneinander zu lernen und Gelerntes weiterzugeben, sodass neue Generationen von den Kenntnissen der Vorfahren profitieren können. So, wie Bücher in einer Bibliothek von immer mehr Besuchern gelesen werden, verbreitet sich dieses Wissen unter den Mitgliedern einer Spezies. Und macht sie erfolgreicher in ihrem Fortbestand.
Kultur ist also nach Ansicht der Biologen ein Wissensfundus, der durch Lernen entstanden ist und nichts mit Genen zu tun hat, nichts mit instinktivem Know-how. So, wie wir üben, mit Messer und Gabel zu essen oder mit Stäbchen – was eine Form unserer Esskultur ist. Oder wie wir Benimmregeln lernen, um als soziale Wesen in unserer Gemeinschaft zurechtzukommen. Nichts davon haben uns die Gene mitgegeben.
Im Fall der Wale kann Kultur also bedeuten, sich eine neue Jagdtechnik durch Nachahmen anzueignen, die besser ist als die alte. Oder Lieder von Artgenossen zu erlernen und sie immer wieder abzuwandeln, um so über weite Entfernungen miteinander zu kommunizieren. Oder als Pottwal-Kalb einen ganz bestimmten Klicklaut zu üben – das ist die Art, wie sich die Tiere untereinander verständigen –, auch wenn es Jahre dauert, bis er sitzt.
»Ich bin davon überzeugt«, sagt Hal Whitehead und schlingt die Beine in den Gummistiefeln um seinen Stuhl, wie kleine Kinder das machen, »dass die Kultur das Leben von Walen maßgeblich bestimmt. Sie ist so wichtig wie das Erbgut und so wichtig wie der Ort, an dem sie leben.«
Diese Sätze sind seine Quintessenz aus mehr als 40 Jahren Walforschung. Man kann sie kaum verstehen, wenn man nicht weiß, wie Wale leben, Pottwale im Speziellen. Wie sie kommunizieren mit ihren Echo-Klicks, die sich manchmal anhören wie wildgewordene Nähmaschinen. Will man Hal Whiteheads Erkenntnissen folgen, muss man Zeit mitbringen. Und ein wenig hineintauchen in diese Unterwasserwelt, in der er mehr als irgendwo sonst zu Hause ist. Denn wie sich zeigen wird: Der Mann hat recht. Wale sind tatsächlich kulturelle Wesen, hochgradig voneinander abhängig und dadurch so fürchterlich in ihrem Bestand gefährdet.
Mutters kleine Familie ist Teil eines riesigen Clans
Derzeit ziehen etwa 360.000 Pottwale durch die Ozeane, das ist die Zahl, die Whitehead für realistisch hält. Es ist ein Näherungswert, der auf Meldungen aus Walbeobachtungsstationen beruht und hochgerechnet wird. Die Tiere verbreiten sich über alle Weltmeere und kommen auch in Regionen vor, in denen man sie nicht unbedingt vermutet hätte, etwa im Mittelmeer. Rund 2000 Pottwale gibt es dauerhaft im westlichen Teil vor Mallorca, aber auch vor Italien und vor der griechischen Küste.
Bei den Pottwalen leben die Geschlechter getrennt. Ausgewachsene männliche Tiere, die Bullen, ziehen vorwiegend in die kalten Gewässer rund um Arktis und Antarktis und sind als Einzelgänger unterwegs. Sie verlassen ihre Familien etwa im Alter von zehn Jahren und sammeln sich als Heranwachsende oft zunächst in kleineren Jungs-Cliquen. Anfang 2016 strandeten solche Gruppen aus halbwüchsigen Pottwalen mehrfach an den Küsten der Nordsee. Mit etwa zwanzig Jahren sind die Bullen geschlechtsreif. Erst dann kehren sie zu den Kühen zurück und paaren sich mit ihnen.
Die weiblichen Tiere leben so vollständig anders, dass es den Anschein hat, als gehörten sie zu einer fremden Spezies. Die Kühe bilden mit ihrem Nachwuchs eine Familie, in der alle Mitglieder miteinander verwandt sind. Diese matrilineare Gemeinschaft besteht ein Leben lang, die meisten Tiere verlassen sie nie. Nur der männliche Nachwuchs löst sich irgendwann aus dem Verband und wandert ab.
Die Mutterfamilien leben in den tropischen Gewässern und verhalten sich zueinander wie Schwestern oder Freundinnen. Sie schützen sich gegenseitig vor Schwertwal-Attacken, ihren einzigen Feinden, wenn man vom Menschen mal absieht. Sie teilen sich das Babysitting an der Wasseroberfläche, damit jedes Muttertier in den Tiefen nach Tintenfisch jagen kann, ihrem Hauptnahrungsmittel. Denn die Kälber können ihnen in ihren ersten Jahren nicht hinabfolgen und bleiben an der Wasseroberfläche – wohlbehütet von Tanten, Schwestern und Müttern ihrer Mütter.
Die Entdeckung dieses Babysittings war für Hal Whitehead Anfang der Achtzigerjahre ein echter Heureka-Moment. Er fand nicht nur die Sache an sich faszinierend – damals war das unter Meeressäugern unbekannt –, sondern sie brachte ihn auch auf die Spur dessen, was sein ganzes Forscherleben prägen sollte: Walkultur, hervorgebracht durch die komplexe soziale Lebensweise der Tiere. Das gegenseitige Hüten des Nachwuchses kam Whitehead wie ein entscheidender evolutionärer Vorteil vor. Das war ein probater Schutz gegen den Verlust der Kälber durch Orcas. Und schon damals keimte in ihm der Gedanke, dass ein solches Verhalten möglicherweise keine genetische Ursache hatte: »Abwechselndes Babysitting«, schrieb er in einer seiner frühen Studien, »müsste sich unter den matrilinear verwandten Tieren weiter ausgebreitet haben – entweder auf genetischem Weg oder auf kulturellem.« Also durch die Überlieferung von Wissen, hier: die Weitergabe einer bewährten Praktik.
Nun ist die Verhaltensforschung alles andere als eine fröhliche Abfolge von Heureka-Momenten. Schon gar nicht bei den großen Walen, wo man schon dankbar sein darf, wenn man auf See regelmäßig Fluke und Blas zu Gesicht bekommt, das Ausatmen der Meeressäuger. Doch Whitehead, der sich während des Gesprächs immer wieder mit den Händen durch die Schafslocken fährt, als vermisse er den rauen Wind auf See, kann sich noch gut an den zweiten Heureka-Moment erinnern, der nicht lang auf sich warten ließ. Als er mit seinen Kollegen herausfand, dass die mütterlichen Pottwal-Familien – Gruppen von vier bis zwölf Tieren – gleichzeitig Angehörige riesiger Clans sind. Diese Großverbände bestehen aus mehreren Tausend Pottwalen und besiedeln weiträumige Areale. Heute weiß Whitehead von mindestens sieben solcher gigantischer Pottwal-Clans: Fünf halten sich im südlichen und mittleren Pazifik auf, zwei in der Karibik, und vor Japan soll es ebenfalls zwei geben, was aber noch nicht als gesichert gilt.
Diese Clans unterscheiden sich in vielen Dingen voneinander: wie sie kommunizieren, wie viele Kälber sie aufziehen, welche Routen sie wählen. Und sie bleiben unter sich. Mitglieder zweier verschiedener Großverbände, die denselben Lebensraum bewohnen, haben nichts miteinander zu tun. Sie bilden eine Art Parallelgesellschaft, ähnlich wie bei uns, wenn Menschen unterschiedlicher Nationalitäten Tür an Tür leben, aber ihre kulturellen Eigenheiten nur untereinander pflegen. Whitehead nennt sie die »multikulturelle Gesellschaft«.
Multikulti im Meer