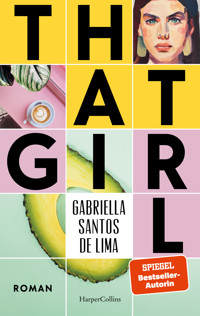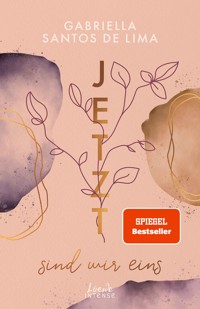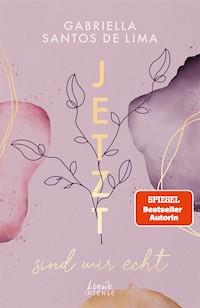13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Alles, was glüht, verglüht irgendwann.« Helena hat eine Schwäche für Liebesromane. Und eine Stärke fürs Schreiben. Ihr Traum wird wahr, als sie einen Platz am renommierten Künstlerinternat Schloss Sankt Zander erhält. Und ihre Liebesromane werden Realität, als sie dort auf Arthur trifft, Typ draufgängerischer Indie-Sänger mit gebrochener Künstlerseele. Helena hat das Gefühl, in einem waschechten Liebesroman gelandet zu sein: gemeinsame Strandspaziergänge, heimliche Treffen auf dem Schlossgelände – alles ist schön und rosa und glitzernd. Doch wieso ist Art manchmal so abweisend? Und warum reagiert er nicht auf ihre Nachrichten? Liebesromane haben doch immer ein Happy End – oder? Schriftstellerin meets Indie-Band-Sänger Was passiert, wenn Liebe schön ist, aber toxisch? In ihrem ersten Jugendbuch zeigt SPIEGEL-Bestsellerautorin Gabriella Santos de Lima auf einfühlsame Art, dass ein Happy End im echten Leben nicht immer so aussieht wie in den Liebesromanen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Playlist
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Grund I
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Grund II
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Grund III
Kapitel 18
Kapitel 19
Grund IV
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Grund V
Kapitel 32
Grund VI
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Grund VII
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Grund VIII
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Grund IX
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Grund X
Kapitel 51
Kapitel 52
Grund ∞
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr auf der letzten Seite eine
Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte!
Wir wünschen euch das bestmögliche Lesevergnügen.
Eure Gabriella und das Loewe-Team
Für alle, die sich im echten Leben in den Bad Boy verliebt und kein Happy End bekommen haben.
Playlist
Rote Flaggen – Berq
bad idea right? – Olivia Rodrigo
kontrollverlust – Edwin Rosen
logical – Olivia Rodrigo
Nirvana – ENNIO
vampire – Olivia Rodrigo
Nie verliebt – Paula Hartmann
love is embarrassing – Olivia Rodrigo
Utopie – ENNIO
making the bed – Olivia Rodrigo
Achilles – Berq
obsessed – Olivia Rodrigo
Rote Flaggen (feat. RTO) – Berq, Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld
I wish you a kinder sea.
Emily Dickinson
Ich habe dich zuerst gesehen, zuerst geküsst und dich zuerst geliebt.
Du hast mich zuerst gebrochen.
Ich werde nicht lügen, von mir ist nicht mehr viel übrig. Dabei habe ich Liebe geliebt. Zumindest die, die ich aus meinen Liebesromanen kannte. Im Grunde sind sie alle gleich. Sie besitzen denselben Aufbau und hören immer mit einem Happy End auf. Die meisten von ihnen beginnen mit einem Neuanfang. Protagonistinnen wollen ihr verhasstes Heimatdorf hinter sich lassen und in einer neuen Stadt jemand sein, den sie selbst noch nicht kennen.
Unsere Geschichte ist nicht so.
Ich fange damit an, dass ich zurückfahre. Nach Hause. Weg von dir. Und ich habe noch eine lange Reise vor mir.
Gleich werde ich umsteigen müssen, in einen ICE. Mein Ziel ist noch Stunden von mir entfernt. Doch auch, wenn es nur Minuten weg wäre, würde sich alles in mir tot anfühlen. Da, aber nicht da. Das ist ein Unterschied, den du mir mit deiner Pseudotiefgründigkeit beigebracht hat.
Ich hasse es.
Dich.
Mich.
Warum willst du jetzt schon gehen?
Ich werde meine Musik niemals laut genug einstellen können, um das Echo deiner Frage in meinem Kopf zu übertönen.
Ich denke nicht nach, als ich meinen Laptop hervorziehe. Innerhalb von Sekunden fahre ich ihn hoch und erstelle ein neues Dokument. Dann tue ich das, was ich am besten kann, wenn ich eigentlich nichts mehr kann.
Ich schreibe.
Ich hasste meine Hände.
Es klingt dramatisch, allerdings muss ich diesen Fakt gleich am Anfang loswerden. Ich mochte nicht, wie klobig und unförmig meine Finger waren. Die Tatsache, dass ich keine Ringe trug, weil meine Haut sonst gequetscht wirkte, was wiederum hässlich aussah. Außerdem waren meine Gelenke krumm und meine Nägel splitterten dauernd ab. Deshalb war es egal, wie viel Geld ich für einen der teuren Nagellacke im Drogeriemarkt ausgab – es sah nie gut aus.
Wer zur Hölle macht sich bitte derart viele Gedanken um seine Hände?
Sicherlich würden sich neunzig Prozent der Menschheit diese Frage stellen, die restlichen zehn Prozent hätten mir wie meine ältere Schwester Mila gut zugeredet.
Mit sechzehn haben wir doch alle ein schwieriges Verhältnis zu uns selbst, das renkt sich bald ein, wirst schon sehen.
Sie sagte das so, als wäre sie zwanzig Jahre älter als ich und nicht sieben. Als hätte sie nicht vor einigen Monaten noch einen Zusammenbruch in ihrem alten Kinderzimmer erlitten, weil ihr irgendein Kleid nicht mehr passte.
Aber was, wenn nicht, Mila? Was, wenn doch alles gleich bleibt?
Letzteres fragte ich mich, bevor ich das Schild in der Fahrerscheibe des dunklen Busses erkannte.
Exklusiv für die Gäste des SZI:
Willkommen an Bord!
SZI.
Sankt-Zander-Internat.
Erleichtert atmete ich auf. Während der Zugfahrt hatte ich befürchtet, den Treffpunkt nicht zu finden, den Bus zu verpassen oder ihn erst im letzten Moment zu sehen und wie eine Irre auf die offenen Türen zulaufen zu müssen, nur um kurz vor meinem Ziel atemlos dabei zuzusehen, wie sie sich schlossen – und der Bus davondüste. Das Schlimmste daran wäre nicht gewesen, dass ich keine Ahnung gehabt hätte, wie ich das Internatsgelände anderweitig hätte erreichen können. Es wären die Blicke der fremden Passanten gewesen. Die, die mich in meiner Verzweiflung schamlos beobachtet und sich leise Idiotin gedacht hätten.
Ich wollte keine Idiotin sein.
Ich wollte das Mädchen werden, das einen Platz am Sankt-Zander-Internat verdient hatte, das Beste aus den nächsten drei Jahren und später aus seinem Leben machen würde.
Das SZI war aufgrund der verschiedenen Schwerpunkte die Schule für angehende Künstler jeden Bereichs. Selbst international war es bekannt. Wenn ich wollte, könnte ich in drei Jahren in New York, London oder an der Akademie der Künste in Berlin studieren. Natürlich war der Abschluss keine Garantie für Reichtum und Ruhm, Emmys und endlosen Erfolg. Aber er machte meine Träume wahrscheinlicher.
Also drehte ich mich ein letztes Mal um und blickte auf die Tafel über dem Bahnsteig. In dreiundzwanzig Minuten würde derselbe Zug, aus dem ich eben gestiegen war, wieder abfahren, zurück in die Stadt, zurück nach Hamburg und nach Hause.
Zuhause.
Ich schnaubte. Dieser Gedanke gab mir den nötigen Ruck. Selbstbewusster, als ich mich fühlte, marschierte ich auf den Bus zu.
Wenn du allein unterwegs bist, lauf schneller. So denken die Leute, du hättest ein Ziel, und du fühlst dich weniger beschämt.
Das hatte ich aus meinem Lieblingsbuch Wenn wir bleiben, das ich umklammert hielt, weil es nicht mehr in meinen Rucksack gepasst hatte, nachdem ich auf der Fahrt in ihm herumgewühlt hatte. Wenn wir bleiben war das beste aller besten Bücher, schon fünfmal von mir gelesen. Die Protagonistin hatte kein leichtes Leben, besaß aber die Hoffnung und Zuversicht, dass zukünftig alles nicht gut, sondern sehr gut werden würde. Manchmal wünschte ich, ich wäre mehr wie sie und weniger wie ich. Vielleicht las ich es genau deshalb gerade zum sechsten Mal.
Keine Minute später verharrte ich vor dem hochgewachsenen Busfahrer, der neben der offenen Tür stand. Ringsum erkannte ich unzählige Menschen. Und Schilder. Eins hieß die Besucher auf der Nordseehalbinsel Sankt Zander willkommen, wohingegen andere die Kilometerzahl in Richtung Strand, Inselzentrum oder weitere wichtige Touristenstopps anzeigten. Wenn ich einatmete, bildete ich mir sogar ein, das Meer riechen zu können.
»Guten Tag.« Der Fahrer blickte auf das Klemmbrett in seiner anderen Hand. »Name?«
»Winkler«, erwiderte ich viel zu leise. »Helena.«
Ich zählte die Sekunden in meinem Kopf, bis er schließlich nickte und einen Haken auf das Papier setzte.
»Mehr Gepäck hast du nicht?«
Stumm schüttelte ich den Kopf, bevor er sich meinen Koffer schnappte. Mit weichen Knien bestieg ich die Stufen in das Businnere, bloß um nach zwei Schritten wieder zu stoppen.
Später würde ich behaupten, es wäre wie im Film gewesen. Urplötzlich passierte nämlich alles ganz langsam. Es erklang sogar Musik. Hörte ich da etwa … Wildest Dreams von Taylor Swift? Ich blinzelte, doch es war keine Einbildung. Das Mädchen in der zweiten Reihe hatte ihre Musik so laut eingestellt, dass wir alle sie mithörten.
Ganz eigentlich galt meine Aufmerksamkeit allerdings nur ihm. Mir war bewusst, wie das klang: klischeehaft und übertrieben.
Aber es stimmte.
Dieser Typ, der keinen Meter von mir entfernt saß, er war einfach anziehend. Wie er lässig mit seinen athletischen Gliedern auf dem Fensterplatz hockte, ein zerfleddertes Notizbuch und einen Stift in der Hand. Er wirkte wie aus einem Film. Wie einer von diesen melancholischen Charakteren, für die meine Freundinnen und ich immer eine Schwäche hatten. Dabei war sein Haar nicht brünett, sondern blond, doch dafür unendlich zerzaust. Er trug ein simples Shirt in Olivgrün und schrieb etwas in ein Buch.
Vielleicht führte er Tagebuch. Vielleicht war er auch nervös. Vielleicht lenkte er sich so ab. Vielleicht dachte er in genau diesen unfassbar nervösen Momenten so viel, dass er es nicht aushielt und seine Gedanken aufschreiben musste.
So wie ich.
Selbst wenn mein Kopf nicht realisieren konnte, dass gerade etwas passierte, spürte es mein Körper. Das Herz in meiner Brust donnerte wie ein plötzliches Sommergewitter, das niemand jemals vorausgesagt hatte.
Ich wusste nicht, ob es schlimmer oder besser wurde, als er plötzlich den Kopf hob. Und alles in mir warm, wärmer und noch wärmer wurde. Als hätte er meinen Blick auf sich gespürt.
Deinen Blick auf sich gespürt? Leni, du hast ihn unverschämt angestarrt, natürlich hat er das bemerkt.
Doch ich ignorierte meine innere Mila, die viel zu oft in meinem Kopf ertönte, weil sie zwar nicht alles, aber zumindest immer alles besser wusste als ich. Sie war so gut darin, mich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und Momente damit zu zerstören. Diesen hier würde sie allerdings nicht bekommen. Der war für mich ganz allein bestimmt.
Und für ihn.
Denn auch der Fremde blieb mit seinem Blick an mir hängen, als spürte er das, was ich spürte, ebenfalls.
Als wäre das Kopfkino hinter meiner Stirn ein einziges Mal echt.
Sonnenstrahlen schienen durch die Scheiben. Dabei war längst alles so unfassbar warm. Allem voran sein Blick, der sich tief und braun an mir entlangschlängelte. Bis er an meinen fürchterlich krummen Fingern hängen blieb, die immer noch das Buch umklammerten.
Schlagartig wurde mir kalt.
Sein Blick zuckte neugierig von meinem Gesicht zu meinen Händen. Immer wieder und wieder und wieder und jetzt immer noch.
Dann, ganz langsam, Zentimeter für Zentimeter, verzog er die Lippen zu einem Lächeln. Es war schief und es passte so verflucht perfekt.
»Wenn wir bleiben?«, flüsterte er geheimnisvoll.
Ich bekam Gänsehaut.
Überall.
Gott.
Seine Stimme.
Wie tief und kratzig sie klang.
Er nickte auf mein Buch, bevor er spielerisch eine Braue anhob.
Mein Mund öffnete sich, doch …
»Also, ich hab schon davon gehört, dass man mitten in der Fußgängerzone stehen bleibt und Passanten den Weg blockiert, aber wenn man das in einem stickigen Bus tut, ist das echt ein anderes Level.« Hinter mir lachte jemand so laut, dass ich mich umdrehen musste.
Unsicher entschuldigte ich mich bei dem dunkelhaarigen Mädchen, das mich angrinste und sich dabei den Pony aus der Stirn pustete. Angestrengt hievte sie ihre Reisetasche auf die Stufe vor sich.
»Sorry«, murmelte ich ein weiteres Mal.
Als ich mich von ihr abwandte, sah der Typ mich gar nicht mehr an. Er hatte seine Aufmerksamkeit längst wieder auf sein Notizbuch gerichtet, während ich hastig auf einen freien Platz huschte. Fünfzehn Minuten später startete der Fahrer den Motor.
Ich hielt das Buch währenddessen noch immer fest. Nicht wie einen Anker, nicht wie einen Schatz. Ich umklammerte es bloß so, wie du etwas umklammertest, wenn du nichts anderes mehr hattest. Traurig, doch tröstlich.
Hundertdreiundfünfzig Tage, nachdem ich Papa zum ersten Mal in meinem Leben weinen gesehen und er anschließend seine Sachen gepackt hatte, hundertachtundvierzig Tage, nachdem Mila unserer Mutter daraufhin geschworen hatte, sie würde nie wieder mit ihr reden, und ihr Wort bis heute gehalten hatte, hundertdreiundzwanzig Tage, nachdem der Brief mich erreicht hatte, achtundneunzig Tage, nachdem Mama mich davon überzeugt hatte, dass ich gehen müsse, zwei Tage, nachdem ich schließlich ebenfalls meine Sachen gepackt und nur vier Stunden, nachdem ich mich von ihr am Bahnhof verabschiedet hatte, hieß mich ein gähnender Busfahrer auf dem Schlossinternat willkommen.
»Sankt Zander«, verkündete er über die Lautsprecheranlage. »Ihr Haltestopp.«
Wow, dachte ich beim Anblick des imposanten Gebäudes, doch den Großteil der Mitfahrenden schien dieser kaltzulassen. Womöglich war es nicht ihr erstes Jahr auf Sankt Zander. Doch meins war es sehr wohl. Also blieb ich staunend stehen, um das helle Gebäude mit dem schieferfarbenen Dach zu bewundern. Das Internat war umgeben von grünem Rasen, perfekt getrimmten Büschen und hohen Baumkronen. Es sah wirklich aus wie ein Schloss, eindrucksvoll und gigantisch. Mit von Efeu bewachsenen Fassaden, ein Ort voller Geschichte, mit alten Gemäuern und drei Türmen. Aus einem der Videos im Internet wusste ich, dass unser Schlossinternat in einem anderen Zeitalter der Urlaubssitz des deutschen Adels gewesen war. »Jetzt gehört es der Kunst, der Kunst allein, meine Damen und Herren«, hatte der Guide in dem Video erklärt.
Hier fand man keine Spur von dem süßen Inselflair, das etliche Touristen in der Saison anzog. Die Umgebung bot eine Vielfalt an Natur, vom Meer und seinem nahezu weißen Strand bis hin zu dem geschützten Waldgebiet.
Mein jetziges Zuhause.
Als ich aus den Augenwinkeln erkannte, dass viele ihr Gepäck bereits über die Kieselsteine in Richtung Innenhof schoben, riss ich mich von dem imponierenden Anblick los und schnappte mir ebenfalls meinen dunklen Koffer. Eine Viertelstunde später erreichte ich das Mädchenwohnheim und stellte mich für die Schlüsselausgabe bei Frau Wall an, der Betreuerin und unserer Ansprechpartnerin. Ich wartete weitere zehn Minuten, lauschte den Gesprächen der anderen, die sich offensichtlich bereits kannten, und wurde mir bewusst, dass ich niemanden kannte. Um mich nicht an diesem Gedanken aufzuhängen, begutachtete ich das Foyer. Hätten wir Schuluniformen tragen müssen, hätte ich mich wie an einer elitären englischen Boarding School gefühlt. Die schwarz-weiß gefliesten Böden. Die edel wirkenden Stillleben an der Wand. Die endlos hohe und runde Decke. Alles hier wirkte so ehrwürdig und wichtig, dass ich mich eine Spur zu nichtig fühlte.
In Frau Walls Büro erläuterte sie mir, dass mein Zimmer die Nummer zweihundertfünf habe, wobei sie sich eine grau melierte Strähne aus der Stirn strich.
»Die Treppen nach oben, dann links«, erklärte sie lächelnd, nachdem sie mir meinen Schlüssel überreicht hatte.
Glücklicherweise fand ich mein schlichtes Zimmer im zweiten Stock auf Anhieb. Nachdem ich die Tür geöffnet hatte, checkte ich die Uhrzeit auf meinem Handy.
Fünfzehn Uhr zweiundvierzig.
Ich hatte noch achtzehn Minuten bis zur Willkommensrede und musste dafür den Innenhof in Richtung Hauptlehrgebäude überqueren.
Mir blieb nicht einmal genug Zeit, das Gepäck meiner Zimmerpartnerin auf der anderen Seite des Raums zu mustern, von der hier jede Spur fehlte. Also tat ich es ihr gleich, stellte meinen Koffer ab, frischte mein Deo auf und huschte dann aus der Tür. Ich schaffte es gerade pünktlich in die Aula, wo ich neben fremden Personen saß, die sich genauso nervös umsahen wie ich.
Bis diese füllige Frau Anfang vierzig sich vor uns positionierte und verkündete, dass mir die beste Zeit meines Lebens bevorstünde.
Na ja, okay. Sie erklärte es nicht nur mir, sondern allen vierunddreißig neuen Gesichtern.
»Wir schätzen uns glücklich, Sie als Jahrgang sechsundachtzig auf Sankt Zander willkommen zu heißen. Ihnen stehen drei Jahre voller neuer Herausforderungen bevor. Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht manchmal schwierig werden wird. Die Wahrheit ist: Es wird viel zu viele Momente geben, in denen Sie einfach hinschmeißen wollen. Aber genau dann dürfen Sie nicht aufgeben. Denn wie sagt das Schild vor unseren Toren so schön? Habe keine Angst vor dem Fortschritt, bloß vor dem Stillstand. Ein Zitat eines unserer ersten Absolventen, Johann Fischer, neunzehnhundertachtundfünfzig.« Lächelnd faltete Frau Schröder die Hände zu einem Dreieck. »Das gesamte Kollegium und ich wünschen Ihnen einen wundervollen Start. Gerne können Sie die Zeit auf Ihren Zimmern nutzen, bis …«
Die Direktorin erklärte den weiteren Ablauf, dass der Rundgang in eineinhalb Stunden starten würde und wir uns anschließend zu einem gemeinsamen Abendessen mit unserem Stufenleiter im Speisesaal I treffen würden. Aufmerksam hörte ich zu, obwohl ich bereits die Wegbeschreibung zum Treffpunkt auswendig kannte. Ich hatte das Informationsmaterial studiert, noch bevor ich mich endgültig für die Zusage entschieden hatte. So sehr hatte ich diesen Platz am SZI gewollt.
»Und genau deshalb«, hörte ich Mamas Stimme in meinem Kopf. »Genau deshalb musst du gehen, Leni-Liebling.«
Also klatschte ich genau wie die anderen ringsum, diese Fremden, meine neuen Mitschüler, als Direktorin Schröder ihre Rede beendete. Hundertdreiundfünfzig Tage, nachdem die ganze Scheiße in meinem Leben begonnen hatte, wollte ich wirklich daran glauben.
Dass es besser werden würde.
Der erste Tag war der Tag der Namen. Und der Schwerpunkte.
Als Teil einer fünfköpfigen Gruppe führte uns unsere Tutorin Marie über das Internatsgelände. Bei der Begrüßung erkannten wir uns gegenseitig sofort.
»Hey«, sagte sie lachend. »Da ist ja das Mädchen, das eine Schwäche fürs Wegblockieren in Bussen hat.«
Ich hingegen lernte, dass sie eine Schwäche für stramme Schrittgeschwindigkeit und ein schnelles Sprechtempo besaß. Innerhalb von wenigen Momenten erfuhren wir, wie alt sie war (achtzehn), seit wann sie das Internat besuchte (vorletztes Jahr), ihren Schwerpunkt (Kreatives Schreiben) und was sie ab nächstem Jahr damit machen wollte (es gibt SO viele Möglichkeiten). Der laue Septemberwind wehte ihr schulterlanges Haar dabei nach hinten und entblößte ihre sonnenförmigen Ohrringe.
»Hat noch jemand von euch Kreatives Schreiben?«
Manuel – der schlaksige Typ mit der klobigen Brille und dem hellen Lockenkopf – schüttelte den Kopf. »Musik«, erklärte er. »Klassisch.«
»Echt?«, erwiderte der dunkelhaarige Typ, der sich als Luca vorgestellt hatte. »Voll cool, ich hab auch Musik.«
Für einen Moment sahen ihn alle an, was nicht unbedingt daran lag, dass er gerade etwas gesagt hatte. Es lag vielmehr an ihm. Seiner Ausstrahlung, seinem Erscheinungsbild. Womöglich sogar an dem Grübchen in seiner linken Wange, wenn er lächelte. Luca sah gut aus, war aber nicht wie die Typen zwei Stufen über mir, die nachmittags von allen Mädchen in den sozialen Netzwerken gesucht wurden. Weil sie attraktiv waren, das gewisse Etwas und Status besaßen. Weil es ein unausgesprochenes Gesetz war, dass du den Jackpot gezogen hattest, wenn sie ein Bild von dir auf Instagram mit einem Gefällt mir markierten. Luca war anders. Er war nicht laut und überheblich, nicht arrogant auf diese Weise, die heiß war. Er hatte eine positive Art und ein strahlendes Lächeln, das zu breit war, um als lässig bezeichnet zu werden.
»Puuuh.« Marie seufzte theatralisch. »Dann haben wir ja schon zwei Musiker. Was ist mit den anderen? Jemand hier, um das auszugleichen?«
»Schauspiel und Film«, erwiderte das Mädchen, das sich uns gerade als Jasmin vorgestellt hatte.
»Ich …« Heiser räusperte ich mich. »Ich habe auch Kreatives Schreiben ausgewählt.«
»Willkommen im Team.« Marie zwinkerte mir zu. »Vielleicht hören wir ja mal was von dir im Hoftheater.«
»Ist das nicht nur für Schauspielstücke?«, fragte Jasmin verwirrt.
»Jeden ersten Freitag im Monat finden dort Open-Mic-Abende statt«, erklärte Marie. »Jeder kann einen Text seiner Wahl vorlesen. Glaub mir, die Abende sind legendär.«
Legendär.
Das klang wohl kaum nach mir. Und die Vorstellung, in diesem Theater zu stehen, vor etlichen von Menschen, die meine Mitschüler waren und denen ich jeden Tag auf den hohen Schulfluren begegnen würde, hörte sich erst recht nicht nach mir an. Ich lächelte Marie trotzdem zu, wohlwissend, dass ich niemals etwas im Hoftheater vorlesen würde, und sie lächelte zurück.
Unter unseren Füßen knirschte der Schutt, während sie uns nun in Richtung Mensa lenkte, vorbei an den mit Efeu bewachsenen Fassaden der zwei mehrstöckigen Hauptlehrgebäude. Weiter links erkannte ich den Umriss der Turnhalle. Rechts von uns befanden sich die Wohnhäuser, knapp sechzig Zimmer für rund einhundertzwanzig Schüler. Jeder, der das Internat besuchte, wohnte auch hier. Das war die Regel am SZI, damit wir unser Potenzial auch voll entfalten konnten mit all den außerschulischen Aktivitäten, abgestimmt auf unsere künstlerischen Schwerpunkte. Marie gab uns Empfehlungen fürs Mensaessen, erklärte, dass die Pizzadreiecke mit gegrillter Aubergine am Freitag die besten seien und wir die Gnocchi mit Roter Bete dienstags lieber vermeiden sollten.
Als Krönung unserer Führung scheuchte sie uns ins Innere des ersten Turms, bis in die oberste Etage.
Scheiße, dachte ich.
Absichtlich lief ich als Schlusslicht, damit niemand sehen konnte, wie heftig meine Beine zitterten.
Ich hasste Wendeltreppen.
Ich hasste oberste Etagen.
Ich hasste Höhe.
Hassen ist ein sehr starkes Wort. Du kannst etwas nicht einfach nicht mögen, nur weil du Angst davor hast, Leni-Maus, meldete sich meine innere Mila zu Wort. Natürlich hatte sie recht. Wie immer. Meine Schwester hatte Journalismus in Köln studiert und lebte seit ihrem Abschluss in Berlin, wo sie als Redakteurin für ein feministisches funk-Format arbeitete. Meine Eltern hatten sich nie erklären können, wieso wir beide schreiben wollten – wenn auch auf unterschiedliche Arten –, obwohl weder Mama noch Papa etwas mit dem Schreiben zu tun hatten. Aber es war schon immer so gewesen. Ich hatte mich am liebsten in die Welten meiner Bücher verkrochen, während Mila unsere Welt mit ihren Worten verändern wollte. Seit ihrem Auszug tönte ihre Stimme noch häufiger in meinem Kopf, weil sie mir leider immer die besten Ratschläge erteilt hatte.
Trotzdem konnte sie mich in diesem Moment nicht daran hindern, nasse Flecken mit meinen schwitzenden Händen an dem Geländer zu hinterlassen. Stufe für Stufe zwang ich mich bis nach oben, bis ich die Aussichtsplattform als Letzte und außer Atem erreichte. Dort peitschte der Wind viel heftiger als unten, sodass es in meinen Ohren rauschte. Ich hielt Abstand zur Mauer und blieb in der Nähe der Treppe, während meine Mitschüler gar nicht genug von der Aussicht bekommen konnten.
»Alles okay?«
Ich wollte ein bisschen im Boden versinken, als ausgerechnet Lucas Blick auf mich fiel und er ehrlich besorgt einen Schritt von der Mauer zurück- und auf mich zutrat.
»J…ja«, sagte ich sofort. »Ich, ähm, ich schaue mir die Aussicht nur lieber von hier an.«
Ich war mir sicher, dass er mich innerhalb von Sekunden durchschaute, während sein Blick zu meinen zitternden Knien zuckte. Ehrlicherweise hätte ich sogar meine gebundene Ausgabe von Wenn wir bleiben darauf gewettet, dass er mich auf meine offensichtliche Höhenangst ansprechen würde. Wider Erwarten blieb er jedoch bloß neben mir stehen.
»Ich mach mit«, sagte er. »An der Mauer ist sowieso so viel Gedrängel. Von hier aus ist der Ausblick genauso gut.«
Danach sagten wir nichts mehr, doch ich spürte ihn weiterhin neben mir.
»Wow«, stieß Jasmin weiter vorn aus. Und sie hatte recht. Von hier oben war Sankt Zander ein Panorama und wir hatten den besten Blick. Freie Sicht über die Halbinsel. Die Menschen links in der Stadt wirkten wie unendlich kleine Spielfiguren. Wenn ich meinen Blick mit noch immer zitternden Knien und schwitzenden Händen weiterschweifen ließ, erkannte ich den Strand, das Meer und die Wellen, die ans Ufer brandeten. Wieder und wieder, auf diese unendlich friedliche Weise.
»Die Sankt-Zander-Klippen.« Marie nickte augenrollend gen Horizont. »Ich bin fast traurig, dass wir hier niemanden mit einem künstlerischen Schwerpunkt haben. Eigentlich wäre jetzt nämlich der Moment, in dem ich natürlich suuuperbegeistert erklären würde, dass auch sie diese Aussicht zehntausendmal zeichnen werden, wie ihre Vorgänger. Mit etwas Glück ist ihr Werk so gut, dass es im Salonzimmer ausgestellt wird – weil natürlich reichen nicht hunderte Bilder von dieser Aussicht. Die Welt benötigt noch das siebenhundertzwölfte.«
Alle lachten, bevor meine Gruppenmitglieder Fotos schossen und sie in ihre Familiengruppen schickten. Ich stand einfach nur da und atmete ein.
Neuanfang, dachte ich. Das hier riecht nach einem salzigen Neuanfang.
Fünfzehn Minuten später entließ uns Marie, nachdem wir unseren Startpunkt am Hauptgelände erreicht hatten. "Süße Freiheit", flötete sie. "Na ja … zumindest, bis der Unterricht losgeht.« Anschließend drückte sie uns ihr Handy in die Hand, damit wir unsere Nummern einspeichern konnten. »Wir sind jetzt ein Team«, sagte sie. »Und eine Gruppe. Team ohne Künstler. Ich hoffe, der Name passt für euch. Falls ihr Fragen habt, immer her damit. Ach, und bevor ich es vergesse: Sehe ich jemanden von euch nachher auf der Strandparty? Ab halb acht startet die Das-neue-Schuljahr-hat-leider-begonnen-willkommen-zurück-Party. Ein paar Bands aus dem Ort spielen. Ihr könnt nach eurem Essen vorbeikommen. Ist richtig cool.«
»Ich schätze …« Manuel rückte erneut die Brille auf seiner Nase zurecht, nachdem Marie uns winkend allein gelassen hatte. »Wir sehen uns dann beim Essen?«
Unsicher nickten wir uns zum Abschied zu, bevor wir unsere Zimmer ansteuerten. Eigentlich wollte ich nicht direkt nach meinem Handy greifen, weil ich durch einen Podcast erfahren hatte, dass wir mehr präsent sein müssten. Wahrnehmen sollten. Diesen Moment nicht verlassen dürften. Aber ich fühlte mich so allein inmitten von Menschen, winzig wie eine wirkliche Spielfigur neben dem imposanten Schlossgebäude.
Hastig überflog ich die Nachrichten deshalb doch auf meinem Handy. Meine Freundinnen wollten wissen, wie mein erster Tag war. Mila hatte mich nach Bildern gefragt und drei Fragezeichen hinterhergeschickt, weil sie ihre erste Nachricht bereits gegen zwölf versendet hatte. Mama hatte mir ein Selfie von sich und unserem Kater Kosmo geschickt. Wir vermissen dich schon jetzt.
Keine Nachricht von Papa.
Ich redete mir ein, dass es nichts ausmachte. Dass es egal wäre. Dass die Dinge sich nun mal verändert hatten und es jetzt war, wie es war.
Du sagtest, was du sagtest, ich fühle, was ich fühle, und es ist, wie es ist.
Ich erinnerte mich an dieses Zitat, das meine Schwester völlig durchschaubar kurz nach der Trennung unserer Eltern in ihrer Story geteilt hatte. Ich unterdrückte ein Seufzen und wollte mein Handy wieder in meiner Tasche verstauen und stattdessen meine Wasserflasche hervorkramen. Doch ich trug einen Jutebeutel über der Schulter und es war schwierig, irgendetwas zwischen dem Krimskrams zu finden. Wie immer hatte ich alles mitgeschleppt. Von meiner aktuellen Lektüre über Müsliriegel bis hin zu Deo. Ich bekam die Flasche gerade zu fassen, da stieß ich gegen etwas Hartes. Etwas Warmes und Pochendes.
Ich stieß nicht gegen etwas.
Ich stieß gegen jemanden.
Genauer noch: gegen die Brust von jemandem, während der Inhalt meines Beutels gleichzeitig zu Boden segelte.
Nur dass es nicht irgendjemand war.
Es war der Typ aus dem Bus.
»Oh shit«, hörte ich ihn sagen, bevor er sich hinkniete und meine Sachen aufsammelte.
Mein Portemonnaie, besagtes Deo und erwähnter Müsliriegel, loses Kleingeld, ein Miniparfum, mein liebster Lipgloss, die verfluchte Wasserflasche, Taschentücher, Puder, Lipliner, meine Heiliger-Gral-Mascara von Essence, das Buch. Jenes reichte er mir als Letztes, bevor er mich diesen einen winzigen Moment zu lange ansah. Wahrscheinlich war das der Augenblick, in dem er mich wiedererkannte.
»Es muss wirklich gut sein, wenn du es überall mit hinschleppst«, sagte er mit seiner unendlich tiefen Stimme, die mir einen Schauder über den Rücken jagte.
Dann ließ er seinen linken Mundwinkel zucken und verschwand.
Alles, wirklich alles in mir glühte.
Meine Mitbewohnerin hieß Amber und ihr Schwerpunkt war Kunst. Das fand ich keine fünf Minuten nach meinem Aufprall heraus. Als ich das Zimmer betrat, saß sie in einem violettfarbenen Rock und einer weißen Bluse auf ihrer Decke, vor ihr ein iPad und ein digitaler Zeichenstift. Das Bett hatte sie bereits bezogen. Weiße Wäsche mit roséfarbenen Herzen. Das rund achtzehn Quadratmeter große Zimmer sah nicht mehr so aus, wie ich es verlassen hatte.
Ich musterte die Salzsteinlampe auf ihrem Nachttisch und die Bilder an ihrer Wand. Fotos und wirkliche Bilder, die sie wahrscheinlich selbst gemalt hatte. Zumindest ließen die Malutensilien auf der Fensterbank darauf schließen. Paletten, Blöcke, Pinsel neben drei Terracotta-Töpfen. Die Lichterketten, die sie um ihren Bettrahmen geschlungen hatte, tauchten das Zimmer in ein warmes gelbliches Licht, während sie von ihrem Bett sprang und mir schüchtern zur Begrüßung zuwinkte. Meine Zimmergenossin war so klein wie ich und damit garantiert nicht größer als einsfünfundsechzig. Die dunklen Haare trug sie lang und leicht gewellt, wobei sie einen Teil am Hinterkopf mit einer Schleife befestigt hatte. Ihr gesamtes Gesicht schien zu strahlen. Vielleicht war es der gold schimmernde Lidschatten über ihren Augen, der Lipgloss oder einfach ihre Art.
»Hi«, sagte sie. »Ich bin Amber. Deutsch ausgesprochen, nicht englisch. Also, Am-ber und nicht Äm-ber. Wenn du mich trotzdem Äm-ber nennen willst, ist das natürlich auch kein Problem. Und du?« Sie räusperte sich heiser. »Wie heißt du?«
»Ähm, hi.« Ich winkte ihr schüchtern vom Türrahmen aus zurück. »Ich bin Helena. Aber du kannst Leni sagen.«
»Leni.« Lächelnd wiederholte sie meinen Namen. »Es freut mich so, dich kennenzulernen.«
Sie trat genauso nervös von einem Fuß auf den anderen wie ich. In genau diesem Moment wusste ich, dass es nicht so werden würde, wie ich es mir in meinen Horrorvorstellungen ausgemalt hatte. Darin hatte ich nämlich mit einem Mädchen zusammengewohnt, das mich grundlos hasste, weshalb ich beinahe täglich in der Kälte bis zur Ausgangssperre spazieren ging, um sie bloß nicht mit meiner alleinigen Anwesenheit zu nerven.
Siehst du? Nicht alles ist so schlimm wie in deinem Kopf.
Ich wollte meiner inneren Mila nicht glauben, auch wenn sie so klug und reflektiert war, dass es unsere Eltern genervt hatte. Denn das Problem war: Sobald ich mich in Sicherheit wiegte, passierten schlimme Dinge, und die konnte ich nicht mehr gebrauchen.
Allerdings schien tatsächlich alles gut.
Denn Amber und ich gingen zusammen zum Abendessen, wo wir gespannt der zweiten offiziellen Rede des Tages lauschten. Diesmal vorgetragen von unserem Stufenleiter Doktor Mühlhausen, einem schlaksigen Mann Ende dreißig. Wir saßen an drei länglichen Tischen, wobei an den Wänden hinter uns schwer gerahmte Bilder wichtiger Ehemaliger hingen.
»Mein Bruder meint, wir haben so Glück, dass wir nicht Herrn Stürmer bekommen haben«, flüsterte Amber mir während der Rede zu.
Verwirrt runzelte ich die Stirn. »Wie meinst du das?«
»Oh, sorry. Total vergessen zu erwähnen.« Sie befeuchtete sich die Lippen, als sie bemerkte, dass unser gesamter Tisch ihr nun zuhörte. »Mein Bruder wohnt auch hier. Er ist in der Dreizehnten, Schwerpunkt Musik, Klassik. Aber eigentlich will er später nichts in der Richtung machen.«
»Nicht?«, hakte Manuel verwundert nach, der uns schräg gegenübersaß und nun die weißblonden Brauen in die Höhe zog.
Zögerlich schüttelte sie den Kopf. »Vince will eher so in Richtung Indie-Rock gehen. Er spielt Bass in einer Band. Sie, ähm, sie treten nachher auf dieser Party auf. Am Strand. Kommt ihr?«
Alle hatten die Party auf dem Schirm, einschließlich mir. Es war unser erster Abend auf Sankt Zander. Der Beginn unseres neuen Lebens. Aber vielleicht dramatisierte auch nur ich das alles so. Vielleicht brauchte nur ich ein neues Leben.
»Ich liebe deine Haare«, sagte Amber, als ich mein Aussehen zum letzten Mal im Spiegel begutachtete.
Ich trug eine weite Jeans und ein kurz geschnittenes weißes Top, darüber meinen liebsten olivfarbenen Cardigan. Mein Outfit rundeten die Chucks mit Plateau und der Jutebeutel auf meiner Schulter ab. In meinen Ausschnitt fiel der Anhänger meiner Kette, während ich mir eine rotblonde Haarsträhne hinter das Ohr schob.
Ehrlicherweise waren meine Haare das Einzige, was ich an mir mochte. Lang und dick und glänzend, wenn ich die richtige Spülung benutzte. Die teure von Douglas, für die ich immer meine Gutscheine ausgab.
»Danke«, murmelte ich schüchtern. »Deine sind auch voll schön. Ich mag deine Schleife total.«
Eigentlich war alles an Amber so schön, dass Olivia Rodrigo einen Song über sie hätte schreiben können. So einen wie lacy, obsessed oder jealousy, jealousy. Das sagte ich ihr jedoch offensichtlich nicht. Stattdessen verließen wir das Zimmer gemeinsam. Wir überquerten den gepflasterten Hauptcampus, bevor Amber uns zielsicher in Richtung Strand lenkte.
»Einer der vielen Vorteile, wenn dein Bruder hier wohnt«, erklärte sie. »Ich weiß, bei welchen Lehrern man sich etwas erlauben kann und bei welchen man am besten nur lächelt. Und ich kenne quasi jeden Weg schon auswendig.«
»Gibt es überhaupt Nachteile?«
»Na ja, das kommt darauf an.« Plötzlich wurde sie ganz ernst. »Wenn dein Geschwisterteil männlich, älter und sowieso besser in allem ist als du, darfst du dir mindestens einmal in der Woche von deinen Eltern anhören, dass er es besser gemacht hätte. Es kann alles sein. Von einer Note in Mathe bis zu der Art und Weise, wie du die Spülmaschine ausräumst oder …« Amber unterbrach sich selbst, bevor sie nervös schluckte. So als hätte sie erst jetzt realisiert, dass sie mir etwas so Privates erzählt hatte. »Sorry«, sagte sie schnell. »Ich hoffe, das war nicht zu persönlich oder komisch oder zu negativ. Ich liebe meinen Bruder. Ich mag nur nicht, wie ungerecht unsere Eltern uns manchmal behandeln.«
»Wir teilen uns ein Zimmer.« Ich grinste. »Ich glaube, es gibt fast kein zu persönlich.«
Sie atmete erleichtert aus. »Und du?«, wollte sie wissen. »Hast du auch Geschwister?«
»Eine ältere Schwester.«
»Versteht ihr euch gut?«
»Eigentlich schon.«
»Das klingt nach einem Aber«, mutmaßte Amber mit einem mitfühlenden Blick.
»Momentan ist es ein bisschen kompliziert bei mir zu Hause.«
Meine Zimmergenossin hakte nicht weiter nach, sie lächelte mir bloß zu. So als wäre beides okay: wenn ich nichts Persönliches über mich erzählen wollte oder etwas zu Privates verriet.
Ich entschied mich für die zweite Option. Ich wollte nicht mysteriös und unnahbar wirken. In erster Linie, weil ich das überhaupt nicht war. Ich war ich, ein wahrscheinlich völlig normales sechzehnjähriges Mädchen, mit dem ein oder anderen Problem, das in der Geschichte der Welt garantiert nicht nennenswert war, und dennoch hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn meine Zimmergenossin meine Freundin werden könnte. Denn das war doch eine meiner größten Ängste gewesen. Umzuziehen, meine Freunde hinter mir zu lassen, meine Freunde dann schließlich zu verlieren, weil ich vier Stunden Zugfahrt entfernt wohnte und keine Ahnung hatte, wer was Freitagabend auf Tiagos Hausparty angestellt hatte. Was sie mir auch gar nicht erzählen könnten, weil – wenn wir uns das nächste Mal unterhielten – bereits jemand anderes auf einer anderen Hausparty etwas anderes getan hatte. Ich hatte mir ausgemalt, hier keine neuen Freunde zu finden, meine Entscheidung zu bereuen und mich allein zu fühlen.
Aber hier war Amber, die mich denken ließ, es könnte ihr vielleicht genauso gehen.
»Meine Eltern haben sich getrennt«, begann ich. »Meine Schwester hat daraufhin beschlossen, nicht mehr mit unserer Mutter zu reden. Ich bin sozusagen das Bindeglied zwischen ihnen.«
»Oh Gott«, erwiderte Amber leise. »Das klingt wirklich mehr als anstrengend.«
»Na ja«, sagte ich mit zuckenden Schultern. »Man gewöhnt sich dran.«
Wir lächelten uns zu, als wären wir schon jetzt Komplizinnen.
Das Inselfest war mehr als gut besucht.
Ehrlicherweise hatte ich keine Ahnung gehabt, dass Sankt Zander überhaupt so viele Einwohner hatte. Meine Internetrecherchen hatten ergeben, dass die deutsche Halbinsel eines der beliebtesten Familienreiseziele war, außerhalb der Ferien und Saison allerdings so wenig los war, dass die meisten Restaurants sogar schlossen. Ade, Take-away-Pizza.