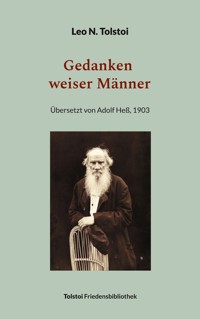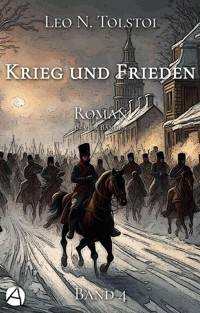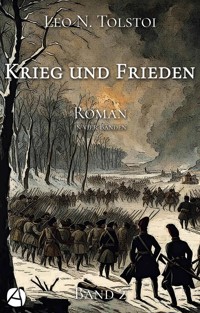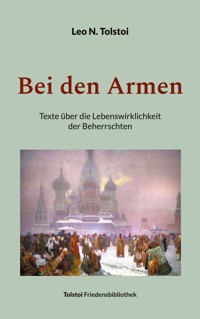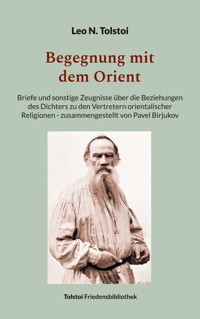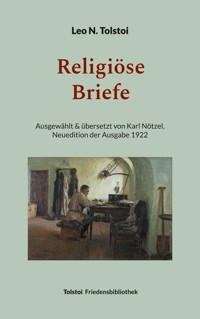Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tolstoi-Friedensbibliothek A
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält die unzensierte Gesamtfassung von L.N. Tolstois Traktat "Was ist Kunst?" (abgeschlossen 1897/98). Bedenkliche Attacken gegen berühmte Werke der europäischen Moderne bilden keineswegs den Kern dieser Schrift. Der Verfasser möchte Wege bahnen für eine allen zugängliche "Kunst der Zukunft", die zur Einen Menschheitsfamilie führt: "Die Kunst unserer Zeit muss katholisch sein im reinen Sinne dieses Wortes, d.h. universell - und daher alle Menschen vereinigen." Ein Kultur- und Wissenschaftsbetrieb der "Siegestempel" dient den Kapitalinteressen und Mächtigen. Er liefert "Werkzeuge zur Ausrottung der Menschen". Doch die Kunst soll sich dem ansteckenden "Heldentum der Liebe" widmen und der Gewalt wehren: "Nur die Kunst kann dies tun." "Warum heute 'Was ist Kunst?' lesen?" - so fragt Marco A. Sorace in der Einleitung zu dieser Neuedition der Übersetzung von Michail Feofanov (1902). "Ohne Zweifel nicht, um sich über einzelne Positionen der Ästhetik oder Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts zu informieren - darüber gibt es (auch aufgrund des nötigen zeitlichen Abstands) unterdessen besseres. Aber vielleicht hat in seiner Zeit kaum ein Zweiter die zivilisatorische Krise so ernst genommen und dermaßen radikal auf die Kunst bezogen wie Leo N. Tolstoi in diesem Text. Gegenwärtig, in unserer nicht minder krisenhaften Zeit kann 'Was ist Kunst?' - die Fallstricke eines normativen und moralistischen Kunstverständnisses wohl beachtend - gelesen werden als ein dringender Aufruf, das ethische und gemeinschaftsstiftende Potenzial der Kunst neu zu heben." Tolstoi-Friedensbibliothek Reihe A, Band 11 (Signatur TFb_A011) Herausgegeben von Peter Bürger Editionsmitarbeit: Bodo Bischof
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tolstoi-Friedensbibliothek
Reihe A | Band 11
Herausgegeben von
Peter Bürger
Inhalt
Einleitung
Von Marco A. Sorace
_____
Leo N. Tolstoi
WAS IST KUNST?
(čto takoe iskusstvo? 1897/98)
Aus dem Russischen von Michail Feofanov (1902)
Anhang I
Anhang II
_____
Bibliographische Übersicht zu Tolstois Werk „Was ist Kunst?“ (1897/98)
Russischer Text
Übersetzungen für eine deutschsprachige Leserschaft (chronologisch)
Tagebuch- und Briefbezüge zu dieser Schrift
Zeitgenössische Rezensionen
Sekundärliteratur zu Tolstois ‚Kunst-Theorie‘
Leo N. Tolstoi (1828-1910)
Fotografie aus dem Jahr 1901: Atelier Scherer & Nabholz, Moskau
EINLEITUNG
Von Marco A. Sorace
Wer „Was ist Kunst?“ von LEO N. TOLSTOI (1828-1910) heute lesen will, benötigt eine Fähigkeit, welche die Leser alttradierter Heiliger Schriften oftmals haben: Sie gehen über vieles hinweg, was überholt erscheint, was aus Gründen des zeitlichen oder räumlichen Horizonts nach heutigem Verständnis unzutreffend ist, um zu dem wahren Kern vorzudringen, der den Text auch gegenwärtig noch kostbar macht. Zu einer solchen Lesweise möchte diese Einleitung verhelfen.
Der späte TOLSTOI veröffentlichte sein Traktat erstmals in den Jahren 1897/1898 und in einer englischsprachigen und unzensierten Fassung 18991. Es handelt sich dabei nicht um einen vom Autor schnell dahingeworfenen Text. Vielmehr hatte TOLSTOI lange – nach eigener Aussage 15 Jahre lang (vgl. S. 286 [→S. 203]) – um seine endgültige Gestalt gerungen.2 Wie eingangs angedeutet, könnte man dazu bereits nach kurzer Lektüre eine Reihe in der aktuellen Perspektive der Kunstwissenschaften gut begründeter methodischer sowie inhaltlicher Kritiken anführen (so z. B. bezüglich seiner Entscheidung für einen „normativen“ Kunstbegriff). Solche Kritik würde aber an den Gründen des besagten Ringens geradewegs vorbeiführen.
Es soll daher einleitend ein anderer Weg genommen und der Blick zunächst auf den unmittelbaren (kunst-)geschichtlichen Kontext von TOLSTOIS „Was ist Kunst?“ gelenkt werden.3
Die Kunst des „fin de siècle“
In der Zeit der Entstehung des Traktats herrscht kunstgeschichtlich eine Stimmung, die mit den Begriffen des „fin de siècle“, einer „l’art pour l’art“ und „Dekadenz“ am besten benannt wird. Bei einigen Künstlerinnen und Künstlern kam in dieser Epoche eine Unruhe auf bezüglich einer Entkopplung der Kunst von ihrer sozialen wie ethisch-moralischen Dimension – einhergehend mit der Gewissheit, dass die Kunst in ihrer damaligen Verfasstheit nicht in der Lage sein würde, auf bevorstehende Menschheitskrisen eine Antwort zu geben.4 Ganz in diesem Sinne beginnt WASSILY KANDINSKY sein 1910 beendetes Werk „Über das Geistige in der Kunst“ im einleitenden Kapitel mit einer Beschreibung der Situation und mit einigen Rückblicken: „Unsere Seele“, heißt es, „die nach der langen materialistischen Periode erst im Anfang des Erwachens ist, birgt in sich Keime der Verzweiflung, des Nichtglaubens, des Ziel- und Zwecklosen.“ Und zur Kunstrezeption in dieser von ihm sogenannten „materialistischen“ Ära führt er aus (die Kunst-Konsumenten ironisch als „Kenner“ bezeichnend): „Die Kenner bewundern die ‚Mache‘ (so wie man einen Seiltänzer bewundert), genießen die ‚Malerei‘ (so wie man eine Pastete genießt). / Hungrige Seelen gehen hungrig ab. / Die große Menge schlendert durch die Säle und findet die Leinwände ‚nett‘ und ‚großartig‘. [Der] Mensch, der etwas sagen könnte, hat zum Menschen nichts gesagt, und der, der hören könnte, hat nichts gehört. / Diesen Zustand der Kunst nennt man l‘art pour l’art.“Nachfolgend beklagt der Text die „Habgier“ der Kunstproduzenten, die auf dem hart umkämpften Markt ihre Werke wie „Güter“ darbieten. Was dabei ausbleibt ist ein wirkliches Verstehen der Kunst. Dagegen KANDINSKY: „‚Verstehen‘ ist Heranbildung des Zuschauers auf den Standpunkt des Künstlers.“ Es erscheint bezeichnend, dass WASSILY KANDINSKY sich genau in dieser zitierten Textpassage zur Frage, ob die Bewältigung dieser Herausforderung auch eine Aufgabe des Malers sei, namentlich auf TOLSTOI beruft.5
Die hier angedeutete Selbstkritik der Kunst führt kunstgeschichtlich in die „Avantgarde der Moderne“, deren um 1909 anbrechende Phase ihrer großen Manifeste nur noch ansatzweise in die Lebzeit TOLSTOIS fällt. Was TOLSTOI jedoch über dessen Tod hinaus mit der Avantgarde verbinden wird, ist ein auf die gesamte Menschheit bezogener Anspruch der Kunst im Zuge einer programmatischen Wiedervereinigung von Kunst und Leben.6 Dabei vollzieht LEO TOLSTOI bereits um 1900 – genauso wie dann später die avantgardistische Bewegung7 – eine geradezu angewiderte Abkehr von der aus dem späten 18. Jahrhundert überkommenen Genieästhetik in ihrem Zusammenspiel mit dem bürgerlich-elitären Kunstkonsum. Er geht in dem wichtigen ersten Kapitel seines Traktats ausführlich auf diese Verhältnisse am Beispiel vor allem der Theater-Kunst ein, die er im Sinne einer unmoralischen, die Menschen untereinander entfremdenden Dekadenz beschreibt (S. 13-22 [→S. 23-29]). Nicht übersehen sollte man einen Einschub (vgl. S. 19 [→S. 27]), der angesichts der Arbeitsverhältnisse in der Landwirtschaft deutlich macht, dass sich in der Kunst hier ein allgemeiner moralischer Niedergang spiegelt.
Eine Kritik an der Kunst des „fin de siècle“ wird zeitgleich mit ganz ähnlichen Anhaltspunkten (etwa in der Malerei der Anreiz durch ein auffälliges Colorit oder die Präsentation lediglich auf Begierlichkeit abzielender Nacktheit) von katholischer Seite vorgebracht – in Deutschland besonders von dem Jesuiten STEPHAN BEISSEL, der das Ressort der Kunstkritik in der Zeitschrift „Stimmen der Zeit“ (damals noch als „Stimmen aus Maria Laach“) von 1880 bis 1908 leitete.8 Wegen der gemeinsamen Forderung einer Neuorientierung der Kunst am Christentum scheint ein Vergleich nahliegend. Im Gegensatz aber zur diffusen Apologetik der katholischen Kunstkritik dieser Zeit, ist der Ansatz TOLSTOIS – wie noch zu zeigen ist – sehr viel konsistenter, was sich nicht zuletzt an seiner Anschlussfähigkeit an die europäischen Avantgarden zeigt.
Pervertierung der Schönheit
Wie konnte es zu dieser moralischen Schwäche der Kunst kommen? TOLSTOI stellt fest, dass die Kunst in seiner Zeit gemeinhin verstanden wird als „eine Tätigkeit, die Schönheit offenbart“ (S. 25 [→S. 31]), wobei die antike und mittelalterliche Einheit des Schönen und Guten nun nicht mehr besteht (vgl. S. 35 [→ S. 37f.]). Einen großen und zentralen Raum nimmt im Traktat nachfolgend die Frage nach der Schönheit bzw. nach der „Schönen Kunst“ ein, so wie sie sich in den ästhetischen Theorien gegen Ende des 19. Jahrhunderts darstellte. Die im dritten Kapitel (S. 36-59 [→S. 39-54]) umfangreichen diesbezüglichen Ausführungen zum Diskurs der Ästhetik in Deutschland, England, Frankreich, Italien und den Niederlanden wird der heutige Leser wohl eher überfliegen – der Autor beruft sich dabei auf eine sehr überschaubare Sekundärliteratur, die heute aus guten Gründen in der Forschung nicht mehr rezipiert wird. Dennoch will TOLSTOI damit, wie er später betont, den erheblichen Aufwand sichtbar machen, den man betrieben habe, um eine scheinbare, den Begriff der Schönheit – in seinem ursprünglichen Verständnis als Transzendentalie und Gottesattribut – pervertierende Begründung für einen lediglich auf vordergründigen Konsumgenuss bzw. Hedonismus basierenden Begriff der „schönen Kunst“ zu konstruieren (vgl. S. 69 [→S. 60f.]).
Und auch das gehört zu einer rechten Würdigung des Tolstoi’-schen Traktats, dass die hier lange im Voraus antizipierte „Nichtmehr-schöne-Kunst“ und die damit zusammenhängende Kritik an der künstlerischen „Autonomie“ in der Ästhetik und Kunstphilosophie des 20. Jahrhunderts zweifelsohne eine große und bleibende Bedeutung hat.9
Kunst als ästhetisch-ethische „Ansteckung“
Nach TOLSTOIS Dekonstruktion des Ästhetizismus seiner Zeit folgt im fünften Kapitel der Schlüssel seiner Ausführungen: Die Kunst sei wesentlich – so seine These – ein „Mittel für die Einigung der Menschen untereinander“ (S. 72 [→S. 63]). Das kann sie sein, weil sie von ihrem Grunde her in der Lage ist, ästhetische (d. h. sinnlich wahrnehmende) Subjekte durch das zu verbinden, was TOLSTOI „Ansteckung“ (vgl. S. 73 passim [→S. 64 passim]) nennt.10 Dieser zunächst an einen Kontext der Virologie erinnernde Ausdruck bezeichnet bei ihm aber ein Phänomen (bei TOLSTOI als „Ansteckbarkeit der Gefühle“ bezeichnet)11, das vor allem in einigen Ansätzen der philosophischen Ästhetik des 20. und 21. Jahrhunderts in dieser Weise durchaus bekannt geworden ist und phänomenologisch weiter ausgewiesen wurde. So weist etwa unter dem Begriff der „Kompassivität“ (in Anschluss an EDMUND HUSSERL – insbesondere an seine späten Untersuchungen zur „Passiven Synthesis“ und „Intersubjektivität“) die aus Frankreich stammende „Radikale Lebensphänomenologie“ die Affekte bzw. die „Gefühle“ als das aus, was imstande wäre, einen auch für das Denken verlässlichen Grund der Gemeinschaft aller Lebenden zu bilden.12 Ursprüngliche Affekte – wie das Gefühl von Schmerz oder Freude – werden dabei in einer präzisen phänomenologischen Begründung als das erkannt, was jegliches „Können“ im Leben erst ermöglicht. Das Phänomen solcher Gefühle wird also verstanden als „Uraffektivität“ im Sinne einer ursprünglichen und passiven Ankünftigkeit des Lebens, die als diese Lebensgabe gleichsam alle Lebendigen untereinander verbindet. Die Vertreter der Lebensphänomenologie sprechen hier von „(Kom-)Passibilität“ als jenen inneren Wirkzusammenhang von allem, „was Leiden kann“13. Es ist sehr wahrscheinlich, dass TOLSTOI mit seinem Begriff der „Ansteckung der Gefühle“ solches intendiert hatte.
Diese Zusammenhänge können hier freilich nicht erschöpfend dargestellt werden, sollen aber als Hinweis darauf dienen, dass die Intuitionen in TOLSTOIS Kunstauffassung in späterer Zeit sehr profund belegt wurden. Dies würde auch dem von TOLSTOI im letzten 20. Kapitel ausdrücklich angemahnten Zusammenspiel von Kunst und „(wahrer) Wissenschaft“ entsprechen.
Zum Problem der „christlichen Kunst“
„Du sollst keine christliche Kunst machen wollen!“14 Mit diesem Satz als ein erstes von „Zehn Geboten für den christlichen Künstler“ unterstreicht der Documenta-Teilnehmer von 1977, der Maler, Zeichner und katholische Priester HERBERT FALKEN sein Bekenntnis zur modernen, von christlich-theologischen Bestimmungen befreiten Kunst. Und so besteht heute auch ein Commonsense darüber, dass Kunst und Christentum zwar einander herausfordern können, aber das Christliche nicht zum inneren Maßstab für aktuelle Kunst werden sollte.
Ganz anders jedoch LEO N. TOLSTOI: Für ihn stellt die Religion – und diese in ihrer gesteigerten Form als „Lehre Christi“ – geradezu das Wertmaß jeder „wahren Kunst“ dar (vgl. S. 80ff. [→ S. 69ff]). Dabei wird man allerdings genau beachten müssen, dass TOLSTOI damit gerade nicht jenes institutionelle und dogmatisch verfestigte Christentum meint, von dem sich die neuzeitliche Kunst in einem mühsamen Prozess emanzipieren konnte. Dagegen meint er vielmehr ein ursprünglicheres Christentum, in dem die Wirklichkeit der Liebe und unverbrüchlichen Einheit aller die einzig tragende Erfahrung ist – ein Christentum dessen Affinität zur Mystik (im Osten zu GREGORIOS PALAMAS u. a. und im Westen zu MEISTER ECKHART u. a.) er wahrscheinlich nicht genug gesehen hat. In jedem Fall – und auch gerade hier wäre Dialog mit der Mystik lohnenswert – hat für TOLSTOI die idolatrische „Entstellung“ der „Lehre Christi“ (vgl. S. 85 [→S. 72]) aufs Engste zu tun mit der zunehmenden Entstellung der Kunst: Es bestehe „das hauptsächliche Unglück der Menschen nicht darin“, so heißt an anderer Stelle, „daß sie Gott nicht kennen, sondern darin, daß Sie an die Stelle Gottes gesetzt haben, was nicht Gott ist. Dasselbe ist auch in der Kunst der Fall.“ (S. 229 [→S. 167])
Auch hier wäre darauf hinzuweisen, dass ein solches Verhältnis von Kunst und „ursprünglichem“ Christentum später in der Kunst – von HUGO BALL bis zu JOSEPH BEUYS und darüber hinaus – durchaus aufgegriffen wurde.
Tolstoi als Kunstkritiker?
Keinen Gefallen – könnte man meinen – hat TOLSTOI seiner Kunsttheorie damit getan, dass er vom neunten Kapitel an eine umfangreiche Geschichte der „Entartung“ (S. 111 [→S. 89])15 der Kunst schreibt. Der heutige Leser wird sicher verwundert sein über die Vielzahl der mitunter herausragenden Künstler, über deren Werk LEO N. TOLSTOI sein vernichtendes Urteil spricht. Darunter sind nicht nur diese, zu denen seine epochale Dekadenz-Kritik16 zu passen scheint – wie CHARLES BAUDELAIRE, RICHARD WAGNER oder ARNOLD BÖCKLIN –, sondern auch ältere Kunst von DANTE ALIGHIERI über MICHELANGELO BUONARROTI bis LUDWIG VAN BEETHOVEN. Was wie ein wilder Rundumschlag anmutet, hat aber wiederum Methode. „Diese Untersuchung hat mich zu der Überzeugung geführt“, so schreibt TOLSTOI, „daß fast alles, was als Kunst und als gute und im umfassenden Sinn Kunst unserer Gesellschaft angesehen wird, nicht nur keine wahre und gute Kunst und nicht die ganze Kunst, sondern überhaupt keine Kunst ist“ (S. 203 [→S. 150]). Wir haben es hier nämlich mit einer Kritik zu tun, welche die Kunst zu einer Ursprünglichkeit führen will, die noch vor dem liegt, was die Kunsthistoriker im engeren Sinne als das „Zeitalter der Kunst“ begreifen.
Diesbezüglich sollte man auch erinnern, dass in der nachfolgenden, wie angesprochen in Bezug auf TOLSTOI bedeutsamen Avantgarde der Gestus, großer Kunst der Vergangenheit aus sehr ähnlichen Gründen einer elementarästhetischen Erweiterung des Kunstverständnisses überhaupt den Stellenwert von Kunst abzusprechen, sehr verbreitet war. Man könnte dazu umfangreich Zitate anführen. Genannt sei nur, die Aufforderung MARCEL DUCHAMPS, ein Tafelbild von REMBRANDT „als Bügelbrett“ zu verwenden.17 In einem solchen, den Weg für ein neues Kunstverständnis freimachenden Sinne sollte auch TOLSTOIS Kritik verstanden werden.
Der Künstler als „organischer Intellektueller“
In seinem Traktat fordert TOLSTOI immer wieder eine „Kunst der Zukunft“ (S. 274ff [→S. 195ff]) – geschaffen von neuen Künstlertypen, die mit dem Volk verbunden eine Kunst schaffen, „die allen Menschen ohne Ausnahme zugänglich“ (S. 280 [→S. 199]) ist – wie oben angesprochen durch Ansteckung der Gefühle.
Diese Künstler sind in den allermeisten Zügen genauso gedacht wie ANTONIO GRAMSCIS „organische Intellektuelle“, die im Gegensatz zu den „traditionellen (oder kristallinen) Intellektuellen“, welche durch soziale Abgehobenheit gekennzeichnet sind, aus der Masse hervorgehen und mit ihr verbunden bleiben.18 Der besondere Reiz, mit GRAMSCI den künstlerischen „organischen Intellektuellen“ TOLSTOIS weiterzudenken, bestände darin, dass GRAMSCI diesen Typus konzipiert vor dem Hintergrund seiner sehr differenzierten umfassenden Machttheorie, die neuerdings auf ein immer größer werdendes Interesse stößt – beispielsweise in einer „postkolonialen“ Kulturwissenschaft.
Warum heute „Was ist Kunst?“ von TOLSTOI lesen? – so lautet die entscheidende Frage dieser Einleitung. Ohne Zweifel nicht, um sich über einzelne Positionen der Ästhetik oder Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts zu informieren – darüber gibt es (auch aufgrund des nötigen zeitlichen Abstands) unterdessen besseres. Aber vielleicht hat in seiner Zeit kaum ein Zweiter die zivilisatorische Krise so ernst genommen und dermaßen radikal auf die Kunst bezogen wie LEO N. TOLSTOI in diesem Text. Gegenwärtig, in unserer nicht minder krisenhaften Zeit kann „Was ist Kunst?“ deswegen – die Fallstricke eines normativen und moralistischen Kunstverständnisses wohl beachtend – gelesen werden als ein dringender Aufruf, das ethische und gemeinschaftsstiftende Potenzial der Kunst neu zu heben.
1 In seinem Vorwort zu dieser Ausgabe schrieb der Autor: „Mein Buch ‚Was ist Kunst?‘ erscheint jetzt zum ersten Mal in seiner wirklichen Gestalt. Es erschien in Russland in mehreren Ausgaben, aber in einer von der Zensur so entstellten Form, daß ich alle, die sich für meine Ansichten über Kunst interessieren, ersuche, darüber nur nach dem Buch in seinem wahren Aussehen zu urteilen.“ Die hier angesprochene unzensierte Ausgabe war wenige Jahre später Grundlage der dt. Übersetzung im Eugen-Diederichs-Verlag, aus dessen durchgesehener Neuausgabe wir hier und nachfolgend (unter bloßer Angabe der Seitenzahl) zitieren: Leo N. TOLSTOI, Was ist Kunst? Übers. von Michail Feafanov. München: Diederichs 1993, hier S. 7-11 (Vorwort), 7 [→S. 19]. [Die vom Hrsg. hinzugefügten →Seitenangaben in eckigen Klammern verweisen auf die entsprechenden Textpassagen innerhalb der hier vorgelegten Neuedition der Übersetzung von 1902.]
2 Sylvia SASSE bringt dies in den Zusammenhang jenes Lebensabschnitts einer „kompletten ästhetischen und religiösen Neuorientierung“ bei Tolstoi. Vgl. DIES., Kunst. In: Martin George u.a. (Hg.), Tolstoj als theologischer Denker und Kirchenkritiker. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015 (2. Aufl.), S. 462-473, 462.
3 Zur Verortung des Traktats in Tolstois Denken zur Kunst vgl. Magdalene ZUREK, Tolstojs Philosophie der Kunst (= Neues Forum für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft 2). Heidelberg: Winter 1996.
4 TOLSTOI selbst lenkt in seiner Schrift indessen stärker den Blick auf jene Künstler, welche unbekümmert um diese Situation mit gewissen „Kniffen“ von ihm so bezeichnete „Falsifikate“ der Kunst hervorbringen (vgl. S. 150ff. [→S. 116ff.]).
5 Wassily KANDINSKY, Über das Geistige in der Kunst. Eingeführt von Max Bill. Bern: Benteli 1952 (10. Aufl.), S. 22; 24. Vgl. dazu auch Leo N. TOLSTOIS Aussage „Ein echtes Kunstwerk bewirkt, daß im Bewußtsein des Empfangenden die Trennung zwischen ihm und den Künstler aufgehoben wird […].“ (S. 218 [→S. 160]).
6 Insbesondere in den russischen Avantgarde-Manifesten kommt der Name Tolstois wiederholt vor – drin aber oft ablehnend im Sinne des rigorosen Traditionsbruchs dieser Bewegungen und scheinbar v. a. hinsichtlich der früheren Literaturästhetik Tolstois. Immerhin aber kritisiert Raoul Hausmanns Dada-Manifest „Der deutsche Spiesser ärgert sich“ von 1919 ein Publikum, das Ethik und Kunst nur sehr vordergründig miteinander verbindet, mit den Worten, dieses hätte „Tolstoi gelesen und selbstverständlich nicht verstanden“, was man sicherlich als eine Zustimmung zur Kunsttheorie Tolstois deuten kann (vgl. Manifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde, 1909-1938. Hrsg. von Wolfgang ASHOLT und Walter FÄHNDERS. Stuttgart/Weimar: Metzler 1995, S. 37; 184).
7 Freilich darf man einen z. T. (etwa bei den italienischen und russischen Futuristen) sehr ausgeprägten gewaltsamen Habitus der frühen Avantgardisten als einen deutlichen Unterschied zu Tolstois Pazifismus nicht übersehen.
8 Vgl. dazu Alex STOCK, Zwischen Tempel und Museum. Theologische Kunstkritik. Positionen der Moderne. Paderborn: Schöningh 1991, S. 22-26.
9 Vgl. dazu Hans Robert JAUß u. a. (Hg.), Die nicht mehr schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen. (Poetik und Hermeneutik 3), München: Fink 1975; vgl. dazu auch Peter BÜRGER, Theorie der Avantgarde. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1974, S. 49-75 („Zum Problem der Autonomie der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft“).
10 Vgl. dazu auch Sylvia SASSE, „Kunst“, a.a.O., S. 463ff.
11 Holger KUßE ist es zu danken, darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass der hier zugrundeliegende Begriff der Gemeinschaft(lichkeit) (russ. „Sobornost“) einer tief in der orthodoxen Spiritualität gründenden und in der Romantik wieder aufgekommenen Tradition folgt; vgl. dazu DERS., Lev Tolstoj und die Sprache der Weisheit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2010, S. 70ff.
12 Vgl. dazu Michel HENRY, Inkarnation. Eine Philosophie des Fleisches. Freiburg/Br.: Alber 2002, S. 373ff. („Die Erfahrung des Nächsten in der Phänomenologie des Lebens“); vgl. dazu auch Rolf KÜHN. Husserls Begriff der Passivität. Zur Kritik der passiven Synthesis in der Genetischen Phänomenologie (= Phänomenologie II, Kontexte 6). Freiburg/Br.: Alber 1998, bes. S. 383 („Einfühlung und passive Intersubjektivität“).
13 Rolf KÜHN, Alles, was leiden kann. Zur Ursprungseinheit von Freude und Leid. Dresden: Text & Dialog 2019.
14 Herbert Falken zitiert nach: Hans GERCKE, Auf der Suche nach dem Bild Christi. In: Philipp Boonen (Hg.), Herbert Falken – Christusbilder (= Aachener Beiträge zu Pastoral- und Bildungsfragen 14). Aachen: Einhard 1986, S. 23-24, 23.
15 Die Geschichte, welche dieser Begriff in der Zeit des Nationalsozialismus machen wird, konnte TOLSTOI Ende des 19. Jahrhunderts nicht ahnen. Jedoch kann die grundsätzliche Problematik eines normativen Kunstbegriffs, welcher der Kunst zwangsläufig eine „Art“ vorgibt, insbesondere an der Kunstgeschichtsschreibung Hans SEDLMAYRS wahrgenommen werden, die vom Nationalsozialismus gerne aufgegriffen wurde und auch nach dem Zweiten Weltkrieg bei jenen, die mit den Entwicklungen der freien Kunst Probleme hatten, starke Resonanz fand. Vgl. dazu. DERS., Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit. Salzburg: Müller 1948.
16 Was TOLSTOI hier im Einzelnen vorträgt, ist Kunstkritik, auch wenn er sich selbst zur „Kunstkritik“ seiner Zeit negativ kritisch äußert (vgl. 168ff. [→S. 127ff]). Er meint mit letzterer jedoch eine Pseudo-Kritik, die dann auftritt, wenn nach dem wahren Wesen der Kunst nicht mehr gefragt wird.
17 Marcel Duchamp zit. nach Dieter DANIELS, Duchamp und die anderen. Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne. Köln: Dumont 1992, S. 196.
18 Antonio GRAMSCI, Gefängnishefte. Kritische Gesamtausgabe auf der Grundlage der von Valentino Garratana besorgten Edition, 10 Bde. Hrsg. von Klaus Bochmann, Wolfgang F. Haug und Peter Jehle. Hamburg: Argument 1991-2002, S. 530, passim; bes. 1390.
Leo N. Tolstoi
Was ist Kunst?
Aus dem Russischen von Michail Feofanov (1902)
Textquelle der dargebotenen Übersetzung | Leo N. TOLSTOJ: Was ist Kunst? Übersetzt von Michael Feofanoff [18281910]. Leipzig: Eugen Diederichs Verlag 1902. [322 Seiten]
VORWORT
„Was ist Kunst?“ wurde zuerst in der Zeitschrift „Woprosy Philosophii i Psychologii“ („Fragen der Philosophie und Psychologie“) abgedruckt und erschien dann in Sonderausgaben. Diese Ausgaben wurden von der russischen, weltlichen und kirchlichen Censur so verstümmelt, daß L. Tolstoj es für nötig befand, zu der vollständigen englischen Ausgabe dieses Buches folgendes Vorwort zu schreiben:
„Mein Buch ‚Was ist Kunst?' erscheint jetzt zum ersten Male in seiner wirklichen Gestalt. Es erschien in Rußland in mehreren Ausgaben, aber in einer von der Zensur so entstellten Form, daß ich alle, die sich für meine Ansichten über Kunst interessieren, ersuche, darüber nur nach dem Buche in seinem wahren Aussehen zu urteilen. Der Abdruck des Buches in seiner entstellten Form mit meinem Namen geschah aus folgenden Gründen. Nach dem von mir schon längst gefaßten Entschlusse, meine Schriften der Censur nicht zu unterwerfen, die ich als eine unsittliche und unvernünftige Einrichtung ansehe, sondern sie nur in dem Zustande zu drucken, in dem sie geschrieben sind, hatte ich die Absicht, dieses Buch nur im Auslande drucken zu lassen; aber mein guter Bekannter, der Professor Grot, Redakteur einer moskauischen psychologischen Zeitschrift erfuhr von dem Inhalt meiner Arbeit und bat mich, das Buch in seiner Zeitschrift abdrucken zu dürfen. Grot versprach mir, den Aufsatz in seiner Gesamtheit durch die Censur durchzubringen, wenn ich mich mit ganz unbedeutenden Veränderungen, die einige Ausdrücke mäßigen, einverstanden erklärte. Ich hatte die Schwäche zuzustimmen und es endete damit, daß ein von mir unterzeichnetes Buch erschien, aus dem nicht nur einige wesentliche Gedanken gestrichen, sondern in das fremde und sogar meinen Überzeugungen vollständig entgegengesetzte Gedanken hineingeflickt wurden.
Dies geschah in folgender Weise. Zuerst milderte Grot meine Ausdrücke, zuweilen schwächte er sie ab, z. B. ersetzte er das Wort „stets“ – durch das Wort „zuweilen“; das Wort „alle“ – durch das Wort „einige“; das Wort „kirchlich“ – durch das Wort „katholisch“; das Wort „Gottesmutter“ – durch das Wort „Madonna“; das Wort „Patriotismus“ – durch das Wort „Pseudopatriotismus“, das Wort „Palais“ – durch das Wort „Palast“ (das erste im Sinne der kaiserlichen und königlichen Palais, das zweite im Sinne von Häusern reicher Leute. Anm. d. Übers.) und dergleichen. Und ich fand es nicht für nötig zu protestieren. Als aber das Buch schon ganz abgedruckt war, verlangte die Censur, daß ganze Sätze geändert und gestrichen, und daß statt dessen, was ich über die Schädlichkeit des Landbesitzes sprach, die Schädlichkeit des landbesitzlosen Proletariates dargelegt werden solle. Ich erklärte mich auch damit und noch mit einigen Veränderungen einverstanden. Ich meinte, daß es sich nicht lohne, die ganze Sache wegen eines einzigen Ausdruckes über den Haufen zu werfen.
Wenn aber eine Veränderung zugelassen wurde, lohnte es sich auch nicht, wegen einer zweiten, einer dritten zu protestieren. So schlichen sich allmählich Ausdrücke in das Buch ein, die den Sinn entstellten und mir das zuschrieben, was ich unmöglich konnte gesagt haben wollen. So war dem Buche, als es gedruckt war, schon ein Teil seiner Einheitlichkeit und Aufrichtigkeit genommen. Aber man konnte sich damit trösten, daß das Buch auch bei diesem Aussehen, wenn es irgend etwas Gutes enthielte, den russischen Lesern Nutzen bringen werde, für die es im umgekehrten Falle unzugänglich sein würde. Aber dem war nicht so. Nous comptions sans notre hôte. Nach der gesetzlich bestimmten viertägigen Frist wurde das Buch mit Beschlag belegt und laut Verordnung von Petersburg aus an die geistliche Censur gegeben. Da sagte Grot sich von jeder Beteiligung an dieser Sache los und die geistliche Censur wirtschaftete in dem Buche, wie es ihr gefiel. Die geistliche Censur aber ist eine der unwissendsten, käuflichsten, dümmsten und despotischsten Einrichtungen von Rußland. Die Bücher, die in irgend etwas mit der Religion, die in Rußland als staatliche anerkannt ist, nicht übereinstimmen und die nach Rußland gelangen, werden fast stets ganz und gar verboten und verbrannt, wie dies mit allen meinen religiösen Werken, die in Rußland gedruckt worden sind, der Fall war. Wahrscheinlich hätte dies Buch dasselbe Schicksal erlitten, wenn die Redakteure der Zeitschrift nicht alle Mittel zu seiner Rettung angewandt hätten. Das Resultat dieser Bemühungen war, daß der geistliche Censor, ein Priester, der sich wahrscheinlich ebenso für die Kunst interessiert, wie ich mich für den Gottesdienst, und der ebensoviel davon verstand, der aber ein gutes Gehalt dafür erhält, daß er alles das, was seinen Vorgesetzten nicht gefallen würde, vernichtet – daß dieser alles das, was ihm gefährlich für seine Stellung erschien, ausstrich und dort, wo er es für nötig hielt, meine Gedanken durch seine ersetzte. So hat der Censor z. B. dort, wo ich von Christus spreche, der sich für die Wahrheit, zu der er sich bekannte, ans Kreuz schlagen ließ, diese Stelle gestrichen und „für das Menschengeschlecht“ gesetzt, d. h. er hat mir auf diese Weise die Behauptung des Dogmas der Erlösung zugeschrieben, das ich als eins der unrichtigsten und schädlichsten Kirchendogmen ansehe. Nachdem der geistliche Censor alles in dieser Weise korrigiert hatte, erlaubte er das Buch zu drucken.
In Rußland kann man keinen Protest erheben: keine Zeitung wird ihn drucken; meinen Aufsatz von der Zeitschrift zurückzuziehen und dadurch den Redakteur in eine unangenehme Lage gegenüber dem Publikum zu bringen, konnte man auch nicht.
So blieb eben die Sache. Es erschien ein Buch unter meinem Namen, das Gedanken enthält, die für die meinen ausgegeben werden, die mir aber nicht gehören. –
Ich hatte meinen Aufsatz deshalb einer russischen Zeitschrift gegeben, damit, wie man mir versicherte, meine Gedanken, die nützlich sein können, den russischen Lesern bekannt würden – und es endete damit, daß ich meinen Namen auf ein Werk gesetzt habe, aus dem man schließen kann, daß ich vollständig willkürlich der allgemeinen Meinung entgegengesetzte Dinge behaupte, ohne Beweise anzuführen, daß ich nur den Pseudopatriotismus als schlecht ansehe, den Patriotismus überhaupt aber als ein sehr gutes Gefühl anerkenne, daß ich nur den Unsinn der katholischen Kirche verneine und nur an die Madonna nicht glaube, an die orthodoxe Kirche und an die Gottesmutter aber glaube, daß ich alle Schriften der Hebräer, die in der Bibel vereinigt sind, als heilige Bücher ansehe, und daß ich die Hauptbedeutung Christi in der Erlösung des menschlichen Geschlechtes durch seinen Tod erblicke.
Ich habe diese ganze Geschichte so umständlich erzählt, weil sie die unbestreitbare Wahrheit schlagend belegt, daß jeder Kompromiß mit einer Einrichtung, die Ihrem Gewissen widerspricht – ein Kompromiß, den man gewöhnlich im Hinblick auf allgemeinen Nutzen schließt – sie unvermeidlich statt zu nutzen, nicht nur in die Anerkennung der Gesetzlichkeit der von ihnen nicht anerkannten Einrichtung hineinzieht, sondern auch in die Beteiligung an dem Schaden, den diese Einrichtung anrichtet.
Ich freue mich, daß ich wenigstens durch diese Erklärung den Fehler, in den ich durch meinen Kompromiß hineingezogen wurde, verbessern kann.
Am 17ten März 1899
Leo Tolstoi
1 |
Nehmen Sie eine beliebige Zeitung unserer Zeit und in jeder finden Sie eine Abteilung für Theater und Musik; fast in jeder Nummer finden Sie eine Beschreibung dieser oder jener Ausstellung oder eines einzelnen Bildes, und in jeder sind Berichte über neuerscheinende Bücher künstlerischen Inhalts, Gedichte, Novellen und Romane zu finden.
Es wird ausführlich und unmittelbar, nachdem es geschehen ist, berichtet, wie die Schauspielerin so und so, oder ein Schauspieler in dem und dem Drama, der und der Komödie oder Oper die eine oder die andere Rolle gespielt haben, welche Vorzüge sie dabei gezeigt haben, worin der Inhalt des neuen Dramas, der neuen Komödie oder Oper, ihre Mängel und Vorzüge bestehen. Mit derselben Ausführlichkeit und Gewissenhaftigkeit wird beschrieben, wie der und der Künstler dies oder jenes Stück gesungen oder auf dem Klavier oder der Geige vorgetragen hat, worin die Vorzüge und Mängel dieses Stückes und seines Vortrages liegen. In jeder großen Stadt ist immer, wenn nicht mehrere, so wenigstens doch eine Ausstellung neuer Bilder, deren Vorzüge und Mängel von den Kritikern und Kennern mit dem größten Tiefsinn einer Besprechung unterzogen werden. Fast jeden Tag erscheinen neue Romane, Gedichte in Sonderausgaben und in Zeitschriften, und die Zeitungen halten, es für ihre Pflicht, ihren Lesern ausführliche Berichte über diese Erzeugnisse der Kunst zu geben.
In Rußland, wo für die Volksbildung nur ein Hundertstel dessen, was zur Verschaffung von Lehrmitteln für das ganze Volk nötig ist, verausgabt wird, erhalten die Akademien, Konservatorien und Theater Millionen an Zuschüssen von der Regierung. In Frankreich werden für die Künste 8 Millionen bestimmt, dasselbe trifft man auch in Deutschland und England. In jeder großen Stadt baut man riesige Gebäude für Museen, Akademien, Konservatorien, dramatische Schulen, Vorstellungen und Konzerte. Hunderttausende von Arbeitern – Zimmerleute, Maurer, Maler, Tischler, Tapezierer, Schneider, Friseure, Juweliere, Bronzearbeiter, Setzer – verbringen ihr ganzes Leben in schwerer Arbeit zur Befriedigung der Forderungen der Kunst, so daß es kaum eine andere menschliche Thätigkeit, außer der militärischen, giebt, die so viel Kräfte verschlingt, wie die Kunst.
Nicht genug aber, daß solch eine große Arbeitskraft für diese Thätigkeit aufgewandt wird, – man vergeudet für sie ebenso, wie für den Krieg, einfach Menschenleben: hunderttausende von Menschen widmen von Jugend auf ihr ganzes Leben, um möglichst schnell die Beine drehen zu lernen (die Tänzer); andere (die Musiker), um möglichst schnell die Tasten oder die Saiten berühren zu lernen; andere (die Maler) um in Farben malen zu lernen und alles, was sie erblicken, wiederzugeben; die vierten um jede Phrase auf jegliche Art umzuwenden zu verstehen und für jedes Wort einen Reim zu finden. Und solche Menschen, die oft sehr gut, klug und zu jeder nützlichen Arbeit fähig sind, verwildern in diesen ausschließlichen sinnberaubenden Beschäftigungen, stumpfen gegen alle ernsten Erscheinungen des Lebens ab, werden einseitige und selbstzufriedene Spezialisten, die nur die Beine, die Zunge oder die Finger zu drehen verstehen.
Aber das ist nicht alles. Ich erinnere mich, wie ich einmal einer Probe einer der gewöhnlichen neuesten Opern, die in allen Theatern Europas und Amerikas aufgeführt werden, beiwohnte. Ich kam, als der erste Akt bereits begonnen hatte. Um in den Zuschauerraum zu treten, mußte ich durch die Kulissen durchgehen. Man führte mich durch dunkle Gänge und Durchgänge des Erdgeschosses des riesigen Gebäudes, an großen Maschinen zur Veränderung der Dekorationen und der Beleuchtung vorüber, wo ich Menschen erblickte, die in der Dunkelheit und im Staube an irgend etwas arbeiteten.
Einer von diesen Arbeitern mit einem grauen mageren Gesichte, in einer schmutzigen Bluse, mit schmutzigen Arbeitshänden, mit ausgespreizten Fingern, offenbar müde und mit irgend etwas unzufrieden, ging an mir vorbei und warf wütend einem anderen irgend etwas vor. Ich stieg eine dunkle Treppe hinauf und kam auf die Bühne hinter den Kulissen. Zwischen den umgeworfenen Dekorationen, Vorhängen, Stangen und Scheiben standen und bewegten sich Dutzende, wenn nicht Hunderte, geschminkter und aufgeputzter Männer in Kostümen, die die Waden umspannten, und Frauen, wie immer mit möglichst entblößtem Körper. Dies alles waren Sänger, Choristen, Choristinnen und Ballettänzerinnen, die, bis sie an der Reihe waren, warteten. Mein Führer leitete mich über die Bühne und eine Brücke aus Brettern durch den Orchesterraum, wo ungefähr hundert Musikanten jeglicher Art, vom Paukenschläger bis zum Flötisten und Harfenspieler, saßen, nach dem dunklen Parterre. Auf einer Erhöhung zwischen zwei Lampen mit Reflektoren saß der Chef des musikalischen Teiles, der Dirigent des Orchesters der Sänger und überhaupt der ganzen Aufführung, mit einem Stöckchen in der Hand auf einem Sessel vor dem Notenpult.
Als ich kam, hatte die Vorstellung schon begonnen, und auf der Bühne wurde ein Zug von Indiern, die eine Braut hergeführt hatten, dargestellt. Außer den aufgeputzten Männern und Frauen liefen auf der Bühne noch zwei Menschen im Jackett herum und mühten sich ab: der eine war der Leiter des dramatischen Teiles und der andere, der mit ungewöhnlicher Leichtigkeit in weichen Schuhen einherging und von einer Stelle nach der anderen herumlief, war der Tanzlehrer, der in einem Monat mehr Gehalt als zehn Arbeiter in einem Jahr erhielt.
Diese drei Chefs ordneten den Gesang, das Orchester und den Zug. Der Zug wurde wie immer, paarweise, mit Hellebarden aus Glanzpapier auf den Schultern, ausgeführt. Alle kamen aus einer Stelle hervor, gingen im Kreise und noch einmal im Kreise herum und blieben darauf stehen. Der Zug kam lange nicht vorschriftsmäßig zu Stande: bald kamen die Indier mit den Hellebarden zu spät, bald zu früh, bald kamen sie zur Zeit, aber beim Rückzuge drängten sie sich zu sehr, oder aber sie stellten sich nicht, wie es sich gehörte, an den Seiten der Bühne auf, und jedes Mal wurde alles unterbrochen und von neuem begonnen. Der Zug wurde durch ein Rezitativ eines als Türken verkleideten Mannes eingeleitet, der mit sonderbar geöffnetem Munde sang: „ich begleite die Braut“. Er singt und macht mit der Hand – die selbstverständlich entblößt ist – unter der Toga eine Bewegung. Und der Zug beginnt, aber da giebt das Waldhorn im Akkord zu dem Rezitativ nicht den passenden Ton, der Dirigent zuckt auf wie von einer Tarantel gestochen und schlägt mit dem Stöckchen auf das Pult. Alles bleibt stehen, der Dirigent wendet sich zu dem Orchester um, fährt den Waldhornisten an und schimpft ihn mit den gröbsten Schimpfworten, wie die Droschkenkutscher es thun, weil er nicht den richtigen Ton genommen hat. Und wiederum beginnt alles von Anfang an. Die Indier mit den Hellebarden kommen von neuem, in ihrer sonderbaren Schuhbekleidung weich dahinschreitend, wiederum singt der Sänger: „ich begleite di–e Bra–ut“. Aber jetzt stehen die Paare zu eng aneinander. Wiederum ein Klopfen mit dem Stöckchen, Schimpfworte, und wiederum fängt man von neuem an. Wieder das: „ich begleite di–e Bra– ut“, wiederum dieselbe Geberde mit der entblößten Hand unter der Toga hervor und die Paare schreiten wiederum leise, mit den Hellebarden auf den Schultern, einige mit ernstem und traurigem Gesichte, einige unterhalten sich und lächeln, sie stellen sich im Kreise auf und fangen an zu singen. Alles scheint gut abgelaufen, aber wiederum klopft das Stöckchen und der Dirigent beginnt mit leidender und erboster Stimme die Choristen und Choristinnen zu schimpfen: es zeigt sich, daß die Choristen während des Gesanges nicht ab und zu die Hände zum Zeichen der Begeisterung erheben. „Was, seid ihr gestorben, wie? Ihr Ochsen! Seid ihr tot, daß ihr euch nicht rührt!“ Wiederum beginnt es von neuem, wiederum das: „ich begleite di–e Bra–ut“, wiederum singen die Choristinnen mit traurigen Gesichtern und erheben bald die eine, bald die andere Hand. Aber zwei Choristinnen unterhalten sich – wiederum ein verstärktes Klopfen des Stöckchens. „Was, seid ihr hierher gekommen um zu schwätzen? Ihr könnt zu Hause klatschen. Sie da, in den roten Hosen, treten Sie näher. Sehen Sie mich an. Von vorn!“ Wiederum das: „ich begleite di–e Bra–ut“. Und so dauert es ein, zwei, drei Stunden. Solch eine Probe dauert sechs Stunden hintereinander. Das Klopfen mit dem Stöckchen, Wiederholungen, Verteilung, Korrigieren der Sänger, des Orchesters, des Zuges, der Tänze, und alles wird mit einem wütenden Schelten gewürzt. Die Worte: „Esel, Dummköpfe, Idioten, Schweine“, die bei den Musikanten und Sängern angewandt wurden, hörte ich im Laufe einer Stunde wohl vierzig Mal. Und der unglückliche, physisch und moralisch entstellte Mensch, der Flötist, der Waldhornist, dem die Schimpfwörter zufallen, schweigt und kommt dem Befehle nach: wiederholt zwanzig Mal „ich begleite die Braut“ und singt zwanzig Mal eine und dieselbe Phrase und schreitet wiederum in gelben Schuhen mit der Hellebarde auf der Schulter. Der Dirigent weiß, daß diese Menschen so entstellt sind, daß sie zu nichts anderem taugen, als zu blasen und mit der Hellebarde in gelben Schuhen einherzugehen, daß sie aber zugleich an ein gutes luxuriöses Leben gewöhnt sind, und alles ertragen werden, um nur nicht dieses gute Leben zu entbehren, – und deshalb ergießt er sich ruhig seiner Grobheit, um so mehr, da er dies in Paris und Wien beobachtet hat und weiß, daß die besten Dirigenten so handeln, daß dies eine musikalische Tradition der berühmten Künstler ist, die von dem großen Werke ihrer Kunst so hingerissen sind, daß sie keine Zeit haben, die Gefühle der Darsteller zu berücksichtigen.
Es ist schwer, ein noch abscheulicheres Schauspiel anzutreffen. Ich habe gesehen, wie beim Abladen von Waren ein Arbeiter den anderen dafür, daß dieser die auf ihn gewälzte Last nicht gestützt hatte, schimpfte, oder wie bei der Heuernte der Starost einen Arbeiter dafür ausschimpfte, daß er das Ende des Heuschobers falsch zusammengestellt hatte, und der Arbeiter schwieg demütig. Und wenn es einem auch unangenehm ist, so etwas zu sehen, wird das unangenehme Gefühl durch das Bewußtsein gemildert, daß hier ein notwendiges und wichtiges Werk verrichtet wird, daß der Fehler, für den der Vorgesetzte den Arbeiter schimpft, ein wichtiges Werk verderben kann.
Was wird denn aber hier gethan, wozu und für wen? Es ist sehr möglich, daß er, der Dirigent, auch abgehetzt ist, wie jener Arbeiter; ja, man sieht sogar, daß er thatsächlich abgehetzt ist, aber wer heißt ihn denn sich abquälen? Ja, und um welche Sache quält er sich? Die Oper, die sie probten, war eine der gewöhnlichsten Opern für diejenigen, die sich daran gewöhnt haben, aber der größte Unsinn, den man sich nur vorstellen kann: ein indischer König will heiraten, man führt ihm eine Braut zu, er verkleidet sich als Sänger, die Braut verliebt sich in den vermeintlichen Sänger und ist in Verzweiflung, aber dann erfährt sie, daß der Sänger der König selbst sei, und alle sind sehr zufrieden.
Daß es solche Indier nie gegeben hat und nie geben kann und daß das, was sie darstellten, nicht nur keine Ähnlichkeit mit Indiern, sondern überhaupt mit nichts auf der Welt, mit Ausnahme der anderen Opern, hat, darüber kann es keinen Zweifel geben; daß man in solch einem Rezitativ nicht redet und die Gefühle nicht im Quartett offenbart, indem man sich in bestimmter Entfernung von einander hinstellt und die Hände bewegt, daß man mit solchen Hellebarden aus Glanzpapier, in Schuhen, paarweise, nirgend wo anders als im Theater herumgeht, daß man sich nicht in solcher Weise ärgert, nicht in solcher Weise gerührt wird, nicht so lacht, so weint und daß alle diese Vorstellungen niemand in der Welt rühren können, darüber kann es keinen Zweifel geben.
Unwillkürlich taucht immer die Frage auf: für wen wird dies gethan? Wem kann dies gefallen? Wenn in dieser Oper auch ab und zu hübsche Motive vorkommen, die angenehm anzuhören sein würden, so könnte man sie doch einfach ohne diese dummen Kostüme, Aufzüge, Rezitative und Schwingungen der Hände singen. Das Ballet aber, wo halbentblößte Frauen wollüstige Bewegungen machen und sich in allerlei sinnlichen Guirlanden verwickeln, ist einfach eine sittenlose Vorstellung, so daß man es gar nicht begreifen kann, für wen dies berechnet ist. Dem gebildeten Menschen ist dies unerträglich, zum Überdruß; dem echten Arbeitsmenschen ist dies vollständig unbegreiflich. – Dies kann – und auch das ist noch fraglich – Menschen gefallen, die herrschaftliche Bedürfnisse angenommen haben, aber von den herrschaftlichen Vergnügungen nicht übersättigt sind, ausschweifenden Handwerkern, die ihre Bildung bekunden wollen, und jungen Lakaien.
Und diese ganze häßliche Dummheit wird nicht mit guter Heiterkeit und Schlichtheit, sondern mit Bosheit, mit tierischer Grausamkeit bereitet. Man sagt, daß dies für die Kunst gethan wird, die Kunst aber sei eine sehr wichtige Sache. Aber ist es wahr, daß dies die Kunst ist und daß die Kunst solch eine wichtige Sache ist, daß ihr solche Opfer gebracht werden können? Diese Frage ist deshalb besonders wichtig, weil die Kunst, derentwegen man die Arbeit von Millionen Menschen, selbst Menschenleben und hauptsächlich die Liebe zwischen den Menschen opfert, weil diese Kunst im Bewußtsein der Menschen immer mehr und mehr zu etwas unklarem und unbestimmtem wird. – Die Kritik, in der die Kunstfreunde früher eine Stütze für ihre Urteile über die Kunst fanden, ist in letzter Zeit so widersprechend geworden, daß, wenn man aus dem Gebiete der Kunst alles das, dem die Kritiker der verschiedenen Schulen selbst nicht die Zugehörigkeit zur Kunst zugestehen, ausschließt, fast nichts mehr von der Kunst übrig bleibt.
Gleich den Theologen verschiedener Lehren, schließen sich die Künstler der verschiedenen Richtungen aus und vernichten sich gegenseitig. Hören Sie die Künstler der jetzigen Schulen an und Sie werden auf allen Gebieten sehen, daß die einen Künstler die anderen nicht anerkennen: in der Poesie sehen sie alte Romantiker, die die Parnassier und Dekadenten nicht anerkennen; Parnassier, die die Romantiker und Dekadenten verneinen; Dekadenten, die alle Vorgänger und die Symbolisten nicht anerkennen; Symbolisten, die alle Vorgänger und Magier abstreiten; und Magier, die alle ihre Vorgänger nicht anerkennen; im Roman sehen Sie Naturalisten, Psychologen, Realisten, die einander nicht anerkennen. Dasselbe ist auch im Drama, der Malerei und der Musik der Fall. So daß die Kunst, die eine riesige Arbeit des Volkes und Menschenleben verschlingt und die Liebe unter den Menschen zerstört, nicht nur nichts klares und fest bestimmtes ist, sondern von ihren Freunden so widersprechend aufgefaßt wird, daß es schwer ist, zu sagen, was überhaupt unter Kunst, besonders unter guter nützlicher Kunst, unter einer solchen verstanden wird, in deren Namen jene Opfer, die man ihr bringt, gebracht werden können.
2 |
Für jedes Ballet, jeden Zirkus, jede Oper, Operette, Ausstellung, jedes Bild, Konzert, für den Druck eines Buches – ist eine anstrengende Arbeit tausender und abertausender von Menschen nötig, die häufig unfreiwillig eine verderbliche und erniedrigende Arbeit verrichten. Es wäre doch gut, wenn die Künstler ihr ganzes Werk selbst verrichteten, sie alle aber bedürfen der Hilfe der Arbeiter nicht allein zur Erzeugung der Kunst, sondern auch für ihr größtenteils luxuriöses Leben; sie erhalten dieselbe auch in der oder jener Weise entweder in Form von Bezahlung seitens reicher Leute oder seitens der Regierung in Form von Subsidien, die ihnen in Millionen für Theater, Konservatorien und Akademien erteilt werden. Dieses Geld aber wird von dem Volke eingesammelt, dem man die Kuh zu diesem Zweck verkauft und das nie jene ästhetischen Genüsse, die die Kunst bietet, ausnützt.
Es war doch gut für den griechischen und römischen Künstler, sogar den russischen Künstler der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, als es noch Sklaven gab und man der Meinung war, daß es so nötig sei, mit ruhigem Gewissen die Menschen zu veranlassen, sich und seinem Vergnügen zu dienen; aber in unserer Zeit, wo in allen Menschen, wenn auch ein dunkles Bewußtsein von der Gleichberechtigung aller Menschen existiert, kann man nicht Menschen unfreiwillig für die Kunst zu arbeiten veranlassen, ohne vorher die Frage zu lösen: ist es wahr, daß die Kunst solch eine gute und wichtige Sache ist, daß sie diese Gewaltthätigkeit rechtfertigt?
Denn der Gedanke ist entsetzlich, daß es doch sehr möglich sein kann, daß der Kunst schreckliche Opfer an Arbeit, Menschenleben und Sittlichkeit gebracht werden, daß diese Kunst aber nicht nur keine nützliche, sondern eine schädliche Sache ist. Und deshalb muß die Gesellschaft, in der Erzeugnisse der Kunst entstehen und unterstützt werden, wissen, ob alles das thatsächlich Kunst ist, was für solche ausgegeben wird, und ob alles das gut ist, was Kunst ist, wie dies in unserer Gesellschaft angenommen wird. Wenn es aber gut ist, ist es auch wichtig und jener Opfer wert, die dafür verlangt werden. Und dies muß jeder gewissenhafte Künstler genau wissen, um überzeugt zu sein, daß alles das, was er schafft, einen Sinn hat, nicht aber um der Begeisterung jenes kleinen Kreises von Menschen willen da ist, in deren Mitte er lebt, wodurch er bei sich eine falsche Überzeugung hervorruft, daß er ein gutes Werk thut, und daß das, was er von anderen Menschen als Unterstützung seines meist sehr luxuriösen Lebens nimmt, durch die Werke, an denen er arbeitet, aufgewogen wird. Und deshalb ist die Beantwortung dieser Fragen in unserer Zeit besonders wichtig.
Was ist denn eigentlich diese Kunst, die für so wichtig und unentbehrlich für die Menschheit gehalten wird, daß man für sie jene Opfer nicht allein an Arbeit und Menschenleben, sondern auch von dem Guten, die ihr gebracht werden, bringen kann?
Was ist Kunst? Wie, was ist Kunst? Kunst ist Architektur, Skulptur, Malerei, Musik, Poesie in allen ihren Arten, wird gewöhnlich ein Durchschnittsmensch, ein Kunstfreund und sogar ein Künstler selbst antworten, in der Annahme, daß die Sache, von der er spricht, vollständig klar und gleich von allen Menschen verstanden wird. Aber, werden Sie fragen, in der Architektur giebt es einfache Bauten, die keinen Gegenstand der Kunst ausmachen, und außerdem Bauten, die die Prätension haben, Gegenstände der Kunst zu sein, mißglückte verstümmelte Bauten, die deshalb nicht als Gegenstände der Kunst anerkannt werden können. Worin besteht denn das Merkmal eines Kunstgegenstandes?