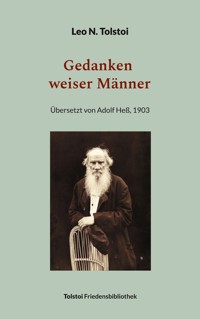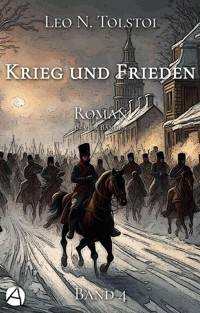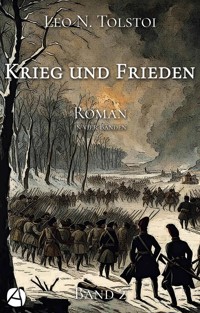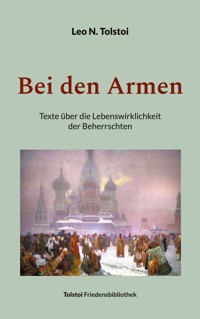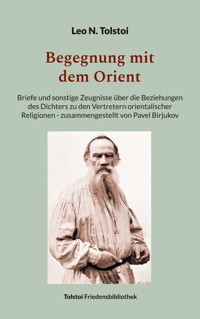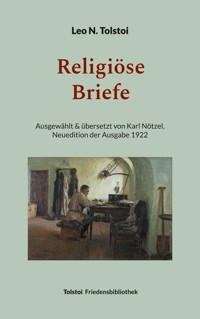Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tolstoi-Friedensbibliothek A
- Sprache: Deutsch
Wenige Jahre nach seiner Hinwendung zu "Christi Lehre" erhält Leo N. Tolstoi als Mitarbeiter der Moskauer Volkszählung Anfang 1882 erschütternde Einblicke in die elende Lage der Besitzlosen. Der begüterte Graf verliert die Illusion, eine karitative Hilfe von oben könne das Geschick der Armen wenden. In seiner Schrift "Was sollen wir denn tun?" (geschrieben 1882-1886) beleuchtet er schonungslos den Widerspruch des eigenen Lebens: "Ich gehöre der Klasse von Menschen an, welche durch allerlei Kunststücke dem arbeitenden Volk das Notwendigste raubt, und die sich durch solche Kunststücke den nie ausgehenden verzauberten Rubel verschafft haben, der diese Unglücklichen dann wieder verführt. Ich will den Menschen helfen, und daher ist es zu allererst klar, dass ich zunächst einmal die Menschen nicht plündern, sie dann aber auch nicht verführen darf. Statt dessen habe ich mir durch die kompliziertesten, listigsten, bösartigsten, durch Jahrhunderte bewährten Kunstgriffe die Lage des Besitzers des nie ausgehenden Rubels geschaffen, das ist die Lage, bei der ich, ohne dass ich selbst je etwas zu arbeiten brauche, Hunderte, ja Tausende von Menschen zur Arbeit in meinem Dienste zwingen kann, was ich auch tue; und ich bilde mir ein, dass ich die Menschen bemitleide, dass ich ihnen helfen will. Ich sitze einem Menschen auf dem Nacken, habe ihn erdrückt und verlange von ihm, er solle mich tragen. Dabei suche ich alle Menschen und mich selbst davon zu überzeugen, dass ich den Menschen sehr bemitleide, während ich nicht daran denke, abzusteigen; ich behaupte, seine Lage durch alle nur möglichen Mittel erleichtern zu wollen, nur nicht durch das eine, dass ich von seinem Nacken heruntersteige." Tolstoi-Friedensbibliothek Reihe A, Band 7 (Signatur TFb_A007) Herausgegeben von Peter Bürger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tolstoi-Friedensbibliothek Reihe A | Band 7
Herausgegeben von Peter Bürger
Inhalt
Vorbemerkungen des Herausgebers zu dieser Neuedition
Leo N. Tolstoi
WAS SOLLEN WIR DENN THUN?
Übersetzt von Carl Ritter
Einführung von Raphael Löwenfeld
Kapitel I – XXIV
Kapitel XXV – XXXIX
Anhang
Bruchstücke aus einem Privatbriefaus Anlaß einer Entgegnung aufden Artikel „An die Frauen“
_____
Bibliographische Übersicht zu Tolstois Werk
„Was sollen wir denn tun?“ (1882-1886)
Porträt Leo N. Tolstois aus dem Jahr 1887 (commons.wikimedia.org)
VORBEMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS ZU DIESER NEUEDITION
„Er, der Schmarotzer, der sein ganzes Leben von der Arbeit anderer Menschen gelebt hatte, er, der Untaugliche, der nicht seine Stiefel selbst putzen oder seinen Tee selbst zubereiten konnte, der nicht einen Tag leben konnte, wenn er nicht hundert helfende Hände hatte, die ihm bei allem halfen, – er kam hierher und wollte ihnen ‚helfen‘, die mit Schufterei und Verzicht nicht nur sich selbst halfen, sondern auch beitrugen, seine Nahrung, Kleidung und Reichtum zu verdienen, für ihn und alle seine ‚gebildeten‘ Kollegen! War das nicht Wahnsinn? Hatte er sich nicht verhalten wie ein Mann, der anderen aus dem Morast helfen möchte und dabei selbst bis zu den Haarspitzen im Morast steckt?“
ARNE GARBORG (1851-1924) über Tolstois Hinwendung zu den Armen in Moskau1
1881 zieht LEO N. TOLSTOI mit seiner Familie in die Moskauer Chamovniki-Straße und wird Anfang 1882 Mitarbeiter einer Volkszählung2 in der Großstadt. Wenige Jahre nach seiner Hinwendung zu ‚Christi Lehre‘ erhält er jetzt erschütternde Einblicke in die elende Lage der Besitzlosen. Die in diesem Band dargebotene Abhandlung „bietet einen grauenvollen Bericht von dem Leben und den Lebensbedingungen der Arbeiter. Viele Frauen hatten Kinder, wälzten sich aber trotzdem mit fremden Männern auf den schmalen Pritschen. Überall der gleiche unerträgliche Gestank, überall Menschen, die durch Alkohol verwahrlost waren, und in allen Gesichtern dieselbe Verachtung und Stumpfsinnigkeit. Tolstoj fühlte sich wie ein Arzt, der mit Medikamenten zu Kranken kommt, aber immer mit dem gleichen schlechten Gefühl, dass alles vergeblich ist. – Wenn diese Menschen an Hunger und Kälte zugrunde gingen, war es nicht ihre Schuld, folgerte Tolstoj. Sie waren mit unschuldigen Gefangenen zu vergleichen. Wenn jemand Schuld hatte, dann mussten das die Gefängniswärter sein, alle, die in Glanz und Freude lebten, in schicken Häusern wohnten und kostbare Wagen fuhren.“3 (GEIR KJETSAA)
Der begüterte Graf verliert sehr bald die Illusion, eine karitative Hilfe von oben könne das Geschick der Armen wenden. In seiner Schrift „Was sollen wir denn tun?“ (Tak čto že nam delatʼ?, 1882-1886) knüpft er an zurückliegende Überlegungen zum Eigentumsbegriff an, geht besonders ausführlich der Frage ‚Was ist Geld?‘ nach (Kapitel XVII – XXI) und beleuchtet schonungslos den Widerspruch des eigenen Lebens: „Ich gehöre der Klasse von Menschen an, welche durch allerlei Kunststücke dem arbeitenden Volk das Notwendigste raubt, und die sich durch solche Kunststücke den nie ausgehenden verzauberten Rubel verschafft haben, der diese Unglücklichen dann wieder verführt. Ich will den Menschen helfen, und daher ist es zu allererst klar, dass ich zunächst einmal die Menschen nicht plündern, sie dann aber auch nicht verführen darf. Statt dessen habe ich mir durch die kompliziertesten, listigsten, bösartigsten, durch Jahrhunderte bewährten Kunstgriffe die Lage des Besitzers des nie ausgehenden Rubels geschaffen, das ist die Lage, bei der ich, ohne dass ich selbst je etwas zu arbeiten brauche, Hunderte, ja Tausende von Menschen zur Arbeit in meinem Dienste zwingen kann, was ich auch tue; und ich bilde mir ein, dass ich die Menschen bemitleide, dass ich ihnen helfen will. Ich sitze einem Menschen auf dem Nacken, habe ihn erdrückt und verlange von ihm, er solle mich tragen. Dabei suche ich alle Menschen und mich selbst davon zu überzeugen, dass ich den Menschen sehr bemitleide, während ich nicht daran denke, abzusteigen; ich behaupte, seine Lage durch alle nur möglichen Mittel erleichtern zu wollen, nur nicht durch das eine, dass ich von seinem Nacken heruntersteige.“ (→S. →)
Die Frage ‚Was sollen wir tun?‘ ist auch eine Frage, die der Verfasser seiner eigenen – im Werk vor aller Welt kompromittierten – Familie stellt. Als wichtigsten Adressaten der Ausführungen müssen wir jedoch TOLSTOI selbst betrachten: ‚Was soll ich tun?‘ Nachdem der Widerspruch der eigenen Lebensführung einmal klar zum Vorschein bzw. zu Bewusstsein gekommen ist, will der Graf sein Gewissen nicht mehr beruhigen lassen: „Für die Seele ist es nicht das beste, unschuldig zu sein, sondern sich schuldig zu fühlen.“4
GEIR KJETSAA schreibt über das Leben in der Großstadt: „Wenn Tolstoj in Moskau war, […] verließ er das Haus, sprach mit den Straßenmädchen auf der Polizeistation, schaute kurz in der Strumpffabrik vorbei, wo Frauen und Kinder von morgens fünf bis acht Uhr abends arbeiteten. Wenn er dann wieder nach Hause an einen mit Keksen und Apfelsinen gedeckten Tisch kam, brach einmal mehr Streit [mit seiner Ehefrau] aus: ‚Entweder ich muss dich verlassen, oder wir müssen unser Leben verändern und von unserer Hände Arbeit leben, wie es die Bauern tun‘.“5 – Dieser Konflikt wird förmlich bis zum letzten Atemzug des Dichters ungelöst bleiben.
Allerdings kann LEO N. TOLSTOI das nunmehr spannungsreiche Miteinander in der eigenen Hausgemeinschaft zunächst auch humorvoll bzw. mit selbstironischer Distanz zur Sprache bringen. In den ‚Familien-Briefkasten‘ des Landgutes, der allen beim gemeinschaftlichen Vorlesen Erheiterung verschaffen soll, wirft er folgende ‚Patientenakte‘ eines verrückten Insassen des „Krankenhauses in Jasnaja Poljana“ ein: „Lew Nikolajewitsch [Tolstoj]. Sanguinische Natur. Gehört zu den ruhigen Patienten. Leidet an einer Manie, die die deutschen Psychiater ‚Weltverbesserungsneurose‘ nennen […] Der Patient ist von dem Gedanken besessen, man könne das menschliche Leben verändern, indem man eine Menge Wörter benutzt. Generelle Symptome: Der Patient ist unzufrieden mit der bestehenden Weltordnung, er verurteilt alle außer sich selbst, er ist entsetzlich geschwätzig und nimmt keinerlei Rücksicht auf seine Zuhörer. Er leidet unter heftigen Stimmungsschwankungen, ist bald rasend und verärgert, bald zu Tränen gerührt sentimental. Spezielle Symptome: Der Patient hat eine Manie für unpassende und unnötige Aktivitäten, wie das Putzen und Besohlen von Stiefeln, Gras mähen u.s.w.“6
Gegenüber der ihm sehr nahestehenden Großtante Gräfin ALEKSANDRA ANDREJEWNA TOLSTAJA beschreibt er später seine Lage nach der religiösen und sozialen Neubesinnung folgendermaßen: „Meine Freunde, ja sogar meine Familie, wenden sich jetzt von mir ab. Die Liberalen und die Ästhetiker sehen jetzt in mir wie in Gogol einen Verrückten oder Geistesschwachen, während die Radikalen und Revolutionäre mich für einen Mystiker halten, einen Schwätzer; für die Regierung bin ich ein gefährlicher Revolutionär; die Kirche betrachtet mich als Teufel. Ich muss gestehen, dass dies alles schwer ist, nicht weil es mich verletzt, sondern weil es mein wichtigstes Ziel zunichte macht – einen liebevollen Umgang mit meinen Mitmenschen“7.
Zunächst hatte TOLSTOI unter dem Titel „Was sollen wir denn tun?“ nur einen Aufsatz schreiben wollen. Doch aus diesem Anfang erwuchs in den Jahren 1882 bis 1886 nach und nach ein stattliches Buch. Im Anhang bieten wir eine knappe Orientierung zur Editionsgeschichte – auch zu frühen Teilausgaben und Teilübersetzungen – an (→S. →-→).
Im Jahr 1902 veröffentlichte Vladimir Čertkov in England die erste unzensierte Gesamtausgabe der Schrift in russischer Sprache. Zuvor war bereits die hier in einem Band neu edierte deutsche Übersetzung eben dieser Fassung erschienen, bearbeitet von Carl Ritter (→S. →), versehen mit einer Einführung des Herausgebers Raphael Löwenfeld und ursprünglich aufgeteilt auf zwei Bände.
pb
1 Zitiert nach Geir KJETSAA: Lew Tolstoj. Dichter und Religionsphilosoph. Gernsbach: Casimir Katz Verlag 2001, S. 206.
2 Vgl. Lew TOLSTOI: Über die Volkszählung in Moskau [Januar 1882]. In: Lew Tolstoi: Philosophische und sozialkritische Schriften. (= Gesammelte Werke in zwanzig Bänden, herausgegeben von Eberhard Dieckmann und Gerhard Dudek, Band 15). Berlin: Rütten & Loening 1974, S. 153-164. – Der Anhang zu Carl Ritters Übersetzung der Schrift „Was sollen wir tun?“ (erster Teil) enthält ebenfalls eine Übersetzung zum Artikel „Über die Volkszählung“, die wir aber in der vorliegenden Neuedition fortlassen und erst später an anderer Stelle in der Tolstoi-Friedensbibliothek (Reihe B, Band 6) darbieten werden.
3 KJETSAA: Lew Tolstoj. Gernsbach 2001, S. 206.
4 Leo N. Tolstoi, hier zitiert nach KJETSAA: Lew Tolstoj. Gernsbach 2001, S. 207.
5 KJETSAA: Lew Tolstoj. Gernsbach 2001, S. 213.
6 KJETSAA: Lew Tolstoj. Gernsbach 2001, S. 210.
7 KJETSAA: Lew Tolstoj. Gernsbach 2001, S. 215. – Der Priester und geistliche Zensor Aleksandr M. Ivancov-Platonov wollte Tolstoi durchaus bei einer Veröffentlichung der Schrift „Was sollen wir tun?“ behilflich sein, doch der maßgebliche Kleriker Oberprokuror Pobedonoscev betrachtete das Buch als schädlich; vgl. das Nachwort in Leo N. TOLSTOI: Was sollen wir denn tun? Band 2. (= Religions- und gesellschaftskritische Schriften, Band 4). Neu herausgegeben und durchgesehen von Paul H. Dörr. München: Eugen Diederichs Verlag 1991, S. 285-287 und 292293.
Leo N. Tolstoi
Was sollen wir denn thun?
Übersetzt von Carl Ritter
Mit einer Einführung von Raphael Löwenfeld
(1902/1911)
Textquelle der dargebotenen Übersetzung aus dem Jahr 1902 | Leo N. TOLSTOJ: Was sollen wir denn t[h]un? Erster Band. Mit Anhang über die Volkszählung in Moskau. (= Leo N. Tolstoj: Gesammelte Werke. Von dem Verfasser genehmigte Ausgabe von Raphael Löwenfeld: II. Serie, Band 5). Jena: Eugen Diederichs Verlag 1911. [323 Seiten; Kapitel I – XXIV.] – Leo N. TOLSTOJ: Was sollen wir denn t[h]un? Zweiter Band. Mit Anhang: Bruchstücke aus einem Privatbrief. (= Leo N. Tolstoj: Gesammelte Werke. Von dem Verfasser genehmigte Ausgabe von Raphael Löwenfeld: II. Serie, Band 6). Jena: Eugen Diederichs Verlag 1911. [279 Seiten; Kapitel XXV – XXXIX.]
EINFÜHRUNG
Raphael Löwenfeld
Die erschütternden Seelenkämpfe, die Tolstoj in seiner „Beichte“ geschildert hat, hatten einen friedlichen Ausklang gefunden in der Rückkehr zu der Lehre Christi, in der geläuterten Auffassung, wie sie in der Schrift „Mein Glaube“ dargelegt ist. Aus dem Mitgliede der bevorrechteten Gesellschaft mit allen überkommenen Anschauungen und Lebensformen war ein neuer Mensch geworden, der im Widerspruch stand mit allem, was ihn umgab. Wer so allein steht, muß in Kämpferstellung stehen; ein befriedigtes Ausruhen kann es für ihn nicht geben. Alles, was ihn im Leben antritt, gestaltet sich zu einer neuen Frage und heischt gebieterisch die Antwort. Kommt zu der ruhelosen inneren Arbeit ein äußerer Anlaß von genügender Stärke, so wird das Gemüt des mitempfindenden Beobachters in seinen Tiefen aufgewühlt und beginnt von neuem die nimmer endende Arbeit.
Die alte Hauptstadt Moskau erlebte (1882) das seltene Ereignis einer Volkszählung. Wo der größere Teil der Einwohner nicht lesen und nicht schreiben kann, ist eine Aufnahme der Seelenzahl einer großen Stadt eine schwere Aufgabe. Zweitausend Zähler waren aufgeboten, um das bedeutsame Werk durchzuführen. Tolstoj war unter ihnen. Ihm aber bedeutete die Volkszählung mehr als ein rein statistisches Werk: er wollte die Menschen, deren Zahl er feststellen sollte, auch kennen lernen, ihre Lebensweise, ihren sittlichen Zustand, er wollte vor allem andern erfahren, was ihnen das Schicksal an Lebensglück gewährt hat.
Mit furchtbarem Ernst trat er an seine Aufgabe heran, und als ein schmerzlich Verwundeter blieb er nach gethaner Arbeit zurück. Noch nie war ihm die äußere Erscheinung des Elends so nahe getreten, wie hier in der Großstadt, wo die Millionen früherer Landbewohner zusammenströmen, um Brot zu suchen, oft ohne es zu finden; und nie war ihm andererseits so klar geworden, wie falsch die Besitzenden die Lage der Ausgestoßenen beurteilen und auf wie falschem Wege sie der körperlichen und geistigen Not Abhilfe zu schaffen suchen. So wie das bisher geschah, durfte es in Zukunft nicht mehr geschehen. Das war ihm klar geworden. Was also thun?
Was sollen wir denn thun? fragte er sich mit den Worten des Evangeliums (Lucas 3, 10) und suchte in seiner Weise nach Antwort. In seiner grüblerischen, tiefgehenden Weise, die zunächst alle überkommenen und vorgefaßten Meinungen abzustreifen strebt, und, auf persönliche Erfahrung gestützt, im unbeirrten Wahrheitsdrange den Problemen des Denkens und Handelns nachgeht.
Er brauchte Zeit, um alle Eindrücke zu ordnen, die er in den schmutzigen Nachtherbergen Moskaus empfangen hatte. Er hatte Mühe, sich von der Selbsttäuschung zu befreien, in der er befangen war, von mancher Regung des Hochmuts und der Selbstzufriedenheit, um nur durchzudringen zu der klaren Fragestellung und weiter zu ihrer rücksichtslosen Lösung. Er mußte erst tausend Irrtümer überwinden, die seinen Geist zu trüben vermochten, erst eine gewisse Höhe erklimmen, um von da aus die dumpfen Niederungen freien Blicks zu überschauen.
In diesem Sinne ist auch die umfangreiche Schrift „Was sollen wir denn thun?“, die Tolstoj abschnittweise in den Jahren 1884, 1885, 1886 niederschrieb, in ihrem ersten Teile nichts anderes als eine Beichte, in ihrem zweiten nichts anderes als die Darlegung eines Glaubensbekenntnisses; nur umfassender, weitreichender als die beiden unmittelbar vorausgegangenen Werke, die sich selbst als Beichte und Glaubensbekenntnis bezeichnen.
Alle Probleme des menschlichen Zusammenlebens werden hier erörtert. Denn es handelt sich um nichts Geringeres, als um den Nachweis, daß unsere Anschauungen von den Pflichten, die die Menschen gegen einander haben, und die Lebensformen, die sich aus diesen Anschauungen ergeben haben, die wiederum unsere Vorstellungen von Glück und unser Maß an Glück bestimmen, – daß sie alle ungerecht, veraltet, einer Umgestaltung von Grund aus bedürftig sind.
Der Rundgang unter den Verlassenen und Enterbten, unter den Gesunkenen und Verstoßenen hatte dem teilnahmsvollen Forscher klar gemacht, daß mit Geld, wie man meinte, hier nicht zu helfen war. Mit Gelde nicht. Was ist denn eigentlich Geld? Geld ist ein Mittel der Versklavung. Was auch die Wissenschaft von den wirtschaftlichen Beziehungen der Menschen und Völker, von der vielgepriesenen Nationalökonomie, sage – Geld ist der schlimmste Feind der Freiheit des Individuums. Wir glauben, die Sklaverei, wie sie das Mittelalter kannte, wie sie nahezu bis auf unsere Tage in der Leibeigenschaft fortlebte, überwunden zu haben; nein! wir haben ihr nur eine neue Form gegeben und täuschen uns selbst, bewußt oder unbewußt, darüber hinweg.
Indem die Besitzenden und Gebildeten, die sich in den Berufen des Staatsbeamten, des Kaufmanns, des Gelehrten und Künstlers von aller körperlichen Arbeit entfernt haben, den Arbeiter glauben machen, sie sorgten durch ihre Thätigkeit für ihn, entziehen sie ihm die Freiheit und zwingen ihn in dauernde Abhängigkeit. Und eine, auf der Grundlage der Entwicklungslehre aufgebaute Pseudo-Wissenschaft, die für sich ebenso zu Unrecht Unfehlbarkeit in Anspruch nimmt, wie es in früheren Perioden geschichtlichen Lebens die Religion that, stützt mit heuchlerischen Beweisen die bestehende gesellschaftliche Ordnung. Die Träger dieser Wissenschaft sind ebensolche eigennützige Priester, wie die eifervollen Diener der Kirche es waren. All unsere Kunst und Wissenschaft dient, unbewußt oder bewußt, nur der Rechtfertigung dieser Vergewaltigung des einen Teiles der Menschen durch den anderen. Und die gedrückte Mehrzahl der Menschen hat auch an unserer Wissenschaft und unserer Kunst keinen Anteil. Unsere schöpferischen Geister schaffen für die Klasse, der sie angehören. Die Erzeugnisse menschlichen Geistes sind nur Besitz einer Minderheit und darum wertlos. Wert hat nur die Arbeit, die allen Nutzen bringt. „In welchem Wirkungskreis der Mensch auch seinen Beruf erblicken mag: ob in der Beherrschung anderer, in der Verteidigung seiner Landsleute, in der Abhaltung eines Gottesdienstes, in der Belehrung seiner Nebenmenschen, in der Auffindung von Dingen, die die Annehmlichkeiten des Lebens erhöhen, in der Forschung nach den Gesetzen des Weltalls, in der Verkörperung der ewigen Wahrheiten durch künstlerische Gestaltung – für den vernünftigen Menschen wird die oberste und nicht zu bezweifelnde Pflicht immer darin bestehen, daß er zum Zwecke der Erhaltung seines eigenen Lebens und des seiner Mitmenschen thätigen Anteil nimmt am allgemeinen Kampfe mit der Natur.“
Diesen thätigen Anteil am allgemeinen Kampfe mit der Natur hat die herrschende Minderzahl, die in den Städten lebt und nur zeitweilig in den milden Monaten des Jahres sich auf dem Lande mit städtischem Überfluß einrichtet, gänzlich verlernt. Genußleben bei den Einen, erdrückende Arbeit bei den Anderen, ist das Merkmal unserer Gesellschaft, das Kainszeichen verewigten Unrechts.
Wir müssen das Eigentum aufgeben und körperliche Arbeit leisten. Das ist das Heilmittel.
Denn Eigentum ist eine Wahnvorstellung, eine Selbsttäuschung, eine Lüge. Nur mein Körper gehört mir; was außer ihm ist, kann ich nicht mein eigen nennen.
Schon sind die Anzeichen dafür da, daß die unterdrückte Minderheit sich der bestehenden Ungerechtigkeit bewußt wird und eine Änderung des unerträglichen Zustandes erstrebt. Wollen wir der gewaltsamen Lösung dieser Spannung aus dem Wege gehen, so müssen wir das Heilmittel ergreifen. Aber mehr als der entartete Mann ist die Frau, die Mutter, berufen, dieser Umgestaltung die Wege zu bahnen. An euch Frauen, an die nichtentarteten, treuen Pflegerinnen der zukünftigen Menschheit, wende ich mich!
Das ist in gedrängtester Knappheit der Gedankengang des reichgegliederten Werkes, in dem die Grundlagen unseres Zusammenlebens in allen Beziehungen erörtert werden, und das zugleich für die Person Leo Tolstojs die letzten Entscheidungen trifft.
Denn wie er es hier entworfen hatte, gestaltete er fortan sein eigenes persönliches Leben.
Mit der Schrift „Was sollen wir denn thun?“ hat die Umwandlung seiner Anschauungen und seiner Lebensführung ihre endgültige Form gefunden. In dieser Form verharrte er, unbekümmert um das Urteil von Feind und Freund, frei von falschem Stolz auf die Höhe der Anschauung, die er erklommen zu haben glaubte, mit der Selbstsicherheit des Mannes, der in ehrlichem Ringen die Normen für sein Verhältnis zur Welt gefunden hat und allen Mächten zum Trotz nach deren Geboten handelt.
Die einzelnen Probleme, die in der Schrift „Was sollen wir denn thun?“ in klar gegliedertem Zusammenhänge behandelt sind, kehren dann oft in Tolstojs Werken in neuer Darstellung wieder. Ausführlicher und mit tieferer Begründung wird der Gedanke der Sklaverei unserer Zeit noch einmal großartig in der Schrift „Das Reich Gottes ist in Euch“ durchgearbeitet, der Wert unseres Kunstschaffens in dem Werke „Was ist Kunst“ theoretisch geprüft; und die Dichtungen der kommenden Jahrzehnte, von denen das Schauspiel „Die Macht der Finsternis“ und der Roman „Die Auferstehung“ neben den Meisterwerken der früheren Schaffensperiode einen Platz beanspruchen, sind nur die künstlerische Gestaltung der neu gewonnenen Weltanschauung. –
Die Schrift „Was sollen wir denn thun?“ erscheint hier zum ersten Male ganz und ungekürzt.
Das Werk war natürlich in Rußland verboten. Nur Bruchstücke konnten gedruckt werden, und auch diese mußten sich Verstümmelungen gefallen lassen. Im 12. Bande der Moskauer Originalausgabe sind unter dem Titel „Werke der letzten Jahre“ einzelne Abschnitte erschienen. Sie fassen unter den Überschriften „Was sollen wir denn thun? – Das Leben in der Stadt – Das Leben auf dem Lande – Der Beruf der Wissenschaft und der Kunst – Arbeit und Genußleben – An die Frauen“ – mehrere Kapitel zu je einem Ganzen zusammen. Diese Bruchstücke liegen auch den Übersetzungen zugrunde, die außerhalb Rußlands erschienen sind. Später hat die bekannte Verlagshandlung Elpidin in Genf Teile des Werkes herausgegeben. Die drei gesonderten Hefte, die dort erschienen sind, führen die Titel: Was ist mein Leben? (Kakowa moja žizn`) – Geld (Djengi) – Was sollen wir denn thun? (Tak čto že nam delat`) – und würden, in dieser Reihenfolge aneinandergefügt, ungefähr dem Gesamtwerke entsprechen, wenn sie nicht bedeutende Stücke der endgültigen Redaktion Tolstojs vermissen ließen.
Unserer Ausgabe liegt diese endgültige Redaktion zu Grunde. Wladimir Grigorjewitsch Tschertkow hat den Originaltext aufs sorgfältigste durchgesehen; er wird in einigen Monaten in seiner (russischen) „Gesamtausgabe der in Rußland verbotenen Werke Tolstojs“ erscheinen. Die Übersetzung für unsere Ausgabe hat mit großer Sorgfalt und Sachkenntnis Carl Ritter angefertigt.
Zum besonderen Verständnis der Beziehungen des Werkes zu Tolstojs Persönlichkeit fügen wir dem ersten Teile noch den Aufsatz „Über die Volkszählung in Moskau“8 bei, dem zweiten Teile „Bruchstücke aus einem Privatbrief“, geschrieben aus Anlaß einer Entgegnung auf den Artikel „An die Frauen“.
[1902]
1904 entstandenes Bildnis von Leo Tolstoi nach einem älteren Gemälde von Iwan Nikolajewitsch Kramskoj (1873)
(commons.wikimedia.org)
8 [In der vorliegenden Neuedition der Gesamtausgabe fortgelassen; vorgesehen ist eine Neuedition dieses Textes über die Volkszählung in Band TFb_B006; pb.]
Leo N. Tolstoi
WAS SOLLEN WIR DENN THUN?
Und das Volk fragte ihn und sprach: „Was sollen wir denn thun?“ Er antwortete und sprach zu ihnen: „Wer zween Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat; und wer Speise hat, thue auch also.“ (Luk. III, 10 u. 11)
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen, und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen, und da die Diebe nicht nachgraben und stehlen.
Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.
Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein.
Wenn aber dein Auge ein Schalk ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn aber das Licht, das in dir ist, Finsternis ist: wie groß wird dann die Finsternis selber sein?
Niemand kann zween Herren dienen. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben; oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht für euern Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise! Und der Leib mehr denn die Kleidung?
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr des alles bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. (Matth. VI, 19–25, 13–34.)
Es ist leichter, daß ein Kameel durch ein Nadelöhr gehe, denn daß ein Reicher ins Reich Gottes komme. (Matth. XIX, 24; Luk. XVIII, 25; Mark. X, 25.)
I.
Ich hatte mein ganzes Leben außerhalb der Stadt zugebracht. Als ich im Jahre 1881 nach Moskau übersiedelte, um dort zu leben, setzte mich das Elend der Stadt in Erstaunen. Ich kenne die Armut der Dörfer, aber die der Städte war mir neu und unverständlich. Man kann in Moskau durch keine Straße gehen, ohne einem Bettler zu begegnen, und zwar ganz besonderen Bettlern, die keine Ähnlichkeit mit denen auf dem Lande haben. Diese Bettler – sind nicht solche mit einem Bettelsack und die im Namen Christi bitten, wie sich die Bettler auf den Dörfern charakterisieren lassen, das sind Bettler ohne Bettelsack und ohne den Namen Christi. Die Moskauer Bettler tragen keine Betteltasche und bitten nicht um Almosen. Meistens suchen sie nur, wenn sie einem begegnen oder jemand an sich vorübergehen lassen, den Blick aufzufangen. Und je nach dem Blick des Betreffenden bitten sie oder bitten sie nicht. Ich kenne einen solchen Bettler aus adligem Geschlecht. Er ist ein Greis, der langsam daherschreitet, indem er sich bei jedem Schritt vornüberbeugt. Wenn er jemandem begegnet, so neigt er sich vornüber und macht gleichsam eine Verbeugung vor einem. Wenn man stehen bleibt, greift er nach seiner Mütze, die mit einer Kokarde versehen ist, und bettelt einen an. Wenn man nicht stehen bleibt, so giebt er sich den Anschein, als hätte er bloß eine solche Gangart, und dann geht er weiter, indem er sich abermals vornüberneigt. Das ist ein echter Moskauer Bettler, der das Betteln studiert hat. Anfangs wußte ich nicht, warum die Bettler Moskaus nicht offen betteln, dann begriff ich, warum sie nicht um Almosen bitten, konnte ihre Lage aber dennoch nicht verstehen.
Als ich einmal durch die Afanaßjewgasse ging, bemerkte ich, daß ein Schutzmann einen von der Wassersucht aufgedunsenen und in Lumpen gehüllten Menschen in eine Lohnkutsche setzte. Ich fragte: „Warum geschieht das?“ Der Schutzmann erwiderte: „Wegen Bettelei.“ – „Ist denn das verboten?“ – „Es wird doch wohl verboten sein“, antwortete der Schutzmann. Man fuhr mit dem Wassersüchtigen davon. Ich nahm mir ein anderes Lohnfuhrwerk und fuhr hinterher. Ich wollte erfahren, ob es wahr ist, daß es verboten sei, um Almosen zu bitten, und in welchem Sinne es verboten sei. Ich konnte durchaus nicht verstehen, wie man es einem Menschen verbieten könne, einen anderen um etwas zu bitten, und außerdem wollte ich nicht daran glauben, daß es verboten sei, um Almosen zu bitten, wo doch ganz Moskau voll von Bettlern war. Ich betrat die Polizeistation, nach der man den Bettler gebracht hatte. In der Polizeistation saß ein mit einem Säbel und einer Pistole bewaffneter Mann. Ich fragte: „Weswegen ist dieser Mensch verhaftet worden?“ Der Mann mit dem Säbel und der Pistole sah mich streng an und sagte: „Was geht Sie das an?“ Indessen fühlte er doch wohl die Notwendigkeit, mir einiges zu erklären, und so fügte er denn hinzu: „Die Regierung ordnet es an, diese Leute zu arretieren, also wird es wohl notwendig sein.“ Ich ging fort. Der Schutzmann, der den Bettler hergebracht hatte, saß im Vorzimmer auf einer Fensterbank und blickte melancholisch in ein Notizbuch. Ich fragte ihn: „Ist es wahr, daß es den Bettlern verboten ist, im Namen Christi um Almosen zu bitten?“ Der Schutzmann besann sich, sah mich an, dann verfinsterte sich sein Gesicht, oder er schien vielmehr wieder einzuschlafen, und während er sich wieder auf das Fensterbrett setzte, sagte er: „Die Regierung ordnet es an, also wird es wohl notwendig sein.“ Hierauf begann er wieder, sich mit seinem Buche zu beschäftigen.
„Nun, wie steht es, hat man ihn eingesteckt?“ fragte mich der Lohnkutscher. Den Kutscher schien die Sache offenbar auch zu interessieren. „Ja“, sagte ich. Der Kutscher schüttelte den Kopf.
„Wie ist denn das bei euch in Moskau; ist es denn verboten, in Christi Namen um Almosen zu bitten?“ fragte ich.
„Wer kann da was wissen?“ sagte der Kutscher.
„Wie ist denn das?“ sagte ich, „der Bettler ist doch Christi, und man führt ihn nach der Polizei?“
„Heutzutage ist man schon von dieser Meinung abgekommen. Das Betteln ist nicht mehr gestattet.“
Nach diesem Ereignis sah ich noch einige Male, wie Schutzleute Bettler nach der Polizeistation und hierauf nach dem Jussupowschen Arbeitshaus führten. Einmal begegnete ich auf der Mjasnitzkaja einem Haufen solcher Bettler, etwa dreißig Mann, vorn und hinten schritten Schutzleute. Ich fragte: „Weswegen geschieht das?“ – „Wegen Bettelei.“
Es stellte sich heraus, daß es nach dem Gesetz in Moskau all den Bettlern, die man zu mehreren auf jeder Straße Moskaus trifft und die während der Messe und besonders während der Beerdigungen in Reihen vor jeder Kirche stehen, verboten ist, um Almosen zu bitten. Aber weswegen fängt man die einen ein und läßt die anderen in Frieden? Oder giebt es unter ihnen gesetzlich anerkannte und nicht anerkannte Bettler, oder sind ihrer so viele, daß man sie nicht alle einfangen kann, oder aber verhaftet man die einen, während sich wieder neue ansammeln?
Es giebt in Moskau sehr viel Bettler von jeder Sorte. Es giebt solche, die vom Betteln leben; es giebt auch wirkliche Bettler, welche aus irgend einem Grunde nach Moskau gekommen sind und wirklich Not leiden.
Unter diesen Bettlern gibt es häufig einfache Männer und Frauen, in bäuerlicher Kleidung. Ich bin oft solchen begegnet. Einige sind hier krank geworden und können sich, wenn sie das Krankenhaus wieder verlassen haben, weder ernähren, noch schaffen sie es, aus Moskau fortzukommen. Einige von ihnen haben wohl außerdem ein wenig herumgebummelt (zu diesen gehörte wahrscheinlich auch jener Wassersüchtige), einige sind auch nicht krank gewesen, sondern es sind solche, denen ihr Haus abgebrannt ist, oder Greise und Frauen mit Kindern; einige sind aber auch gesunde und arbeitsfähige Leute. Diese völlig gesunden Männer, die bettelten, interessierten mich ganz besonders.
Diese gesunden und arbeitsfähigen Bettler erregten mein Interesse auch aus dem Grunde, weil ich es mir seit meiner Ankunft in Moskau zur Gewohnheit gemacht hatte, um mir Bewegung zu verschaffen, mit zwei Männern, die dort Holz sägten, auf die Sperlingsberge arbeiten zu gehen. Diese beiden Arbeiter waren genau solche arme Leute wie jene, welche ich auf der Straße antraf.
Der eine hieß Peter und war ein Soldat aus dem Gouvernement Kaluga, der andere hieß Sjemjon und war ein Arbeiter aus dem Wladimirschen. Sie hatten nichts außer einem Anzug am Leib und ihre zwei Hände. Und mit diesen Händen erwarben sie bei sehr harter Arbeit etwa vierzig bis fünfundvierzig Kopeken pro Tag, wovon sie beide noch etwas zurücklegten – der aus Kaluga, um sich einen Pelz zu kaufen – der aus Wladimir, um Geld für die Reise nach seinem Dorf zu sammeln. Wenn ich daher ebensolche Leute auf der Straße traf, interessierte ich mich besonders für sie.
Warum arbeiten diese und warum betteln jene?
Wenn ich solch einem Manne begegnete, fragte ich ihn gewöhnlich, wie er in eine solche Lage gekommen sei? Einmal begegne ich einem gesunden Mann mit einem grau schimmernden Bart. Er bettelt mich an; ich frage ihn, wer er und woher er sei. Er sagte, er sei zum Arbeiten aus Kaluga hergekommen. Im Anfang habe er Arbeit gefunden, er habe alte Holzabfälle zu spalten gehabt. Nachdem er und ein Genosse bei einem Arbeitgeber alles Holz gespalten, hätten sie nach einer anderen Arbeit gesucht; sie hätten keine gefunden; der Freund sei abgeschwenkt, und nun schlage er sich schon die zweite Woche in dieser Weise durch, alles sei aufgezehrt und er habe nichts mehr, um sich eine Säge oder ein Instrument zum Spalten des Holzes zu kaufen.
Ich gebe ihm Geld zu einer Säge und nenne ihm einen Ort, an den er zur Arbeit kommen soll. Ich hatte mich schon vorher mit Peter und Ssemjon verabredet, daß sie den Genossen aufnehmen und noch einen Mitarbeiter für ihn finden sollten.
„Sieh nur zu und kommʼ, da giebt es viel Arbeit.“
„Ich werde schon kommen. Wie sollte ich nicht? Meinen Sie, es ist ein Vergnügen, sich so durchzuschlagen?“ sagte er. „Ich kann arbeiten.“
Der Mann verbeugt sich und verspricht zu kommen, und ich habe den Eindruck, daß er mich nicht betrügen will, sondern die Absicht hat, zu erscheinen.
Am anderen Tage gehe ich zu den mir bekannten Arbeitern und frage, ob der Mann gekommen sei. Nein, er sei nicht dagewesen. Und in derselben Weise haben mich mehrere betrogen. Auch von solchen bin ich betrogen worden, die mir sagten, sie brauchten nur Geld für eine Fahrkarte, um nach Hause zu fahren; nach einer Woche aber traf ich sie wieder auf der Straße. Viele von ihnen erkannte ich wieder, und sie erkannten mich; zuweilen aber hatten sie mich vergessen und wiederholten dieselbe Lüge, als sie mich sahen. So erkannte ich, daß auch unter dieser Art Menschen viele Betrüger sind. Aber auch diese Betrüger waren sehr elend; alle waren sie halb bekleidete, arme, elende und kränkliche Menschen; es waren dieselben Leute, welche thatsächlich erfrieren oder sich erhängen, wie wir es in den Zeitungen lesen.
II.
Wenn ich von dieser Armut in den Städten mit Stadtbewohnern sprach, sagte man mir immer: O, das ist noch gar nichts – all das, was Sie gesehen haben. Gehen Sie einmal auf den Chitrow-Markt und in die dortigen Nachtherbergen, da werden Sie die echte „goldene Rotte“ finden. Ein Spaßvogel sagte mir, das sei jetzt schon keine Rotte mehr, sondern ein ganzes Regiment: so zahlreich seien sie geworden. Der Spaßvogel hatte recht, aber er hätte noch mehr recht gehabt, wenn er gesagt hätte, daß diese Leute in Moskau keine Rotte und kein Regiment, sondern eine ganze Armee ausmachen, wie ich glaube an die fünfzigtausend Mann. Wenn mir die alten Stadtbewohner von der Armut in der Stadt sprachen, so erzählten sie mir dieses immer mit einem gewissen Vergnügen, als brüsteten sie sich vor mir damit, daß sie das wüßten. Ich erinnere mich, daß auch in London die von altersher dort Ansässigen, als ich dort war, sich gleichsam damit brüsteten, wenn sie von dem Elend in London sprachen. „Seht einmal, wie es bei uns steht!“ Und ich wollte diese ganze Armut kennen lernen, von der man mir geredet hatte. Mehrmals schlug ich die Richtung nach dem Chitrow-Markte ein, aber ein jedesmal wurde mir ängstlich zu Mute; ich schämte mich. „Wozu soll ich hingehen und mir die Leiden der Menschen ansehen, denen ich doch nicht helfen kann?“ so sprach eine Stimme in mir. „Nein, wenn du hier lebst und alle Schönheiten des Stadtlebens kennen lernst, so geh und sieh dir auch dieses an“, sagte eine andere Stimme. So ging ich denn im Dezember des vorvergangenen Jahres, an einem kalten und windigen Tage, nach diesem Zentrum des städtischen Elends, nach dem Chitrow- Markt. Es war ein Werktag, etwa um vier Uhr. Schon als ich längs der Ssoljanka ging, konnte ich immer mehr und mehr Menschen in seltsamen Anzügen bemerken, die nicht ihnen gehörten, und mit noch seltsamerem Schuhwerk, Menschen mit einer besonderen, ungesunden Gesichtsfarbe und, was die Hauptsache ist, mit einer eigenartigen, ihnen allen gemeinsamen Mißachtung für alles, was sie umgab. In dem seltsamsten, unmöglichsten Kostüm ging so ein Mensch ganz frei daher, offenbar ohne jeden Gedanken darüber, wie er wohl den anderen Menschen erscheine. All diese Menschen gingen nach einer Richtung. Ohne mich nach dem Weg zu erkundigen, der mir unbekannt war, ging ich hinter ihnen her und kam nach dem Chitrow-Markt. Auf dem Markte fand ich ebensolche Weiber in zerrissenen Kapotten, altmodischen Pelzen, Jacken, Stiefeln und Galoschen, die ebenso unbefangen in Bezug auf ihre scheußliche Kleidung, alt und jung, herumsaßen, irgend was verkauften, oder umhergingen und schimpften. Auf dem Marktplatz waren wenig Menschen. Der Markt war offenbar zu Ende und die Mehrzahl der Leute ging bergan am Markt vorbei und über den Marktplatz weg, immer nach einer Richtung. Ich ging hinter den Menschen her. Je weiter ich kam, um so mehr ebensolche Leute strömten auf dem einen Weg zusammen. Als ich am Markt vorüber war und eine Straße hinausstieg, holte ich zwei Frauen ein, eine alte und eine junge; beide trugen graue und zerfetzte Kleider. Sie gingen und unterhielten sich über irgend etwas.
Auf jedes notwendige Wort folgte ein unnötiges und ganz unanständiges Wort, oder auch zwei.
Die Frauen waren nicht betrunken: sie schienen um etwas besorgt zu sein, und die Männer, die ihnen entgegenkamen, vor oder hinter ihnen gingen, gaben gar nicht acht auf ihre, für mich so seltsame, Redeweise. Hier wurde offenbar immer so gesprochen. Links waren private Nachtquartiere, und einige bogen dorthin ab, andere gingen weiter. Als wir auf dem Berge waren, kamen wir an ein großes Eckhaus. Die Mehrzahl der Menschen, die mit mir gegangen waren, blieb an diesem Hause stehen. Längs des ganzen Trottoirs dieses Hauses standen oder saßen auf den nackten Fliesen oder auf dem Schnee, der auf der Straße lag, lauter solche Menschen. Rechts vom Eingangsthor die Frauen – links die Männer. Ich ging an den Frauen vorbei, dann auch an den Männern (im ganzen waren es einige Hundert) und blieb dort stehen, wo die Reihe aufhörte. Das Haus, vor dem diese Leute warteten, war die Ljapinsche unentgeltliche Nachtherberge. Die Menschenmenge bestand aus Leuten, die ein Nachtquartier haben wollten und auf Einlaß harrten. Um fünf Uhr abends wird ihnen geöffnet und dann werden sie hineingelassen. Hierher gingen alle, die ich überholt hatte.
Ich blieb dort stehen, wo die Reihe der Männer aufhörte. Die mir Zunächststehenden betrachteten mich und zogen mich mit ihren Blicken an. Die Kleiderreste, die diese Leiber bedeckten, waren sehr mannigfaltig. Aber der Ausdruck der Augen dieser Menschen, die auf mich gerichtet waren, war immer derselbe. In allen Blicken lag die Frage: warum hast du, ein Mensch aus einer anderen Welt, dich neben uns gestellt? Wer bist du? Bist du ein stolzer Reicher, der sich an unserem Elend freuen, sich aus Langeweile zerstreuen und uns noch quälen will, oder bist du, was ja nicht vorkommt, was nicht möglich ist, ein Mensch, der uns bemitleidet? Auf allen Gesichtern stand diese Frage. Man sieht mich an, unsere Augen begegnen sich, und man wendet sich weg. Ich wollte mit einem der Leute ein Gespräch anknüpfen, konnte mich aber lange nicht entschließen. Aber während wir schwiegen, hatten unsere Blicke uns schon näher gebracht; wie auch das Leben uns trennen mochte, nachdem unsere Blicke sich zwei-, dreimal begegnet waren, fühlten wir, daß wir alle Menschen seien, und wir hörten auf, uns vor einander zu fürchten. Mir zunächst stand ein Mann mit einem aufgedunsenen Gesicht und einem roten Bart, in einer zerrissenen Jacke, abgetretenen Galoschen mit fast nackten Füßen. Und es waren doch acht Grad Kälte. Drei- oder viermal trafen sich unsere Blicke, und ich fühlte mich ihm so nahe, daß ich mich jetzt nicht nur nicht schämte, ihn anzureden, sondern mich eher geschämt hätte, nichts zu sagen. Ich fragte ihn, woher er sei? Er antwortete bereitwillig und fing an, mit mir zu sprechen; andere näherten sich uns. Er stammte aus Smolensk, und war gekommen, Arbeit zu suchen, um sich zu nähren und seine Steuern bezahlen zu können. „Arbeit ist nicht zu bekommen“, meinte er, „heuer haben uns die Soldaten die ganze Arbeit weggenommen. Ich treibe mich jetzt so herum, bei Gott, ich habe zwei Tage nicht gegessen.“ Er sagte das schüchtern, mit einem Versuch zu lächeln. Ein alter Soldat, der Sbitjen9* verkaufte, stand nicht weit von uns. Ich rief ihn heran. Er goß ein wenig Sbitjen in ein Glas. Der Mann nahm das heiße Glas in die Hände, und ehe er trank, wärmte er sich die Hände daran, um die Wärme nicht unbenützt entfliehen zu lassen. Während er sich die Hände wärmte, erzählte er mir seine Abenteuer. Diese Abenteuer oder diese Erzählungen der Abenteuer sind fast immer dieselben: erst hatte man eine kleine Arbeit, dann hörte sie auf, – im Nachtquartier wurde einem der Geldbeutel mitsamt der Fahrkarte gestohlen, und nun kann der Betreffende nicht aus Moskau fortkommen. Er erzählte, daß er sich tagsüber in den Schenken aufhalte, um es warm zu haben, und sich daselbst vom „Imbiß“ nähre (das sind in den Schenken ein paar Brotschnitten); zuweilen gäbe man ihm was, zuweilen jage man ihn fort, und dann übernachte er hier umsonst im Ljapinschen Haus. Er warte nur auf die Polizeirevision, dann werde er als Paßloser ins Gefängnis gebracht und mit einer Arrestantengruppe in seine Heimat transportiert. „Wie man sagt, ist Donnerstag Revision“. (Das Gefängnis und die Etappe sind für ihn das gelobte Land.)
Während er erzählte, bestätigten etwa drei Männer aus der Menge seine Worte und sagten, daß sie in ganz derselben Lage seien. Ein magerer, blasser und langnäsiger Jüngling, der am oberen Teil des Körpers nur ein Hemd trug, das noch dazu an den Schultern zerrissen war, und eine Mütze ohne Schirm als Kopfbedeckung hatte, drängte sich seitwärts durch die Menge zu mir. Er zitterte fortwährend heftig und bemühte sich, verächtlich über die Reden der Männer zu lachen, weil er glaubte, damit meinen Ton zu treffen; dazu sah er mich immer an. Ich bot auch ihm Sbitjen an. Auch er nahm das Glas und wärmte sich daran die Hände. Eben wollte er etwas sagen, als ihn ein großer, schwarzer Mann mit einer Adlernase, in einem Hemd von Kattun, einer Weste und ohne Mütze, zurückdrängte. Der Adlernasige bat auch um Sbitjen.
Hierauf kam ein betrunkener Greis mit einem keilförmigen Bart, er trug einen mit einem Strick umgürteten Mantel und Bastschuhe, dann ein kleiner Mann mit einem geschwollenen Gesicht und thränenden Augen, in einer braunen Rankinjacke und mit nackten Knieen, die durch die Löcher einer Sommerhose hindurchschimmerten und vor Zittern zusammenschlugen. Weil er zitterte, konnte er das Glas nicht festhalten, und er goß den Inhalt über sich aus. Man fing an, auf ihn loszuschimpfen. Er lächelte bloß schmerzlich und zitterte. Dann drängte sich eine verwachsene, in Lappen gehüllte Mißgeburt, deren nackte Füße mit Lumpen umwickelt waren, dann eine Gestalt, die an einen Offizier erinnerte, dann wieder etwas wie ein Priester an mich heran.
All dieses Kalte und Hungernde, Flehende und Unterwürfige drückte sich um mich herum und drängte sich zu dem Sbitjen. Der Sbitjen war ausgetrunken; einer der Leute bat mich um Geld, und ich gab ihm welches. Es entstand eine Verwirrung und ein Gedränge. Der Hausknecht des benachbarten Hauses schrie die Menge an, sie solle das Trottoir seinem Hause gegenüber räumen, und die Menge folgte unterwürfig seinem Befehl. Aus der Menge kamen Aufsichtsbeamte hervor und nahmen mich unter ihre Obhut – sie wollten mich aus dem Gedränge hinausführen, aber die Menge, die vorher das Trottoir entlang stand, war jetzt ganz aus der Ordnung gekommen und drückte sich an mich. Alle sahen mich bittend an; und ein Gesicht war immer noch elender, ausgemergelter und gedrückter als das andere.
Ich verteilte alles, was ich bei mir hatte. Ich hatte nicht viel Geld mitgenommen: ungefähr 20 Rubel, und ich ging mit der Menge in die Nachtherberge hinein. Diese stellt ein gewaltiges Haus dar. Es besteht aus vier Abteilungen. In den oberen Stockwerken sind die Abteilungen für die Weiber, in den unteren die für die Männer. Zuerst betrat ich die Abteilung für Frauen, ein großes Zimmer, das ganz von Bänken erfüllt war, die an die Bänke der dritten Klasse in den Eisenbahnwagen erinnern. Die Bänke sind in zwei Etagen angeordnet, unten und oben. Seltsame, mit Lumpen bedeckte Weiber bloß in Kleidern, alte und junge, kamen herein und nahmen einen Platz ein, die einen unten, die anderen oben. Einige von den alten bekreuzigten sich und beteten für den, der dieses Heim eingerichtet, andere lachten und schimpften. Ich ging weiter, nach unten. Dort waren die Männer untergebracht. Unter ihnen sah ich einen von denen, denen ich Geld gegeben hatte. Als ich ihn sah, mußte ich mich plötzlich furchtbar schämen; ich beeilte mich fortzukommen, und mit dem Gefühl, ein großes Verbrechen begangen zu haben, verließ ich dies Haus und ging heim. Zu Hause eilte ich die mit Teppichen bedeckte Treppe hinauf und betrat das Vorzimmer, dessen Diele mit Tuch ausgeschlagen war. Dann legte ich den Pelz ab und nahm eine Mahlzeit ein, welche aus fünf Gängen bestand, und von zwei Dienern in Fräcken, weißen Halsbinden und weißen Handschuhen serviert wurde.
Vor dreißig Jahren hatte ich in Paris mit angesehen, wie einem Mann im Beisein von tausend Zuschauern mit einer Guillotine der Kopf abgeschlagen wurde. Ich wußte, daß dieser Mensch ein furchtbarer Verbrecher war: ich kannte all die Betrachtungen, welche seit so vielen Jahrhunderten von den Menschen niedergeschrieben werden, um diese Art von Handlungen zu rechtfertigen; ich wußte, daß das absichtlich und mit Bewußtsein geschah, aber in dem Augenblick, als Kopf und Leib sich trennten und in den Kasten hinabfielen, schrie ich auf und begriff, nicht mit dem Verstand oder mit dem Herzen allein, sondern mit meinem ganzen Wesen, daß alle Raisonnements, die ich über die Todesstrafe gehört hatte, ein böser Unfug sind, daß, zu wie vielen die Menschen auch zusammenkommen mögen, um einen Mord, dieses schändlichste Verbrechen der Welt, zu begehen, wie sie sich auch nennen mögen; ich begriff, daß ein Mord ein Mord bleibt, und daß hier vor meinen Augen dieses Verbrechen geschehen war. Ich hatte durch meine Gegenwart und weil ich mich nicht hineingemischt hatte, dieses Verbrechen gutgeheißen und hatte Anteil an ihm. Ebenso begriff ich, angesichts dieser hungernden, frierenden und erniedrigten Menge von tausenden von Menschen, nicht nur mit dem Verstand oder mit dem Herzen, sondern mit meinem ganzen Wesen, daß die Existenz von zehntausenden solcher Leute in Moskau, während ich mit tausend anderen meinen Magen mit Filet und Stör überlade, meine Pferde und meinen Fußböden mit Tuch und Teppichen bedecke, daß dieser Zustand – und wenn selbst alle Gelehrten der Welt sagen mögen, er sei notwendig – ein Verbrechen ist, das nicht ein einziges Mal begangen ist, sondern beständig begangen wird, und daß ich mit meinem Luxus es nicht nur zulasse, sondern geradezu daran teil habe. Für mich bestand der Unterschied dieser beiden Eindrücke nur darin, daß ich in jenem Fall nur das eine zu thun vermochte, ich konnte nämlich den Mördern, die bei der Guillotine standen und den Mord leiteten, zurufen, daß sie eine Sünde begehen und sie mit allen Mitteln daran zu hindern suchen. Aber auch, wenn ich das gethan hätte, so konnte ich im voraus wissen, daß mein Vorgehen den Mord nicht aufhalten werde; hier aber konnte ich nicht nur einen Trunk und das bißchen Geld darreichen, das ich bei mir hatte, ich konnte auch meinen Mantel hergeben und alles, was ich zu Hause hatte. Ich habe das aber nicht gethan und darum fühlte ich, fühle ich es noch heute und werde nicht aufhören es zu fühlen, daß ich Anteil habe an einem sich immer vollziehenden Verbrechen, solange ich noch Nahrung im Überfluß habe, während ein anderer gar keine besitzt, solange ich zwei Anzüge habe, während ein anderer auch nicht einmal einen hat.
9 *Russisches Getränk aus Kwas und Zwetschen.
III.
An demselben Abend, als ich aus dem Ljapinschen Hause zurückkehrte, erzählte ich einem Freunde meine Eindrücke. Mein Freund – ein Stadtbewohner – begann, mir nicht ohne Vergnügen zu erklären, daß das eine ganz gewöhnliche Erscheinung in den Städten sei, daß nur ich als Provinzbewohner etwas Besonderes darin sähe, daß das immer so war, sein werde und immer so sein müsse, und daß es eine notwendige Bedingung der Zivilisation sei. In London stehe es damit noch schlechter, also liege hier nichts Schlimmes vor, und es sei kein besonderer Grund zur Unzufriedenheit vorhanden. Ich suchte meinen Freund zu widerlegen, aber mit einem solchen Feuer und einer solchen Erbitterung, daß seine Frau aus dem Nebenzimmer herbeigelaufen kam und fragte, was passiert sei. Es stellte sich heraus, daß ich, ohne es selbst zu merken, vor meinem Freunde stand, mit thränenerstickter Stimme schrie und mit den Händen fuchtelte.
Ich rief: „So kann man nicht weiter leben, man kann nicht so leben, es geht nicht.“ Man sagte mir, ich solle mich wegen meiner übertriebenen Erregtheit schämen, ich könne auch über nichts mit Ruhe reden, ich rege mich in einer unangenehmen Weise auf und, was die Hauptsache ist, man bewies mir, daß die Existenz solcher Unglücklicher durchaus kein Grund sei, seinen Nächsten das Leben zu vergiften.
Ich fühlte, daß das ganz richtig war und schwieg still, aber im Innern meiner Seele fühlte ich, daß auch ich Recht hatte, und ich konnte mich nicht beruhigen. Das für mich immer fremdartige Stadtleben wurde mir jetzt so zuwider, daß all die Genüsse eines luxuriösen Lebens, die mir früher als solche erschienen waren, mir jetzt zur Qual wurden. Und so sehr ich auch bemüht war, in meiner Seele auch nur eine Möglichkeit der Rechtfertigung unseres Lebens zu entdecken, ich konnte nicht mehr ohne Gereiztheit mein eigenes, oder ein fremdes Gastzimmer sehen, keinen vornehm gedeckten Tisch, keine Equipage, keinen satten Kutscher und keine Pferde, keine Läden, keine Theater, keine Gesellschaften. Es war mir unmöglich, neben all diesem nicht die hungernden, frierenden und erniedrigten Bewohner des Ljapinschen Hauses zu sehen. Und ich konnte auch den Gedanken nicht los werden, daß diese beiden Dinge zusammenhängen, und daß eins aus dem andern folgt. Ich erinnere mich, daß dasselbe Gefühl meiner Schuld, wie es mir in der ersten Minute erschien, mir auch fürderhin verblieb, aber in dieses Gefühl mischte sich sehr bald ein anderes und verdunkelte es.
Wenn ich über meine Eindrücke von dem Ljapinschen Hause zu meinen nahen Freunden und Bekannten sprach, antworteten mir alle dasselbe, was mir mein erster Freund gesagt hatte, den ich angeschrieen hatte, aber daneben lobten sie meine Güte und mein Mitgefühl, und sie gaben mir zu verstehen, daß dieses Schauspiel so besonders stark auf mich gewirkt hätte, weil ich, Lew Nikolajewitsch, ein so guter und edler Mensch sei. Und ich schenkte ihnen gerne Glauben. Und kaum hatte ich Zeit, mich zu besinnen, als an Stelle der Gefühle der Selbstanklage, der Reue, die ich im Anfang gespürt hatte, in mir schon das Gefühl der Zufriedenheit mit meiner Tugend und der Wunsch, sie den Leuten zu zeigen, Platz gegriffen hatte.
Wahrscheinlich, sagte ich mir, bin ich thatsächlich hieran durch mein luxuriöses Leben nicht schuld, schuld sind die notwendigen Bedingungen des Lebens. Die Änderung meines Lebens kann doch das Übel, das ich gesehen habe, nicht wieder gut machen. Wenn ich mein Leben ändere, mache ich nur mich selbst und meine Angehörigen unglücklich, und jenes Elend bleibt bestehen, wie vorher.
Und daher liegt meine Aufgabe nicht, wie es mir vorher schien, darin, mein Leben zu ändern, sondern darin, soweit es in meiner Macht steht, mitzuarbeiten an der Verbesserung der Lage jener Unglücklichen, die mein Mitgefühl herausgefordert hatten. Die Sache ist die, daß ich ein sehr edler und guter Mensch bin und meinen Nächsten Gutes zu thun wünsche. Ich begann mir den Plan einer philantropischen Thätigkeit zu machen, durch die ich meine ganze Tugendhaftigkeit zum Ausdruck bringen konnte. Doch muß ich hinzufügen, daß ich, auch während ich über diese philantropische Thätigkeit nachdachte, die ganze Zeit über im Innern meiner Seele fühlte, daß das nicht das Richtige war, aber, wie das häufig zu sein pflegt, die Arbeit des Verstandes und die Phantasie, übertönte die Stimme des Gewissens. Zu dieser Zeit fand eine Volkszählung statt; diese erschien mir als ein Mittel, jene Wohlthätigkeit ins Werk zu setzen, durch die ich meinen Edelmut zum Ausdruck bringen wollte. Ich wußte von vielen wohlthätigen Institutionen und Gesellschaften, die in Moskau existierten, aber ihre ganze Thätigkeit schien mir falsch geleitet und unbedeutend im Verhältnis zu dem, was ich zu thun gedachte. Und ich sann mir folgendes aus. Ich wollte in den reichen Leuten das Mitgefühl für die Armut der Stadt wachrufen, Geld sammeln, Leute finden, die an dieser Sache mitarbeiten, zugleich mit der Volkszählung alle Stätten der Armut aufsuchen und während der Volkszählung in Connex mit den Unglücklichen treten, die genaueren Verhältnisse ihrer Armut kennen lernen und ihnen durch Geld, Arbeit, Auswanderung aus Moskau, sowie durch Unterbringung der Kinder in Schulen, der Greise und alten Frauen, in Greisenheimen helfen sollten. Nicht genug, ich glaubte, daß sich aus den Leuten, die sich damit abgeben würden, eine weiterbestehende Gesellschaft bilden werde, welche die Stadtviertel Moskaus unter sich verteilen und darauf achten werde, daß die Armut und die Bettelei dort nicht entstehen könne; daß sie diese im Anfang ihrer Entstehung ausrotten und nicht so sehr die Pflicht der Heilung als die der Hygiene des städtischen Elends erfüllen werde. Ich stellte mir schon vor, daß es schließlich nicht nur keine Bettler, sondern nicht einmal Notleidende in der Stadt geben, daß all dies durch mich geschehen werde und daß wir, d. h. alle Reichen, hieraus in unserem Gastzimmer sitzen, Mahlzeiten von fünf Gängen essen, in unsern Equipagen nach dem Theater und in Gesellschaften fahren würden, ohne uns durch solche Schauspiele, wie ich sie im Ljapinschen Hause gesehen, beunruhigen zu lassen. Nachdem ich mir diesen Plan zurecht gemacht, schrieb ich einen Aufsatz darüber und bevor ich ihn drucken ließ, begab ich mich zu den Bekannten, von denen ich eine Unterstützung erwartete. Allen, die ich an diesem Tage sah (ich wandte mich in erster Linie an die Reichen), sagte ich ein und dasselbe, fast dasselbe, was ich in meinem Artikel geschrieben hatte. Ich schlug ihnen vor, die Volkszählung zu benutzen, um die Armut in Moskau kennen zu lernen und ihr Abhilfe durch Geld und durch die That zu schaffen, um zu erreichen, daß es in Moskau keine Armen mehr gäbe, auf daß wir Reichen mit ruhigem Gewissen die gewohnten Güter des Lebens genießen könnten. Alle hörten mich aufmerksam und ernsthaft an, und dabei ging mit allen ohne Ausnahme ein und dasselbe vor. Sowie die Zuhörer begriffen, um was es sich handelte, schienen sie sich unangenehm berührt und ein wenig beschämt zu fühlen. Wie es schien, schämten sie sich auch vor allen Dingen um meinetwillen, weil ich Dummheiten sagte, die aber so beschaffen waren, daß man es nicht direkt aussprechen konnte, daß es Dummheiten waren. Es war so, als ob ein gewisser äußerer Grund den Zuhörer verpflichtete, dieser meiner Dummheit Vorschub zu leisten. O ja! Das versteht sich! Das wäre sehr schön, – sagte man mir – das versteht sich von selbst, daß man damit nur einverstanden sein kann. Ja, Ihr Gedanke ist vortrefflich. Ich selbst habe daran gedacht – aber bei uns ist man allgemein so gleichgiltig, daß man kaum auf einen Erfolg rechnen darf … Übrigens, ich für meinen Teil bin natürlich bereit, Sie hierbei zu unterstützen!“
Ähnliches sagten mir alle. Alle waren mit mir einverstanden, aber, wie mir schien, nicht aus Überzeugung, auch nicht aus eigenem Bedürfnis, sondern aus einem gewissen äußeren Grunde, welcher es ihnen nicht erlaubte, mir nicht zuzustimmen. Ich bemerkte das schon daran, daß nicht ein einziger von denen, die mir ihre Unterstützung durch Geld zusagten, von selbst die Summe nannte, welche er dazu geben wollte, so daß ich sie selbst ansehen und fragen mußte, „kann ich also darauf rechnen, daß Sie etwa 300 oder 200 oder 100 oder 30 oder 25 Rubel stiften“, und kein einziger gab mir das Geld. Ich bemerke das, weil die Menschen, wenn sie für Dinge Geld ausgeben, die sie selber gerne haben möchten, sich gewöhnlich beeilen, das Geld auszugeben. Für eine Loge zum Gastspiel der Sarah Bernhard giebt man das Geld gleich her, um den Handel zu befestigen. Hier aber erbot sich von all denen, welche Geldbeiträge zu stiften sich bereit erklärt, und ihre Sympathie für mein Unternehmen ausgedrückt hatten, kein einziger, das Geld sogleich herzugeben, sondern sie gaben mir stillschweigend ihre Zustimmung zu der Summe, welche ich vorschlug. Im letzten Hause, wo ich an diesem Tage gegen Abend erschien, traf ich zufällig eine große Gesellschaft beisammen. Die Wirtin dieses Hauses beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit Wohlthätigkeitsbestrebungen. Vor dem Hause standen einige Wagen, im Vorzimmer sahen einige Lakaien, in teuren Livreen. Im großen Gastzimmer saßen an zwei von Lampen erleuchteten Tischen Damen und junge Mädchen in teuren Kleidern, mit teurem Aufputz und beschäftigten sich damit, kleine Puppen anzukleiden; einige junge Leute saßen gleichfalls in der Nähe der Damen. Die von diesen Damen gemachten Puppen sollten in einer Lotterie für die Armen zur Verlosung kommen.
Der Anblick dieses Gastzimmers und der darin versammelten Menschen berührte mich unangenehm. Abgesehen davon, daß das Vermögen der hier Anwesenden einige Millionen ausmachen mochte, abgesehen davon, daß allein die Zinsen von dem Kapital, das hier auf Kleider, Spitzen, Bronzesachen, Broschen, Wagen, Pferde, Livreen, Lakaien verwendet sein mochte, hundertmal mehr ausmachten, als das, was all diese Damen durch ihre Arbeit erzeugten, hiervon abgesehen: die Ausgaben all dieser Damen für den Besuch in diesem Hause, die Handschuhe, die Wäsche, die Wagenfahrt, die Kerzen, Thee, Zucker und das Backwerk, all dieses kostete der Wirtin hundertmal mehr, als das, was hier an Geldwert hervorgebracht werden konnte. Ich sah das alles mit an und hätte daher begreifen können, daß ich hier keine Sympathie für meine Sache vorfinden werde; aber ich war hierher gekommen, um meinen Plan zu unterbreiten und so schwer es mir auch wurde, ich sagte ihnen alles, was ich sagen wollte (ich sprach über alles in derselben Weise, wie ich es in meinem Artikel dargestellt hatte). Von den hier Anwesenden bot mir eine Dame Geld an, weil sie, wie sie behauptete, wegen ihrer Empfindsamkeit nicht im stande sei, selbst zu den Armen zu gehen, doch wollte sie gern Geld dafür geben; wie viel Geld es sein solle und wem sie es zustellen werde, verschwieg sie. Eine andere Dame und ein junger Mann boten mir ihre Dienste an; sie wollten zu den Armen gehen, aber ich nahm ihr Anerbieten nicht an. Die gewichtigste Persönlichkeit aber, an die ich mich wandte, meinte, es ließe sich hierbei nicht viel thun, weil es an Mitteln fehle. Daß es aber an Mitteln fehle, liege daran, daß die reichen Leute in Moskau über ihr Geld schon Bestimmung getroffen hätten, man habe ihnen schon alles abgenommen, was nur möglich, daß all diesen Wohlthätern schon Medaillen und andere Ehrenzeichen verliehen seien, auch Beförderungen stattgefunden hätten, und daß man, um in pekuniärer Beziehung Erfolg haben zu können, die Regierung um neue Auszeichnungen ersuchen müsse, dies sei das einzige wirksame Mittel, aber es sei sehr schwer zu erreichen. Als ich an diesem Tage nach Hause kam, ging ich mit dem Vorgefühl zu Bett, daß aus meinem Plan nichts herauskommen werde; dazu kam noch das Gefühl der Scham und das Bewußtsein, daß ich den ganzen Tag über etwas sehr Albernes und Schmachvolles getrieben hatte; trotzdem gab ich diese Sache nicht auf. Erstens hatte ich mit der Sache angefangen und ein falsches Schamgefühl hätte mich gehindert, sie jetzt fallen zu lassen, zweitens aber gab mir nicht nur der Erfolg dieses Planes, sondern schon die bloße Beschäftigung damit, die Möglichkeit, meine Lebensweise unter den Bedingungen fortzusetzen, unter denen ich bisher gelebt hatte. Ein Mißerfolg aber hätte mich dem Zwang unterworfen, mich von meiner ganzen Lebensweise loszusagen, und nach einem neuen Lebensweg zu suchen. Davor aber fürchtete ich mich ohne es selbst zu wissen, daher schenkte ich meiner inneren Stimme keinen Glauben und setzte die einmal begonnene Sache fort. Nachdem ich meinen Aufsatz in Druck gegeben hatte, las ich ihn nach dem Korrekturbogen im Rathaus vor. Ich las ihn, während ich unter Thränen erröten mußte, mit stockender Stimme; so peinlich war es mir. Ebenso peinlich war es, wie ich bemerken konnte, für die Zuhörer. Auf meine Frage, die ich nach Schluß der Vorlesung an die Herren, welche die Leitung der Volkszählung übernommen hatten, stellte, ob sie meinen Vorschlag annehmen und auf ihren Plätzen bleiben wollten, um zwischen der Gesellschaft und den Notleidenden zu vermitteln, erfolgte ein peinliches Schweigen. Dann hielten zwei Herren eine Rede. Diese Reden machten das Peinliche meines Vorschlags gleichsam wieder gut; es wurde mir volle Sympathie ausgedrückt, doch wurde auf die Unausführbarkeit meines Gedankens, der übrigens bei allen die höchste Anerkennung fand, hingewiesen. Alle fühlten sich erleichtert. Aber als ich dann, um doch meine Absicht durchzusetzen, die Vorsteher einzeln befragte: ob sie bereit seien, bei der Volkszählung die Bedürfnisse der Armen zu erforschen und dann auf ihren Plätzen zu verbleiben, um als Vermittler zwischen den Armen und den Reichen zu dienen, fühlten sich wiederum alle peinlich berührt. Es war, als läge in ihren Blicken die Erwiderung: Jetzt hat man aus Achtung vor dir deine Dummheit vertuscht und nun kommst du wieder damit. Derart war der Ausdruck der Gesichter, aber mit Worten sagten sie, sie seien dazu bereit und zwei von ihnen antworteten mir, zwar ein jeder für sich, aber doch als hätten sie sich verabredet, mit denselben Worten: „Wir halten uns für moralisch verpflichtet es zu thun“. Denselben Eindruck machte meine Erklärung auch auf die Studenten, die bei der Volkszählung mitwirkten, als ich ihnen sagte, daß wir, außer der eigentlichen Zählung, während derselben wohlthätige Zwecke verfolgen werden. Als ich mit ihnen darüber sprach, merkte ich, daß es ihnen peinlich war, mir in die Augen zu sehen, wie man sich schämt, einem guten Kerl in die Augen zu sehen, wenn er Dummheiten redet. Einen ebensolchen Eindruck machte mein Aufsatz auf den Redakteur der Zeitung, als ich ihm meinen Artikel überreichte, desgleichen auf meinen Sohn, meine Frau, sowie auf die verschiedenartigsten Leute. Alle fühlten sich peinlich berührt, und doch hielten es alle für notwendig, meinen Gedanken gutzuheißen, aber jeder begann sogleich nach dieser Äußerung der Anerkennung seine Bedenken zu äußern, ob die Sache Erfolg haben könne, und alle begannen aus einem gewissen Grunde (aber auch alle ohne Ausnahme) die Gleichgiltigkeit und Herzlosigkeit unserer Gesellschaft zu verurteilen, sowie die aller Menschen, natürlich mit Ausnahme der eigenen Person.
Im Innersten meiner Seele fuhr ich fort, zu empfinden, daß all dieses nicht das Richtige sei, daß bei all dem nichts herauskommen werde; indessen, der Aufsatz war gedruckt und ich hatte es übernommen, an der Volkszählung teilzunehmen. Ich hatte die Sache ins Werk gesetzt und nun riß sie mich selbst mit sich fort.
IV.
Man hatte mir für die Volkszählung auf meine Bitte hin im Stadtteil Chamownitschewski bei dem Smolenskschen Markt, die Prototschny-Gasse zwischen der Durchfahrt Beregowaja und der Nikolskij-Gasse angewiesen. In diesem Stadtteil befinden sich Häuser, die gemeinsam das Rshanow-Haus oder die Rshanowsche Festung genannt werden. Diese Häuser gehörten einmal einem Kaufmann Rshanow, jetzt gehören sie den Simins. Ich hatte schon längst von diesem Ort gehört, er sei die Herberge des entsetzlichsten Elends und Lasters und darum hatte ich die Veranstalter der Volkszählung gebeten, mir diesen Stadtteil zu überlassen. Mein Wunsch ward erfüllt.
Nachdem ich vom Stadtrat die Aufforderung erhalten hatte, begab ich mich, einige Tage vor der Volkszählung, nach meinem Viertel um es zu besichtigen. Nach einem Plan, den ich erhalten hatte, fand ich die Rshanowsche Festung sogleich. Ich ging durch die Nikolskij-Gasse dorthin. Diese Gasse schließt links mit einem finstern Hause ab, das auf dieser Seite keine Eingangsthür hat. Nach dem Äußeren des Hauses erriet ich, daß dies die Rshanowsche Festung war. Während ich die Nikolskij-Gasse bergab ging, holte ich einige Knaben zwischen zehn und vierzehn Jahren in Jacken und Mänteln ein, welche den Berg hinabrutschten, die einen auf ihren Füßen, andere auf einem Schlittschuh. Sie glitten längs dem gefrorenen Abhang des Trottoirs hinab, das sich am Haus entlang zog.